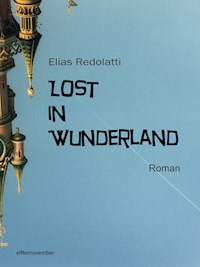Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ausgerechnet Pankow-Süd. Lennarts neuer Kiez hat wenig vom typischen Berliner Flair. Keine Szenebars, keine Start-ups, keine Touristen. Aber immerhin ist sein WG-Zimmer günstig, vom Dach aus kann man den Fernsehturm sehen, und seine Mitbewohnerin Emma lässt sich auf einen Flirt ein. Nach einem tödlichen Sturz jedoch kippt die Stimmung in der WG. War es ein Unfall – oder etwa Mord? Was genau ist mit den Vormietern passiert? Und was verheimlicht sein anderer Mitbewohner Bastian? Auf einmal ist alles ganz anders.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buch
Ausgerechnet Pankow-Süd. Lennarts neuer Kiez hat wenig vom typischen Berliner Flair. Keine Szenebars, keine Startups, keine Touristen. Aber immerhin ist sein WG-Zimmer günstig, vom Dach aus kann man den Fernsehturm sehen, und seine Mitbewohnerin Emma lässt sich auf einen Flirt ein.
Nach einem tödlichen Sturz jedoch kippt die Stimmung in der WG. War es ein Unfall - oder etwa Mord? Was genau ist mit den Vormietern passiert? Und was verheimlicht sein anderer Mitbewohner Bastian?
Auf einmal ist alles ganz anders.
Autor
Elias Redolatti, Jahrgang 1972, aufgewachsen in Schleswig-Holstein, unternahm erst einen Ausflug ins Filmgeschäft in Hamburg, bevor er im Disneyland Paris die Liebe fürs Leben fand. Nach einem Studium am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig lebt er seit 2002 in Berlin.
Optische Täuschungen ergeben sich aus der Tatsache, dass Wahrnehmung auf unvollständiger Information beruht.
Wikipedia
Inhaltsverzeichnis
Wohnungsnot
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Mieterinitiative
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Verdrängung
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Sanierungsstau
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Besitzverhältnisse
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Profithunger
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Aktivismus
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Gentrifizierung
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Wohnungsnot
Die Erfahrung bestimmt die Lage, in der die Figur vorzugsweise wahrgenommen wird. Bei längerer Betrachtung des Bildes kippt der Necker-Würfel.
1.
Sie schwamm hilflos mit den Flügeln schlagend in der trüben Brühe. Patsch, patsch, patsch. Ich griff nach der Flasche.
Woher wissen wir, dass stimmt, was man uns erzählt? Müssen wir nicht irgendwann aufhören, alles zu hinterfragen? Unwissenheit kann ein Segen sein.
Ich schlug mit den Briefumschlägen in meine offene Hand.
Was sagt man, wenn jemand stirbt, jemand, den man zu kennen glaubt, über den man aber so wenig weiß wie über seinen Nachbarn, seinen Mitbewohner?
Ich sage, ich werde den Anblick der verdrehten Gliedmaßen nie vergessen. Wie die Hände auf dem Eis. Patsch, patsch, patsch.
Wo soll ich anfangen? Was soll ich erzählen? Sie können die Wahrheit erfahren. Oder meine Sicht der Dinge.
2.
»Was sollten wir noch über dich wissen?«
Ich rutschte auf meinem Küchenstuhl nach vorne.
Was mussten sie wissen? Dass ich immer schon in WGs gewohnt hatte, seit ich zuhause ausgezogen war? Dass mein Mitbewohner das WG-Zimmer gekündigt hatte, weil er die Wohnung ausschließlich für sich haben wollte? Dass ich verzweifelt war, weil nur noch zwei Wochen blieben, bis die erste Frist verstrichen war, bis zu der ich ausziehen sollte? Und dass ich keine Lust hatte, um Verlängerung zu betteln?
Es war die zehnte oder elfte Besichtigung insgesamt und hoffentlich die letzte. Facebook sei Dank. Ein Zimmer in Berlin zu finden, war nicht mehr so einfach wie vor ein paar Jahren. Je mehr Menschen nach Berlin wollten (ich war ja auch kein gebürtiger Hauptstädter), umso knapper wurde der Wohnraum, das war eine ganz einfache Rechnung. Man müsste mehr Wohnungen bauen, aber es würde vermutlich nie reichen. Zu viele wollten in die Hauptstadt.
Eine eigene Wohnung hatte ich mir längst abgeschminkt. Eigentlich war ich eine gute Partie. Fester Job, Mitte Dreißig, kein Migrationshintergrund. Aber es gab immer jemanden, der mehr verdiente, und wenn man sich in eine Schlange mit 80 oder mehr Wohnungsinteressenten reihte, um eine gut geschnittene, helle Zwei-Zimmer-Wohnung in Friedrichshain zu besichtigen, konnte man sicher sein, dass ein doppelverdienendes Pärchen oder ein Arzt oder ein IT-Spezialist mit dreimal mehr Netto darunter waren und den Zuschlag erhielten.
Leider lag ich mit meinem Gehalt als Designer jetzt nicht besonders weit über dem Mindestlohn. In einer anderen Stadt sähe das bestimmt anders aus, aber wer will schon woanders leben?
Also blieb nur geteilter Wohnraum. Und bei meinen Bewerbungen hatte ich sie alle gesehen: Die Zweier-WG mit einem Geschäftsmann, der eines seiner Zimmer untervermietete und dafür erwartete, dass ich in seiner Abwesenheit putzte. Die Kiffer-WG, in der es aussah, als sei seit den 70er Jahren nicht mehr geputzt worden. Die Berufsjugendlichen-WG aus hängengebliebenen Althippies, die sich nach hübschen Studentinnen für den zweiten Frühling sehnten und einmal im Monat putzten. Die Hedonisten-WG mit Partystudenten, die jemanden zum Mitfeiern suchten und einmal im Jahr putzten. Die Öko-WG mit vier Veganern und Veganerinnen, die von mir verlangten, ebenfalls vegan zu leben, dafür würden sie putzen. Die syrischen Studenten, die Katzenliebhaberin oder die Engländer, bei denen sich die Frage nach dem Putzen nicht einmal stellte.
Selbst als eine WG sympathisch genug erschienen war, hatten sie mich nicht genommen. Vermutlich war ich zu alt gewesen, zu jung, zu uncool oder zu nerdig. Zu groß war die Auswahl an Suchenden und zu klein das Angebot.
Mich rettete mein verzweifelter Post auf Facebook. WG gesucht. Wer kennt jemanden, der jemanden kennt, der ein WG-Zimmer frei hat? Normalerweise nutzte ich Facebook nicht für solche Aufrufe, ich postete ab und zu ein Bild von Orten, an denen ich gewesen war, ganz ohne Gesicht. Den Birnbaum in Ribbeck, der Biergarten im Treptower Park, die Kreuzgewölbe in der S-Bahnstation Heidelberger Platz.
Ich fand auf Facebook interessante Konzerte, markierte meine Lieblingskollegen David und Serkan und manchmal auch noch andere, meistens Ex-Kollegen, damit wir uns auf dem Konzert trafen und im Anschluss ein Bier trinken gehen konnten.
Nach der letzten Absage einer WG, in die ich gerne eingezogen wäre, weil das Zimmer direkt im Schillerkiez lag, startete ich dennoch einen Aufruf. Es meldete sich Emma, die Freundin meiner Arbeitskollegin Antonia. Ihr Mitbewohner sei gerade ausgezogen. Ob ich Lust habe, mich mal vorzustellen. Es sei wie bei der Jobsuche: Die Empfehlung einer Freundin sei besser als ein unbekannter Bewerber.
Die Wohnung lag schon in Pankow, also dem Stadtteil Pankow. Zum Bezirk Pankow gehörten noch Buch, wo keiner hinzog, und Weißensee, wo die ganzen Familien hinzogen, denen es in Prenzlauer Berg zu teuer geworden war, drüben, auf der anderen Seite der Wisbyer Straße, die der ADAC und die AFD gerne zur Stadtautobahn ausgebaut hätten.
In Pankow-Süd war es noch bezahlbar. Die Frage war nur, wer da wohnen wollte. Als ich Emmas Einladung gefolgt war, hatte ich mich von der U-Bahnstation zur Zielstraße mit Google Maps orientiert. Ich kam mir vor wie ein Tourist. Noch nie zuvor war ich in dieser Gegend gewesen.
An der Tankstelle die Wohnstraße überqueren, an einer heruntergekommenen, halbverfallenen Brauerei vorbei, die offensichtlich saniert werden sollte. Hier lagen Gebäude in Trümmern. Die Rückseiten hatten anscheinend noch großformatige Graffiti geschmückt, jetzt fehlte die Hälfte und ein großformatiges Bauschild informierte über Bauherrn und Architekten.
Erste oder zweite Querstraße links. Wo der Trödelladen ist, hatte sie geschrieben. Du kannst es nicht verpassen. Vor dem Schaufenster blieb ich stehen. Schaukelpferde, Blechschilder, Lampenschirme, DDR-Spielzeug, Lego in Tüten, alte Kommoden. Irgendwo in der Tiefe des Raumes eine Gitarre, Möbel, alte Fahrräder. In der Tür klebte ein Schild. Geöffnet montags und donnerstags von elf bis achtzehn Uhr. Genau das hatte ich erwartet.
Hier tobte echt das Leben.
Das Haus war teilsaniert, das heißt, irgendwann in den Neunzigern waren die Kohleöfen durch eine Gasetagenheizung ausgetauscht worden. Erstes Geschoss war Hochparterre.
Ein klassischer Altbau, der zwar den Krieg überstanden, in der DDR aber stark gelitten hatte.
Im Hausflur hinter der schweren, vermutlich zuletzt vor 50 Jahren gestrichenen Eingangstür hingen acht Briefkästen unterschiedliche Form, Farbe und Größe an der Wand. Graffiti verunzierte die Wände, der Putz bröckelte. Auf den Treppenstufen braunes Linoleum, das zur Mitte hin beinahe weiß abgetreten war und zu den Seiten hin lange keinen Wischmopp mehr gesehen hatte.
Die Klingel war vor 28 Jahren mal erneuert worden, ebenso hatte man die Briefschlitze in den Wohnungstüren zugenagelt. Der Rest schien original von 1910 zu sein.
»Was genau arbeitest du?«, fragte Emma. Sie hatte gesagt, sie würden ein Interview machen. Sie und Bastian, ihr Mitbewohner. Aber ich hatte nicht erwartet, dass sie sich mir gegenübersetzen würden, Notizzettel in der Hand, wie die Jury bei DSDS. Deutschland sucht den Supermitbewohner. Castingshow in Zeiten der Wohnungsknappheit. Aber irgendwie hatten sie ja Recht. Man sollte sich schon sehr genau ansehen, mit wem man zusammenwohnt.
Schwarzer Vollbart, die Brille mit dem dicken schwarzen Rand, seine Retro-Sneaker. Bastian war einer der Typen, die im Spiegel als Hipster bezeichnet wurden, aber das wäre eine oberflächliche Betrachtungsweise gewesen, der erste Eindruck.
»Ich mach was mit Medien«, begann ich und grinste. Ich hatte beschlossen, mit offenen Karten zu spielen. Vermutlich hatten sie diesen Einstieg in das Bewerbungsgespräch schon häufiger gehört. Dieser Satz konnte in Berlin inzwischen nur noch selbstironisch Verwendung finden. Ich mache was mit Medien. Ende der Neunziger und kurz vor dem Platzen der Internetblase, von dem inzwischen nur noch auf Wikipedia und im Handelsblatt geschrieben wurde, hatte es ausgereicht, seinen Job auf diese Weise zu beschreiben, und jeder hatte große Augen bekommen. Selbst in den Nullerjahren in Berlin war es noch cool gewesen, was mit Medien zu tun zu haben. Jetzt konnte es dir passieren, dass du blöd angemacht wurdest, weil man dich für einen Gentrifizierer hielt, der ins hippe Berlin zog und so die Mieten hochtrieb.
Meine beiden Gegenüber verzogen keine Miene.
»Jetzt sag nicht Start-up.«
»Ich sage: digitale Werbung.«
Bastians Augen funkelten angriffslustig hinter seiner Brille. »Du steckst also hinter Big Data, Bewegungsprofilen und totaler Transparenz?«
Das war nicht ganz richtig. Ich war Pixelschubser. Grafiker. Designer. Ich machte die Layouts, bearbeitete JPGs, erstellte Animationen, setzte Konzepte meiner Kollegen in Bilder um. Ich war Handwerker in einer Digitalagentur. Mit einem befristeten Vertrag. Das war so in der Werbung, und die Tendenz ging sogar dahin, immer mehr Freiberufler für Projekte zu beschäftigen. Nur wenn eine Agentur mit kontinuierlicher Arbeit beauftragt war, brauchte man feste Mitarbeiter. Wir arbeiteten für Automobilhersteller und Telekommunikationsunternehmen. Newsletter erstellen, Webseiten bauen, Content einpflegen. Maintenance - Wartung – so nannten wir das. Ich machte in manchen Wochen nicht einmal eine Überstunde. Für Werbung war das ganz untypisch. Glamour sah aber auch anders aus. Preise würden wir mit unserer Arbeit nie gewinnen. Aber das Leben bestand eben nicht nur aus Goldenen Nägeln.
»Ich bin nur der Angestellte. Wenn du so willst, baue ich den Todesstern, aber verantwortlich ist das Superhirn des bösen Imperators.«
»Du steckst trotzdem hinter den ganzen E-Mails, die ich nicht haben will.«
»Ich bin der Designer. Ich lass das Ganze gut aussehen. Auf der dunklen Seite der Macht sitzen die Strategen.«
»Klonkrieger also«, sagte Emma.
»Wäre dir ein Rebell lieber?«
Eine Sekunde lang fürhtete ich, das Gespräch würde kippen. Aber dann sah ich Emma verschmitzt lächeln. Bastians anfangs vor der Brust verschränkte Arme öffneten sich. Die Hände auf die Knie gelegt, beugte er sich vor: »Hättest du gesagt, du bist Lehrer, hätten wir dich gleich rausgeworfen.«
Ich legte den Kopf schief. »Auch Sportlehrer?«
»Die erst recht.«
Am Ende geben ja nur Details den Ausschlag für eine Entscheidung. Niemand kann dem anderen in den Kopf sehen, um zu wissen, ob er nur eine Rolle spielt. Vorstellungsgespräche sind Werbung in eigener Sache, verbunden mit der Hoffnung, dass hinter der glitzernden Verpackung ein Inhalt steckt, der den Erwartungen entspricht. In meiner Agentur tat ich jeden Tag nichts anderes. Ich feilte so lange am Produkt herum, bis ich sicher war, dass es sich besser verkaufen ließ.
Hoffentlich hatte ich meiner Verpackung genügend Glanz verliehen, hoffentlich wirkte mein Dreitagebart cool und nicht ungepflegt und meine Sneakers nicht zu betont jugendlich, hoffentlich fiel das Gel in meinen mittellangen Haaren nicht zu sehr auf. Das T-Shirt hatte ich aus der Hose gelassen, das Handy war dringeblieben. Doch Selbstzweifel waren gar nicht angebracht. Schließlich war ich Marketingprofi.
»Und was macht ihr so?«
Emma sagte freimütig: »Ich arbeite im Kletterwald Jungfernheide. Voll nice, ab 19:00 Uhr habe ich frei. Ist zwar wenig Geld, aber mit dem Trinkgeld reicht‘s. Vorher habe ich nach meiner Ausbildung in einem Hotel am Empfang gearbeitet.«
»In welchem?«
Sie nannte das Hotel, einen Fünf-Sterne-Kasten, mit vollem Namen. Es klang wie auswendig gelernt. Der Job sei ihr zu stressig gewesen. Immer nur Schichtarbeit und Überstunden, immer nur in geschlossenen Räumen, da hatte sie auf das Geld verzichtet und half nun im Kletterwald den Touristen beim Aufstieg. Legte Gurte an. Erklärte die Funktion der Haken. Der zweite Haken lässt sich erst öffnen, wenn der erste gesichert ist. Dazu steckst du den Stift in das Loch und drückst. Nicht zu zweit auf eine Plattform. Zur Toilette immer ohne Gurt. Nicht rauchen.
Im Sommer sei sie fast jeden Tag da und würde Geld sparen für den Winter, wenn sie zum Freeclimbing auf die Südhalbkugel flog.
»Ohne die niedrige Miete könnte ich das gar nicht machen.«
Ihr durchtrainierter Körper konnte sich wahrlich sehen lassen. Ein schmales, sehr hübsches Gesicht, eingerahmt von kurzen, aschblonden Haaren, darin eine niedliche Nase über sehr vollen, blassroten Lippen. Sie als muskulös zu bezeichnen, wäre unfair gewesen, aber einen Ringkampf mit ihr hätte ich nicht gewonnen.
Mein Blick wanderte zu Bastian. Er lächelte nur. »Ich mache meinen Master in BWL.«
Auweia. Ein langweiliger BWLer. Aber es machte keinen Unterschied, was er studierte. Ich wäre vermutlich auch eingezogen, wenn Bastian einen Handyladen betrieben hätte.
Anschließend folgte ein kleiner Rundgang durch die Wohnung. Drei Meter fünfzig hohe Decken, ein Schlauchbad, abgezogene, honiggelbe Dielen, frisch gestrichene Doppelkastenfenster, und vor dem französischen Balkon zur Straße ein schmiedeeisernes Gitter, das nur noch von der Farbe zusammengehalten wurde. Die Küche war von IKEA. Im Flur hingen auf Leinwand gezogene Fotos von Berlin, Paris, New York.
Das freie Zimmer ging nach Norden zur Straße, die nur von Anliegern genutzt wurde. Der Vormieter war Mitte des Monats ausgezogen und hatte bis auf einen seltsamen Geruch nichts hinterlassen. An den bis zur Unkenntlichkeit übermalten Stuckresten hingen Spinnweben, aber die Dielen waren sauber abgeschliffen und die Türrahmen glänzten makellos. Die letzte Sanierung lag noch nicht lange zurück. Ich hatte genug WGs gesehen, die sich mit den Gegebenheiten ihrer Vormieter arrangiert hatten. Einziehen, verwohnen, ausziehen. Mit den Jahren kam da einiges an Patina zusammen.
Bastian hatte sich als Hauptmieter das beste Zimmer ausgesucht. Es war etwas größer als die anderen beiden, hatte noch Stuck an der Decke und führte nach Süden zum ruhigen Innenhof, auf dem die Mülltonnen überquollen und die vergessenen Fahrräder verrosteten.
Das Bad hatte noch Doppelkastenfester, aber immerhin stand eine relativ neue Badewanne quer davor. Ich konnte schon Emma vom Baden mit Blick auf die Sterne schwärmen. Hoffentlich war sie keine von denen, die immer nur froh über die Möglichkeiten waren und sie doch nie nutzten. So wie man ein SUV kaufte, mit dem man theoretisch durch die Wildnis fahren konnte, es aber nie tat, weil sich nie die Gelegenheit dazu ergab. Aber es war ein geiles Gefühl zu wissen, dass man es jederzeit könnte.
Ich fragte noch nach der Kaution und dem Verhältnis zum Vermieter. Die Höhe der Miete würde lächerliche 300 Euro warm betragen, inklusive 50-Mbit-Internet und Strom.
Dass sie Nichtraucher waren, schloss ich aus der Abwesenheit von Aschenbechern. Mehr war mir nicht wichtig. Weinflaschen hatte ich auf dem Küchentisch gesehen und in der Ecke einen Kasten Wasser. Eine Spülmaschine und eine Mülltonne, vor der zwar die obligatorischen Pfandflaschen standen, aber alles hatte seinen Platz, war sauber. Eine WG, nach der ich gesucht hatte. Ich erwähnte noch meine Vorliebe für Rosé. Die beiden nickten.
»Wir rufen dich an«, sagte Bastian und brachte mich zur Tür. Das Treppenhaus roch nach nichts. Ein Segen für ein Mehrfamilienhaus. Vermutlich würde man es bemerken, wenn jemand in seiner Wohnung verweste, nachdem er vereinsamt gestorben war.
Mein Fahrrad stand noch im Flur. Auf der Straße kaum was los. Kein Parkplatz frei, aber durch die fehlenden Restaurants und Kneipen wirkte es sehr unbelebt. Der Prenzlauer Berg, wie man ihn kannte, lag jedoch gleich hinter der Wisbyer Straße.
Ich war erst 2002 nach Berlin gezogen und hatte mich damals anfangs wie ein Tourist gefühlt. Die anderen waren alle schon dagewesen, als Berlin noch ein Trümmerfeld gewesen war. Wenn man sich mit denen verglich, die schon länger in einer Stadt wohnten, konnte man das nur kompensieren, indem man die Stadt anders erlebte, intensiver, besser, genauer.
An manchen Wochenenden, nachdem ich mich von meiner letzten Freundin getrennt hatte, oder besser sie sich von mir, war ich mit der Ringbahn gefahren und an jeder Station ausgestiegen. Der Ring war erst im Jahr meines Zuzugs wieder geschlossen worden – immerhin hatte ich diese Baulücke noch erlebt. An jeder Station hatte ich einen Blick auf die Netzspinne geworfen, überlegt, auf welchem Weg ich nach Hause käme, und war dann zur nächsten Station weitergefahren. Ich hatte alles getan, um nicht in die leere Wohnung fahren zu müssen.
Ich sah mich noch einmal um. Das Haus was das letzte unsanierte Gebäude in diesem Abschnitt der Straße. Meine alte WG hatte in einem topsanierten Altbau gelegen. Eine Gegend, die ich bislang als meinen Kiez bezeichnet hatte. Eine Querstraße weiter hatte es vor ein paar Jahren Straßenkämpfe zwischen der Polizei und Autonomen gegeben. Da war es um besetzte Wohnungen gegangen, die geräumt werden sollten.
Alle sollten bleiben, nur nicht diejenigen, die später kamen.
Auf der Straße saßen meist gutaussehende, hippe Menschen an Biertischen und bestellten Essen aus handgeschriebenen Speisekarten und eisgekühlten Wein zu Literpreisen, die sich denen von Druckertinte näherten. In meinem alten Kiez hießen die Backshops Kornblume und die Friseure Haarspalterei. Um die Ecke fanden sich das Badeschiff, der Freischwimmer, die Simon-Dach-Straße, das RAW-Gelände.
In Pankow-Süd hingegen gab es Janny's Eis, Lidl, Vandéll-Friseure, deren Namen ich vermutlich nie aussprechen konnte, und eine Kleingartenkolonie namens Bornholm II. Ab U-Bahnhof Vinetastraße nahm das Leben rapide ab, je weiter man die Berliner Straße, wie die Verlängerung der Schönhauser Allee hieß hinunterlief. Ein Späti, ein Bürgerbüro der Grünen, eine Änderungsschneiderei, eine Eckkneipe mit Happy-Hour rund um die Uhr. Viele Geschäftsräume standen leer und der letzte Bäcker in einer Querstraße schien schon ewig geschlossen.
Die Dichte an DriveNow- und Car2Go-Mietwagen aber war auch hier erstaunlich hoch. Ebenso wurde man, wenn man sich über Gehwegradler ärgerte, mit »Fresse halten« beschimpft. Müll wurde mit dem Schild Zu verschenken auf die Straße gestellt. Hundehalter vergaßen grundsätzlich, die Haufen aufzuheben. Und seit im März eine Filiale eines hippen Eishändlers am U-Bahnhof eröffnet, ein Fotostudio zur Selbstnutzung um Kunden warb und die Sanierung der Brauerei begonnen hatte, war auch hier ein Hauch von Veränderung zu spüren.
Vielleicht war das Viertel ja wirklich im Kommen.
3.
»Was ist denn da drin?«, keuchte Bastian auf der letzten Stufe. Sein Karton schwankte bedrohlich.
»Ganz vorsichtig, das ist der Rotwein«, ächzte ich zurück und überlegte bereits, ob er die richtige Temperatur hatte. Ich trank nicht viel Wein, kannte mich damit nicht einmal besonders gut aus. Ich kaufte den Wein normalerweise nach dem Etikett. Ein Freund, der schon lange nicht mehr in Berlin lebte, hatte mich früher einmal zu Weinseminaren in eine Weinhandlung am Gendarmenmarkt geschleppt.
Gute Weine für unter zehn Euro. Weinreise durch Spanien. Riesling & Co. Aber ich hatte mir das alles nicht merken können. Am Ende kaufte ich den Wein doch wieder nur nach Etikett und war froh, beim nächsten Einkauf im Spezialitätenmarkt um die Ecke noch zu wissen, was ich zuletzt gekauft und ob der Wein geschmeckt hatte.
Wir schleppten meine Kisten und Kästen aus dem Kleintransporter, den ich bei einem der stadtbekannten Vermieter für ein paar Stunden geliehen hatte. Es war das letzte Wochenende im April, Ende des Monats, an dem früher die Berliner zu Dutzenden oder sogar Hunderten umgezogen waren. Inzwischen konnten es sich die Hauptstädter kaum noch leisten, so einfach die Wohnung zu wechseln, weil man mit dem neuen Mietvertrag auch gleich 20 Prozent mehr Miete zahlen musste.
Noch am selben Abend nach meinem Vorstellungsgespräch hatte Emma angerufen und zugesagt. Ich hatte vor Erleichterung fast geheult.
Wie Emma bekam ich von Bastian einen Untermietvertrag. Im Hauptmietvertrag stand lediglich Bastian, weil die Hausverwaltung keine Arbeit mit ständig wechselnden Hauptmietern haben wollte. Sie war mit einer WG einverstanden. Ob das zu Bastians Nachteil oder Vorteil gereichte, wollte ich mir in diesem Moment nicht ausmalen. Wenn wir uns vertrugen, war alles gut. Ich überwies mein Geld direkt an Bastian und verließ mich darauf, dass er die Vermieter bezahlte. Sollte einer verrücktspielen, wäre es für Bastian einfach, ihn rauszuwerfen. Sollten wir jedoch mit ihm Probleme haben, wären wir seiner Willkür unterworfen. Oder müssten ausziehen. Als Hauptmieter wäre er jedoch auch für jeden Ärger verantwortlich, der in und mit dieser Wohnung passierte.
Tausche Freiheit gegen Verantwortung.
Eine Entscheidung, die in diesem Moment leichtfiel. Man denkt in manchen Momenten ja häufig nicht weiter als bis zum Ende des Monats.
Später fragte ich nach den anderen Bewerbern für das Zimmer und wie knapp die Entscheidung für mich gewesen sei.
»Die anderen Bewerber?«, hatte Emma erwidert und gelacht. »Wir haben allen anderen gleich nach deinem Besuch abgesagt. Da hat nicht nur Antonia ein gutes Wort für dich eingelegt – mir hat auch dein Facebook-Profil gefallen. Und bei Google habe ich auch nichts Auffälliges über dich gefunden.«
Viele Sachen hatte ich nicht aus meiner alten Bleibe mitgebracht. In meinem Zimmer in Friedrichshain war wenig Platz gewesen. Ich hielt es dennoch nicht für selbstverständlich, dass meine neuen Mitbewohner beim Umzug halfen. Schließlich ist das der Moment, in dem sich bei Freundschaften die Spreu vom Weizen trennt, oder besser: die Rückenkranken von den Altruisten.
Zum Einladen hatte ich David und Serkan aktivieren können, Kollegen, die ich zu meinem Freundeskreis zählte, weil wir in der Vergangenheit nicht nur nach der Arbeit einen trinken gegangen, sondern uns sogar mal am Wochenende getroffen hatten, um zusammen Billard zu spielen oder um die Häuser zu ziehen, was sich meist darin erschöpft hatte, in eine Kneipe zu gehen und zu quatschen, bis es Zeit wurde, in einem Club die Besinnung zu verlieren und es mit den Öffi sicher nach Hause zu schaffen.
Serkan und David waren an diesem Samstag etwas verkatert, aber halbwegs pünktlich gekommen, hatten meine schon seit Tagen gepackten Kartons und zerlegten Möbel wortlos in den weißen Kleintransporter mit der blauen Robbe darauf getragen und sich literweise das bereitgestellte Mineralwasser in den Hals gekippt.
Kaum war die letzte Kiste eingeladen, hatten meine Kollegen sich verabschiedet. Emma und Bastian hatten dann das gleiche Spiel in meinem neuen Kiez in Gegenrichtung wiederholt.
Ich musste den Transporter in zweiter Reihe parken, da vor dem Haus ein großer Umzugswagen stand. Zwei starke Männer trugen Kisten und antiquiert aussehende Möbel auf die Straße. Das Treppenhaus wurde zur unfreiwilligen Begegnungszone, die bis in die dritte Etage reichte. Ein Blick in die Nachbarwohnung offenbarte ungefähr 40 Jahre Mietverhältnis, in Auflösung begriffen. Nächster Halt: Seniorenheim. Die nächsten Mieter waren vermutlich 60 Jahre jünger, machten irgendetwas im Internet und zahlten doppelte Miete.
Am frühen Abend schließlich, nachdem ich den Transporter zurückgebracht und mich erschöpft auf einen der wackligen Stühle in der Küche hatte fallen lassen, empfingen mich Emma und Bastian mit einer Flasche Wein. An diesem Abend hätte ich zwar auch nichts gegen ein kühles Bier gehabt, aber ich wollte das Bild des distinguierten Weintrinkers nicht gleich am ersten Abend zerstören.
So goss Bastian uns in der Küche einen trockenen Chardonnay ein, die Tür zum französischen Balkon stand sperrangelweit offen, und ich versuchte, die gestapelten Kisten in meinem Zimmer zu ignorieren, die danach schrien, ausgepackt zu werden. Ich hasste es, umzuziehen, doch ich ahnte damals noch nicht, dass Emma es noch viel weniger mochte.
»Auf uns«, sagte ich mit erhobenem Glas. Bastian kratzte sich den Vollbart, bevor er nippte, und als er das Glas auf den Tisch stellte, atmete er tief durch.
»Nett.«
»Nicht gut?«
»Doch, klar«, sagte Emma und nippte noch einmal. Bastian schmatzte. »Ist noch Bier im Kühlschrank?«
Emma hustete. Ich stellte mein Glas ebenfalls ab.
»Hey. Das ist ein teurer Chardonnay. «
Bastian grinste wie ein Kind, welches mit der Hand in der Keksdose erwischt wurde. »Ich kann doch einen Chardonnay nicht von einem Riesling unterscheiden.«
»Ich dachte, ihr seid Weintrinker.«
Bastian lächelte andeutungsweise und schob seine schwarze Brille zurück auf die Nasenwurzel. »Wie kommst du darauf?«
Ich sagte ihm, ich hätte keine Bierflaschen gesehen, als ich zum Interview in der Küche gesessen hatte, dafür aber die Weinflaschen. Und als ich betont hätte, ich tränke sehr gerne Rosé, sei ich sicher gewesen, dass sich beide einen Blick zugeworfen hätten.
»Da hast du uns wohl missverstanden.«
Ich grinste. »Dann trinkt ihr mir den Wein wenigstens nicht weg.«
Sie lachten, holten sich ein Bier aus dem Kühlschrank, und ich lachte mit und wusste, dass ich zuhause war. So leerte ich meine Flasche Wein allein, bald landete eine Tüte Chips auf dem Tisch, und Kronkorken klingelten.
Emma schwärmte von der Brauerei an der Ecke, in der es so tolle Pizza gäbe, vom Klub der Republik, der dort vor ein paar Jahren im Trafohäuschen aufgemacht habe und wo man tatsächlich tanzen gehen könne, nur leider würde der Ende des Sommers schließen, dann käme das große Geld, mit dem wieder ein Stückchen wildes Berlin und Kreativität wegsaniert würde. Totsaniert, ergänzte sie.
Bastian sagte, wenn man die Brauerei nicht saniere, käme der Verfall. Das Dach würde einstürzen und alles würde nur noch umso teurer oder es fände sich nicht einmal ein Investor, und die Brauerei würde dann eben abgerissen. Ich wollte beiden Recht geben.
Obwohl niemand fragte, erzählte ich von meinem früheren Kiez in Kreuzberg, unvermeidlichen Rollkoffern, Airbnb und Luxussanierung, bis wir alle keine Lust mehr auf das Thema hatten und einen Moment lang schwiegen.
»Wie spät ist es?«, fragte Bastian.
»Wieso?«
»Wenn Herr Kassulke schläft, können wir es ihm zeigen.«
»Nach neun«, sagte ich nach dem Blick aufs Handy. Was wollten sie mir zeigen? »Wieso? Und wer ist Herr Kassulke?«
Bastian griff in die Chipstüte und stopfte sich den Mund voll. Seine ersten Worte gingen in einem Nuscheln unter.
»Was?«, fragte ich.
Emma sprang ein und lenkte ab. »Natürlich zeigen wir es ihm. Komm, nimm dir was zu trinken mit.«
Kichernd schlichen wir aus der Wohnung und zogen die Tür hinter uns zu. Es war ruhig im Treppenhaus, in dem es sehr nach Essen roch.
»Es gibt einen Dachboden?«
Bastian lächelte spöttisch. »Da oben ist ein Dachgeschoss, nach dem sich jeder Immobilienentwickler die Finger leckt. Staubig und leer.«
Emma lief voraus und ich fand, dass ihr der unsichere, schwankende Gang gut stand.
»Wie habt ihr den entdeckt?«
»Zufall. Die Hausverwaltung hat jemanden durch das Haus geführt. Ich habe mich angeschlossen.«
»Und jeder hat Zugang?«
Eine Treppe noch bis zum Investorenhimmel. Keuchend nahmen wir den letzten Absatz. Die Tür war von gleicher Gestalt wie die Wohnungstüren, nur weniger übermalt. Eigentlich sah sie aus, als sei sie seit dem letzten Krieg nicht ein einziges Mal überstrichen worden.
»Und mein Schlüssel passt auch?«
Bastian drehte sich auf dem Podest um.
»Schlüssel?« Er nahm den Türgriff in beide Hände, stemmte die Füße in den Boden und hob die Tür ein wenig an. Das Holz knackte, es knirschte, dann schwang die Tür in den Raum dahinter. Dunkler Muff strömte uns entgegen.
»Lichtschalter?«
»Quatsch«, sagte er und ließ etwas klicken. Ein heller Finger wies in die Dunkelheit. Grobe Dielen auf dem Boden. In den Ecken gestapelte Dachziegel. Holzbalken ragten in den leeren Raum. Es roch staubig, aber trocken. Bastian ging mit der kleinen Taschenlampe voran, dahinter Emma. Ich war versucht, sie um die Hüften zu fassen, als machten wir eine Polonäse. Die Dachluke lag versteckt in einer Gaube. Der Riegel knirschte rostig. Einer nach dem anderen schlüpften wir hindurch.
Zwischen unserem Haus und den auf den ersten Metern fensterlosen Quergebäuden der Nachbarhäuser erstreckten sich bestimmt zwanzig Quadratmeter Dach, bedeckt mit rissiger Teerpappe, uneinsehbar von drei Seiten. Auf der vierten Seite breitete sich die Stadt aus.
Unter uns der schäbige Innenhof, nach Süden hin durch eine Ziegelmauer getrennt von durchsanierter Blockrandbebauung, darüber ein freier Blick auf das Lichtermeer, in dessen Mitte der Fernsehturm prangte. Irgendwo rechts von uns, hinter den Häusern entlang der Hauptstraße, rappelten U-Bahn und Tram.
»Boah, wie geil«, flüsterte ich und setzte mich neben Bastian. Emma nahm im Schneidersitz hinter uns Platz. Ich hörte sie aus der Flasche trinken.
»Dit is Balin, wa?«, sagte Emma und es war ihr anzuhören, dass sie nicht in dieser Stadt geboren war. »Wenn Herr Kassulke wüsste, dass wir hier oben sind, würde er die Polizei rufen.«
Ich sah Bastians Augen blitzen.
»Ich wollte eigentlich, dass du unvoreingenommen die Menschen kennen lernst. Aber Herrn Kassulke wirst du anders vermutlich gar nicht kennen lernen.«
Während unter uns die Stadt nicht zur Ruhe kam und sich am Horizont nur noch ein letzter lila Schimmer zeigte, erzählten sie die ganze Geschichte.
Herr Kassulke wohnte in der Etage unter uns. Er war pensionierter Bahnbeamter und lebte anscheinend seit seiner Geburt in diesem Haus. Er war mindestens 80 Jahre alt, in Emmas Augen sogar über 90, und hatte in der Vergangenheit häufig sehr empfindlich auf Lärm reagiert, auch wenn es nur ganz kleine Partys gewesen waren, wie Bastian schmunzelnd erzählte.
Dann stand Herr Kassulke entweder vor der Tür, klopfte mit einem harten Gegenstand in seiner Wohnung an die Heizungsrohre, dass es nur so dröhnte, oder rief gleich die Polizei. Anfangs hatten Emma und Bastian sich noch über den alten Mann geärgert, doch irgendwann verstanden, dass er einfach skurril war und ein Teil ihres Hauses.
»Und immer wieder sagt er: Setzt euch nicht aufs Dach. Das ist nicht nur verboten, sondern auch gefährlich.«
Emma äffte den Alten nach: »Was da allet passieren kann. Ihr stürzt runter oder kracht durch die Teerpappe, wa, oder eine Flasche fällt in den Hof und erschlächt jemanden…«
Bastian nippte von seinem Bier. »Weißt du noch? Als wir mit Philip zum ersten Mal hier oben saßen?«
»War das, nachdem wir die Böden gemacht haben?«
Die Wohnung musste in einem erbärmlichen Zustand gewesen sein, als sie eingezogen waren. Drei Tage lang hatten sie die Dielen abgeschliffen, bis sich der Staub in jeder Pore ihres Körpers festgesetzt hatte. Eine schöne Vorstellung: Emma in der Dusche und wie sie sich den Staub abwusch.
Sie hatten Tage damit zugebracht, die ziemlich heruntergekommene Wohnung zu sanieren. Die Wände gestrichen, zweimal, um den Gilb zu übertünchen. Die Dielen abgezogen, bis sie beinahe an einer Staublunge krepiert waren. Noch tagelang, so erzählte Emma, hatte sie beim Naseputzen den feinen Staub in der Nase gefunden.
»Die haben vorher einfach irgendeine graue Farbe auf das Holz gepinselt. Und die Decken sahen aus. Das war nicht mehr charmant, das war einfach nur eklig. Philipp hat von uns am meisten gelitten. Das nächste Mal, hat er gesagt, kauft er sich eine Neubauwohnung, in der er nichts mehr machen muss.«
Philipp war der dritte Mitbewohner gewesen, ebenfalls ein BWL-Student, mein Vormieter. Er hatte Bastian durch sein Studium kennen gelernt.
»Ist ja erstaunlich, dass er so viel Arbeit reinsteckt und nach einem Jahr schon wieder geht.«
Gerade in Berlin, wo jeder froh sein sollte, überhaupt noch bezahlbaren Wohnraum zu finden. Inzwischen konnte ich ja selbst ein Lied davon singen.
»Der hat in München einen Job gefunden und ist von heute auf morgen weg. Wahrscheinlich arbeitet er jetzt als Consultant und hat seine Eigentumswohnung. Aber mich musst du hier mit den Füßen voran raustragen«, lachte Emma. Bastian schnaubte. Ich nahm es als Zustimmung.
»Ich habe hier so viel Staub geschluckt und Lösungsmittel eingeatmet, das muss ich erst noch ein paar Jahre abwohnen. Weißt du, wie Farbe in den Haaren klebt? Schlimmer ist nur Sperma.«
»Ist das so?«, fragte ich und Emma kicherte verlegen, als sei ihr erst jetzt bewusstgeworden, was sie da gesagt hatte.
»Auf jeden Fall war das die Hölle. Und meine Finger sahen vielleicht aus. Haben uns eigentlich die Vermieter was dazugegeben?«
Bastian räusperte sich. In der Ferne jammerte die Sirene eines Krankenwagens. Ein anschwellendes Heulen, das von der gegenüberliegenden Hauswand zurückgeworfen wurde, verkündete von der nahen Einflugschneise des Flughafen Tegels. Daran hatte ich vorher überhaupt nicht gedacht. Aber auch daran gewöhnte man sich, vor allem bei dieser Aussicht.
»Nein, keinen Cent. Ich hatte den Eindruck, als sei die Erlaubnis zur Eigeninitiative schon Belohnung genug gewesen.«
Allmählich versandete unser Gespräch. Nach ein paar Minuten spürte ich die Müdigkeit. Der Umzug steckte mir tief in den Knochen. Ich war es gewohnt, einen Stift über ein Grafiktablett zu führen. Sport gehörte wieder auf meine To-do-Liste.
In meinem Zimmer empfingen mich die vollen Kartons wie eine der zwölf Aufgaben des Herkules. Ich plante es für das Wochenende ein und legte mich tatenlos ins Bett.
Wie die beiden wohl zu Beziehungen innerhalb der WG standen? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Bastian noch keinen Gedanken daran verschwendet hatte.
Bevor ich einschlief, dachte ich noch, was für ein Glück ich doch mit meinen Mitbewohnern hatte.
4.
Ich war mit Anfang zwanzig nach Berlin gekommen und hatte die ersten Jahre als Dauerstudent verbracht. Ohne Vorstellung davon, was ich aus meinem Leben machen sollte. Zwar war ich für Soziologie eingeschrieben, damals hatte es noch den Diplomstudiengang gegeben, doch ich hatte die meiste Zeit auf Partys zugebracht.
Berlin in vollen Zügen genießen – das war meine Devise gewesen. Meine Eltern hatten mich finanziell ein wenig unterstützt, den Rest des Geldes verdiente ich durch Nebenjobs. Manchmal arbeitete ich in einer Bar, manchmal als Host auf einer Messe.
Nach über fünfzehn Jahren hatte ich eine andere Sicht auf Berlin gewonnen. Für die einen war die Hauptstadt noch immer ein Spielplatz, auf dem sie all das tun konnten, wozu sie Lust hatten. Party ohne Ende. Jede Nacht ein neuer Club. Wer nicht ins Berghain kam (dazu gehörte ich), fand auch so genügend Plätze, um sich auszutoben. Es musste ja nicht gleich der Kitkat-Club mit Gangbang-Partys sein. Man konnte sich auch im RAW nachts um zwei um Jacke und Handy erleichtern lassen.
In den vergangenen Jahren hatte sich die Begeisterung ein wenig abgenutzt und war Müdigkeit gewichen. Vielleicht war ich einfach älter geworden, aber ich empfand das Überangebot inzwischen erdrückend. Manchmal sehnte ich mich nach meiner Kleinstadt zurück, nach Überschaubarkeit, doch sobald ich bei meinen Eltern zu Besuch war, schwand die Lust auf Provinz spätestens in dem Moment, in dem ich die sterbende Innenstadt sah, die leeren Gewerberäume, die Ein-Euro-Shops, den moralischen Verfall. Die sanierten Plätze schienen zu groß geworden zu sein für die wenigen Menschen, die dort noch wohnten.
Wie hatte Rainald Grebe gesagt? Wenn du zur Ostsee willst, musst du durch Brandenburg. Nimm dir Essen mit, wir fahren nach Brandenburg. Seine Hymne auf Berlin hatte mich die letzten Jahre ebenso begleitet wie die bitteren Lobgesänge auf die Hauptstadt von Peter Fox. Halleluja Berlin. Alle wollen da hin. In das Drecksloch, in dem jeder einen Hund, aber keinen zum Reden hatte.
Ich war großstadtmüde geworden in manchen Momenten. Doch ich konnte hier nicht weg. Jede andere Stadt würde enger erscheinen, weniger dynamisch. Es fing beim Protest gegen die A100 an und hörte nicht bei Zalando und dem Protest dagegen auf. Hier wurde Weltpolitik gemacht und über den Müll in den Parks diskutiert.
Natürlich hätte ich das auch in Stuttgart haben können oder in München, Hamburg oder Köln. Doch die Wahrheit war, dass es in Berlin noch unvergleichlich billig war. Solange ich ein WG-Zimmer für 350 Euro bekam, würde ich hierbleiben.
5.
Ich faltete den letzten Umzugskarton zusammen und stellte ihn an die Zimmertür. Von dort aus betrachtete ich mein Werk. Alle Bücher hatten im Regal Platz gefunden. Erst durch den Umzug war mir wieder klargeworden, wie viel Ballast ich mit mir herumschleppte. Bücher, die man in seinem Leben nur einmal las. Vinyl-LPs, die man nicht mehr abspielte, seit der Plattenspieler den Geist aufgegeben hatte. Die Comicsammlung, die wohl nie vervollständigt wurde, weil die fehlenden Hefte inzwischen so teuer geworden waren, dass sie zusammengerechnet dem Wert eines fabrikneuen Mittelklassewagens entsprachen. Fotoalben, die darauf warteten, digitalisiert zu werden, wenn man sich nur aufraffen könnte, die Negative zu einem Datenrettungsunternehmen zu schicken.
So viele Dinge, die man in den Keller bringen könnte, um sie nach einem Jahr, wenn man sie keinen Tag lang vermisst hatte, bei eBay oder im Mauerpark zu verkaufen. Falls sie überhaupt jemand haben wollte.
Wie musste es erst dem alten Ehepaar gegangen sein, das die Wohnung nebenan bewohnt hatte? Wie sie jetzt wohl lebten? In einem Seniorenheim mit einem kombinierten Wohn-, Ess- und Schlafzimmer. Die Kinder hatten vielleicht schon alle Möbel verkauft, sich einverleibt, was noch verwertbar war und im Pflegeheim nicht mehr gebraucht wurde. Ein Bild von der Urgroßmutter würde dort an die Wand passen, ein Lieblingssessel. Aber der Ballast, der das Leben ausmachte, war weg. Jetzt konnte der Tod kommen.
Ich klopfte an Bastians Tür.
Er saß am Rechner, wie immer, und bevor er sich umdrehte, wechselte er auf den Windows-Startbildschirm.
»Sag mal, gibt es hier eigentlich einen Kellerraum?«
»Wieso?«
»Ich will meine restlichen Sachen irgendwo unterstellen.«
»Messie?«
»Irgendwann ist Vinyl wieder viel Wert.«
»Alternative Geldanlage also.«
Bastian grinste. Beim Aufstehen schob er seinen Bürostuhl nach hinten. »Du wirst enttäuscht sein. Unser Kellerraum ist etwas rustikal.«
Er klappte seinen Laptop zu, ehe ich auch nur einen Absatz hatte entziffern können. Warum bist du so neugierig?, schalt ich mich in Gedanken.
Wir gingen über die Hintertür in den Hof, in dem die Mülltonnen standen, Fahrradleichen und Laufräder. Direkt an der Mauer befand sich eine Luke mit zwei großen, rostroten Klappen. Mit seinem Wohnungsschlüssel entriegelte er ein Schloss, das ich zwischen den Griffbügeln lediglich für eine funktionslose Antiquität gehalten hatte. Gemeinsam hoben wir die Klappen an und ließen sie knirschend zur Seite fallen. Ein dunkles Loch gähnte uns an, roch nach Kalk und Staub und Muff. Bastian stieg die ersten Stufen hinunter und drückte auf einen Lichtschalter, der auf den Putz geschraubt war, irgendwann bei einer oberflächlichen Instandsetzung. Ich hatte Angst, er könne abfallen und wie ein Auge am Sehnerv von der Wand baumeln.
Wir nahmen die staubigen Betonstufen und mussten achtgeben, dass wir uns nicht die Köpfe stießen. Am Ende der kurzen Treppe ging es links und rechts tiefer in die Katakomben. Schnaufend blieb Bastian stehen, schien sich orientieren zu müssen, und bog dann links ab. Ich fand es skurril, dass ich innerhalb von wenigen Tagen erst das Dachgeschoss und dann den Keller kennen lernte.
Jeden Mieterkeller verschloss eine der typischen Holzgittertüren, die man vermutlich in jedem Berliner Keller fand. Vor jeder Tür baumelte ein anderes Vorhängeschloss. Eine Nummer suchte ich vergeblich. Eng geschraubte Holzlatten verbargen die Verpackungen von Computern und Mikrowellen, brachen Umzugskartons, Wintersportgeräte und Autoreifen in horizontale Fragmente. Dinge, die man gerade nicht braucht. Was man ein Jahr lang nicht vermisst, kann man wegwerfen.
Nur einer war leer. Vermutlich der des alten Ehepaars. Die Tür stand offen. Bastian drückte sie im Gehen zu und blieb an der nächsten Ecke stehen. Der Verschlag hatte nicht einmal eine Tür, eine Nische in einer Ecke, wo der Putz bröckelte und eine staubige Schicht auf dem groben Estrich gebildet hatte. Dort standen ein paar Bananenkisten mit Büchern und ein altes Fahrrad.
»Und wo habt ihr eure Sachen, für die man im Zimmer kein Platz hat und nicht wegwerfen will?«
»Dokumente, Fotos und Filme liegen auf der Festplatte und in der Cloud. Ich habe keinen Platz für Nostalgie.«
»Echt jetzt? Und die anderen Mieter haben alle einen Keller? Nur wir nicht?«
Das konnte ich nicht glauben. Jede Wohnung hatte einen Kellerraum mit Tür. Selbst die miesesten Löcher. Bastian lächelte müde, als hätte er diese Diskussion schon mit meinem Vormieter und Emma geführt.
»Die Preisfrage: Wie viele Türen müssten hier sein?«
Ich zählte im Geiste nach.
Pro Etage zwei Wohnungen, bei vier Etagen machte das acht. Dazu der Trödelladen im Erdgeschoss. Es müsste also neun Kellerräume geben.
Wir begannen auf der linken Seite. Langsam schritten wir die Türen ab. Nach drei Türen war Schluss. Eine Stahltür an der Stirnseite war Nummer vier. Auch sie war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Ich hatte eine solche Tür schon einmal in einem Selfstorage-Lagerhaus gesehen. Vermutlich hatte der Trödelheini dort sein privilegiertes Lager.
Wir drehten um und gingen an der Treppe vorbei auf die rechte Seite. Dort befanden sich vier Verschläge. Es waren insgesamt also acht Räume.
»Was sagt die Hausverwaltung dazu? Das ist doch keine Reise nach Jerusalem. Wer zuerst kommt, kriegt einen Raum und der letzte muss seine Sachen verscherbeln?«
»Frag mich nicht. Als ich die Wohnung übernommen habe, war der Keller irgendwie kein Thema gewesen. Sollen wir mal im Mietvertrag nachsehen? Oder fragen, ob wir den freien Kellerraum bekommen können?«
Ich winkte ab. Ich gab ihm ohnehin insgeheim Recht. Ich hatte viele Dinge ein Jahr lang nicht benutzt. Meine CDs gehörten dazu.
Schließlich stellte ich meine Kartons in die Nische, ich stapelte sie vielmehr, und was ich dort nicht unterbringen konnte, verkaufte ich bei eBay Kleinanzeigen.
6.
Wir gewöhnten uns schnell aneinander. Und mit Gewöhnung meine ich, dass es keine Reibungspunkte gab. Dazu gehörte, dass wir abwechselnd den Müll herunterbrachten, Bastian sein Altglas in den Container im Hof und Emma ihre Espressomaschine abwusch. Sie nutzte eine dieser achteckigen Dinger aus Alu, die man in Italien auf die Herdplatte stellt.
Wenn ich morgens in die Küche kam, Emma stand schon mit einem Espresso am offenen Balkon und sah hinunter auf die Straße, hörte ich am liebsten Radio Eins. Anscheinend hörte sonst niemand Radio, denn der Sender war nie verstellt. Es waren solche Kleinigkeiten, so wie wir unsere Grenzen im Kühlschrank respektierten, die Schuhe an der Tür auszogen, und die Post auf den kleinen Tisch im Flur legten, wo der WLAN-Router ständig blinkte. Wir waren eine Berufstätigen-WG, das war von vorneherein klar gewesen, aber ich war dennoch überrascht, dass wir auf eine überraschende, sehr freundschaftliche Art miteinander harmonierten.
In meiner vorherigen WG war es ein Nebeneinander gewesen. Meinen Mitbewohner hatte ich nie zu sehen bekommen, weil er einen ganz anderen Rhythmus hatte. Spät aufstehen, spät nach Hause kommen. Manchmal hatte er sich nachts noch in der Küche etwas zu essen gemacht und die Musik aufgedreht, ohne Rücksicht, ohne schlechtes Gewissen, als sei er allein auf der Welt.
Wenn ich abends mit verpixelten Augen aus der Agentur nach Hause kam, fand ich Emma manchmal in der Küche sitzen und sich etwas zu essen machen. Sie war das Gegenprogramm zu meinem Werberalltag. Unberührt von Photoshop und dennoch zielgruppenorientiert. Sie wollte nichts verkaufen, denn der einzige Call-to-Action am Ende lautete: jetzt abschalten. Emma machte auf dem alten Herd kleine Gerichte, die sie Tapas nannte. Pflaumen im Speckmantel. Kartoffelomelette, gebratene Sardinen, Tortillas.
Einmal setzte sich auch Bastian dazu, nahm sich ein Bier aus dem Kühlschrank, und wir quatschten wir bis spät in die Nacht und es schien, als wollte keiner von uns ins Bett, um nicht noch einen klugen Kommentar zu verpassen oder ein Wortgefecht, das Bastian und ich uns lieferten.
Ich erfuhr nicht viel von seinem Studium oder was er sonst so machte, dafür erzählte ich von meiner Arbeit. In meinen Augen arbeitete ich tatsächlich für die dunkle Seite der Macht, musste ein Produkt verkaufen, hinter dem ich nicht stand. Ich besaß nicht einmal ein Auto, hatte nie eines besessen, und musste Hochglanzbilder von übermotorisierten SUV bearbeiten, Fahrzeuge, die immer mehr versprachen, als sie in Wirklichkeit halten konnten. Wer konnte denn in einer Stadt etwas mit 280 km/ h anfangen, mit 320 PS, mit Vierradantrieb? Niemals würden die Käufer dieser 50.000-Euro-Schlitten das tun, was ihnen die Werbung versprochen hatte. Und weil dieser Frust bei den Autoverkäufern stieg, rasten sie auf Autobahnen oder Landstraßen, drängelten und dröhnten durch die Straßen.
»Aber am Ende ist doch der Käufer selbst verantwortlich. Werbung macht die Dinge transparent«, sagte ich provozierend. »Die Entscheidung liegt doch beim Käufer.«
»Das nennst du Transparenz? Werbung verspricht dir doch Dinge, die gar nicht stimmen.«
»Natürlich stimmen die Werbeversprechen. Ein Auto fährt 280. Über menschenleere Straßen und an einsame Strände. Wenn sie denn leer und einsam sind.«
»Aber im Alltag stehst du mit der Karre halt im Stau.«
»Solange du ein mündiger Verbraucher bist, erwarte ich, dass du selbst herausfindest, was Werbeversprechen und was Wirklichkeit ist.«
»Und die Verbrauchswerte? Kann ich die auch nachprüfen?«
»Nein, da musst du dem Hersteller vertrauen. Wenn er dich belügt, hast du Pech gehabt. Das ist bei Lebensmitteln nicht anders, zum Beispiel bei Bioprodukten. Entweder vertraust du dem Hersteller, dass er wirklich seine Tiere gut behandelt und sein Gemüse ohne Pestizide anbaut oder du prüfst alles nach. Aber das kannst du gar nicht.«
»Das ist doch ein schiefer Vergleich«, sagte Emma. »Ein Biohersteller belegt seine Behauptungen mit einem Siegel.«
»Und wer prüft, ob das Siegel zu Recht draufklebt?«
»Gibt's da nicht Behörden?«
»Das heißt, du musst darauf vertrauen, dass die ihre Arbeit richtig machen.«
»Und das sollte ich nicht?«