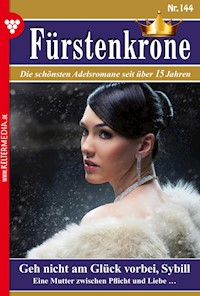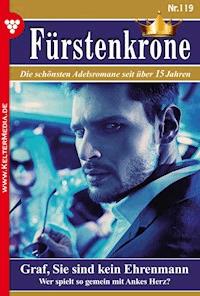Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fürstenkrone Classic
- Sprache: Deutsch
Nun gibt es eine exklusive Sonderausgabe – Fürstenkrone Classic In der völlig neuen Romanreihe "Fürstenkrone" kommt wirklich jeder auf seine Kosten, sowohl die Leserin der Adelsgeschichten als auch jene, die eigentlich die herzerwärmenden Mami-Storys bevorzugt. Romane aus dem Hochadel, die die Herzen der Leserinnen höherschlagen lassen. Wer möchte nicht wissen, welche geheimen Wünsche die Adelswelt bewegen? Die Leserschaft ist fasziniert und genießt "diese" Wirklichkeit. Rechtsanwalt Dr. Günther erhob sich, als Sabine das Zimmer betrat. Ein paar Schritte ging er auf sie zu und streckte ihr beide Hände entgegen. »Sabine. Nun ist es überstanden. Du warst sehr tapfer, Mädel.« »Tapfer?« wiederholte sie und zuckte hilflos die Achseln. »Ich weiß es nicht. Von dem ganzen Begräbnis habe ich kaum etwas wahrgenommen, aber ich bin froh, daß es vorüber ist, wenngleich daheim jetzt auch alles so leer, so unheimlich still ist. Mutti ging für immer fort, das ist so entsetzlich schwer zu begreifen, Onkel Hans.« »Ja, zu begreifen ist es auch kaum. Angela war noch so jung, kaum vierzig Jahre alt. Und doch sollten wir dankbar sein, Sabine. Sie hat unter ihrer Krankheit sehr leiden müssen, und es wäre schlimmer, immer schlimmer geworden. Das hat Gott ihr erspart.« »Guter Onkel Hans«, sagte das schöne Mädchen. »Ich weiß nicht, wie ich diese Tage durchgestanden hätte, wenn du nicht gewesen wärst.« Sabine wollte nicht weinen, aber zu groß war der Schmerz, der ihr einsames Herz erfüllte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fürstenkrone Classic – 59 –
Sie spielte die Rolle der Braut
Christel Förster
Rechtsanwalt Dr. Günther erhob sich, als Sabine das Zimmer betrat. Ein paar Schritte ging er auf sie zu und streckte ihr beide Hände entgegen.
»Sabine. Nun ist es überstanden. Du warst sehr tapfer, Mädel.«
»Tapfer?« wiederholte sie und zuckte hilflos die Achseln. »Ich weiß es nicht. Von dem ganzen Begräbnis habe ich kaum etwas wahrgenommen, aber ich bin froh, daß es vorüber ist, wenngleich daheim jetzt auch alles so leer, so unheimlich still ist. Mutti ging für immer fort, das ist so entsetzlich schwer zu begreifen, Onkel Hans.«
»Ja, zu begreifen ist es auch kaum. Angela war noch so jung, kaum vierzig Jahre alt. Und doch sollten wir dankbar sein, Sabine. Sie hat unter ihrer Krankheit sehr leiden müssen, und es wäre schlimmer, immer schlimmer geworden. Das hat Gott ihr erspart.«
»Guter Onkel Hans«, sagte das schöne Mädchen. »Ich weiß nicht, wie ich diese Tage durchgestanden hätte, wenn du nicht gewesen wärst.«
Sabine wollte nicht weinen, aber zu groß war der Schmerz, der ihr einsames Herz erfüllte. Aufschluchzend barg sie das Gesicht an der Schulter des Anwaltes. Der ließ sie gewähren, denn er wußte, daß Tränen auch erlösen können.
Es dauerte lange, ehe Sabine Rothe sich wieder aufrichtete. Mit dem Handrücken wischte sie sich über Augen und Wangen, und, noch immer schluckend, fragte sie dann:
»Du wolltest mich sprechen, Onkel Hans? Ich darf doch weiter deine Sekretärin sein, oder?«
»Welche Frage. Ich bin sehr froh, daß ich dich habe, und das sage ich weiß Gott nicht, um dir zu schmeicheln.«
»Ich werde gleich morgen früh wiederkommen, ja?« Der Anwalt nickte zwar, aber man sah ihm an, daß ihn ein anderer Gedanke sehr beschäftigte, und Sabine erriet ihn:
»Betrifft es Mutti, was du mir zu sagen hast?«
»Sie und dich, vor allem dich«, antwortete Günther zögernd. »Aber setzen wir uns doch zuerst einmal.«
Er schob ihr einen bequemen Sessel hin und nahm selbst wieder hinter seinem Schreibtisch Platz.
Gespannt beobachtete Sabine ihn. Einige Minuten ließ er vergehen, ohne zu sprechen. Offensichtlich fiel es ihm schwer.
»Du kannst mir alles sagen, Onkel Hans, das weißt du doch. Hat Mutti dir etwas aufgetragen?«
»Ich würde nicht die rechten Worte finden. Nein, nein, deine Mutter soll zu dir sprechen, aber du wirst tapfer sein, ja? Du wirst alles in Ruhe in dir aufnehmen, und wenn du dann noch Fragen hast, werde ich sie dir gern beantworten. Schau, hier ist der Brief.«
»Das ist ja ein Päckchen.«
»Deine Mutter hat sehr lange daran geschrieben. Am besten nimmst du es mit hinüber ins kleine Zimmer. Dort bist du allein, und niemand wird dich stören.«
Nur zögernd nahm Sabine dem Anwalt jenes Päckchen ab. Ihre Hände zitterten. Was würde sie erfahren? Was kam nun wieder auf sie zu?
Langsam erhob sie sich aus ihrem Sessel, und nachdenklich, Schritt für Schritt, verließ sie das Zimmer. Ihren Blick hielt sie starr auf das Päckchen gerichtet.
Und dann war sie allein. Niemand beobachtete Sabine, als sie den langen Brief der geliebten Mutter zu lesen begann. Ja, es war die zierliche Handschrift Angela Rothes, die viele, viele Briefbogen füllte.
Mein geliebtes Kind, heute spreche ich in ungewohnter Weise zu Dir. Wir können einander nicht mehr in die Augen sehen, Du und ich, aber Du darfst deshalb nicht traurig sein. Wenn Du diese Zeilen liest, sind meine Schmerzen überwunden, und ich werde Ruhe und Frieden haben. Weine nicht mehr, Sabine, ich wünsche es mir von ganzem Herzen.
Aber nicht das ist es, was ich Dir zu sagen habe. Ich möchte ein Geheimnis vor Dir ausbreiten, mein Leben. Ich schulde es Dir. Bitte, verzeih, daß ich es so lange wahrte.
Laß mich ganz von vorn beginnen, an dem Tag, an dem die achtzehnjährige Angela Bernhold dem Manne ihrer Liebe begegnete, Leopold von Alsleben. Als ich ihn zum ersten Mal sah, wußte ich: Dieser Mann wird dein Schicksal sein.
Ohne Bedenken wurde ich seine Frau und ging mit ihm. Er hatte mir sein Zuhause geschildert, aber die Wirklichkeit übertraf all meine Vorstellungen. Gut Alsleben schien mir das Paradies zu sein. Ich betrat es also mit den wunderbarsten Hoffnungen.
Daß man mich recht eisig empfing, empfand ich nicht einmal. Ich wußte, für so viel Glück hatte ich dankbar zu sein, und Gott ist mein Zeuge, daß ich es auch sein wollte.
Meine Wünsche sollten sich nicht erfüllen, mein Kind. Bald schon zeigte man mir, daß die bürgerliche Frau Leopold von Alslebens nicht auf das Gut gehörte. Die Mutter meines Mannes haßte mich, und Tag und Nacht sann sie darauf, wie sie mich wieder vertreiben konnte.
Sie sagte es mir offen, Leopold gegenüber aber spielte sie die gütige Mama. Er hing an ihr. Sollte ich es sein, die Zweifel in ihm erweckte? Ich hoffte weiter und schwieg, ich liebte meinen Mann und wollte ihn nicht verlieren.
Oft geschah es, daß man mich verleumdete, aber noch glaubte Leopold mir. Dann aber mußte er auf lange Zeit verreisen. Da ich ein Kind erwartete und es mir gar nicht gut ging, konnte ich ihn nicht begleiten. Mein Mann hatte das Gut kaum verlassen, als das Leben für mich zur Hölle wurde. Meine Schwiegermutter ließ nun ihrem Haß und ihren Launen freie Bahn. Böse, entsetzliche Worte hörte ich tagein, tagaus. Sie quälte mich unablässig, und ich konnte mich nicht wehren. Das Schicksal war auf ihrer Seite.
Kurz vor der Rückkehr meines Mannes spielte es ihr den wichtigsten Triumph in die Hand. Auf dem Gut arbeitete ein junger Mann, der mit seiner Mutter in einem kleinen Häuschen unweit des Gutes wohnte.
Eines Tages verunglückte er, und seine Mutter hatte allen Anlaß, sehr besorgt zu sein. Mit irdischen Gütern waren die beiden Menschen nicht gesegnet, und ich glaubte, Gutes zu tun, wenn ich ihnen hin und wieder heimlich etwas brachte. Dann kam jener Tag, der alles entschied.
Es ging ihm nicht schlecht an diesem Tag, und als er aufzustehen verlangte, half ich ihm. Er mußte sich auf mich stützen, und weil es gar so gut ging, umarmte er mich in seiner Freude. Just in diesem Augenblick ging die Tür auf, und Leopold stand da.
»Es ist also wahr!« Nur diese Worte sagte er und ließ sich nicht mehr davon abbringen. Böse Worte fielen zwischen uns, und ich begann zu zweifeln, daß er mich jemals wirklich geliebt hatte. Einzig mein Stolz blieb mir.
Die Scheidung war nunmehr nur noch eine Frage der Zeit. Das Recht stand auf seiner Seite, und schon bald sollte ich spüren, wie sehr er davon Gebrauch zu machen gedachte. Ich erwartete ein Kind, und Leopold verlangte, daß ich es hergab, sobald ich es geboren hatte.
Furchtbare Monate hatte ich auszuhalten. Natürlich war ich nicht auf dem Gut geblieben, sondern wohnte wieder in der Stadt. Mein Zimmer war klein, und ich besaß kaum etwas, um leben zu können. Sicher war dies die schwerste Zeit meines Lebens, Sabine, und heute begreife ich kaum noch, daß ich sie durchstand.
O doch, ich begreife es schon, denn da war jemand, der mir sehr half: Klaus Rothe. Er war Arzt, und ich kannte ihn von früher. Ausgerechnet ihn holte man, als ich eines Morgens wieder einmal ohnmächtig in meinem Zimmer lag. Ich nahm kaum wahr, was man mit mir anstellte, um mich ins Leben zurückzurufen.
Nur eines begriff ich: Mein Kind würde nun zur Welt kommen. Ich mußte Klaus all meine Angst bekannt und ihn um Hilfe angefleht haben. Erinnern kann ich mich nicht daran, aber er handelte für mich. Viele Tage später erst konnte er mir berichten, was geschehen war. Ich hatte nicht ein, sondern zwei kleine Mädchen geboren, Zwillinge, die man sofort nach der Geburt trennen mußte, weil eines gar zu schwach war. In dem Körbchen neben mir lag also nur Susanne, und Klaus Rothe entwickelte mir seinen Plan.
»Das Kind ist dem Vater zugesprochen, und wir dürfen nicht zweifeln, daß er es holen wird. Du mußt Susanne hergeben, Angela, aber da ist ja noch Sabine. Ich habe dafür gesorgt, daß die Alslebens nicht erfahren werden, daß es sie gibt«, sagte er.
Es hätte keinen Sinn gehabt, mich zu wehren. Ich kann nicht schildern, was ich empfand, als Leopold Susanne wirklich holen ließ. Ich habe nie so verzweifelt geweint wie an diesem Tag, und wäre Klaus nicht gewesen, ganz sicher hätte ich den Mut zum Leben verloren.
Aber er war da, und er beschützte Dich und mich, mein Kind. Ich war genesen, als er mich bat, seine Frau zu werden. Ich habe mein Jawort nie bereuen müssen, denn Klaus war mir ein guter Gatte und Dir ein liebevoller Vater.
Allzu früh nahm Gott ihn wieder von uns, aber Du erinnerst Dich an ihn, nicht wahr, Sabine? Er war uns ein verläßlicher Freund.
Trotzdem konnte ich nicht verhindern, daß meine Gedanken oft den Weg zurückeilten, den ich gekommen war. Ich mag nicht lügen, also gestehe ich Dir, mein Kind, daß ich meine Liebe zu Leopold von Alsleben nicht überwand. Vor allem in den letzten Jahren, in denen meine Krankheit fortschritt, habe ich oft an ihn gedacht, und heute, da ich diese Zeilen an Dich schreibe, weiß ich, daß ich ihm verziehen habe.
Ich werde ihn nie mehr wiedersehen, also kann ich ihm auch nicht mehr sagen, was damals wirklich geschah. Soll er es nie erfahren, Sabine? Der Gedanke ist mir fast unerträglich.
So bitte ich Dich also, geh zu Deinem Vater und sage ihm, daß ein Herz zu schlagen aufhörte, das einzig ihm gehörte. So wird er nicht mehr in Gram und Bitterkeit an mich denken, und ich werde ruhig schlafen können. Aber nicht nur deswegen geh nach Alsleben.
Du weißt jetzt, daß dort Deine Schwester lebt. In der gleichen Stunde kamt ihr zur Welt. Susanne ist der Mensch, der Dir am nächsten steht. Noch weiß sie nichts von Dir, aber ich bin ganz sicher, daß Ihr einander liebhaben werdet. Das Schicksal trennte Euch, die Natur aber wird Euch zusammenführen.
Seid glücklich miteinander, meine Kinder, und in Eurem Glück denkt hin und wieder auch an mich. Leb wohl, meine kleine Sabine. Gott schütze Dich. Deine Mutti
»Nein«, flüsterte Sabine. »Um Gottes willen, nein, das alles kann doch nicht wahr sein.«
Aufschluchzend preßte sie den Brief der Mutter an die Brust, und heiße Tränen überströmten ihr liebliches Gesicht. Mit unbändiger Gewalt stürmte das eben Gelesene auf sie ein. Das sollte sie begreifen?
Die Stille in dem kleinen Raum drohte sie zu ersticken. Sie sprang auf, und wie gehetzt lief sie in die Kanzlei Dr. Günthers zurück. Der wartete bereits auf sie, und schützend zog er sie in seine Arme.
»Du kennst diesen Brief?«
»Ja, ich habe ihn gelesen, bevor Angela ihn versiegelte, und sowohl vorher als auch nachher haben wir sehr oft über alles gesprochen. Ich sagte eben schon, wenn du noch Fragen hast, will ich die sie gern beantworten.«
»Fragen? Ich habe hundert oder tausend Fragen, wenn das wirklich alles wahr ist. Mein Gott, mir schwindelt. Vielleicht bin ich es, die träumt.«
»Wir wollen uns wieder setzen, ja? Und vor allem höre zu weinen auf, Sabine. Das würde deiner Mutti weh tun.«
Wie zu einem kleinen Kind sprach er, und willenlos ließ Sabine sich zu einem Sessel führen. Für Sekunden schloß sie die Augen, und noch immer waren ihre Wangen tränennaß.
»Du glaubst also auch, daß ich zu ihm gehen werde?«
»Es war der letzte Wunsch deiner Mutter und sicher der größte.«
»Sie würde mir verzeihen, daß ich ihn nicht erfülle. Nein, Onkel Hans, dieser Herr von Alsleben ist mir fremder als Herr Jedermann draußen auf der Straße. Mein Vater war Klaus Rothe, und er ist tot.«
»Der Baron ist dein Vater, und er lebt«, widersprach Dr. Günther.
»Baron ist er? Dann wird er über Sabine Rothe doch nur die Nase rümpfen.«
»Jetzt wirst du bitter, das hat deine Mutter sicher nicht gewollt. Er ist dein Vater, Sabine, das allein wird wichtig für ihn sein.«
»Du meinst also, ich sollte vor ihn hintreten und ihn um Mitleid bitten? O nein, das werde ich niemals tun.«
»Von Mitleid war nicht die Rede, das hat auch deine Mutter nicht gewollt. Er soll durch dich die Wahrheit erfahren und seinen Irrtum erkennen.«
»Nach zwanzig Jahren? Er wird Mutter längst vergessen haben.«
»Ich weiß nicht, ob man das überhaupt kann, sie vergessen, da es auf Alsleben einen Menschen gibt, der ihn immer an sie erinnerte.«
»Susanne, meine Schwester.«
»Stell es dir doch einmal vor, Kind. Dort lebt ein Mensch, in dessen Adern das gleiche Blut wie in deinen fließt. Weißt du nicht mehr, daß du dir immer eine Schwester gewünscht hast?«
»Ja, das tat ich. Wie mag sie sein, Onkel Hans?«
»Na, Gott sei Dank, wenigstens ein bißchen neugierig bist du. Ich weiß es nicht, wie Susanne ist, weiß nicht, wie sie aussieht und wie sie lebt.«
»Mutti hat nie von ihr gehört, in all den Jahren nicht?«
»Nein. Sie sehnte sich nach ihr, aber die Trennung wäre nicht leichter für sie gewesen, wenn sie sie hin und wieder aus der Ferne hätte sehen können. Mit Recht war mein Freund Klaus Rothe entschieden dagegen, daß in dieser Hinsicht auch nur der kleinste Versuch unternommen wurde.«
»Wäre er dafür, wenn ich jetzt zu ihnen gehe?«
»Ich denke ja, nur sollte es unter der richtigen Voraussetzung geschehen. Dein Papa hat Haß und Rachegedanken stets verurteilt, und vergiß eines nicht, er hat durch den Verrat Leopold von Alslebens die Frau gewonnen, die er liebte. Ich weiß sehr genau, daß Klaus Rothe ein paar Jahre seines Lebens überaus glücklich war. Die Jahre nämlich, die er mit euch verbunden war.«
»Du bist ein guter Anwalt, Onkel Hans, ich habe nie daran gezweifelt.«
»Ein väterlicher Freund möchte dich überzeugen, Kind. Verzeihen ist etwas Wundervolles, und deine Mutter hat verziehen. Kannst du verachten, was sie liebte?«
»Ich soll also wirklich nach Alsleben gehen?«
»Ich würde sagen, bedenke es ein paar Tage und entscheide dann. Es könnte dort etwas sehr, sehr Schönes auf dich warten.«
*
Als Sabine nähernde Schritte hörte, wäre sie am liebsten noch jetzt davongelaufen.
Es war ein livrierter Diener, der die Tür öffnete.
»Gnädiges Fräulein sind schon zurück?«
Kein Zweifel, der Diener war ungehalten. Die Braue über seinem linken Auge hob sich, als sein Blick ihr Kleid streifte.
»Sah ich Sie nicht im Reitanzug fortgehen, Baronesse?«
»Bitte?«
Zu dumm diese Situation. Sabine war sich nie so hilflos vorgekommen.
»Kann ich den Herrn Baron sprechen?« Alle Energie und allen Mut nahm sie zusammen.
Der Diener schien sie nicht für ganz normal zu halten.
»Darf ich Sie anmelden?« fragte er, und das Zucken in seinen Mundwinkeln verriet, daß er die vermeintliche Baronesse absolut nicht verstand.
»Ja, bitte«, sagte Sabine erleichtert, und für einen Moment atmete sie erst einmal auf.
Der Diener durchquerte die Halle gemessenen Schrittes, und ehe er an eine der vielen Türen klopfte, sah er sich noch einmal nach ihr um. Was konnte Sabine anderes tun, als ihm zuzunicken?
Er öffnete jene Tür, blieb in ihrem Rahmen stehen und verbeugte sich ins Zimmer hinein.
»Das gnädige Fräulein bittet darum, den Herrn Baron sprechen zu dürfen«, hörte Sabine ihn sagen, und die tiefe Stimme eines Mannes antwortete:
»Wie bitte? Was soll das, Franz? Bei dieser Hitze auch noch Scherze?«
Das also ist mein Vater, dachte das Mädchen. Oh, lieber Gott, hilf, daß ich alles richtig mache.
»Ich erfülle nur einen Auftrag, Herr Baron«, verteidigte sich der Diener. »Das gnädige Fräulein wartet in der Halle.«
»Auf Gedanken kommt sie. Na schön, dann lasse ich also bitten.«
So langsam wie nur möglich ging Sabine durch die Halle. Jede Sekunde, die sie gewann, erschien ihr kostbar. Dann aber hatte sie jenes Zimmer doch betreten, aus dem die Stimme des Barons eben gekommen war. Tief senkte das Mädchen den Blick und schluckte.
»Einen schönen Tag, Fräulein von Alsleben. Bitte, womit kann ich denn dienen?«
Ist es möglich, daß ich Susanne so ähnlich bin? überlegte Sabine. Selbst er verwechselt mich.
»Ich… ich bin nicht… ich meine«, begann sie zu stottern. »Herr Baron, das ganze ist ein Irrtum.«
»Das scheint mir allerdings auch so.« Er kam auf sie zu und schüttelte verständnislos den Kopf.
»Welche Ideen dir nur kommen. Du läutest, schreckst den guten Franz aus seinem Mittagsschlaf auf und läßt dich dann gar noch anmelden. Also, heraus mit der Sprache. Was hast du verbrochen? Du weißt, ich bin der großzügigste Vater auf der Welt.«
»Ich kann mich nur wiederholen, Herr Baron. Ich bin nicht die Baronesse«, sagte Sabine leise und blickte noch immer nicht auf. »Mein Eindringen hier… ich meine…«
Endlich stutzte er und kam noch näher heran. Seine Augen zogen sich zusammen, und sein Gesicht wurde ernst.
»Mir scheint es jetzt auch so«, sagte er, »aber ich begreife nicht.«
»Ich heiße Sabine Rothe. Sie werden meinen Namen nie gehört haben, Herr Baron.«
»Kaum, ja, ich erinnere mich jedenfalls nicht. Herrgott, wie soll das möglich sein. Sie sind genau wie Susanne, das gleiche Haar, die gleichen Augen, das gleiche Gesicht. Auch Ihre Stimme ist wie Ihre.«
»Das dachte ich mir schon. Man sprach mich überall mit ihrem Namen an.«
»So? Und deshalb kamen Sie her?«