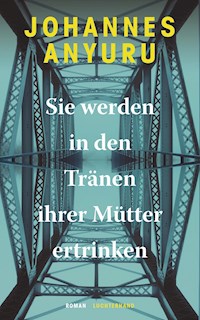
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Winternacht in Göteborg. Ein Anschlag auf einen Comicshop. Unter den Attentätern: ein junges Mädchen, die das Ganze filmen und später ins Internet stellen soll. Mitten im Angriff kommen ihr Zweifel. Auf einmal ist sie sich sicher, dass falsch ist, was sie tut. Zwei Jahre später, inzwischen untergebracht in der Psychiatrie, bittet sie um ein Treffen mit einem Schriftsteller, dessen Bücher sie gelesen hat. Ihm überreicht sie ein Manuskript, in dem sie eine düstere Zukunftsvision zeichnet. Was aber will sie ihm sagen? Was ist wirklich passiert? Der Schriftsteller macht sich auf die Suche nach Antworten, spricht mit Zeugen und Opfern des Attentats. Es ist die Suche nach Wahrheit, aber auch die Suche nach einer Antwort auf die Frage, ob man als Muslim noch in Schweden leben kann.
Dieses Buch hallt lange nach, weil es ein Beitrag zum Verständnis unserer Gegenwart ist, der sich jeglicher Vereinfachung entzieht, der simplen Parolen die Komplexität des Menschen gegenüberstellt. Ein wichtiges Buch. Eindringlich und poetisch. Hochaktuell und originell. Traurig und tröstlich zugleich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Eine Winternacht in Göteborg. Ein Anschlag auf einen Comicshop. Einer der Attentäter ist ein junges Mädchen, die das Ganze filmen und später ins Internet stellen soll. Mitten im Angriff kommen ihr Zweifel. Auf einmal ist sie sich sicher, dass falsch ist, was sie tut. Zwei Jahre später, inzwischen untergebracht in der Psychiatrie, bittet sie um ein Treffen mit einem Schriftsteller, dessen Bücher sie gelesen hat. Ihm überreicht sie ein Manuskript, in dem sie eine düstere Zukunftsvision zeichnet. Was aber will sie ihm sagen? Was ist wirklich passiert? Der Schriftsteller macht sich auf die Suche nach Antworten, spricht mit Zeugen und Opfern des Attentats. Es ist die Suche nach Wahrheit, aber auch die Suche nach einer Antwort auf die Frage, ob man als Muslim noch in Schweden leben kann.
Dieses Buch hallt lange nach, weil es ein Beitrag zum Verständnis unserer Gegenwart ist, der sich jeglicher Vereinfachung entzieht, der simplen Parolen die Komplexität des Menschen gegenüberstellt. Ein wichtiges Buch. Eindringlich und poetisch. Hochaktuell und originell. Traurig und tröstlich zugleich.
Autor
Johannes Anyuru, geboren 1979, gilt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Autoren Schwedens. Er debütierte 2003 mit einer viel beachteten und hoch gerühmten Gedichtsammlung (Det är bara gudarna som är nya/Nur die Götter sind neu). Für seinen zweiten Roman »Ein Sturm wehte vom Paradiese her«, eine autobiografisch geprägte Annäherung an das Schicksal seines Vaters, bekam er zahlreiche Preise, er wurde für den wichtigsten Literaturpreis des Landes, den Augustpreis, nominiert sowie für den Preis des Nordischen Rates. Ausgezeichnet wurde er mit den Literaturpreisen von Svenska Dagbladet und Aftonbladet, er stand auf Platz 1 der Kritikerliste von DagensNyheter und wurde in sieben Sprachen übersetzt. Für seinen dritten Roman »Sie werden in den Tränen ihrer Mütter ertrinken« bekam er schließlich den Augustpreis sowie den Per-Olov-Enquist-Preis verliehen, das Buch wird in vierzehn Ländern erscheinen. Es stand monatelang auf der schwedischen Bestsellerliste, die Filmrechte sind verkauft.
Johannes Anyuru
Sie werden in den Tränen ihrer Mütter ertrinken
Roman
Aus dem Schwedischen von Paul Berf
Luchterhand
Die schwedische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »De kommer att drunkna i sina mödrars tårar« bei Norstedts, Stockholm
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Übersetzung wurde von The Swedish Arts Council gefördert. Der Verlag bedankt sich dafür.
Copyright © der Originalausgabe 2017 Johannes AnyuruCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2021 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH Neumarkter Straße 28, 81673 München Satz: Uhl + Massopust, Aalen Umschlaggestaltung: Buxdesign Covermotive: DEEPOL by plainpicture/Stefan IsakssonISBN 978-3-641-22029-7V001
www.luchterhand-literaturverlag.de
Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen
Es gibt keine Geschichte in Guantanamo.
Es gibt keine Zukunft in Guantanamo.
Es gibt dort überhaupt keine Zeit,
weil es keine Grenze dafür gibt,
was geschehen kann.
GEFANGENER
freigelassen nach dreizehn Jahren
Aufenthalt in Guantanamo Bay
Was geschah in den Häusern.
So gut wie nichts.
Es ging alles zu schnell, um wirklich zu geschehen.
Stellt euch eine Uhr auf einem Nachttisch vor,
die, gestellt, um die Zeit in Sekunden zu messen
überrascht wird von ihrem eigenen Schmelzen
und verkocht und davonwirbelt als Gas
alles im Millionstel einer Sekunde.
HARRYMARTINSON
Aniara, siebenundsechzigster Gesang
Jetzt kommt ein Windstoß. Er wirbelt vor den Hochhausfassaden Sand und eine Handvoll Halme trockenes Gras auf. Die beiden Mädchen auf den alten Autoreifenschaukeln schwingen sich höher.
Ich betrachte sie durch das Fenster. Ich höre nicht ihr Lachen. Ich höre panische, heisere Schreie, das Brüllen von Maschinengewehrfeuer, das Krachen, wenn Gegenstände und Körper umgerissen werden.
1
Es ist ihre erste Erinnerung: der Schnee, der in willkürlichen Schleiern auf die Krankenhaustrakte, den Parkplatz und die Pappeln, der auf die Bremsschwellen herabwirbelte. Davor: eigentlich nichts.
Sie sitzt still, mit geschlossenen Augen, während Amin mehrmals den Namen wiederholt, den er ihr gegeben hat. Nour. Erst als sie in seiner Stimme einen Anflug von Hysterie vernimmt, öffnet sie die Augen.
»Erinnerst du dich an etwas Neues?« Sein Gesicht ist ausgemergelt, der Mund angespannt, er sitzt neben ihr in Hamads weißem Opel, auf der Rückbank, die Schaumgummikrümel verliert, die an ihren Kleidern hängenbleiben.
Sie schüttelt den Kopf.
Hamad sagt etwas vom Fahrersitz aus, ermahnt sie zur Eile, und Amin befeuchtet seine Lippen und tippt mit zitternden Händen auf dem Mobiltelefon herum, das mit Klebeband an den Metallrohren ihres Gürtels befestigt ist. Sie bleibt vollkommen regungslos sitzen. Hinter der Glasscheibe taumeln vor der gelben Backsteinwand einzelne Schneeflocken herab. Wenn sie den vierziffrigen Code auf den Tasten eingibt, werden die Metallrohre explodieren und etwa so viele Nägel und Schrotkörner hinausschleudern, wie in zwei gewölbten Händen Platz finden, und die Druckwelle wird im Umkreis von fünf oder vielleicht auch zehn Metern die Knochen von Menschen brechen und ihre inneren Organe zerstören. Gleiches gilt, wenn jemand den Code in einer SMS an das Telefon sendet.
Sie steigen aus dem Auto. Hamad hat in einer Seitenstraße geparkt, wo sie von einem Müllcontainer verdeckt werden. Er hievt die große, schwarze Sporttasche aus dem Kofferraum. Die Kälte brennt auf ihren Wangen und Händen; um sich aufzuwärmen tritt sie ein wenig auf der Stelle.
Gemeinsam biegen sie auf die Kungsgatan und teilen sich im Samstagsgewimmel auf. Als sie sich nach ein paar Schritten umdreht, verharrt Amin mit den Händen in den Taschen vor einem Schaufenster und tut so, als schaute er sich Anzüge an.
Sie fühlt, dass sie miteinander verflochten sind.
Sie wünscht sich ein anderes Leben für sie beide.
Es ist der siebzehnte Februar, eine gute Stunde vor dem Terroranschlag auf den Comicladen Hondos.
Einmal ist sie kurz davor, auf die Straße zu treten und von einer Straßenbahn angefahren zu werden – eine Frau hält sie zurück, indem sie nach ihrem Mantel greift –, das Scheppern der Straßenbahn ist schrill und hohl, und sie bleibt im Schneematsch stehen, mit suchendem Blick in dem leichten Schneefall, der im dunkler werdenden Nachmittag hängt.
Wieder versucht sie, sich zu erinnern, wer sie ist, woher sie kommt, findet aber nur zu dem Zimmer im Krankenhaus zurück, als sie aufstand und sich auf den Infusionsständer gestützt an das Fenster stellte. Sie erinnert sich an die pfeifende Dünung der Pulsschläge hinter ihren Schläfen und die Kühle des Bodens unter den Fußsohlen.
Sie hat gelesen, dass der Schneeschauer, der an jenem Sommerabend über dem Krankenhausgelände aufzog, eine Folge der Umweltzerstörung war, oder von Wettermanipulationen des Militärs, oder auch, dass es gar kein Schnee war, was da fiel, sondern etwas, das aus einem Chemiewerk ausgetreten war.
Die Frau, die sie davon abgehalten hat, auf die Straße zu treten, berührt ihren Arm und sagt etwas, was sie nicht versteht, ihre Stimme ist flach und fern, und als sie nichts erwidert, geht die Frau davon. Noch eine Straßenbahn fährt vorbei, um sie herum überqueren Menschen den Zebrastreifen.
Immerhin glaubt sie zu wissen, dass sie hier herkommt. Aus Göteborg. Und ihre Mutter ist tot. Irgendwie gestorben. Wurde überfahren. Nein. Sie erinnert sich nicht. Ballt die Hände zu Fäusten, öffnet sie.
Eine einzige Handlung kann die Welt wecken.
Sie setzt sich erneut in Bewegung, verliert sich im Strom der Käufer und Jugendlichen in aufgeplusterten Winterjacken und der Paare mit Kinderwagen.
Vor den aufgestellten Türen des Comicladens flackert unruhig ein Festlicht in der Dämmerung, vor einem handgeschriebenen Schild:
Heute, 17 Uhr, signiert Göran Loberg sein neues Comicalbum und spricht mit Christian Hondo über die Grenzen der Meinungsfreiheit.
Als sie unter die Lampen tritt, bricht ihr, wegen des Gedränges und des Wintermantels, der den Sprengstoffgürtel verbirgt, der Schweiß aus.
Und wegen dem, was nun näher rückt.
Um keine Aufmerksamkeit zu erregen, stöbert sie in einem Karton mit Comicheften, zieht eines heraus, blättert darin.
Eine einzige Handlung kann, wenn sie nur radikal genug, rein genug ist, mit den besitzlosen Massen der Welt kommunizieren, das Band zwischen dem Kalifat und fehlgeleiteten Muslimen erneuern, den Zustrom neuer Rekruten steigern und das Kriegsglück wenden.
Hamads Worte. Hamads Gedanken.
Sie blättert weiter.
In dem Comicheft ziehen nadelförmige Raumschiffe an Plantagen und Wolken aus brennendem Gas vorüber. Männer in unförmigen Raumanzügen wandeln in einer surrealistisch gefärbten Wüstenlandschaft. Sie wundert sich darüber, wie naiv die Bilder sind.
Es bringt sie, in sich gekehrt und grüblerisch, tatsächlich zum Lachen.
Sie fragt sich, ob die Rohrbomben durch ihre Körperwärme explodieren können.
Erstens. Sie weiß, dass sie Muslimin ist. Zweitens. Die Schweden haben Muslime in einer Art Lager getötet. Drittens. Ein Name, der nicht ihrer ist, aber irgendetwas bedeutet. Liat – jemand, den sie geliebt hat. Viertens. Die Schweden tun so, als herrschte Friede, als gäbe es die Todeslager gar nicht. Fünftens. Sie hat mit Amin über das alles geredet, hat versucht, Ordnung in das Ganze zu bringen.
Hamad kommt. Von der Straße wird durch die zufallende Tür ein wenig Schnee hereingeweht. Er und Amin haben sich am Vorabend die Bärte abrasiert, und wenn sie seine nackten Wangen sieht, muss sie unweigerlich an einen Vogelschädel denken – er sieht mager und brutal aus. Er trägt eine schwarze Steppjacke und eine blaue Kappe mit dem Emblem einer amerikanischen Eishockeymannschaft – ein Hai –, die er nun abzieht und in seine Tasche steckt. Er stellt sich in die Nähe der Kasse und legt die schwarze Sporttasche zu seinen Füßen ab.
Rund dreißig Personen halten sich zu diesem Zeitpunkt in dem Geschäft auf, sie stehen in Trauben zusammen oder sitzen auf Klappstühlen, die Jacken zu Bündeln gefaltet auf dem Schoß. Christian Hondo, dem das Geschäft gehört, ein langhaariger Mann in einem fadenscheinigen gelben T-Shirt, schaltet ein Mikrofon ein. Rückkoppelungswellen jaulen aus zwei aufgestellten Lautsprechern.
»Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen.« Seine Stimme ist dumpf und polternd, als sie, verdoppelt, aus den Lautsprechern strömt.
Durch eine Tür hinter der Kasse tritt Göran Loberg ein. Das Publikum wendet sich ihm erwartungsvoll, nahezu andächtig zu.
Loberg ist älter als Hondo, etwa sechzig, schief und wettergegerbt. Sie meint, einen harten Zug um seinen Mund zu erkennen, Verachtung oder Wut. Wallendes, weißes Haar, kariertes Hemd. Er legt Notizblock und Stift auf die Tischplatte.
»Wir wollen heute über Ihr neuestes Projekt sprechen«, sagt Hondo, »bei dem es sich um ein Sammelalbum Ihres satirischen Comicstrips Der Prophet handelt, der wöchentlich im Internet erscheint und Karikaturen des Propheten Mohammed und andere, sagen wir … ketzerische Objekte enthält?«
Göran Loberg nickt und kratzt sich über die Bartstoppeln, seine ganze Erscheinung strahlt etwas Ungepflegtes aus, und ein wirres Desinteresse an sich selbst und seiner Umgebung. Sie steht am hinteren Ende des Geschäfts. Sie bekommt nicht alles mit, was die beiden sagen. Sie findet, dass es sich anhört, als befänden sie sich außerhalb des Raums, als gehörten ihre Stimmen und ihre Körper nicht zusammen. Umhertreibende Klänge.
Hondo steht auf und entrollt ein Plakat. Er hält es hoch, damit das Publikum es sehen kann.
Eine Gruppe von Männern mit Turbanen und krummen Nasen, die sich im Gebet vorneigen und denen Marschflugkörper in den After gesteckt werden.
Sie merkt, dass sie sich selbst von außen sieht wie in einem Traum.
Die Riemen des Sprengstoffgürtels spannen über dem Brustkorb.
Erstens. Sie erinnert sich nicht an ihren Namen. Zweitens. Sie erinnert sich nicht an ihre Eltern, hat aber Grund zu der Annahme, dass sie ermordet wurden. Drittens. Wenn sie sich im Spiegel sieht, hat sie das falsche Gesicht. Viertens. Es überkommt sie, genau jetzt, als sie hier steht und dieses Bild betrachtet, intensiv das Gefühl, dass sie hier schon einmal gewesen ist, dass dies eine Szene ist, in der ein wichtiges Ereignis, ein historisches Ereignis, wiedererschaffen wird.
Sie wirft einen Blick zur Seite und sieht, dass Amin hereingetreten ist und sich an die Eingangstür gestellt hat. Sein Gesicht ist schweißnass, obwohl er aus der Kälte kommt. Mehrere Besucher in dem Laden reagieren besorgt auf diesen vom Tode gezeichneten und elenden jungen Mann und flüstern sich etwas zu. Amin schaut verstohlen in ihre Richtung und tut so, als würde er sie nicht kennen.
Sie tritt zu ihm.
»Amin«, zischt sie. Er ignoriert sie und scheint nicht recht zu wissen, wie er reagieren soll: Der Plan lautete, sich in dem Geschäft zu verteilen und zu warten, bis möglichst viele Menschen beisammen sind. Unter gar keinen Umständen sollten sie miteinander sprechen.
»Amin. Amin.« Er sieht sie nicht einmal an. Sie greift nach seiner Hand, was er widerwillig zulässt. Sie flicht ihre Finger in seine, drückt sie. »Alles ist verkehrt.« Sie weiß nicht wirklich, was sie damit meint. »Amin, alles ist verkehrt.«
Hamad hat Amin und sie ein paar Monate zuvor in seiner Wohnung getraut, und sie ist von ihren schrecklichen Vorahnungen hierhergetragen worden, von ihrem Gefühl, dass sie und Amin, und vielleicht auch Hamad, zusammengehören, und dass sie einen Auftrag hat.
»Wir sollten von hier weg«, zischt sie, und ein Mann in einem schwarzen Pullover, der mit seiner Jacke über dem Arm neben Amin steht, wirft ihnen einen genervten Blick zu – sie beachtet ihn gar nicht. »Wir hauen ab«, sagt sie, und erst da gestattet sich Amin zu reagieren – er windet seine Hand aus ihrer, packt ihren Arm und starrt sie durchdringend und vorwurfsvoll an. Dann versetzt er ihr einen leichten Stoß, wohl halb, um sie loszuwerden, und halb, um sie an den Plan zu erinnern.
Sie sollen sich verteilen und warten.
An dem Tisch vorne sagt Hondo, er hasse Religion und dass er für etwas stehe, was er eine traditionell subversive Richtung nennt, Dinge, die sie nicht begreift oder in keinen Zusammenhang einordnen kann, »eine libertäre Richtung«, sagt die blechernsirrende Lautsprecherstimme, »eine Art Schundgalerie«.
Sie schließt die Augen und spürt, wie Striemen drückender Kopfschmerzen zur Oberfläche steigen und anschließend wieder nach unten sinken. Es gibt etwas, was sie Amin nicht anvertraut hat. Seit Hamad ihnen erzählt hat, was sie tun würden, hat sie vor ihrem inneren Auge manchmal Schlagzeilen gesehen. Als würde sie sich schon vorher daran erinnern, was sie, hinterher, darüber schreiben werden.
Etwa: Das Terrorpaar heiratete vor dem Anschlag. Sehen Sie hier Bilder von der Hochzeit.
Als sie die Augen aufschlägt, hat Hondo ein weiteres Poster entrollt, auf dem eine Frau auf einer Brücke steht und ein Maschinengewehr auf eine Menschenmenge richtet. Hinter ihr ein Transparent: Refugees welcome.
»Sie haben wegen dieser Bilder zahlreiche Drohungen erhalten.«
»Wem nicht mit dem Tod gedroht wird, hat nichts Wesentliches gesagt«, erwidert Loberg und rückt seine Brille gerade. Die Menschen um sie herum lachen. Sie sehen wächsern und gespenstisch aus, sie hat das Gefühl, einen grauen, toten Lichtschein aus dem Inneren ihrer Haut zu sehen. Das Lachen verebbt, Leute kratzen sich und machen sich Notizen in ihren Schreibheften, oder lehnen sich vor oder verschränken die Arme.
Sie denkt, dass sie alle in weniger als einer Stunde tot sein werden.
Es passiert ohne Vorwarnung, rund zwanzig Minuten nach Beginn des Gesprächs. Göran Loberg sagt, die Kunst müsse expandieren, dass dies die konstituierende Eigenschaft der Kunst sei, als seine Argumentation von einer Männerstimme unterbrochen wird, die einen undeutlichen Ruf von sich gibt, han oder va – möglicherweise schreit die Stimme auch auf Englisch, gun?
Sie hört den Ruf und denkt, dass jemand auf Englisch schreit, weil Amin, der in einer hastigen, flatternden Bewegung die Pistole aus dem Hosenbund gezogen hat, kein Schwede ist.
Gun. Sie hört das Wort, und sie hört den Schuss, und eine Frau in der vorderen Stuhlreihe zieht den Kopf ein und beugt sich vor wie bei einem Flugzeugabsturz.
Sie steht nahe genug, um den Schwefelgeruch wahrzunehmen, und das lässt sie, mehr als der laute Knall, verstehen, dass ihre Aktion tatsächlich begonnen hat.
Amin bleibt mit erhobener Pistole stehen. Der Schuss hat ein qualmendes Loch in einer der Holzfaserplatten über seinem Kopf hinterlassen. Sie sucht seinen Blick, aber er visiert einen Punkt vor oder weit hinter ihr an.
Die Leute sind bereits aufgesprungen. Sie bewegen sich auf den Ausgang zu, die Füße in den Klappstühlen verheddert, machen jedoch kehrt, als sie Amin sehen. Viele werden daraufhin hilflos und wie gelähmt, sie wissen nicht, wohin sie sollen, drehen sich im Kreis, werfen Zeitschriftenstapel um und wälzen Taschenbücher aus den Regalen. Die Gegenstände wirken schwerer. Die Zeit läuft langsamer und gleich darauf schneller, in verketteten Bündeln von Vorfällen. Ein Typ mit Stofftasche und Hahnenkammfrisur versucht, durch die Tür hinter der Kasse hinauszugelangen, aber Hamad stößt ihn um – sein Kopf knallt mit einem stummen, furchtbaren Laut gegen eine Ecke des Kassentischs, und er bleibt liegen.
Bete zu Gott, bis sie glauben, dass du verrückt bist.
Hondo bleibt an dem Schreibtisch vorne ruhig sitzen. Als glaubte er, die Vorgänge wären geplant, ein Teil der Veranstaltung – er grinst sogar ein wenig selbstbewusst, während er sich umschaut. Ihre Blicke begegnen sich für einen Moment.
Die Menschen um sie herum fallen hin und klettern übereinander, als würde der Fußboden schwanken.
Hamad schreit etwas, und als ihr das bewusst wird, erkennt sie, dass er wohl schon eine ganze Weile schreit. Sie kann seine Worte nicht verstehen, begreift nur, dass er schreit. Ein stoßweise anhaltender Laut.
Eine Frau mit blutigem Gesicht liegt da und zieht an dem Pullover einer anderen Frau, um sich aufzurichten. Jemand versteckt sich in einer Ecke, hinter einem Haufen herausgerissener Comichefte, sie sieht den Schuh der Person hervorlugen, ein schwarzer Winterstiefel – ein weinender Mann stolpert darüber.
Hamad springt auf den Kassentisch und holt eine Maschinenpistole aus der schwarzen Sporttasche, er hält sie mit beiden Händen über seinen Kopf, wie eine Kriegsbeute oder einen neugeborenen Säugling, den er vorzeigt, und jetzt hört sie, dass er gar keine Worte schreit, sondern nur eh, eh, eh.
Er tritt mehrmals gegen die Kasse, bis sie krachend herunterfällt und sich Münzen und Geldscheine auf dem Fußboden verteilen.
»Ihr wollt den Islam schänden!« Als er schließlich Worte formt, bricht seine Stimme zu einem heiseren Geheul – das Wort Islam klingt nur wie ein schmerzerfülltes Stöhnen. Er zerrt eine zweite Maschinenpistole aus der Tasche. Sie zieht ihren Mantel aus, schleudert ihn zu Boden und geht auf ihn zu. Wieder das Gefühl, dass sie sich selbst von außen sieht. Und dass ihre Füße nicht wirklich den Boden berühren. Sie nimmt die Waffe an, entsichert sie.
Hamad reicht ihr außerdem eine Maschinenpistole, die sie an Amin weitergeben soll. Einige, die ihren Sprengstoffgürtel sehen, seit sie keinen Mantel mehr trägt, brechen in Tränen aus, und als sie sich auf Amin zubewegt, der weiter die Eingangstür bewacht, fallen die Menschen rückwärts ineinander, um ihr Platz zu machen.
Hamad hat die Abflussrohre gekappt, sie mit Nägeln und Schrot gefüllt und die Sprengladungen aus Haushaltschemikalien zusammengemischt. Er hat sie an drei gewöhnliche Angelwesten gehängt.
Sie fragt sich, ob das Gefühl, dass sich alles dreht, rundherum, immer schneller, mit Gott zusammenhängt.
Ist Gott mit ihnen?
Vor ein paar Wochen fuhren sie eines Abends in den Wald, eine gute Stunde landeinwärts auf Waldwegen voller Schlaglöcher, und schossen probehalber mit den Maschinenpistolen. Erst als sie spürte, wie die Waffe bebte, ihr der Schwefelgeruch in die Nase stieg und sie das giftige Flackern des Mündungsfeuers sah, begriff sie, was sie vorhatte. Dass dies wirklich war. Sie stand da, mit klingenden Ohren, und sah die Bäume im Lichtkegel der Autoscheinwerfer bleich und unheimlich leuchten.
Es passiert wirklich. Wir werden es tun.
Amin steckt die Pistole in den Hosenbund und hängt sich die Maschinenpistole über die Schulter. Sie legt ihre Arme um ihn und drückt ihn schwesterlich. Sie will zu dem Gefühl vordringen, dass sie jetzt tatsächlich tun, was sie geplant haben, hat aber erneut den Eindruck, dass sie nicht ganz anwesend ist, sich eher in einer Erinnerung befindet.
Erstens. Sie tut es, um sich zu rächen, weil die Schweden ihre Mutter getötet haben. Sie glaubt, dass es so ist. Zweitens. Falsch, es ist ein Auftrag. Sie tut es, weil sie an einem verregneten Nachmittag Amin in der Straßenbahn gesehen und gewusst hat, dass er sie zu ihrem Schicksal führen würde, und alles, was seither passiert ist, hat sie hierhergeführt, zu Hondos, wo sie etwas Wichtiges tun wird, etwas, was sie vergessen hat.
Drittens. Der Name. Liat. Sie muss Liat finden. Liat retten.
Sie massiert ihre Schläfen.
Am Kassentisch kommt es zu einem Tumult, Hamad springt auf den Boden herab und läuft durch die Tür, die zum Lager und zu der Personaltoilette führt. Man hört Schüsse, lautes Knallen, drei in schneller Folge. Mehrere Menschen im Laden schreien auf, und sie versucht, die Leute zu beruhigen, zunächst scheu und verlegen, dann immer aggressiver:
»Still. Seid still. Eh. Eh!«
Es hilft wenig. Um sie herum Schluchzer. Warum hat sie die ganze Zeit das Gefühl, sich hieran zu erinnern, während es passiert?
Hamad kehrt zurückweichend in das Geschäft zurück. Er schleift Göran Loberg am Kragen herein, ein Bein des Mannes hinterlässt eine blutige Spur auf dem Fußboden. Als würde jemand mit einem breiten Pinsel Farbe verschmieren.
Erstens. Sie hat nur Amin und Hamad, und diese Gewalt, diese Rache, die sie für diffuse Misshandlungen in ihrer Vergangenheit nehmen will.
Sie wird sich einer Menschenmenge bewusst. Die Leute stehen vor dem Schaufenster, hinter den Regalen mit Comicheften und Sammelfiguren, eine Ansammlung von Schatten, und als sie hinausschaut, trifft genau in dem Moment der erste Streifenwagen ein, Blaulichter flammen auf, und ihr Licht, das sich im Winterabend dreht, lässt die Widerspiegelung des Geschäfts im Glas verschwinden, auftauchen, verschwinden.
Sie hätte gehen sollen.
Hamad setzt Göran Loberg mit dem Rücken gegen den Kassentisch und presst den Lauf seiner Waffe gegen die Stirn des Mannes. Sie sieht es geschehen und fühlt sich wie gelähmt. Warum schneite es an jenem Abend, als sie aufwachte. Warum erinnert sie sich nicht an ihren richtigen Namen.
Hamad schlägt Göran mit dem Kolben gegen die Stirn, so dass er zusammensinkt. Schießt nicht.
Das muss in den Film.
Göran Loberg lehnt halb sitzend am Tisch, der Körper schlaff, mit ausgestreckten Beinen und zerbrochener Brille. Er starrt sie an. Um sie herum zerrt Amin die Geiseln auf die Knie, fesselt ihre Hände mit Kabelbindern aus weißem Plastik, setzt silbernes Klebeband auf ihre Münder und zieht ihnen schwarze Stofftüten über den Kopf. Er arbeitet schnell und teilt gelegentlich gestresst eine Ohrfeige aus, wenn jemand ihm nicht gehorcht.
Göran Loberg bekommt einen Streifen Klebeband auf den Mund, aber keine Stofftüte über den Kopf, und sieht sie weiter durch den gezackten, zersplitterten Abgrund seiner Brille an, bis sie sich abwendet.
Sie wischt ihre verschwitzten Handflächen an der Hose ab und zieht das Handy aus der Tasche.
Im Krankenhaus behaupteten sie, sie sei eine andere. Gaben ihr einen Namen, der nicht ihrer war, und redeten in einer Sprache mit ihr, die sie nicht verstand.
Sie ist eines unter tausend Opfern von Entführungen und Folter, zu denen es seit dem elften September gekommen ist. Soviel weiß sie.
Soviel glaubt sie zu wissen.
Hamad tauscht mit Amin den Platz an der Eingangstür. Er soll sich um die Polizisten draußen kümmern, während Amin und sie den Film drehen.
Amin breitbeinig vor einer schwarzen Flagge. Die Räubermaske, die er aufgezogen hat, haben sie zusammen mit den Angelwesten in einem Billiggroßhandel gekauft. Die schwarzen Stofftüten, die sie den Geiseln über die Köpfe gezogen haben, haben sie dagegen gestohlen – es sind Kissenbezüge aus einem Möbelgeschäft.
»Im Namen Gottes«, sagt Amin, der wie sie und Hamad seine Jacke ausgezogen hat, so dass man den Sprengstoffgürtel sieht. »Wir grüßen unsere Brüder an der Front.«
Sie zoomt maximal zurück, muss aber trotzdem zwei Schritte nach hinten machen, damit die Kamera die ganze Szene einfängt.
Sie hat die Flagge gefertigt, nach Bildern aus dem Netz. Vier aufgeschnittene Müllsäcke mit schwarzem Isolierband zusammengeklebt und das weiße Siegel von Hand aufgemalt. Sie hängt hinter Amin von einem Bücherregal herab.
Sie ist für den Film verantwortlich. Sie streamt ihn live über eine Reihe von sozialen Netzwerken und YouTube-Kanälen – Hamad hat ihr geholfen, die richtigen Konten einzurichten, das Handy entsprechend einzustellen.
Amin zieht ein Blatt aus der Hosentasche. Er liest einen Satz in holprigem Arabisch ab, und einige Geiseln brechen unter ihren schwarzen Hauben erneut in Tränen aus, angesichts der unerhörten und furchteinflößenden Kraft von Menschen mit Schnellfeuerwaffen, die eine fremde Sprache sprechen, die sich fälschlicherweise leicht für die Kraft von Gottes Wort halten lässt. Sie sieht einen Mann, der ein Südamerikaner oder ein Türke sein könnte, ein Student – bevor Amin ihm die Tüte über den Kopf zog, war ihr aufgefallen, dass er kein Schwede war –, sie sieht, dass er sich zusammenkauert, als würde er einen geschwungenen Schlag von oben erwarten.
Sie schauen acht Stunden täglich fern. Aber uns nennen sie Extremisten.
Sie wollen über unsere Religion lachen.
Sie ermorden uns in Syrien, im Irak, in Afghanistan, in Tschetschenien, in Palästina.
Sie versucht, alles zu filmen, und die Bilder werden ruckend und unscharf.
Amin wollte eine Hammerdigitalkamera für sie klauen, aber Hamad sagte, alles solle mit dem Handy gefilmt werden.
Das Filmmaterial soll die einfachen Arbeitsbedingungen der Produzenten bezeugen.
»Im Namen des Führers aller Rechtgläubigen. Im Namen der Ehre jedes Muslims.« Amin bricht ab und geht zu Göran Loberg, der noch am Kassentisch lehnt. Er wirkt desorientiert und geblendet, als sie die Handykamera auf ihn richtet. Weil er als Erster sterben soll und weil sein Tod sinnvoll ist, da er der ist, der er ist – im Gegensatz zu den anderen Geiseln, die sterben werden, weil sie irgendwer sind, gewöhnliche Ungläubige, auserwählt vom Zufall, also von Gott –, ist sein Kopf nicht verhüllt.
Amin bugsiert ihn vor die Flagge, zu dem Platz, der für sie eine Bühne ist, indem er an Lobergs grobem Baumwollhemd zerrt und ihn mit Tritten weiterscheucht. Der Mann kriecht und hüpft auf den Knien und fällt mehrere Male der Länge nach hin, als Amin ihn mit der Schuhspitze anstößt – Letzteres bringt Hamad voller Schadenfreude zum Lachen, als er es auf seinem Posten an der Eingangstür sieht.
Sie sind einfache Menschen, die außerhalb aller Lügen und Verzerrungen der Medien stehen.
Bald werden sie im Paradies sein.
Noch keine Kommunikation mit den Polizisten im Freien.
Amin steht wieder vor der schwarzen Flagge. Er rückt die Räubermaske zurecht, zupft an ihr – wahrscheinlich juckt sie an der Haut.
Der Märtyrer verlässt diese Welt, noch ehe der erste Blutstropfen den Erdboden berührt.
Sie betrachtet Amin auf dem Display, zusammen mit Göran Loberg, der vor ihm kniet, und um ihre fürchterliche Sorge darüber zu vertreiben, dass nichts so ist, wie es sein soll, denkt sie an die gewaltigen Bäume des Paradieses, wie ihre Wipfel sich im Wind bewegen.
Der Film soll verpixelt, verwackelt sein, unerwartet die Schuhe des Sprechers heranzoomen und so weiter – sie folgt Amins Bewegungen, aber die Linse fängt auch Comicalben ein, die auf dem Fußboden verstreut liegen, umgekippte Stühle, jemandes Ellbogen, Blutspritzer von Göran Lobergs Bein.
»Wir haben diesen Mann verurteilt, der euch allen bekannt ist«, sagt Amin. Seine Körpersprache zeugt von Nervosität. Er will das Ganze beschleunigen. »Diesen sogenannten Künstler. Diesen Mann haben wir also verurteilt. Wegen Gotteslästerung und Entehrung. Er hat unseren Propheten nicht geehrt.«
Sie zoomt Amins Augen heran, die aus dem schmalen Schlitz in der Maske hervorlugen. Ihr wird schwindlig, sie blickt vom Lichtschein des Handydisplays auf und blinzelt angesichts der Lichtflecken, die vor ihr flimmern. Schlagzeilen und Nachrichtensendungen im Kopf, yani, eine Stimme, die sagt, wir möchten an dieser Stelle empfindsame Zuschauer warnen. Yani krank.
Wer ist sie.
Sie blickt verstohlen zu Hamad hinüber, der wiederum durch die Scheibe hinausschaut.
Schwer zu sehen, was sich da draußen tut, wenn die Blaulichtkegel der Einsatzfahrzeuge durch das Schaufenster huschen.
Eilmeldung: Terroranschlag in Göteborg.
Das Handydisplay hat einen leichten Grünstich, und sie kehrt zu den Geschehnissen darauf zurück. Dabei hat sie das Gefühl einer Heimsuchung, der sie sich aussetzen will, durch etwas, was damit zusammenhängt, dass sie sich an Dinge zu erinnern meint, unmittelbar bevor sie eintreffen – eine Phrase, die Amin ausspricht, eine Geste –, die Dinge kehren in einer Doppelbelichtung, einem Echo wieder.
»Die Strafe ist der Tod«, sagt Amin auf der Bühne, und Göran Loberg schnaubt durch die Nasenlöcher, als würde ein Unterdruck Luft aus ihm heraussaugen, und die unbestreitbare Kraft einer Weltanschauung, die sich das Recht nimmt, über Leben und Tod zu bestimmen, lässt ihn völlig zusammenbrechen.
Sie kennt das.
Warum kennt sie diese Szenen.
Amin blickt erstaunt und wohlwollend auf die zusammengefallene Gestalt zu seinen Füßen herab. Es ist möglich, dass Loberg sich übergeben muss, seine Haare stehen in alle Richtungen ab, und seine gewissermaßen aristokratisch wirre Würde ist verschwunden. Er sieht eher wie ein obdachloser Alter aus, der beim Stehlen von Portemonnaies erwischt wurde und ein paar Ohrfeigen kassiert hat.
»Die Strafe ist der Tod«, sagt Amin ein zweites Mal und nestelt nachdenklich an seiner Maschinenpistole herum. Er nickt vor sich hin, scheint den Text im Kopf durchzugehen.
Er verbirgt sein Gesicht nicht, weil seine Identität geheim bleiben soll, sondern um zu demonstrieren, dass er Teil einer anonymen Masse ist, dass er jeder sein kann. Er könnte der Muslim sein, der neben dir im Bus sitzt, arbeitslos und freundlich – ein normaler, wohlerzogener junger Mann, der Älteren, meistens, seinen Platz anbietet, aber irgendwie genug hat von Rassismus und Kolonialismus.
»Die Strafe ist der Tod«, wiederholt er, ein drittes Mal, und lacht auf.
Er ist neunzehn und hat keinen Schulabschluss. Er lacht wieder, lauter. Er ist höflich und ist im Moment ohne Anstellung, weil er keine fucking Chance bekommen hat, so ist es, das sagt er ihr immer wieder – nicht eine einzige, kleine, fucking Chance haben die Schweden ihm gegeben.
Er ist irgendwer, ein Typ aus Hasselbo, der einiges an Haschisch geraucht hat, okay, das stimmt, im Licht des Computerbildschirms sind einige Joints zusammengekommen, im Wirbel aus amerikanischen und örtlich produzierten Trap-Videos und allen Verschwörungstheorien, Illuminati und wie sie alle hießen, von denen er immer laberte, wenn er stoned war, die Familie Rothschild, während er von Erfolg oder Rache fantasierte, oder etwas anderem, was dem Gefühl entsprechen könnte, nach Strich und Faden hereingelegt worden zu sein – er steht nämlich immer für Ältere auf, auch für Schweden, vor allem für Schweden, um zu zeigen, wofür der Islam steht, in einer Welt, die Güte niemals belohnt.
Sie betrachtet ihn weiter auf dem Display, er steht mit leicht gesenktem Kopf und lacht – eine Art Mittelstufenkichern, das sich besonders genießen lässt, weil es hier und jetzt völlig unpassend ist.
Er nimmt eins von Lobergs Alben vom Tisch und blättert darin. Die Bilder lassen sein Lachen verstummen – er verdeutlicht mit dem ganzen Körper, wie sehr ihn anekelt, was er da sieht. Hält die Seiten in die Kamera.
Noch eins von Göran Lobergs Bildern: ein Mann mit einem Lampenschirm auf dem Kopf, durch seine Brustwarzen wird Strom geleitet. Der Autofokus der Kamera macht den Text in der Sprechblase unscharf. Die aufgerissenen Augen und der gähnende Mund leuchten auf eine Zeitung herab, die eine mit einer Burka bekleidete Frau in einem Sessel liest.
»Ihr wollt den Islam schänden!« Amin hält Loberg die Seiten hin, sagt was was was, und schlägt ihm dabei mit der flachen Hand auf den Hinterkopf und die Wangen.
Eine männliche Geisel atmet heftig, in Panik – sie dreht sich etwas, um sich das anzuschauen und die Handykamera schwenkt mit – die schwarze Stofftüte wird in die Nase des Mannes gezogen.
Die Stofftüte wird hinausgeblasen, hereingezogen – er scheint tatsächlich fast zu ersticken.
Sie merkt, dass es etwas Wahnsinniges hat, diejenigen zu sein, die in einem Raum Waffen tragen.
Amin blättert zum nächsten Bild, sagt was was, und Loberg stößt als Antwort ein paar dumpf brüllende, angsterfüllte Laute aus, vielleicht auch, weil er tatsächlich langsam begreift, dass er gleich sterben wird. Amin bringt ihn mit einem Ruck am Kragen in eine sitzende Position.
Er fängt wieder an, leise vor sich hin zu kichern. Sie zoomt im richtigen Moment näher heran oder wieder zurück. Amin zerrt an Lobergs Kragen, obwohl der Mann bereits aufrecht sitzt – er lebt irgendetwas aus, was mit früheren Lehrern oder seinem Alten zu tun hat.
Es erstaunt sie, dass sie kein Mitleid empfindet. Vielleicht hängt es mit der Kamera zusammen, die alles, was geschieht, nicht nur von der Wirklichkeit, sondern auch voneinander trennt und isoliert.
Allerdings ist sie, auf eine heimliche Art, auch mit dieser Grausamkeit vertraut, die in der wohlgeordneten Welt verborgen liegt, in der Loberg eben noch dasaß und scherzte und kurze Notizen auf seine Blätter kritzelte. Vielleicht empfindet sie deshalb nicht die geringste Zärtlichkeit beim Anblick des misshandelten Körpers dieses Mannes. Wegen etwas Herzlosem und Rohem, was sich in Händeschütteln und Busfahrplänen und lustvollen Kommentaren versteckt, wegen etwas, was sie in ihrer Haut und ihren Haaren spürt.
Irgendwann hat Amin Loberg einen Schlag auf die Nase versetzt, die jetzt stark blutet. Sie richtet die Kamera schräg nach unten, aus Ermattung und trotz allem auch aus einer Trauer über das heraus, was sie hier sieht und verewigt, einer Trauer, der sie nicht mehr entfliehen kann.
Amin ist durch das Blut aus Lobergs verletztem Bein getrampelt und hat rote, schmierige Nike-Logos auf dem grauen Kunststoffboden hinterlassen.
Ein Comicheft klebt unter seiner Sohle und flattert hoch.
Inzwischen ist es ungefähr halb acht. Die Polizei ist mit einer großen Zahl von Streifenwagen und Einsatzbussen vor Ort, darüber hinaus sind mehrere Krankenwagen und ein Löschzug eingetroffen. Der Premierminister ist informiert worden, und die Nationale Eingreiftruppe ist in einem Militärhubschrauber aus Stockholm unterwegs.
Ihre Hände sind steif und fremd vor Adrenalin und Schock, mehrfach lässt sie beinahe das Handy fallen.
Amin holt das Messer heraus, ein Teppichmesser mit orangem Griff. Er spielt ein bisschen damit herum, schiebt die Klinge hinaus, zieht sie wieder zurück, schiebt sie hinaus. Sie stellt das kalte Fischglänzen der Messerklinge scharf, nimmt dann jedoch eine Bewegung am Eingang wahr: Hamad presst eine männliche Geisel gegen das Glas und schreit die Polizisten in der Dunkelheit und im Schnee an:
»Zurück!« Er hält die Geisel im Nacken und presst den Mann gegen das Glas, schreit noch einmal: »Zurück!« Er macht einen Schritt nach hinten und stellt sich leicht geduckt auf, die Waffe in einer Art Feuerstellung haltend und mit breit gespreizten Beinen – er deutet mit dem Lauf auf das Genick der Geisel, als wollte er der Außenseite auf die Art mitteilen, dass er schießen wird, wenn seine Worte nicht ernstgenommen werden. »Zurück!«
Sie versucht, den Ereignissen mit der Handykamera zu folgen, aber es fällt ihr schwer auszuwählen, was entscheidend ist – sie beschließt, dass es Zeit für einen verstohlenen Blick auf Amin ist, doch der ist ganz mit den Vorgängen am Eingang beschäftigt, und so schwenkt sie zu Hamad zurück, der immer noch mit der Waffe im Anschlag dasteht und schreit – das ist die aufgeregte, hypergegenwärtige Ästhetik der viralen Handyvideos, oh, mein Gott, ich kann nicht glauben, dass das gerade passiert – muss es filmen –, sie ist zugleich Attentäterin und Zeugin.
Zwei Polizisten aus dem Göteborger Sondereinsatzkommando haben sich entgegen aller Verhaltensregeln für eine Geiselnahme mit gezogenen Pistolen der Tür genähert, und Hamad, der mit gewissen, mehr oder weniger vorhersagbaren Reaktionen der Polizei gerechnet hat, ist dadurch völlig aus dem Konzept gebracht worden – wieder schreit er:
»Zurück!«
Es passiert zuerst in ihrem Kopf.
Sie will Hamad zurufen, dass er sich ducken soll.
Klicken Sie den Link an, um den Film zu sehen.
»Hamad!«, bringt sie heraus. Sie sieht es als Erinnerung, als eine Filmszene unter den Augenlidern, und danach auf dem kleinen Schirm des Handys, und dann, am ehesten als ein verwirrter Gedanke, blickt sie auf und begreift, dass es tatsächlich passiert.
Der Knall von draußen ist hohl und schwach, gefolgt von einem pfeifenden Geräusch von Schnelligkeit und gesplittertem Glas und schließlich einem saugenden Schmatzen.
Sehr drastische Bilder von der Kamera der Terroristin.
Hamads Kopf wird nach hinten geschleudert – Hamad mit seinem alten, weißen Opel und seinen Geschichten über Syrien –, sein Kopf wird nach hinten geschleudert, und im Film sieht man ein Stück Kopfhaut nach außen explodieren – Blut und graue Masse spritzen auf die Kisten voller Comics –, er sagte, dies könnte nicht passieren – die Sprengstoffgürtel wären ihre Lebensversicherung.
Sie hört Rufe von draußen, undeutlich und vermischt mit Stimmen der Geiseln, die jetzt hinter den silbernen Klebebandstreifen ungehemmt und gellend schreien.
Was tue ich hier.
Alles ist verkehrt.
War Gott nicht mit Hamad.
Eine Stimme im Laden ruft, dass es einer von ihnen gewesen ist, dass die Polizei einen von ihnen erschossen hat – Göran Loberg, die einzige Geisel, die keine schwarze Tüte auf dem Kopf hat und sich deshalb halbwegs orientieren kann, ruft dies, um die anderen zu beruhigen.
Sie geht zu Hamad, so tief geduckt, dass sie manchmal auf allen vieren hüpft. Sie hält immer noch das Handy in der Hand – filmt Bilder vom Fußboden, von roten Spritzern, Comicbildern.
Sein Körper liegt auf dem Rücken, Arme und Beine von sich gestreckt, der Mund atmet stoßweise, das Gesicht ist angeschwollen, bläulich.
Sie meint einen Nachtfalter zu sehen, groß wie eine offene Hand, der über Hamads Gesicht krabbelt.
»Mach aus«, sagt er. »Mach aus.«
Die Flügel des Falters sind dunkel gesprenkelt, braun mit Streifen von Blau.
Das Lärmen der Zeit.
Sie ist nicht, wer sie zu sein scheint.
Kommt nicht von hier.
»Mach das Licht aus.« Das Einschussloch in Hamads Wange ist so klein, dass man kaum einen Finger hineinschieben könnte, aber ein Rinnsal von Blut strömt daraus pulsierend auf seine blasse, eingesunkene Wange.
Der Nachtfalter krabbelt mit zitternden Flügeln über seine Stirn und in sein Haar. Sie starrt ihn an, unfähig, sich zu bewegen. Ein neues Erinnerungsbild: Ein Mann steht an einem zerbrochenen Fenster und blickt in die Nacht hinaus. Ihr Vater. Sie erinnert sich an ihren Vater. Die Mutter neben ihm, mit einem Messer in der Hand. Sie sieht die beiden ganz klar, ganz deutlich.
Was hat sie erlebt.
Mach das Licht aus, damit es nichts gibt, worauf sie zielen können. Das ist es, was Hamad meint.
Sie wendet das Handy Amin zu, der hinter einer Kiste mit plastikverschweißten Comicalben hockt, die Maschinenpistole in einer krampfhaften Umarmung. Sie zischt seinen Namen, aber er reagiert nicht.
Sie nimmt eine Wirkung im Inneren der Zeit wahr, eine Kraft, die alles rückwärts in die Dunkelheit saugt.
Diesen Nachtfalter hat sie nicht zum ersten Mal gesehen.
Denk nicht daran, was es bedeutet. Zu spät zum Denken.
Zu spät, Nour.
Sie heißt doch gar nicht Nour, das ist nur ein Name, den Amin ihr gegeben hat.
Sie kriecht zum Stromschalter hinter dem Kassentisch und schaltet die Deckenlampen aus. Der Laden wird daraufhin nur noch von dem Blaulicht erhellt, das durch das Fenster blinkt.
Hamads freie Hand bewegt sich tastend in der Luft, seine Bewegungen gleichen denen eines Blinden. Sie hält Ausschau nach dem Nachtfalter, aber er ist wieder weg.
Das tosende Flussdelta der Sekunden.
Im Film: ein Zipfel von Hamads blutüberströmtem Gesicht, eher beiläufig gefilmt. Sie richtet die Kamera auf ihn, um in ihrem Blick Trost zu suchen. Der Anschein des Kamerablicks von einem endgültigen Urteil, und sein Auge kommt der Linse so nah, dass es aufhört, ein Teil der Anatomie seines Gesichts zu sein und zu etwas anderem wird, unmenschlich und obszön: der blutunterlaufene, eiweißweiche Glaskörper, die rosaschimmernde Schwelle des Lids, das Astgeflecht der Iris um das schwarze Loch der Pupille.
Der Planet des Auges blinzelt sachte.
Der Film, der im Hondos gedreht wird, während Hamad stirbt, wird von Millionen Usern in aller Welt auf Smartphones, Laptops, Tablets gestreamt. Mehrere größere Nachrichtenseiten im Ausland – allerdings keine schwedischen – stellen ihn in Echtzeit ins Netz.
Das Auge, feucht, sterbend, blinzelt immer langsamer.
Der Gedanke, der aus dem Bewusstseinsbrei in Amins Kopf geschüttelt wird, als er Hamads Hand sieht, die sich in einer scharrenden oder reuigen Geste hebt, das halbe Gehirn auf Comichefte, Münzen und Geldscheine geblasen: dass Hamad sich in jenem Sommer, als er anfing, auf dem Platz herumzuhängen, offenbar Kontaktlinsen besorgt hat.
Vor so vielen Jahren.
Er will zu Hamad kriechen, aber es ist, als würde er von einer Kraft festgehalten, die in keiner Verbindung zu seinem Willen steht, von einer hämmernden, lähmenden Schwere – die intime Trägheit des Lebens, die ihn zu Boden presst.
Rund um Hamads Hinterkopf wächst eine Pfütze aus Blut und körnigen Schädelfragmenten.
Er erinnert sich an diesen Sommer.
Hamad ging in dieselbe Schule wie er. Stammte aus einer Eigenheimsiedlung gleich östlich von Hasselbo, zwei Jahre älter, allerdings ein Streber, pummelig und pickelig, mit Hemd in der Hose und Brille. Echt so ein Typ, bei dem Amin und seine Kumpel auch schon mal auf die Idee kamen, ihn sich in den Pausen vorzuknöpfen. Dann, in den Sommerferien zwischen der neunten Klasse und dem Gymnasium, tauchte Hamad in schwarzer Windjacke und Trainingshose in Hasselbo auf und begann, Braunes zu verkaufen, und ratet mal, ob er Amin nervte, seine Kleider und die Härte, die so offensichtlich antrainiert war – er selbst war ja schon seit Langem einer der Unerwünschten ohne Richtung, der im Licht von Tabakläden stand und rauchte, und in dem kälteren Licht einer betonierten Wut, die sich ihr Ventil in Schlägereien suchte, bei denen Kettenglieder um die Knöchel geschlungen wurden. Und Hamad kam doch aus den Einfamilienhäusern und hatte einen Alten, der nicht nur da war, sondern auch noch einen Superjob hatte, also irgendwie in einer Bank arbeitete. Und dann lief dieser Typ herum und laberte von Preisen für hundert Gramm und ein Kilo – Amin hatte große Lust, ihn fertigzumachen. Aber gleichzeitig. Gleichzeitig war Hamad älter und schaffte es, den Respekt der Älteren zu gewinnen – irgendwann hörte Amin, dass er geholfen hatte, in die Firma seines Alten einzubrechen, und für gewisse schwere Jungs ziemlich viel Cash abgegriffen hatte.
Das war ein Sommer.





























