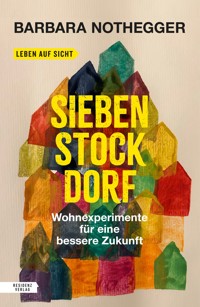
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein unterhaltsamer und lebensnaher Erfahrungsbericht über das Wohnen in Gemeinschaft. Wie wir wohnen, beeinflusst, welches Leben wir führen – ob wir einsam sind, wie viel wir zur Klimawende beitragen, wie hart wir arbeiten müssen, um die Wohnkosten zu decken. Als Barbara Nothegger ein neues Zuhause für ihre junge Familie suchte, trieben sie genau diese Fragen an. Trotz vieler Einwände wagte sie das Experiment und schloss sich mit ihrer Familie einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt in Wien an. Hundert Menschen bauten sich ein Haus mit vielen Gemeinschaftsräumen und Freiflächen, die die Bewohner*innen zum Zusammenkommen, Teilen und Austauschen einladen. Nach mehr als zehn Jahren im Wohnprojekt zeigt Nothegger in einer humorvollen Anleitung, wie eine moderne Gemeinschaft gelingen kann und gute Nachbarschaft ein klimafreundliches Leben erleichtert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Barbara Nothegger
Sieben Stock Dorf
Barbara Nothegger
Sieben Stock Dorf
Wohnexperimente für eine bessere Zukunft
Residenz Verlag
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.com
© 2017
Überarbeitete und erweiterte Neuauflage © 2025 Residenz Verlag GmbH
Mühlstraße 7, 5023 Salzburg
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
Umschlaggestaltung: Boutiquebrutal.com
Umschlagmotiv: Barbara Nothegger
Typografische Gestaltung, Satz: Lanz, Wien
ISBN ePub:
978 3 7017 4750 4
ISBN Printausgabe:
9783701736393
Inhalt
Zuhause
Ab ins Kollektiv
Das Kollektiv hat Konjunktur
Vom Volkspalast zur Hausbesetzung
Neuland
Achtung, Baustelle!
Anklopfen
Zweifeln
Träumen
Reden
Planen
Bauen
Zahlen
Zittern
Sieben Stock Dorf
Wir Hausbesitzer
Mach du mal
Ich, du, wir
Hände hoch, Oma!
Halt die Klappe
Zukunft
Teilen Sie auch Ihren Mann?
Die Kraft des Zusammenseins
Aufbruch
Danke!
Das Wohnprojekt Wien
Weiterbauen
Quellen
Zuhause
»Welche Uni besuchen? Welche Karriere verfolgen? Wen heiraten? Alles wichtige Fragen – aber keine so bedeutend wie die wichtigste Entscheidung, die du jemals zu trefen hast: wo du leben sollst.«
Richard Florida, »Who'syourcity?« (2008)
Es gibt Momente im Leben, in denen die großen Fragen auftauchen. Jahrelang leben wir dahin, ohne uns näher Gedanken über das Wie, Wo und Warum zu machen. Doch meistens passiert es dann doch, dass das Leben plötzlich an die Tür klopff und Entscheidungen verlangt: Wohin soll es gehen, mit wem und wie? In meinem Leben ist dieser Moment, als ich erfahre, dass ich schwanger bin. Ich bin überglücklich, dass mein Freund Clemens und ich Eltern werden. Doch es fühlt sich auch an, als stünde ich an einer Schwelle, an der nun bestimmte Fragen dringend beantwortet werden müssen: Wie soll unser Kind aufwachsen? Auf dem Land oder in der Stadt? Wer wird für unser Kind da sein, außer wir Eltern? Wird es frei aufwachsen können, zwischen Wiesen und Feldern so wie wir damals? Welche Freunde wird es haben? Und wird es sich geliebt, sicher und geborgen fühlen? Egal, welche Bilder ich mir in meinem Kopf ausmale, welche Möglichkeiten ich durchspiele – all diese Überlegungen münden am Ende doch in der immer gleichen Frage: Wie wollen wir wohnen?
Als ich ein Kind war, hatten ich und meine beiden Schwestern ein Spiel, das sich einfach nur »Haus« nannte. Es war eine Art Fantasiespiel, das wir selbst erfunden hatten. In der alten Garage unserer Tagesmutter Rosi schoben wir verstaubte Sesseln zusammen, legten Holzstücke und Steine auf den Boden, sammelten Besen, Schaufeln und alte Töpfe. Wir nahmen zerschlissene Decken und zimmerten uns aus all diesen Gegenständen Räume. Viele Stunden verbrachten wir damit, in unserer Vorstellung Essen zuzubereiten, Gäste in unseren Wohnzimmern zu empfangen und uns gegenseitig zu besuchen. Ich stellte mir dabei immer vor, wie mein eigenes Zuhause sein würde, wenn ich groß bin. Ich weiß heute nicht mehr im Detail, wie es aussah. Es ging jedenfalls in Richtung Villa mit Garage, Sauna, Kino und vielen Kinderzimmern. Aber ich erinnere mich genau an das Gefühl, das ich dabei hatte. Ich war glücklich, weil ich ein schönes Haus hatte.
In gewisser Weise ist dieses »Haus«-Spiel universell: Wie ich damals, spielen Millionen von Kindern rund um den Globus mit Häusern. Sie besitzen Barbie-Häuser und welche für andere Puppen, sie bauen Häuser aus Karton, formen matschigen Sand zu Burgen und verbringen ganze Tage damit, bunte Lego-Steine zu kunstvollen Wohnhäusern, Feuerwehrstationen und Bauernhöfen zusammenzubauen. Wenn sie größer sind, tauchen sie in die virtuelle Welt ab und zocken Minecraff auf der Konsole. Das ist nicht verwunderlich, denn wie wir wohnen, beeinflusst maßgeblich, was für ein Leben wir führen.
Ein Zuhause kann uns Sicherheit, Rückzug und Geborgenheit bieten. Es kann aber auch genau das Gegenteil mit uns machen: Wir können daheim beengt und deswegen belastet sein. Wie wir wohnen, bestimmt, was für sozialen Kontakte wir haben und welche Menschen uns tagtäglich über den Weg laufen. Es macht einen Unterschied, ob wir Tür an Tür mit Menschen wohnen, die manchmal mit uns plaudern und helfen, falls wir krank sind. Es prägt auch den Zugang zur Natur. Den meisten von uns geht es besser, wenn sie einen Baum vor ihrem Fenster haben oder sogar einen Garten hinterm Haus. Wer hingegen an einer lauten Straße wohnen muss, ist tagtäglich mit Autolärm und Asphalt konfrontiert. Wie wir wohnen, sagt auch etwas darüber aus, wie groß unser ökologischer Fußabdruck ist – ob wir das Auto brauchen, um in die Arbeit und zum Supermarkt zu kommen, oder wir unsere Wege zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen können. Ob wir Strom und Energie fürs Heizen konsumieren oder nicht. Und es beeinflusst, wie viel wir arbeiten müssen, um uns unser Zuhause leisten zu können.
Ich und mein Freund Clemens leben in Wien. Einer Stadt, die in Bezug auf Wohnen als Paradies gilt – ist sie doch weltweit ein Vorbild für sozialen Wohnbau. Für unsere 90 Quadratmeter große Altbauwohnung mit knarrendem Parkett, 100 Jahre alten Fenstern mit Holzrahmen und vier Meter hohen Wänden zahlen wir Anfang der 2010er-Jahre 700 Euro Miete pro Monat. Wir leben recht unbeschwert dahin, in einer Wohnung, die eigentlich als Übergangsbleibe zwischen Studienende und Berufseinstieg gedacht war, die aber so bequem ist, dass sie ein fixes Daheim geworden ist. Ohnehin sind wir wenig zu Hause, weil mein Job als Journalistin bei einem Wirtschaffsmagazin mich sehr fordert und ich viel unterwegs bin. Trotzdem ist es seltsam: Wir fliegen nach Bolivien, um bei der Hochzeit eines befreundeten Paars dabei zu sein, trauen uns aber nicht, unsere Nachbarn um etwas Zucker zu fragen. Wir übernachten unter freiem Himmel auf Berggipfeln in den Alpen, während die Sonne den ganzen Tag nicht in unsere Wohnung scheint. Was für ein Haus war es nochmal, das wir uns für unser Leben vorstellten?
Seit ich schwanger bin, bemerke ich, wie mich einige Eigenschaffen unserer Altbauwohnung nach und nach stören – und was ich mir stattdessen wünsche. Sie liegt im ersten Stock, nordseitig, und ist deshalb ein finsterer Ort. Off zieht ein Hauch von Calamari fritti mit Knoblauch von der darunterliegenden Pizzeria über den Hinterhof in unsere Küche. Ich mag diesen Geruch nicht, und so bleiben unsere Fenster off geschlossen. Vor allem im Sommer ist das deprimierend – immer, wenn wir an einem lauen Abend in der Küche sitzen und dazu gerne eine Brise Sommer durchs Fenster spüren würden. Dann fühle ich mich eingesperrt.
Die Lage unserer Wohnung nahe der Wiener Innenstadt fand ich immer toll: Nette Cafés und Bars sind vor der Haustüre, Theater und Kino nicht weit. Doch mit dem Gedanken an unser Kind sehe ich die dichte Urbanität auf einmal als Bedrohung. Ich beobachte das vierjährige Nachbarskind, wie es quietschend vor Freude mit seinem Laufrad vor der Haustüre losstartet und nach ein paar Metern von seiner Mutter hinterhergeschrien bekommt: »Stopp, nicht so weit, da kommt die Straßenbahn!« Was nützen mir Plätze zum Ausgehen, wenn Kinder hier keinen Schritt alleine machen können? Der freie Bewegungsraum endet an den eigenen vier Wänden.
Und ich muss zugeben, dass manchmal eine Art von Einsamkeit leise daherkriecht. Es fühlt sich an, als sei ich getrennt von der Welt, von anderen Menschen, vom Leben. Als wäre ich in einem Glasgefäß gefangen und müsste zusehen, wie außerhalb alle fröhlich tanzen. Dieses Gefühl schlägt mich nieder. Seit ich zum Studium nach Wien gezogen bin, lebe ich zweihundert Kilometer weit weg von meiner Familie. Ich habe zwar Freund*innen, doch wenn ich mich nicht verabrede, gibt es niemanden –, außer Clemens – der einfach mal klopff und fragt, wie es geht. Es gibt in unserem Haus keine zufälligen Begegnungen, keine ungezwungenen Gespräche, spontane Einladung zum Essen. Außer Harri, einem aus Rumänien zugewanderten Elektriker, kenne ich keinen anderen Nachbarn näher. Und selbst bei Harri, der mir zwar manchmal selbst gefangenen Fisch aus der Donau schenkt, habe ich Hemmungen, einfach so für einen Tratsch zu klingeln. Wie einsam werden wir sein, das Baby und ich?
Ich muss immer wieder daran denken, wie es war, als ich klein war. Das Zuhause der Kindheit ist für die meisten von uns ein sehr besonderer Ort. Wie off denken wir als Erwachsene noch zurück an unser Elternhaus, an den Küchentisch, wo wir zusammengegessen sind, erinnern uns an das Geschirr und den wackligen Stuhl. Wir haben den Geruch des Leders der Wohnzimmercouch in der Nase, auf der wir herumgesprungen sind. Wir hören die Schallplatten, zu denen wir mit unseren Freundinnen getanzt haben, während die Erwachsenen drüben im Esszimmer getrunken und gelacht haben. Es ist erstaunlich, wie viele Details wir gespeichert haben. Dabei geht es nicht um die Dinge, die uns umgaben, sondern das Leben, das wir führten. Die Dinge sind wie Fotos, die wir anschauen, und plötzlich fällt uns detailliert die Szene ein, in der das Foto entstanden ist.
Aus der Soziologie ist bekannt, dass, wenn Menschen das Nest für ihre eigene Familie bauen, sie auf diese Kindheitserfahrungen zurückgreifen. Sie sind eine Referenz für das, was wir uns für unsere eigenen Kinder wünschen. Wir orientieren uns an den gelernten »Wohnmustern« und vollziehen dabei einen biografischen Zirkelschluss. Tatsächlich ist das auch bei mir so. Seit ich schwanger bin, versuche ich herauszufinden, was es genau war, das mir eine glückliche und unbeschwerte Kindheit beschert hat. All die Geschichten, die mir dazu einfallen, drehen sich im Grunde um zwei Aspekte: Freiheit und mein Dorf.
Was die Freiheit betrifft, sind meine Erfahrungen wohl denen anderer Kinder sehr ähnlich, die in den 1980er-Jahren aufgewachsen sind. Ich wurde in einem mächtigen Dreikanthof in einem kleinen Dorf in Oberösterreich groß. Meine Eltern betrieben im Ortszentrum eine Fleischerei und ein Gasthaus. Das Haus beherbergte mehrere Wohnungen (neben den Großeltern und meiner Tante lebten auch nichtverwandte Mieter*innen dort) sowie Geschäffsflächen. Meine beiden Schwestern und ich verbrachten unsere Zeit nicht in unserer Wohnung im ersten Stock, sondern zwischen Gaststube und Geschäff. Mein Bewegungsradius erstreckte sich deswegen weit über die Wohnungstüre hinaus, weshalb ich ein enormes Freiheitsgefühl entwickelte. Im ganzen Haus warteten Abenteuer – vom verlassenen Dachboden bis zum letzten Winkel in der Waschküche. Off nahmen wir auch kleine Arbeitsaufträge in der Fleischerei an. Oder waren draußen, auf den Straßen des Dorfs, unterwegs. Wir radelten stundenlang am Platz rund um die Kirche oder setzten uns auf die von der Sonne aufgeheizten Treppen, um die kreischenden Vögel und den Abendhimmel zu beobachten. Das war off unser Ritual vor dem Zubettgehen.
Auch zwei meiner Freundinnen, die in der Stadt aufwuchsen, erzählten mir einmal, wie viel sie als Kinder auf der Straße gespielt hatten, als es noch Ecken mit »wilder« Natur hinter den Wohnsiedlungen gab. Mich wunderte das, als ich es hörte. Denn ich hatte bis dahin gedacht, dass mein kindliches Freiheitsgefühl mit dem Aufwachsen auf dem Land zu tun gehabt hätte. Doch offenbar hatten auch Heranwachsende in Städten ein ähnliches Gefühl. Das liegt wohl daran, dass es früher in den Städten wesentlich weniger Verkehr gab und nicht jeder Winkel verbaut und durchkommerzialisiert war.
Das zweite prägende Gefühl meiner Kindheit ist wesentlich komplizierter als die Freiheit, es ist das Dorf. Genauer gesagt hatte ich zwei Dörfer. Ich hatte ein kleines Dorf in unserem Haus und das richtige Dorf rundherum noch dazu. Obwohl meine Eltern sehr viel arbeiten mussten und kaum Zeit für uns hatten, gab es viele Menschen, die sich um uns Kinder kümmerten: unsere Großmutter, Tagesmutter Rosi und Tante Herta. Wenn wir von der Schule nach Hause kamen, gingen wir in die Wirtshausküche und die Köchin bereitete uns Essen zu. Auch Herta, die jüngere Schwester meiner Mutter, war eine wichtige Bezugsperson. Sie hatte eine Wohnung im Obergeschoß unseres Hauses und wir konnten sie besuchen, wann immer wir wollten. Sie war sehr kreativ und bastelte und malte ständig mit uns. Außerdem verwickelte sie uns junge Mädchen off in Diskussionen über Frauenrechte. Einmal schenkte sie mir Sticker mit der Aufschriff »Frauenpower macht Männer sauer«, die ich später ahnungslos auf die Verkaufsvitrinen in der Fleischerei klebte – Mitte der 1980er-Jahre empörten sich die Kunden noch über solche Sprüche. Es waren ständig Menschen um uns, die wir anreden konnten und die auch uns ansprachen. Schon das Frühstück nahm ich nicht mit Mama und Papa ein, sondern mit den Fleischergesellen am großen Tisch in der Gasthausküche. Und wenn wir nicht redeten, sogen wir dennoch etwas von ihnen auf (und sie vielleicht etwas von uns). Für die Metzgergesellen hegte ich gewisse Sympathien, weil ich fasziniert davon war, wie sie es schafften, zwei dicke Wurstsemmeln zu verschlingen, während ich an einem halben Marmeladenbrot knabberte. Wer wird das Dorf meines Kindes sein?
Dass das Verhältnis zu meinem Dorf kompliziert ist, liegt daran, dass ich es verloren habe. Meiner Mutter ging es sehr schlecht in unserem Dorf. Sie begann, ihre Arbeit in der Fleischerei und im Gasthaus nicht mehr zu mögen. Sie ertrug es nicht, zu jeder und jedem freundlich sein zu müssen, immerfort höflich grüßen zu müssen. Sie hielt die Atmosphäre der Enge und Engstirnigkeit nicht mehr aus. Noch dazu ging die Ehe mit meinem Vater den Bach runter. Schließlich entschied sie, ihr Leben hinter sich zu lassen, packte ihre Sachen und flüchtete mit uns drei Mädchen – ich war zwölf Jahre alt – für immer in die nächste größere Stadt. Für mich war das ein gewaltiger Bruch, der sich tief in meine Biografie eingebrannt hat. Ich hatte dadurch nämlich bereits als Jugendliche erste tiefe Erfahrungen mit Einsamkeit.
In der Stadt kannten wir niemanden. Wir lebten in einer Reihenhaussiedlung eines Vororts. Da meine Mutter Vollzeit arbeitete, verbrachte ich meine frühe Jugend allein vor dem Fernseher. In meinem alten Zuhause waren immer Menschen da, die, wenn ich es wollte, mit mir in Kontakt traten. Nun gab es nur mich und diese fürchterliche Stille, wenn ich von der Schule kam. Niemand kochte für mich, ich ernährte mich hauptsächlich von Cornflakes, Spiegeleiern und Tiefkühlpizza. Erst viele Jahre später habe ich verstanden, dass mich diese sehr frühe Erfahrung mit Einsamkeit wohl stärker als andere angetrieben hat, neue Verbundenheit, Gemeinschaff und Freundschaffen zu suchen.
* * *
»Ich möchte umziehen«, sage ich zu Clemens, als wir an einem Sonntagnachmittag im Wienerwald spazieren gehen. Er sieht mich überrascht an. Die Überlegungen der vergangenen Wochen haben so weit geführt, dass ich mir nicht mehr vorstellen kann, dass unser Baby, Clemens und ich in unserer Altbauwohnung gut leben werden. Mit meinem Bauch ist auch mein Wunsch nach einem neuen Zuhause gewachsen. Mir ist klar geworden, was ich mir für unsere Zukunff wünsche: Ich möchte, dass mein Kind Platz zum Aufwachsen, zum Ausprobieren und Kräffemessen hat. Ich sehne mich danach, dass wir als Familie mehr Beziehungen zu unserer nahen Umgebung haben, also Freund*innen oder Familien in der Nähe oder zumindest liebe Nachbar*innen haben. Ich will keine Einsamkeit spüren müssen und stelle mir vor, dass unser Leben mit netten Menschen um uns herum unkomplizierter wird. Und ich träume von einem Garten, wo wir den Wechsel der Jahreszeiten spüren und Gemüse anbauen. In diesem Moment versinkt mein Fuß im matschigen Frühlingsboden. »Schlamm und Erde, auch das braucht der Mensch«, sage ich. Clemens grinst.
Ich weiß, dass Clemens der Gedanke gefällt, im Grünen zu wohnen. Für ihn ist das Leben in der Stadt eine einzige Überwindung. Ginge es nach ihm, würde er in einer Jurte mitten im Wald hausen. Wenn er länger keine Bäume und Wiesen um sich hat, bekommt er schlechte Laune und schimpff ununterbrochen, er müsse sich »endlich wieder erden«. Clemens nimmt seinen Kalender aus der Tasche: »Dreißig Wochen, also circa sieben Monate, haben wir noch bis zum Geburtstermin. Wenn wir einen Monat vor der Geburt eine neue Wohnung haben wollen, bleiben uns sechs Monate. Ob sich das ausgeht?« Eine Weile geht er schweigend neben mir. »Okay, lass es uns versuchen«, sagt er schließlich und gibt mir einen Kuss. Unser Vorhaben ist besiegelt: Wir machen uns auf die Suche nach einer neuen Wohnung – einem richtigen Zuhause für uns und unser Kind.
Warum ist aus dieser Suche ein Buch geworden? Die Suche führte mich an einen Ort, von dem ich nicht vermutet hätte, dass es ihn gibt, geschweige denn, dass ich dort jemals Wurzeln schlagen werde: in einem gemeinschafflichen Wohnprojekt. Es ist eine Art von Haus, die sehr selten ist. Wir erwägen Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, Bauernhäuser, Gemeindebauten, Wohnhäuser und Hochhäuser. Aber gemeinschaffliche Wohnprojekte? Dabei gelten moderne gemeinschaffliche Wohnprojekte als Leuchtturmprojekte für ökologisches Wohnen und sozialen Zusammenhalt. Das Haus, in dem ich selbst schließlich gelandet bin, das »Wohnprojekt Wien«, erhielt etwa den österreichischen Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit 2014 und die beteiligten Architekt*innen von einszueins architektur wurden 2025 mit dem renommierten »World Habitat Award« der UN ausgezeichnet. Denn es ist offensichtlich, dass viele Herausforderungen unserer Zeit neue Lösungen und kollektives Handeln erfordern: die Klimakrise, die Vereinsamung und bezahlbaren Wohnraum.
Ich habe dieses Buch geschrieben, weil für mich mit dem Einzug ins Wohnprojekt eine Reise in eine unbekannte Welt begonnen hat, eine Reise ins Reich der Gemeinschaff. Die wenigsten von uns wissen heute, wie man gut mit vielen Menschen eng zusammenlebt. Ich wusste das bis vor Kurzem auch nicht. Woher auch? Mit dem Buch nehme ich Sie mit auf meinem Weg und zeige Ihnen, was eine gute Gemeinschaff bewirken kann. Das Buch ist für Menschen, die selbst den Versuch unternehmen wollen, ein gemeinschaffliches Wohnprojekt zu gründen oder sich einem Kollektiv anzuschließen. Es ist eine Art Reiseführer, der Ihnen zeigt, wie Hausgemeinschaffen entstehen und man selbst Teil davon wird, und der hilff, schwierige Situationen (ja, auch diese gibt es!) zu meistern. Ich habe auch viele andere Menschen getroffen, die in Wohnprojekten leben – auch sie werden im Buch ihre Erfahrungen teilen.
Ich kann Ihnen eines vorab verraten: Das Leben in einer Hausgemeinschaff ist ein Auf und Ab mit vielen unterschiedlichen Gefühlen. Erlebnisse in Gruppen können zu rauschartigen Zuständen führen, die das Gehirn mit Glückshormonen fluten. Sie machen tief zufrieden, weil man sich aufgehoben fühlt. Aber sie können auch Wutanfälle auslösen oder so krass an einem nagen, dass man genervt die Flucht ergreifen möchte. Doch ganz egal, welche Gefühle ein Wohnprojekt auslöst, eines ist doch immer gleich: Wir sind darin mit anderen Menschen verbunden und verspüren die kollektive Kraff, die es möglich macht, die Zukunff ein klein wenig besser zu gestalten. Und genau das ist es ja, wonach sich so viele Menschen heute sehnen.
* * *
Zurück zu unserer Wohnungssuche. Zunächst fangen Clemens und ich dort an, wo wir vermuten, dass sich unser Wunsch nach Natur und Nachbarschaff erfüllt: auf dem Land. Genauer gesagt in Clemens’ Heimatort im oberösterreichischen Mühlviertel. Obwohl der Ort nur 1600 Einwohner*innen hat, konnten sich hier ein kleiner Lebensmittelladen, eine Bankfiliale und die Volksschule halten. Es gibt eine Musikkapelle, die Freiwillige Feuerwehr und zwei Dutzend andere Vereine. Der Ort ist bei jungen Familien sehr beliebt geworden, weil die nächste größere Stadt nur vierzig Kilometer entfernt liegt und die Grundstückspreise vergleichsweise günstig sind. Wenn wir hierher kommen, ist unser erster Weg jener hinauf zu unserem Lieblingsplatz »Vogeltenn«, was so viel wie »Tränke der Vögel« heißt. Es ist ein großer Südhang gleich hinter Clemens’ Elternhaus. Von hier haben wir einen spektakulären Blick auf die Alpen. Wir setzen uns auf die Bank vor der kleinen Kapelle. Der Wind streicht durch die knospenden Bäume, und unter dem braunen Laub schimmern Frühlingsblumen. »Es ist so schön hier«, sagt Clemens. »Am liebsten würde ich hier wohnen, in einem Haus zwischen Bergkulisse und Wald.« Ich stimme ihm zu. Was braucht man mehr zum Leben?
Für gut 75 Prozent der Österreicher*innen (und siebzig Prozent aller Deutschen) ist ein Einfamilienhaus mit Garten die Traumimmobilie. Ein solches Haus scheint große Versprechen einlösen zu können: Freiraum, Grün und Ruhe. Es ist eine Möglichkeit, Eigentum zu bilden, Vermögen anzusparen und im Alter abgesichert zu sein. Die Besitzer*innen haben großen Gestaltungsspielraum, quasi einen Platz unter ihrer eigenen Kontrolle. Außerdem sind Einfamilienhäuser nach wie vor ein Symbol dafür, dass man es »geschafft« hat, ein Prestigeobjekt. Und sie sind für viele Menschen der biografische Zirkelschluss, von dem weiter oben schon die Rede war. Wer in einem Einfamilienhaus groß wurde, möchte das auch für seine eigenen Kinder. Allerdings ist es in den vergangenen Jahren aufgrund der gestiegenen Preise für Grundstücke, Baumaterialien, Energie und Fachkräffe sowie der höheren Zinsen immer schwieriger geworden, sich diesen Wunsch zu erfüllen. Dazu kommt, dass in manchen Gemeinden schon das Bauland knapp ist. Trotzdem errichten Menschen immer noch Einfamilienhäuser – sie machen Abstriche bei der Ausstattung oder ziehen in etwas günstigere Lagen weiter weg von den Zentren.
Dabei hatte das Dorf immer etwas Ambivalentes: Einerseits verspricht es Heimeligkeit und Behaglichkeit. Die Dorfbewohner*innen kennen sich – niemand muss sich erklären. Es gibt ein feines Netz von Hilfen und über die vielen Vereine auch Möglichkeiten, schnell Anschluss zu finden. Andererseits schlägt diese Heimeligkeit eben schnell in Enge, Eintönigkeit, Neid und soziale Kontrolle um. Aus dieser Mufflgkeit flüchtete man gerne in die Anonymität der Großstadt. Die Stadt galt lange als Kontrapunkt zum Dorf – weltoffen, modern, intellektuell und divers. Seit dem Mittelalter gibt es den Spruch »Stadtluff macht frei«, und schon Marx und Engels beklagten die »Idiotie des Landlebens«. Diese Trennlinie scheint heute aufgelöst: Urbane Qualitäten finden sich genauso auf dem Land, und dank Internet und sozialen Medien lässt sich der Anschluss zur Welt in jede noch so abgelegene Hütte holen. Das Land konnte auf diese Weise zu einem Sehnsuchtsort werden, wo sich die Vorteile beider Sphären scheinbar verbinden lassen.
Bei unserem Besuch am Vogeltenn ist diesmal etwas anders. Es dauert eine Weile, bis wir merken, was es ist: Die Bauparzellen für Einfamilienhäuser am Nachbarhang rücken seit ein paar Jahren immer näher an unseren Lieblingsplatz heran. Zum ersten Mal sehen wir von unserer Bank aus direkt auf solch eine frische Parzelle. Ein Volksschulkamerad von Clemens hat das Grundstück kürzlich gekauff und wird hier bald seinen Haustraum verwirklichen. Die Parzelle ist mit Schnüren abgesteckt, der Bagger für den Aushub bereitgestellt. In den nächsten Jahren wird der ganze Hügel voll sein mit Einfamilienhäusern. Dort, wo Clemens als Kind zwischen den hohen Gräsern die Wiese hinunterhüpffe, wird sich bald ein Haus an das andere reihen – alle mit Garage, Pool und Trampolin für die Kinder. Die Gemeinde wird neue Straßen gebaut und die Erde für neue Rohre umgegraben haben. Unser Vogeltenn wird nicht mehr das sein, was er immer für uns war. Diese Aussicht bedrückt uns. Das, was wir so lieben an diesem Ort, verschwindet Quadratmeter für Quadratmeter. Wäre es weniger schlimm, wenn wir selbst es wären, die hier ein Haus bauen?
Das Landleben hatte lange das Image, besonders naturfreundlich zu sein: Jeder hat einen Garten, und zum nächsten Bauernhof ist es nicht weit. Die ökologischen Kosten des Einfamilienhauses aber sind heute kaum mehr zu ignorieren und die Debatten darüber – wie etwa in Hamburg, wo vor ein paar Jahren ein Verbot von Einfamilienhäusern erlassen wurde – werden immer lauter geführt. In seinem Buch »Stadt, Land, Klima« macht der austro-amerikanische Klimaökonom Gernot Wagner darauf aufmerksam, dass die wenigsten Landbewohner*innen tatsächlich auf dem Land-Land wohnen. Vielmehr leben sie in den Speckgürteln rund um große Städte, in Vororten, in der Suburbia, wie er es nennt. Und er rechnet vor, dass diese Menschen einen doppelt so hohen CO2-Ausstoß pro Kopf haben wie Stadtbewohner*innen. »Der Vororttraum ist ein Natur- und Klimakiller«, schreibt Wagner.
Einer der Gründe dafür ist der enorme Ausstoß von CO2, der durch das tägliche Pendeln mit dem Auto zum Arbeitsplatz entsteht. Die Tag für Tag zurückgelegten Autokilometer sind durch nichts aufzuwiegen – auch nicht durch eine ökologische Bauweise des Eigenheims. Dazu kommt der enorme Verbrauch an Böden – nicht nur beim Bau eines Einfamilienhauses selbst, sondern bei all dem, was mit dem Landleben derzeit so einhergeht. Hier spielt das Phänomen Zersiedelung eine entscheidende Rolle. Zersiedelung bedeutet, dass sich Wohnsiedlungen, Infrastruktur, Gewerbe- und Verkehrsflächen in ländlichen und suburbanen Gebieten planlos ausdehnen und teilweise weit verstreut in der Landschaff stehen. Heute hat schon jeder halbwegs größere Ort ein Industrie- oder Einkaufsareal am Ortsrand. Zum Vergleich: In den Städten, zumindest im Inneren, sind Gebäude kompakt errichtet. Auf einem Quadratmeter ist wesentlich mehr Wohnfläche untergebracht, weil Wohnungen ja »übereinandergestapelt« sind. Stadtbewohner*innen verbrauchen deshalb erheblich weniger Boden pro Kopf als Menschen außerhalb der dicht verbauten urbanen Zentren.
Die Bodenversiegelung hat weitreichende Auswirkungen auf die Umwelt. Etwa auf den Wasserhaushalt: Einerseits kann Regenwasser weniger gut versickern – bei starken Regenfällen kommt es schneller zu Überschwemmungen. Andererseits fehlt in heißen Sommern das Verdunstungswasser zur Kühlung. Auch die landwirtschafflichen Flächen zur Produktion von Gemüse und Getreide nehmen stark ab. Die Raumplanerin Gerlind Weber rechnet in der Publikation »Boden für alle« vor, dass schon heute jede dritte Kalorie, die in Österreich gegessen wird, importiert ist. Und sie warnt, dass eine der größten Bedrohungen für das Land – noch vor den öffentlich viel diskutierten Themen Cyberattacken, Migration oder Terrorismus – der Verlust der Ernährungssouveränität ist. Ginge der Bodenverbrauch in diesem Tempo weiter, wäre Österreich in zweihundert Jahren komplett verbaut. Dazu kommen die dramatischen Folgen des Verlusts an Biodiversität. Das World Economic Forum rechnet im Global Risks Report 2024 damit, dass das Risiko eines Biodiversitätsverlusts und eines Zusammenbruchs von Ökosystemen kontinuierlich ansteigt und in der kommenden Dekade eines der drei gefährlichsten Risiken für die Weltwirtschaff ist.
Clemens und ich sitzen diesmal länger als sonst auf der Bank am Vogeltenn. Wäre hier, in einem Einfamilienhaus auf dem Land, das Leben möglich, von dem wir träumen? Einen Teil der Antwort gibt Tarek Leitner. Der bekannte österreichische Nachrichtenmoderator schreibt in seinem Buch »Wo leben wir denn? Glückliche Orte. Und warum wir sie erschaffen sollten«, dass das Landleben nicht etwa die Vorteile von Stadt und Land vereint, sondern – ganz im Gegenteil – von beidem nur die Nachteile birgt. Er spricht von einer Illusion, die Städter*innen vom Landleben hätten. Das Leben im Grünen sei ein glatter Selbstbetrug. Schon allein das Pendeln zur Arbeitsstelle dauert mehrere Stunden pro Woche – Zeit, von der man fälschlicherweise annahm, sie im Liegestuhl im Garten zu verbringen. Auch der erhoffte Freiraum bleibt aus: In manchen Orten besteht der Dorfplatz aus nicht mehr als einem Kreisverkehr. Und ebenfalls skeptisch ist Leitner, ob zwischen den mit grünen Hecken dicht eingezäunten Einfamilienhäusern wirklich ein soziales Leben stattfindet.
Den zweiten Teil der Antwort geben wir uns selbst. Ein Gedanke lässt uns nämlich nicht mehr los: Ja, es wäre wundervoll, an diesem magischen Ort am Vogeltenn zu wohnen. Doch gleichzeitig wäre es sehr paradox: Wir kaufen unser Biogemüse beim Bauern am Markt, fahren viel mit dem Rad und versuchen uns in einer nachhaltigen Lebensweise. Und dann würden wir mitten ins Grüne ein Einfamilienhaus klotzen und unseren geliebten Vogeltenn damit zerstören? Das passt nicht zusammen. Und auch der Autor Gernot Wagner formuliert es ganz klar: Wer nachhaltig leben will, sollte in die Stadt ziehen. Hier verbraucht man vergleichsweise wenig Boden und alle Notwendigkeiten des täglichen Lebens sind nah beieinander, sodass man die Mobilität ökologisch gestalten kann. Ein Leben in der Stadt ist die efflzienteste Wohnform.
Doch was ist überhaupt eine »nachhaltige« Wohnform? »Das nachhaltigste Haus ist das, das nicht gebaut wird« heißt es so schön. Wer nicht baut, verbraucht keine Böden, natürlichen Ressourcen für Baumaterialien und Energie zur Gebäudeherstellung. Blöd nur, dass wir alle ein Dach über dem Kopf brauchen und ohne Bautätigkeit die moderne Welt nicht funktionieren würde. Worauf der Spruch jedenfalls hinweist: Bauen und Wohnen haben enorme Auswirkungen auf unser Klima und unsere Umwelt. Rund vierzig Prozent der globalen Treibhausgasemissionen entstehen durch die Herstellung und den Betrieb von Gebäuden.
Dabei sind die Effekte auf das Klima nur einer von mehreren Aspekten. Das zeigt etwa das Konzept der planetaren Belastungsgrenzen, das von einer Gruppe internationaler Umweltwissenschaffer*innen unter der Leitung des schwedischen Resilienzforschers Johan Rockström entwickelt wurde. Darin gibt es insgesamt neun kritische Umweltbereiche (die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre ist nur einer davon), die für das Leben auf der Erde von grundlegender Bedeutung sind. Werden bestimmte Grenzwerte überschritten, besteht das Risiko, dass das globale Umwelt- und Klimasystem destabilisiert und irreversibel geschädigt wird. In einer Studie des deutschen Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung aus dem Jahr 2020 wird der Umweltfußabdruck von Gebäuden in Deutschland untersucht. Das Ergebnis: Neben den Auswirkungen auf das Klima hat die Herstellung, die Nutzung und der Betrieb von Gebäuden viele andere negative Umweltauswirkungen, beispielsweise Luffverschmutzung, Wasserverbrauch, Nährstoffeintrag in Gewässer und den Verlust von Biodiversität. Beim Bauen geht es also um viel mehr als nur ums Klima.
Alarmierend ist beispielsweise, wie hoch der Ressourcenverbrauch beim Bauen ist. Rund vierzig bis fünfzig Prozent aller weltweit abgebauten Rohstoffe werden für Bautätigkeit verwendet. Rund dreißig Milliarden Tonnen Sand und Kies (etwa für Beton) werden jährlich verbaut. Die Nachfrage nach Primärrohstoffen ist heute wesentlich höher, als die Erde eigentlich hergeben kann. In Deutschland war 2024 der sogenannte »Erdüberlastungstag« am 2. Mai. Es ist der Tag, an dem die natürlichen Ressourcen aufgebraucht sind, die die Erde in diesem Jahr regenerieren kann. Dazu gehen weltweit etwa dreißig bis vierzig Prozent aller Abfälle auf die Baubranche. In industrialisierten Ländern wie Deutschland und Österreich liegt der Anteil bei rund sechzig Prozent, weil hier viel mehr investiert wird. In Zukunff muss es darum gehen, bereits Vorhandenes besser zu nutzen: etwa indem die Nutzungsdauer von Gebäuden verlängert, der Altbestand revitalisiert oder Baustoffe wiederverwertet werden.
Um zu messen, wie nachhaltig Häuser tatsächlich sind, wird in der Immobilienwirtschaff häufig der Kriterienkatalog der Deutschen Gesellschaff für Nachhaltiges Bauen (DGNB) angewendet. In die Beurteilung fließen mehrere Dutzend unterschiedlich gewichtete Aspekte der drei für alle Nachhaltigkeitsbetrachtungen relevanten Bereiche Ökologie, Ökonomie und Soziales ein. Etwa: wie viele Emissionen ein Gebäude in der Herstellung, im Betrieb und bei einem Rückbau ausstößt; wie viele Ressourcen während des gesamten Lebenszyklus verbraucht werden; was für Baustoffe verwendet und mit welchen Chemikalien und Lösemitteln sie verarbeitet wurden; ob Gebäude umgebaut (etwa von einem Wohnhaus in ein Bürogebäude), ob sie rückgebaut und recycelbar sind. In der Bewertung ist auch relevant, ob die Gesundheit und das Wohnbefinden der Bewohner*innen berücksichtigt sind und wie die Planung des Gebäudes abläuff. Außerdem wird beurteilt, welche öffentlichen Mobilitätsangebote rund um das Gebäude vorhanden sind und wie flexibel ein Haus genutzt werden kann – beispielsweise ob ein Wohnhaus leicht in ein Bürogebäude umzubauen wäre. Und natürlich, wie viel und was für eine Fläche für das Gebäude beansprucht wird: Ein saniertes Industriegebiet beispielsweise ist für die Bewertung am besten, ein Neubau auf der grünen Wiese am schlechtesten.
Insgesamt lässt sich feststellen: »Nachhaltiges Wohnen« ist sehr komplex. Noch komplexer wird es, wenn man Folgendes bedenkt: Im und um den Wohnraum findet eine ganze Reihe von Alltagsaktivitäten statt, die nachhaltigkeitsbezogen höchst relevant sind – Ernährung, Mülltrennung, Energiekonsum und auch nachbarschaffliche Kontakte fallen darunter. Hier wären wir wieder am Anfang: Wie und wo wir wohnen, beeinflusst viele unserer Alltagsaktivitäten, unser Leben.
* * *
Zurück nach Wien. Es wäre doch gelacht, wenn wir hier keine schöne, helle Wohnung – oder sogar ein kleines Häuschen – mit Garten oder Balkon und netten Nachbarn finden. Und zumindest im Ansatz nachhaltig wohnen könnten! Ein Blick in den Kalender: Fünf Monate haben wir noch Zeit, bis unser Baby auf die Welt kommt.
Ich registriere mich bei sämtlichen Immobilienportalen im Internet, richte eine Suchmaske mit unseren Präferenzen ein und überprüfe täglich die mir vorgeschlagenen Objekte. Zunächst durchforste ich alle Angebote, die zum Kauf stehen. Warum einem Vermieter Monat für Monat Geld in den Rachen stopfen, wenn man um die gleiche Summe in ein paar Jahren stolzer Immobilienbesitzer sein und möglicherweise durch Wertsteigerungen sogar noch Gewinn machen kann? Es erscheint uns nur logisch, unser kleines Polster an Erspartem in eine Wohnung zu investieren, die wir irgendwann unseren Kindern vererben können.
Doch schon nach ein paar Tagen begreife ich, dass ein Kauf nur schwer möglich ist. Die Preise sind absurd hoch. Immobilien gelten seit der globalen Finanzkrise als eine der wenigen sicheren Anlageformen mit stabilen Renditen. Das – zusammen mit den niedrigen Zinsen – hat die Nachfrage und Preise in die Höhe getrieben. Auch wenn wir es irgendwie schaffen könnten, unsere Traumimmobilie zu finanzieren: Ohne ein größeres Erbe (das derzeit nicht in Aussicht ist) würden wir die nächsten Jahrzehnte hart dafür arbeiten müssen. Ein Jobverlust, der angesichts der Umwälzungen in vielen Branchen gar nicht so abwegig ist, oder eine berufliche Auszeit wären eine finanzielle Katastrophe. Unsere Wohnung wäre nicht unser Zuhause, sondern wir wären der Knecht unseres Heims.
Dann doch lieber Miete. Ich ändere Angaben in der Suchmaske im Internet, und los geht’s. In den nächsten beiden Monaten besichtigen Clemens und ich: eine Altbauwohnung gegenüber unserem Lieblingspark, dem Augarten; eine Altbauwohnung nicht weit vom Grünen Prater; eine Wohnung aus den 1960er-Jahren am Rande des Wienerwalds; ein Häuschen mit kleinem Garten am Wilhelminenberg; eine Dachgeschoßwohnung mit Terrasse beim Augarten; eine Wohnung in einem alten Kloster mit großem, begrüntem Innenhof; eine Altbauwohnung am Karmelitermarkt; eine Genossenschaffswohnung mit zwei kleinen Balkonen; eine Gartenwohnung im Nobelbezirk Döbling. Unterm Strich sind das neun Immobilien – macht neun Mal Termin vereinbaren, neun Mal hinfahren und alles durchüberlegen, sich hineinfühlen: Passt die Lage? Ist die Wohnung groß genug? Ist die Zimmeranzahl okay? Können wir uns die Miete leisten? Was müssten wir renovieren? Was für Leute wohnen im Haus? Kommt Sonne zum Fenster herein? Wie laut hören wir den Verkehr?
All die Objekte, die ich mir nur auf dem Papier und auf Fotos angesehen habe oder die bei der Kontaktaufnahme mit dem Makler schon vergeben waren, sind da noch gar nicht mitgezählt. Die Wohnungssuche gleicht einem Nebenjob – einem ziemlich erfolglosen Nebenjob. Denn immer passt irgendetwas nicht. Nur eine einzige Wohnung hätte uns wirklich gefallen, und die haben wir nicht bekommen: Die Eigentümerin meinte mit Blick auf meinen Babybauch, dass es im Haus sehr ruhig zugehe …
Eigentlich gilt Wien als Eldorado für Mieter*innen, weil der soziale Wohnbau im »Roten Wien« seit hundert Jahren hochgehalten wird. Internationale Delegationen von Wohnbaugesellschaffen, Stadtverwaltungen und Architekten pilgern in Scharen hierher, um das »Wiener Modell« zu studieren. Die Stadt dominiert den Wohnungsmarkt: Rund fünfzig Prozent der Mietobjekte sind geförderte Wohnungen oder Gemeindewohnungen. Die Kommune hat hier – im Gegensatz zu vielen deutschen Metropolen – auf einen Ausverkauf ihrer Wohnungsbestände verzichtet und ist heute mit rund 220000 Wohnungen einer der größten Immobilienbesitzer Europas. Und trotzdem steigen auch hier wegen des Immobilienbooms und des Zuzugs die Preise.





























