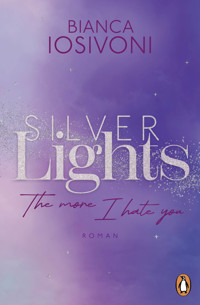
12,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Silver-Lights-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der Auftakt der prickelnden Haters-to-Lovers-Romance auf der kanadischen Insel Golden Bay!
Sie können sich nicht ausstehen. Doch sie können einander auch nicht widerstehen.
Wenn Shae und Beck aufeinandertreffen, knallt es – und das schon seit dem Moment, in dem sie sich das erste Mal begegnet sind. Er hält sie für eine verwöhnte, reiche Prinzessin, sie ihn für einen arroganten, ungehobelten Mistkerl. Und auf einer Insel wie Golden Bay ist es unmöglich, sich aus dem Weg zu gehen. Als Shae dringend einen Fake-Boyfriend braucht, ist ausgerechnet Beck zur Stelle und spielt die Rolle des charmanten Gentlemans perfekt. Schon bald mischt sich etwas anderes unter die allgegenwärtige Abneigung zwischen ihnen: ein gefährliches Knistern, dem sie beide nur schwer widerstehen können und von dem sie sich keinesfalls ablenken lassen dürfen. Denn während Shae alles versucht, um ihre Geschwister zu beschützen, kämpft Beck um das Überleben seines Pubs – und ist bereit, jedes Risiko einzugehen. Auch wenn das bedeutet, Shaes Herz in tausend Teile zu zerbrechen.
Entdecke auch die Canadian-Dreams-Reihe:
Band 1: Golden Bay. How it feels
Band 2: Golden Bay. How it hurts
Band 3: Golden Bay. How it ends
Enthaltene Tropes: Fake Dating, Forced Proximity, Found Family, He Falls First, Haters to Lovers
Spice-Level: 3 von 5
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 567
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Bianca Iosivoni ist eine der beliebtesten und erfolgreichsten New-Adult-Autorinnen Deutschlands. Ihr Roman SORRY. Ich habe es nur für dich getan, ein unwiderstehlicher Mix aus Romantik und Thrill, sprang sofort auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste und hielt sich wochenlang in den Top 10. Auch mit ihren New-Adult- und Romantasy-Bestsellern macht Bianca Iosivoni seit Jahren unzählige Leser*innen süchtig. Ihre Canadian-Dreams-Trilogie wurde zur Nr. 1-SPIEGEL-Bestsellerreihe und sorgte für ausverkaufte Lesungen und endlose Signierschlangen. Mit Silver Lights kehrt die Autorin auf dringenden Wunsch ihrer Fans endlich zurück nach Golden Bay.
Außerdem von Bianca Iosivoni lieferbar:
SORRY. Ich habe es nur für dich getan
Die Canadian-Dreams-Reihe:
Golden Bay. How it feels
Golden Bay. How it hurts
Golden Bay. How it ends
bad vibes. Deine Geheimnisse sterben nie
www.penguin-verlag.de
Bianca Iosivoni
Silver Lights
The more I hate you
Roman
Band 1
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 by Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch
die Langenbuch & Weiß Literaturagentur.
Redaktion: Melike Karamustafa
Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Covermotiv: © Composing aus Motiven von shutterstock.com
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-33360-7V001
www.penguin-verlag.de
Soundtrack
Taylor Swift – The Great War
Torine – bitches get lonely
Diane Warren, G-Eazy, Carlos Santana – She’s Fire
JC Stewart – I Need You To Hate Me
Dove Cameron – Girl Like Me
The Chainsmokers, bludnymph – Self Destruction Mode
Zella Day – Ace of Hearts
Will Post – Wonderlust
Ashley Sienna – What You Need
BLÜEYES – rest in peace
Jon McLaughlin – I Want You Anyway
blurblur – burned
Dean Lewis – Lose My Mind (Acoustic)
Ed Sheeran – Eyes Closed
Omido, Rick Jansen – Toxic
Sam Short – Naked
Rhys – Too Good To Be True
Society of Villains, Sam Tinnesz – Smoke & Trouble
Bea and her Business – Sunburnt Shoulders
Taylor Swift – Clara Bow
Besomorph, Coopex, EthanUno – Born To Die
Sam Nelson Harris, X Ambassadors, Madi Diaz – give me hell
Tokyo Project, LissA – Lies
Taylor Swift – How Did It End?
Lewis Capaldi – Bruises
Abigail Fierce – Some Sorta Goodbye
Calum Scott – You Are The Reason
Liebe Leser*innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.Deshalb findet sich auf dieser Seite eine Triggerwarnung.Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch.Wir wünschen allen das bestmögliche Leseerlebnis.
Bianca Iosivoni und der Penguin Verlag
Für alle,
die sich Shaes & Becks Story gewünscht
und mich jeden Tag daran erinnert haben.
Diese Geschichte ist für euch.
Und für mich,
denn ich hatte immer vor,
sie zu schreiben.
»She wears strength
and darkness equally well,
the girl has always
been half goddess,
half hell.«
– Nikita Gill
Kapitel 1
Shae
Wenn wir ehrlich sind, gibt es nur zwei Arten von Menschen: diejenigen, die klug genug sind, Orte wie diesen zu meiden – und diejenigen, die so lebensmüde sind, hierherzukommen. Wobei es meiner Meinung nach einen klaren Unterschied zwischen lebensmüde und risikofreudig gibt. Ich gehöre eindeutig in die erste Kategorie, auch wenn ich gern so tue, als wäre es die zweite.
Der Sand gibt bei jedem Schritt unter mir nach, während ich an den Warnschildern von Shipwreck Bay vorbei Richtung Ozean marschiere. Kalter Wind zerrt an meiner Kleidung und schneidet mir ins Gesicht. Der Sommer ist vorbei, auch wenn der Herbst noch nicht ganz da ist und die letzten Sonnenstrahlen mein Gesicht wärmen.
Ich bin allein am Strand. Die Einheimischen meiden diese Bucht, und nur wenige Touristen ignorieren die Warnungen und kommen hierher. Wegen den starken Gezeiten, der gefährlichen Sneaker-Wellen, dem eiskalten Wasser und scharfkantigen Riffen vor der Küste ist Schwimmen an diesem Strandabschnitt strengstens verboten.
Aber ich bin auch nicht hergekommen, um zu baden, sondern um Fotos und Videos zu machen. Genau hier, am nördlichsten Punkt von Golden Bay, taucht die untergehende Sonne den bewölkten Himmel und den tiefblauen Ozean in atemberaubendes Licht.
Ich komme den Wellen näher, als ich sollte, befreie meine Kamera aus der Schutzhülle und schalte sie ein.
Der Nordatlantik ist aufgewühlt, wirft schäumende Wellen an den Strand, zieht sich langsam zurück, nur um noch schneller anzugreifen. Die Szenerie erinnert mich an einen der vielen Horrorfilme, die ich früher mit meiner besten Freundin Ember geschaut habe, als wir noch viel zu jung dafür waren und entsprechend davon traumatisiert wurden. Die einzelnen Sonnenstrahlen zwischen den dunklen Wolken sind das sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels.
Für die perfekte Aufnahme bleibe ich stehen, stemme mich mit aller Macht gegen den pfeifenden Wind und versuche, die Hände ruhig zu halten. Ich will alles einfangen: den dramatischen Sonnenuntergang über dem Wasser, die zornige See, den finsteren Himmel, den Sandstrand voller Muscheln und Seetang, die steilen Klippen und schroffen Felsen. Felsen, die vor mir aus dem Wasser ragen, denn Shipwreck Bay trägt seinen Namen nicht ohne Grund. Die Bucht hat eine lange, tragische Geschichte und ist bis heute einer der gefährlichsten Orte der ganzen Insel.
Früher sind hier regelmäßig Schiffe gekentert, bis unsere Vorfahren den Hafen nach Bayville verlegt haben. Bei Ebbe kann man sogar den Mast eines Wracks erkennen; und aus der Secret Cove, der Höhle, die Schmugglern früher als Umschlagplatz gedient haben soll, meint man manchmal die gequälten Schreie der Ertrunkenen zu hören. Eine Warnung an alle vor den tückischen Strömungen.
Wie gesagt: Man muss schon lebensmüde sein, um freiwillig hierherzukommen.
Langsam gehe ich für einen anderen Winkel in die Hocke und halte mir die Kamera vors Auge. Ja, das ist gut. Das Meer kracht im Licht der letzten Sonnenstrahlen so gewaltsam gegen die Klippen, dass sogar mir der Atem stockt, obwohl mir der Anblick vertraut ist. Aber es gibt Dinge, an die gewöhnt man sich nie.
Das Rauschen der Wellen ist derart laut, dass ich die kreischenden Möwen über mir kaum wahrnehme, aber vor allem übertönt es meine eigenen Gedanken. Hier draußen gibt es nur mich, den Atlantik und das Fotografieren.
Aus dem Augenwinkel sehe ich die nächste Welle näher kommen und zähle stumm die Sekunden. Nur noch ein Moment für das perfekte Bild.
Kälte an meinen Füßen. In derselben Sekunde bröckelt der Sand. Reflexartig springe ich auf und renne zurück, weg von den Wellen, die mich in rasender Geschwindigkeit umspülen, mir den Boden unter den Füßen wegreißen, mich mit sich zerren wollen. Dann schaue ich mit hämmerndem Herzen zu, wie sich das Meer schäumend zurückzieht.
Eine Sneaker-Welle. Nicht mal Fischer und Fischerinnen, die ihr ganzes Leben auf dem Ozean verbringen, können sie vorhersehen. Sneaker-Wellen schleichen sich ohne jedes Vorzeichen unbemerkt an. In der einen Sekunde stehst du noch sicher am Strand, in der nächsten packen sie dich, und die Strömung zieht dich unerbittlich ins Wasser.
Die wichtigste Regel habe ich bereits in der Grundschule gelernt: Drehe den Wellen von Shipwreck Bay niemals den Rücken zu. Denn ehe du dich versiehst, bist du Fischfutter.
Halte ich mich daran? Meistens. Wage ich mich trotz der Gefahr wieder näher ans Wasser, um weiter zu fotografieren? Auf jeden Fall.
Angst ist mein ständiger Begleiter geworden. Sie legt sich schwer auf meinen Körper, verankert mich an Ort und Stelle, schärft meinen Fokus und pumpt Adrenalin durch meine Adern.
Mittlerweile sind meine Finger eiskalt. Der Wind zerrt wütend an mir. Trotzdem richte ich die Kamera erneut auf ihr Ziel. Noch ein Bild. Und noch eins. Knips. Knips. Knips.
Verdammt, warum habe ich mein Handystativ nicht mitgenommen? Dann könnte ich neben den Fotos auch noch ein Video drehen. Aber ich habe es bei Mom und Dad liegen gelassen. Um es zu holen, müsste ich ans andere Ende der Insel fahren. Doch selbst wenn die Strecke kürzer wäre: Ich will nicht. Jede Sekunde, die ich außerhalb dieser Villa verbringen kann, ist wertvoll.
Eine weitere Welle baut sich wenige Meter von mir entfernt auf. Höher. Stärker. Gewaltsamer. Sie wird gleich da sein, aber ich brauche …
Plötzlich packt mich jemand von hinten und reißt mich zurück.
Ich stolpere, strauchle, bin zu überrascht, um zu reagieren. Dann ramme ich meinen Ellbogen nach hinten, und der Arm um meine Mitte lässt locker.
Ich wirble herum und stoße die Person mit beiden Händen zurück. »Was zur Hölle?! Was soll das?«
»Das sollte ich dich fragen, Prinzessin.« Niemand Geringeres als Kilian Beck steht vor mir und überragt mich deutlich. Zugezogener, Barkeeper im besten Pub der Stadt und das größte Arschloch von ganz Golden Bay.
Im Licht der untergehenden Sonne wirkt seine Miene noch finsterer als sonst. Dazu das schwarze Haar, die stechend graublauen Augen, breiten Schultern und volltätowierten Arme – sein Markenzeichen. Er trägt Jeans, die schon bessere Tage gesehen haben, dazu Shirt und Motorradjacke, und starrt mich wütend an. Ganz so, als würde ihn mein verwaschener Prinzessin-Mononoke-Hoodie mit den Kirschblüten darauf persönlich beleidigen.
»Hast du sie noch alle?«, fährt er mich an und verschränkt die muskulösen Arme vor der Brust. »So nahe ans Wasser zu gehen, dass die Wellen dich erwischen könnten?!«
Mein Blick zuckt zu der Stelle, an der ich gerade stand. Das Meer zieht sich schäumend zurück. Adrenalin pumpt durch meine Adern. Und Angst. Ich habe gelernt, sie zu akzeptieren, sie als etwas Gutes und Hilfreiches anzunehmen. Im Gegensatz zu dem, was Beck denkt, bin ich mir der Gefahren überdeutlich bewusst und setze mich ihnen aktiv aus.
»Ich weiß sehr genau, was ich tue. Vielen Dank auch.« Kurz überprüfe ich meine Kamera. Sie hat nur ein paar Spritzer abbekommen. Zum Glück. Doch das verdanke ich sicher nicht Beck.
»Ach ja? Du weißt also, was du tust?« Mit ausgestrecktem Arm deutet er Richtung Klippe. »Das sah von dort aber ganz anders aus.«
Widerwillig folge ich seinem Blick. Sein schwarzes Motorrad mit den leuchtend gelben Akzenten steht am obersten Punkt der schroff abfallenden Felsen. Dahinter eine Ansammlung von Bäumen mit roten, orangefarbenen und vereinzelten grünen Blättern. Beck muss mich im Vorbeifahren gesehen und angehalten haben, dann ist er den Pfad runtergerannt, um … was genau zu tun? Den Helden zu spielen? Mich wieder mal anzuschreien? Dieser Kerl braucht dringend ein neues Hobby.
Frustriert breite ich die Arme aus. »Dann schau nicht hin! Problem gelöst. Win-win für alle.«
»Mir bleibt gar nichts anderes übrig, als hinzuschauen und einzugreifen, wenn du dich ständig selbst in Gefahr bringst. Hast du Todessehnsucht, oder was?«
Er hat nicht die geringste Ahnung. Vor langer Zeit habe ich die gewaltsamen Wellen von Shipwreck Bay schon mal überlebt, als mein Bruder und ich bei einer Mutprobe hier schwimmen gegangen sind. Glücklicherweise konnten wir uns beide an den Strand retten. All die Jahre danach habe ich tiefe Gewässer gemieden, weil ich nicht gut schwimmen kann. Bis ich damit begonnen habe, die Gefahr bewusst zu suchen und mich selbst herauszufordern.
Heute bin ich ganz allein. Niemand würde mich retten kommen, sollten die Wellen mich verschlucken. Doch das steigert den Nervenkitzel nur noch.
Entschieden wende ich mich halb ab und stattdessen dem Meer zu. Lass die Wellen niemals aus den Augen …
»Selbst wenn es so wäre«, kontere ich scharf. »Was interessiert es dich?«
Ist schließlich nicht so, als wären wir Best Buddys, nur weil wir einen gemeinsamen Freundeskreis haben. Jeder aus unserer Clique weiß, dass ich diesen Kerl nicht ausstehen kann – was auf Gegenseitigkeit beruht. Beck und ich konnten uns vom ersten Moment unseres Kennenlernens vor ein paar Monaten an nicht leiden. Dass er im Pub den Obermacker gespielt und nach meinem Ausweis gefragt hat, als wäre ich eine vierzehnjährige Schülerin, hat es nicht besser gemacht. Im Gegenteil.
»Mich interessiert es nicht, wenn dir etwas zustößt, aber andere Leute sehr wohl.«
»Ohhh, Kilian Beck, der selbstlose Held und Retter.« Ich kann mein Lachen nicht unterdrücken. »Ernsthaft? Das ist dein Argument? Und das ausgerechnet von Mister Adrenalinjunkie höchstpersönlich.«
Er kneift die Augen zusammen.
»Will und Zion haben mir davon erzählt«, beantworte ich seine unausgesprochene Frage. »Nach dem Schulabschluss warst du auf Reisen, nicht wahr? Hast den krassesten Shit gemacht, Bungee-Jumping, Skydiving und was weiß ich noch alles. Und jetzt stehst du hier und wirfst mir allen Ernstes vor, unvorsichtig zu sein und mein Leben zu riskieren? Nur weil ich ein paar Fotos mache?«
»Das kann man nicht vergleichen«, knurrt er mühsam beherrscht.
»Ach nein?«
»Nein.« Beck starrt mich nieder, als würde er mich allein mit seinem Blick auslöschen wollen. Das haben schon andere vor ihm versucht – erfolglos. »Ich bin ein kalkuliertes Risiko mit allen erdenklichen Sicherheitsmaßnahmen eingegangen. Was du tust, ist einfach nur hirnverbrannt und rücksichtslos.«
»Hirnverbrannt und rücksichtslos?!«, wiederhole ich ungläubig und deute aufs Meer. »Was zum Teufel ist daran bitte rücksichtslos?«
Ich habe nur ein paar Fotos geschossen. Ich bin nicht mal dazu gekommen, ein Video zu drehen, weil er mir unbedingt dazwischenfunken musste.
»Du scherst dich einen Dreck um die Menschen, die dich lieben und denen du wichtig bist. Anscheinend haben sie dir in diesem Eliteinternat in der Schweiz weder Verstand noch Empathie eingebläut. Hast du auch nur eine Sekunde lang darüber nachgedacht, wie es ihnen gehen würde, wenn dir bei deinen Eskapaden etwas zustößt?«
»Bei meinen Eskapaden?!« Ich bin so wütend, dass ich gar nicht weiß, was ich Beck zuerst an den Kopf werfen soll. Abgesehen von meiner Kamera vielleicht, doch die ist zu wertvoll, um Bekanntschaft mit seinem Dickschädel zu machen. »Für wen hältst du dich eigentlich?«
»Für jemanden, der dich gerade vor einer Monsterwelle retten musste, Prinzessin.«
»Du hättest mich nicht wegziehen müssen, weil ich alles im Griff hatte!«
»Ja, klar. Wäre es dir lieber gewesen, ich hätte dich aus dem Wasser zerren und wiederbeleben müssen? Die Seenotrettung alarmieren? Wärst du lieber im Krankenhaus aufgewacht oder gar nicht mehr, weil du in einem verdammten Sarg liegst?«
Was zur Hölle fällt ihm eigentlich ein?
»Ich sag es noch mal ganz langsam, damit es in der einsamen Zelle, die dein Gehirn darstellt, auch ankommt: Ich. Hatte. Alles. Im. Griff. Ich bin auf dieser Insel aufgewachsen – und habe deutlich länger als du hier gewohnt. Ich kenne die Gegend und weiß, was ich tue, also spar dir das verdammte Mansplaining und die Fake-Besorgnis!«
Was zum Teufel ist eigentlich sein Problem? Hat dieser Mann nichts Besseres zu tun, als mir ständig auf den Geist zu gehen und sich als Held aufzuspielen?
Entgegen der allgemeinen Meinung besitze ich durchaus ein paar Hirnzellen, kann eine Gefahr als solche erkennen, richtig einschätzen und mich im Notfall in Sicherheit bringen. Und das hätte ich auch getan, ganz ohne Becks Hilfe. Aber nein, er musste ja unbedingt eingreifen, und jetzt ist das Licht nicht mehr das gleiche, weil die Sonne fast vollständig hinter dem Horizont verschwunden ist. Ganz toll. Selbst wenn ich morgen Abend wieder herkomme – Licht, Wolken und Ozean werden nicht dieselben sein wie heute. Jedes Bild ist einmalig.
Aber ich erwarte natürlich nicht, dass ein ungehobelter Mistkerl wie Kilian Beck das versteht.
Er holt schon Luft, um zu kontern, aber ich bin noch lange nicht fertig.
»Ich habe nicht um deine Hilfe gebeten, Mister Ich-muss-mich-unbedingt-einmischen, und ich brauche auch keinen Retter, also hör verfickt noch mal auf, dich als einer aufzuspielen! Abgesehen von unseren gemeinsamen Freunden und Freundinnen, die dich aus irgendeinem mir völlig unverständlichen Grund mögen, haben du und ich nicht das Geringste gemeinsam oder miteinander zu tun, verstanden? Und daran wird sich auch nie etwas ändern. Wenn du mich also das nächste Mal während deiner Spazierfahrt siehst, fahr einfach vorbei und lass mich tun, was immer ich will. Denn es geht dich einen Scheißdreck an!«
»Schön, wie du willst.« Abwehrend hebt er die Hände und tritt einen Schritt zurück. »Dann bring dich doch in Lebensgefahr. Ich werde nicht derjenige sein, der dir hilft.«
»Gut!«
»Gut.«
Das dröhnende Rauschen ist die erste Warnung. Eine Sekunde später umspült uns eine gewaltsame Welle und reißt uns den Sand unter den Füßen weg.
Fuck!
Wir springen gleichzeitig zurück und rennen landeinwärts. Kälte und Feuchtigkeit durchdringen den Stoff meiner Jeans. Meine Stiefel sind wasserfest, meine Hose ist es nicht. Und erst recht nicht meine Kamera.
Ich sehe von der Welle, die wieder im Meer verschwindet, zu Beck und dann an mir hinunter. »Toll! Danke für nichts, du Schwachkopf!«
Denn ohne diese sinnlose Diskussion wäre das niemals passiert.
Ohne ein weiteres Wort lasse ich ihn stehen und stapfe den Pfad hinauf zu meinem Auto. Es ist nur eine alte Klapperkiste, die gar nicht mehr fahren sollte, aber sie gehört mir. Inklusive sämtlicher rostiger Stellen, tropfender Klimaanlage und kaputter Heizung. Aber vor allem genieße ich es, dabei zuzuschauen, wie die Ader in der Stirn meiner Mutter jedes Mal zu pulsieren beginnt, wenn sie diesen Schrotthaufen sieht. Ihre Worte, nicht meine. Allein dafür hat sich die Anschaffung gelohnt.
Fast rechne ich damit, dass Beck mir nachläuft, um mich über die Defizite meines Wagens und korrektes Fahrverhalten aufzuklären, aber nichts dergleichen passiert. Besser ist das.
Nicht in einer Million Jahre würde ich freiwillig mehr Zeit als unbedingt nötig mit diesem Mistkerl verbringen. Und zum Glück muss ich das auch nicht – der einzige Lichtblick an diesem beschissenen Abend. Das und die Tatsache, dass ich ihn Beck genauso versaut habe wie er ihn mir.
Ich sollte es nicht tun, trotzdem werfe ich, am höchsten Punkt der Klippe angekommen, einen kurzen Blick zurück.
Beck starrt mir finster nach. Wahrscheinlich wünscht er sich, mir niemals begegnet zu sein.
Schnaubend wende ich mich ab. Gleichfalls, Arschloch.
Kapitel 2
Shae
Ich liebe den Herbst. Ich liebe die warmen Sonnenstrahlen, die alles in goldenes Licht tauchen. Ich liebe den Nebel und den Regen, die bunten Blätter, den Grusel rund um Halloween und alles andere, was dazugehört. Ich liebe den Herbst. Wirklich. Und auch der Sommer, den ich zusammen mit meiner besten Freundin Ember hier verbracht habe, war wunderschön.
Aber wenn ich noch mehr Small Talk über das Wetter oder den köstlichen Brunch ertragen muss, den meine Eltern veranstalten, springe ich von der nächsten Klippe. Praktischerweise befindet die sich nur wenige Meter entfernt und scheint förmlich darauf zu warten, dass sich jemand in die Tiefe stürzt. Die Alternative ist, dass ich mein Champagnerglas zertrümmere und jemanden damit ermorde. Aktuell stehen die Chancen fifty-fifty.
»Das Wetter ist heute so angenehm, nicht wahr, Liebes?« Eine ältere Frau, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, stellt sich neben mich. Sie trägt ein teures Paillettenkleid und prostet mir zu, ehe sie ihr Glas in einem Zug leert.
Ich umklammere mein eigenes fester. »Wundervoll«, bringe ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor und setze mein bestes Nette-Tochter-Lächeln auf. »Auf einmal wieder ungewöhnlich warm, vor allem dafür, dass es Ende September ist. Finden Sie nicht?«
Die Floskeln gehen mir viel zu leicht über die Lippen. Ich will mich schütteln, reiße mich jedoch mit größter Mühe zusammen. Wie schon den ganzen Tag, ach was, die ganzen vier Monate seit meiner Rückkehr nach Golden Bay.
An diesem Sonntagnachmittag stehen wir im Garten hinter dem Haus, nein, korrigiere, hinter der Villa meiner Eltern am südlichsten Punkt der Insel. Der Rasen ist bis auf den Millimeter getrimmt, die Dekoration perfekt. Die weißen Tischdecken flattern leicht in der Brise, die vom Meer her weht. Nur meine Eltern bringen es zustande, von einem lockeren Brunch zu reden, wenn es Platzkärtchen und einen strikten Dresscode gibt.
Und irgendwie haben sie es auch noch hinbekommen, dass ihre Party bei traumhaftem Wetter stattfindet. Wenn das kein Beweis für einen Pakt mit dem Teufel ist, dann weiß ich auch nicht.
Normalerweise lassen mit dem Ende des Sommers die Ströme an Touristen nach, die die Insel regelmäßig besuchen. Aber mein Vater hat dafür gesorgt, dass ein Haufen reicher Leute extra vom Festland angereist ist, um ihn in seinem Wahlkampf zu unterstützen. Deswegen die vielen Partys und Veranstaltungen. Es ist ein Zirkus, bei dem meine Eltern die Hauptattraktion sind und alle anderen das begeistert klatschende Publikum.
Die Dame, an deren Namen ich mich noch immer nicht erinnere, nickt sichtlich zufrieden mit meiner Antwort und lässt sich von einem Kellner in Uniform ein neues Glas bringen. »Die Rede, die dein Vater gehalten hat, darüber, wie wichtig es ist, an Werten und Traditionen festzuhalten …« Sichtlich ergriffen fasst sie sich an die Brust. »Meine Stimme hat er sicher. Wir brauchen jemanden wie ihn im Unterhaus der kanadischen Regierung. Jemand Konservativen, der gegen diese Plage an neumodischen Erscheinungen hart durchgreift.«
Ich beiße die Zähne fester zusammen.
»Er und natürlich auch deine Mutter haben sich heute wie immer selbst übertroffen.«
»Ja, so sind sie.« Ich trinke einen großen Schluck, um meine Grimasse zu verbergen. Gleichzeitig muss ich den Drang unterdrücken, das ganze Glas hinunterzustürzen, nur um dieses Event erträglicher zu machen. Dabei wäre so ziemlich alles erträglicher als das hier. Über glühende Kohlen zu laufen oder trotz Höhenangst auf dem Dach eines fünfzigstöckigen Gebäudes zu balancieren, zum Beispiel.
Es ist nur eine von vielen, vielen Veranstaltungen, die meine Familie dieses Jahr gibt, um die Gunst der Wählenden zu gewinnen. Premierminister von Golden Bay zu sein, reicht meinem Erzeuger nicht mehr. Er will ins Unterhaus gewählt werden und dem Parlament angehören. Und sobald er das geschafft hat, wird Premierminister von ganz Kanada sein nächstes Ziel sein, da bin ich mir sicher. Das hat er bisher zwar nicht ausgesprochen, aber ich kenne diesen Mann schon mein ganzes Leben. Er macht keine halben Sachen. Wenn er sich ein Ziel gesetzt hat, verfolgt er das bis zum bitteren Ende. Und ohne Rücksicht auf Verluste.
Selbst wenn das bedeutet, zwei von seinen drei Kindern aus dem Haus zu jagen, weil sie seinem ach so perfekten Ruf schaden könnten. Bisher wurde das natürlich geheim gehalten, aber mittlerweile glaube ich, diese Aktion würde ihm nur noch mehr Stimmen einbringen. Wünscht sich nicht jeder einen starken Mann an der Macht, der hart durchgreift und alles wieder in Ordnung bringt?
Entschuldigt mich kurz, während ich mal eben kotze.
Natürlich ist meine Mutter ihrem Ehemann treu ergeben und unterstützt ihn in jeder Hinsicht. Wenigstens ist der ganze Wahlkampf-Spuk in vier Wochen wieder vorbei. Wenige Tage vor Halloween. Wie passend – vor allem für den Fall, dass Dad gewinnen sollte.
»Mit Leuten wie deinem Vater wäre unsere Welt in keinem so schrecklich verwahrlosten Zustand«, fährt die Frau unbeirrt fort und schnippt nach dem Kellner für noch mehr Champagner.
Stratford! Verdammt, jetzt ist mir ihr Name doch noch eingefallen.
»Weißt du, in deinem Alter war ich längst verheiratet. Ich hatte bereits meine Pflicht erfüllt und meinem Mann die ersten Kinder geschenkt, wie es sich gehört.«
Ja, und wahrscheinlich trinkst du deshalb auch schon das dritte Glas Champagner innerhalb weniger Minuten …
Ich hole bereits Luft, um genau das zu sagen, aber der vernünftige Part in mir hält mich in letzter Sekunde zurück. Sei nicht gemein, Shae. Du weißt nichts über ihr Leben, nur das, was du gerade siehst. Wir urteilen nicht über andere.
Aber … verdammt! Sie verurteilt mich doch genauso!
»Die Jugend von heute …« Sichtlich enttäuscht schüttelt Mrs Stratford den Kopf. »Wenigstens sind du und deine Schwester auf dem richtigen Weg.«
Nicht, wenn ich es verhindern kann.
»Da fällt mir ein: Ich habe deinen Partner noch gar nicht gesehen«, fährt sie fort – und ich erstarre. »Deine Mutter hat allen erzählt, er wäre heute hier.«
Ich bringe sie um. Ich schwöre, ich werde meine Mutter umbringen.
»Oh, er musste leider kurzfristig absagen«, lüge ich mit einem falschen Lächeln, das ich von der Besten gelernt habe. »Aber ich soll herzliche Grüße ausrichten.«
»Ein Jammer.« Mrs Stratford fasst sich an ihre Perlenkette, die erschreckende Ähnlichkeit mit meinem Armband hat. Ein Armband, das ich nicht freiwillig trage. »Ich hätte den mysteriösen Monsieur, der es geschafft hat, dich endlich zur Vernunft zu bringen, gerne kennengelernt. Er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, nicht wahr?«
»Mhm«, mache ich und versuche mich fieberhaft an die Details zu erinnern, die ich meiner Familie den Sommer über erzählt habe, damit sie mich mit dem Partnerschafts-Thema in Ruhe lassen.
Ich gestehe: Ich bin eine Lügnerin. Und damit meine ich nicht die typischen höflichen Floskeln, mit denen man einen hässlichen Haarschnitt kommentiert, sondern gravierende, allumfassende Lügen, die mein ganzes Leben betreffen. Seit ich zurück auf Golden Bay bin, habe ich fast nichts anderes getan, als zu lügen. Und das Einzige, was ich jetzt zutiefst bereue, ist, mir nicht jede einzelne dieser Unwahrheiten aufgeschrieben zu haben.
Andererseits, wie schlimm kann es schon sein? Ich habe meinen angeblichen Freund bestimmt als sportlich beschrieben. Nett anzusehen. Intelligent. Humorvoll. Anständig. Die Basics eben. Nichts Außergewöhnliches.
»Stimmt es, dass er ein Selfmade-Millionär ist?«
Ich verschlucke mich an meinem Drink und versuche, mein Husten zu verbergen. Scheiße, habe ich das wirklich behauptet?
»Und so selbstlos«, fährt sie vollkommen unbeeindruckt fort, obwohl ich beinahe neben ihr ersticke. »Deiner Mutter zufolge hat er mehrere Millionen Dollar für den Aufbau eines Schutzhofs für kranke und alternde Tiere gespendet.«
Ohh, ich komme so was von in die Hölle …
»Entschuldigen Sie mich bitte«, würge ich hervor, stelle mein leeres Glas auf dem nächstbesten Tisch ab und ergreife möglichst unauffällig die Flucht.
Was, bei den Anime-Göttern, habe ich mir nur dabei gedacht? Und was hat sich Mom dabei gedacht, alles weiterzuplappern?
Als mein Blick auf meine Mutter fällt, bleibe ich stehen. Sie ist in ein Gespräch mit mehreren Leuten vertieft. Das Haar, das die gleiche schokoladenbraune Farbe hat wie meins, ist kunstvoll hochgesteckt, das Make-up dezent. Für den »ungezwungenen« Brunch hat sie sich in ein elfenbeinfarbenes Kleid von einem ihrer Lieblingsdesigner geworfen, das mit Sicherheit mehr gekostet hat als andere Menschen eine ganze Monatsmiete. Oder drei. Louis Vuitton, Chanel, Prada, was weiß ich schon.
Ich will mich gerade unauffällig davonmachen, bevor sie mich bemerkt, als …
»Shaelynn!«
Argh. Ich hasse es, wenn sie meinen vollen Namen verwendet. Schlimmer ist nur, wenn sie alle Namen benutzt.
Widerwillig drehe ich mich um und setze ein Lächeln auf, das so fake ist, dass es mir niemand abkaufen würde. Niemand außer meinen Eltern.
»Komm.« Sie winkt mich zu sich wie einen Hund. »Komm her.«
Der einzige Grund, aus dem ich dieses lächerliche Event nicht einfach verlasse, steht direkt neben ihr. Etwas kleiner als wir beide, zierlich, mit der gleichen helleren Haarfarbe unseres Vaters und den gleichen grünen Augen wie Mom und ich. Während ich eine erschreckende Kopie unserer Mutter bin, stellt meine kleine Schwester Serafina die perfekte Mischung aus unseren beiden Elternteilen dar.
Wie Mom trägt sie ein Designerkleid, das allerdings eher gelblich ist. Ich bin die Einzige, die in Dunkelgrün heraussticht, und das auch nur, weil ich mich geweigert habe, mir von Mom etwas aussuchen zu lassen. Schlimm genug, dass sie mir dieses hässliche Perlenarmband aufgezwungen hat, obwohl ich viel lieber meine normalen bunten, absolut nicht zusammenpassenden Armbänder tragen würde.
Sera scheint sich in dem Outfit und den hohen Pumps jedoch wohlzufühlen. Als ich sie das letzte Mal vor meiner Rückkehr nach Golden Bay gesehen habe und umarmen konnte, war sie neun Jahre alt. Wie kann sie jetzt schon sechzehn sein? Ich kenne das aufgeweckte, neugierige Mädchen von früher, aber über den Teenager von heute weiß ich noch immer viel zu wenig.
Kurz vor ihrem sechzehnten Geburtstag bin ich nach Jahren fernab von dieser Insel zurückgekommen, weil ich genau weiß, was meine Eltern für sie planen. Und sie haben schon damit angefangen. Das ist der einzige Grund, aus dem ich hier bin. Für meine Familie. Oder das, was davon noch zu retten ist.
»Was gibt’s?«, frage ich, als ich zu ihnen gehe, und wappne mich innerlich. Weiß der Teufel, was Mom sich jetzt schon wieder überlegt hat.
»Wie schön, dass du dich uns anschließt.« Jeder hört ihre herzlichen Worte. Niemand außer mir bemerkt die Ironie und das Gift darin. »Da dein Freund leider schon wieder nicht herkommen konnte, möchte ich dir jemanden vorstellen. Euch beiden«, fügt Mom hinzu, nickt der Gruppe, bei der sie bis eben stand, zum Abschied höflich zu und führt uns zu einem Mann im Anzug ein paar Meter weiter. »Das ist Mr Van Der Vol. Ihm gehören einige Banken, und er ist ein glühender Unterstützer eures Vaters.«
Ich mustere ihn von oben bis unten. Um die fünfzig. Zu volles Haar für sein Alter. Zu glatte Haut. Der Anzug ist maßgeschneidert und kaschiert seinen Bauchansatz. Dezentes Auftreten, doch dafür brüllen einem der goldene Siegelring und die ebenfalls goldene Armbanduhr praktisch ins Gesicht. Ebenso wie der fehlende Ehering.
Meine Schwester wirft mir einen vielsagenden Blick zu, bevor sie ihm brav die Hand schüttelt, aber ich kann nicht einschätzen, ob sie sich genauso unwohl fühlt wie ich oder nicht. Sie passt viel besser hierher, zu diesen Leuten, als ich es jemals getan habe – und das macht mir Sorgen.
Ich sehe viel zu viel von unserer Mutter in Sera, aber in ihr schlummert noch immer das Kind von früher. Ich will es herauskitzeln, will sie dazu bringen, all das hier, die Villa, die Partys, das Geld, nicht als selbstverständlich zu betrachten, sondern zu hinterfragen. Irgendjemand muss diesem Mädchen kritisches Denken beibringen, und das werden ganz sicher nicht unser Politikervater und seine Trophy Wife sein.
Ein Grund mehr, warum ich sie davor schützen muss, bevor es zu spät ist. Bevor sie genauso wird wie unsere Mutter. Bevor sie eine von ihnen wird und es kein Zurück mehr gibt.
Ich zwinge meine Mundwinkel nach oben, auch wenn mir mittlerweile die Gesichtsmuskeln vom vielen Lächeln wehtun, und gebe dem Mann ebenfalls die Hand. Sein Händedruck ist kurz und schlaff. Er nickt uns beiden zu und wendet sich dann wieder an unsere Mutter.
Während sich die beiden unterhalten, stelle ich mich neben meine kleine Schwester, da wir offensichtlich kein Teil dieses Gesprächs sind, sosehr Mom das auch zu erzwingen versucht.
»Wollen wir von hier verschwinden?«, flüstere ich Serafina verschwörerisch zu.
Sie sieht sich unsicher um. »Ich denke nicht, dass …«
»Nur für ein paar Minuten«, beharre ich. »Eine kleine Atempause.«
Es ist eine der wenigen Gelegenheiten, meine Schwester dem Einfluss unserer Eltern zu entziehen, und sei der Moment auch noch so kurz. Da ich nicht mehr bei ihnen wohne, schaffen Mom und Dad es, Sera vor mir abzuschirmen und unseren Kontakt so gering wie möglich zu halten. Bei Veranstaltungen wie diesen haben sie gar keine andere Wahl, als mich ebenfalls einzuladen, denn ich habe meine Rückkehr nach Golden Bay sehr deutlich gemacht. Es gibt niemanden, der nicht weiß, dass ich wieder da bin. Und im Gegensatz zu allen anderen hier weiß ich von mehr als einem kleinen schmutzigen Geheimnis meiner Familie und bin mir nicht zu schade, es falls nötig als Druckmittel gegen sie einzusetzen.
Sera zögert, schaut zu Mom und Mr Van Der Vol und nickt kaum merklich.
Yessss!
Sobald ich sicher bin, dass uns niemand allzu viel Beachtung schenkt, hake ich mich bei Sera unter und ziehe sie Richtung Haus.
»Dir ist schon klar, dass Mom dir potenzielle Heiratskandidaten vorstellt, die locker dreißig Jahre älter sind als du?«
Denn das ist in ihren Augen der einzige Nutzen ihrer Töchter. Ein Sohn hätte alles erben können, aber den haben sie ja rausgeworfen. Bleibt nur noch, die beiden Mädchen möglichst gewinnbringend zu verschachern. Jepp, so konservativ und traditionell sind meine Eltern. Willkommen im achtzehnten Jahrhundert.
»Ach, das meint sie doch gar nicht so.« Sera winkt mit der freien Hand ab. »Solche Leute sind wichtige Geschäftskontakte für Dad, deshalb sind sie hier. Es ist unsere Aufgabe, freundlich zu ihnen zu sein und sie willkommen zu heißen.«
Diesmal kann ich ein Schaudern nicht unterdrücken. Das kann sie nicht ernsthaft glauben, oder?
»Es ist okay, nicht alles gut zu finden, was Mom und Dad tun. Das weißt du, oder?«
Sie senkt den Blick und nickt, aber ob sie mir tatsächlich zustimmt, kann ich nicht einschätzen. Mist. So komme ich nicht weiter. Ich muss es auf andere Art versuchen.
»Hey, wir könnten doch aufs Dach gehen!«, schlage ich vor, als wir die Eingangshalle betreten, und weiche in letzter Sekunde einer vorbeieilenden Kellnerin aus. »Das haben wir früher immer gemacht.«
Früher ist mehr als sechs Jahre her, und wir sind keine Kinder mehr. Andererseits war ich genauso alt wie Sera heute, als Mom und Dad mich von Golden Bay verbannt haben.
Sera zögert und bleibt stehen. »Da war ich schon ewig nicht mehr. Es ist zu gefährlich. Und wenn Mom uns erwischt …«
»Wird sie nicht«, behaupte ich. Und falls doch, werde ich die Schuld auf mich nehmen. Niemand wird daran zweifeln, schließlich bin ich hier der offizielle Troublemaker.
Es hat eine Zeit gegeben, in der ich genauso war wie Sera heute. Die brave Tochter mit vorbildlichen Manieren und Bestnoten in der Schule. Doch dann …
Nein.
Ich vertreibe die Erinnerung, bevor sie richtig Gestalt annehmen kann.
»Dann lass uns …«
»Ich glaube, das war keine gute Idee«, unterbricht mich Sera und wirft einen Blick über die Schulter in den Garten. Dann schenkt sie mir ein warmes Lächeln. »Aber nimm du dir ruhig die Pause, die du brauchst. Du findest mich draußen.«
Sie ist fort, bevor ich etwas erwidern kann. Bevor ich ihr erklären kann, dass ich diese Pause nicht bloß für mich, sondern auch für sie will. Und ich … ich bleibe allein zurück.
Zumindest so allein man im Eingangsbereich einer Villa sein kann, wenn ständig Leute um einen herumschwirren. Nur dass es sich bei ihnen nicht um die gut betuchten Gäste meiner Eltern handelt, die fleißig für Dads Wahlkampf spenden sollen, sondern um das Personal. Wie ein perfekt aufeinander abgestimmtes Uhrwerk sorgen sie dafür, dass alles nach Plan läuft. Etwas anderes würde meine Mutter auch nicht tolerieren.
In diesem Moment ertönt ein ohrenbetäubendes Scheppern aus der Küche, und ich verziehe das Gesicht. So viel zum perfekt abgestimmten Uhrwerk.
Obwohl man mir von klein auf beigebracht hat, dass ich dort nichts verloren habe, steuere ich die Küche an, die mit dem Lieferanteneingang hinter dem Haus verbunden ist. Ja, meine Familie hat einen eigenen Eingang für die Angestellten und Lieferungen. Reden wir nicht darüber, wie abgehoben und abgefuckt das ist.
Doch noch bevor ich einen Fuß in die Küche setzen kann, ertönt plötzlich eine tiefe, viel zu vertraute Stimme.
»Wohin sollen die Kisten?«
Kapitel 3
Beck
Ich verabscheue Alkohol. Ironisch, da ich einen Pub führe, ich weiß. Aber mein alter Herr war ständig besoffen, und ich habe mir geschworen, nie so zu werden wie er. Wenn ich also etwas trinke, dann nur selten. Und wenig. Trotzdem wäre mir eine riesige Gruppe Sturzbetrunkener an diesem Nachmittag lieber als ein praktisch leerer Pub.
Seufzend wische ich über die Arbeitsfläche hinter der Bar und lasse den Blick wandern. Nur zwei Tische sind besetzt, beide vor den Fenstern des alten Sandsteingebäudes. Der Kamin ist noch aus, also sind die Sessel davor leer. Ein einzelner Fischer sitzt auf einem Hocker an der Bar und klammert sich an sein erstes und vermutlich einziges Bier, wenn er später noch rausfahren will.
Den Sommer über hatten wir praktisch jeden Tag volles Haus. Aber seit es kühler geworden ist und die vielen Touristen und Reisegruppen abgereist sind, zeigt sich das erschreckend deutlich in der Kasse.
Die Tür geht auf, und Will spaziert herein. »Hallo, Boss.«
Selbst nach Jahren in Kanada wirkt er noch immer wie der typische Surferboy aus Kalifornien, wo er ursprünglich herkommt: blond, von der Sonne gebräunt, sportlich und immer gut drauf.
Ich schnaube. »Du weißt genau, dass ich nicht der Boss bin.«
Lässig zuckt Will mit den Schultern. »Solange der Besitzer über alle Berge ist und du der Einzige bist, der diesen Laden zusammenhält, bist du für mich der Boss.« Er salutiert scherzhaft, dann geht er am Tresen vorbei nach hinten, um sich für die Arbeit umzuziehen.
Turner’s Tavern ist eines der ältesten Gebäude in Bayville. Der Pub existiert schon seit über fünfzig Jahren, eröffnet von einem älteren schottischen Ehepaar, das sich damals in Golden Bay niedergelassen hat. Da die beiden keine Kinder hatten und es keine Verwandten gab, die den Pub hätten übernehmen wollen, wurde er verkauft. Mehrfach, bis Charlie das Lokal in die Hände bekam. Mein Chef, der schon immer viel unterwegs war und von dem ich seit mehr als einem halben Jahr gar nichts mehr gehört habe, weil sich der Mistkerl nach Südamerika abgesetzt hat und seither tot stellt.
Im Grunde hat Will mit seinem »Boss«-Gehabe also recht, denn seitdem habe ich nichts anderes getan, als zu versuchen, das Lokal am Leben zu erhalten.
Und diesen Herbst ist es besonders hart, denn das Feriengeschäft hat nicht genug in die Kassen gespült, um uns die nächsten Monate über Wasser zu halten. Nicht, wenn der Pub an einigen Stellen Renovierungen nötig hat. Eine Backsteinwand bröckelt an mehreren Stellen, der Kamin raucht manchmal zu stark und muss dringend überprüft werden, und die Tapeten in den hinteren Räumen haben mehr Risse, als ich mir eingestehen will.
Will kehrt aus dem Pausenraum zurück und klatscht sich zur Begrüßung mit Annie ab. Den Sommer über ist er nur Teilzeit angestellt, weil er noch einen Job als Rettungsschwimmer hat. Aber sobald es zu kalt zum Baden wird, arbeitet er fast jeden Tag hier. Genau wie Annie, die schon im Turner’s gekellnert hat, als ich meinen Schulabschluss in Bayville gemacht habe. Beide brauchen diesen Job dringend. Genau wie ich. Genau wie Heather und Jamal hinter der Bar oder Courtney und Bakir in der Küche.
Verflucht.
Ich werfe mir das Küchentuch über die Schulter und versuche, nicht an die roten Zahlen zu denken, die mir Tag für Tag entgegenstarren, wenn ich mich um die Buchhaltung kümmere. Der Pub hat zu viele Angestellte dafür, dass er so schlecht läuft.
Zum Glück bewahrt mich ein Vibrieren davor, mit meinen Gedanken wie schon so häufig in eine Abwärtsspirale zu geraten.
Ich ziehe das Handy aus meiner Hosentasche und gehe nach einem kurzen Blick aufs Display ran. »Hey, Zion, was gibt’s?«
Soweit ich weiß, müsste er gerade in der Küche des Restaurants stehen, in dem er seine Ausbildung gemacht hat und bis heute arbeitet. Oder hat er frei? Aber warum kommt er dann nicht einfach vorbei?
»Hey, Bro«, begrüßt er mich. Allein diese zwei Worte klingen gestresst. »Wir haben ein klitzekleines Problem, und ich habe gehofft, dass du uns spontan helfen kannst.«
»Was ist passiert? Gab es einen Unfall in der Küche?«
Das Turner’s hat zwar eine eigene Küche, aber die ist winzig. Gerade mal groß genug für Pub-Food wie Burger, Poutine, Fish & Chips und Ähnliches. Nicht zu vergleichen mit dem teuren Restaurant, in dem Zion kocht. Und sicher kein Ersatz dafür, falls sie die eigene geflutet oder abgebrannt haben.
»Nein, zum Glück nicht. Wir haben einen Catering-Auftrag für einen großen Brunch, aber es gibt Probleme mit der Getränkelieferung. Unser Händler hat uns hängen lassen, es fehlen ein paar Kisten.«
»Und jetzt soll ich …?«
»Bezahlt natürlich«, fällt er mir ins Wort. »Es ist eine Sache von fünf Minuten. Zehn maximal. Du musst nur die Getränke aus eurem Lager zur Feier bringen. Die Liste kann ich dir sofort schicken. Ich bin mir sicher, dass ihr alles dahabt.«
Langsam lasse ich den Blick durch den gähnend leeren Pub wandern. Annie fragt die Gäste an den beiden Tischen zum dritten Mal, ob sie noch etwas bestellen wollen, und Will ist dazu übergegangen, heimlich Staub zu wischen, weil sie nichts anderes zu tun haben.
»Also, was sagst du?«, hakt Zion nach.
Mir ist klar, warum er das tut. Warum er mich als Erstes anruft und mir anbietet, den Auftrag zu übernehmen, obwohl er andere Möglichkeiten hätte. Zion weiß, dass der Pub wirtschaftlich nicht gut dasteht. Das ist seine Art, mir unter die Arme zu greifen, ohne es anzusprechen und ohne dass ich ihn um Hilfe bitten muss.
Als er mir meinen Anteil nennt, reiße ich die Brauen hoch. Wer zahlt bitte so viel für ein paar Kisten Wasser und Softdrinks? Und wie teuer muss dann erst der Rest sein?
»Wie sieht’s aus?«, fragt Zion. »Kann ich auf dich zählen?«
Ich nicke, auch wenn er es nicht sieht. »Bin schon unterwegs.«
Die zusätzliche Kohle kann ich definitiv gut gebrauchen.
»Danke, Mann. Du rettest mir den Arsch.«
Nein, du mir. Ich bin dankbarer, als ich es jemals zum Ausdruck bringen könnte.
»Immer wieder gern.« Damit lege ich auf und sehe mich noch einmal um.
Gerade öffnet sich die Tür. Herein kommt ein älteres Paar, das seit Ewigkeiten jeden Sonntag hier zu zweit zu Mittag isst, bevor sich ihre Freunde und Freundinnen für Karten und Brettspiele zu ihnen gesellen. Unkomplizierte und dankbare Kundschaft, für die ich nicht zwingend anwesend sein muss.
»Annie, kann ich dich und Will kurz allein lassen? Ich hab was zu erledigen.«
»Klar.« Sie lächelt gut gelaunt und wischt einen Tisch sauber. »Will kann für dich hinter der Bar einspringen, bis Jamals Schicht anfängt.«
So lange wird es hoffentlich nicht dauern.
Ich nicke ihr erleichtert zu und gehe nach hinten. Aus dem Büro hole ich meine Jacke sowie die Schlüssel für das Lager und den Pick-up, dann mache ich mich an die Arbeit. Dabei überschlage ich in Gedanken wie so oft die Zahlen.
Ich hasse es, mir das eingestehen zu müssen, aber selbst mit diesem Zusatzjob wird es schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, alle Mitarbeitenden weiter zu beschäftigen. Wenn in den nächsten Tagen kein Wunder geschieht, muss ich jemanden feuern. Eigentlich sollte das nicht mal meine Aufgabe sein, da ich als Barkeeper hier angefangen habe, aber ohne Charlie bin ich plötzlich Manager, Türsteher, Buchhalter und Personalleiter in einem und erledige jede Aufgabe, die anfällt. Bald auch Kündigungen, wie es aussieht. Fuck my life.
Entschlossen schiebe ich den Gedanken beiseite. Ein Tag nach dem anderen. Eine Aufgabe nach der anderen.
Natürlich hat Zion total untertrieben, was die Fahrt angeht, und so stehe ich rund dreißig Minuten später mit ausgeschaltetem Motor vor einer Auffahrt zu einer der wenigen Villen auf der Insel und verfluche alles. Hätte ich gewusst, wohin es geht, hätte ich den Auftrag abgelehnt. Das kleine Detail hat Zion bestimmt nicht zufällig verschwiegen. Er weiß genau, was ich von dieser Familie halte – und von ihrer Tochter.
Ich habe die Hand bereits am Autoschlüssel, um einfach wieder umzukehren, als jemand an die Scheibe auf der Fahrerseite klopft.
Widerwillig öffne ich das Fenster.
Ein schwarz gekleideter Typ beugt sich zu mir herunter. »Gehören Sie zum Catering, Sir?«
Sir. Ich schnaube innerlich. Als ob das Logo von Turner’s Tavern nicht deutlich genug auf dem weißen Pick-up prangen würde.
»Ja«, bestätige ich trotzdem. »Ich bringe die fehlenden Getränke.«
»Sehr gut. Fahren Sie auf diese Seite des Hauses zum Lieferanteneingang.« Er deutet in die Richtung.
Es gibt einen Lieferanteneingang? Was sind das für Leute? Der König und die Königin von Kanada? Zumindest kommt es mir so vor, als ich die Auffahrt hinauffahre, die teuren Limousinen und Sportwagen passiere und schließlich hinter einem anderen Lieferwagen auf der linken Seite der riesigen Villa parke und aussteige.
Die Tür ist geöffnet, und aus dem Inneren sind Stimmen zu hören. Jemand ruft Befehle – vermutlich die Küchenchefin –, leises Gemurmel und das Klappern von Töpfen sind die Antwort.
Plötzlich klirrt etwas so laut, dass ich unwillkürlich das Gesicht verziehe. Da ist eindeutig was zu Bruch gegangen. Shit. Vermutlich der schlechteste Zeitpunkt, einfach reinzuschneien, trotzdem tue ich es. Je schneller ich die Getränke loswerde, desto schneller kann ich wieder abhauen.
»Hi. Wohin sollen die Kisten?«, frage ich mit zwei davon in den Händen und sehe mich um.
»In den Kühlraum dort drüben.« Eine Frau mit Schürze deutet mit dem Kochlöffel in der Hand zur anderen Seite des Raumes. Dann wettert sie weiter, während zu ihren Füßen jemand die Scherben aufsammelt.
Ich gehe in die von ihr angegebene Richtung. Der Lagerraum ist nicht abgeschlossen und völlig dunkel. Mit dem Ellbogen taste ich nach dem Lichtschalter, doch die einzelne Glühbirne, die von der Decke hängt, bringt nicht sonderlich viel. Schon ironisch, dass die Villa von außen so protzig wirkt, und dann reicht es nicht mal für eine anständige Beleuchtung im Lager.
Schritte sind zu hören, das deutliche Klackern von High Heels. Erst in der Küche und dann direkt hinter mir.
»Was zum Teufel machst du denn hier?«
Kapitel 4
Shae
Das muss ein Witz sein. Als wäre dieser Tag nicht schon schlimm genug, muss ausgerechnet Kilian Beck hier aufkreuzen. Was habe ich bitte verbrochen, um ihm an einem Wochenende gleich zweimal begegnen zu müssen? Ich hätte doch jemanden mit meinem Champagnerglas ermorden und mich verhaften lassen sollen. Die Nacht in einer Zelle zu verbringen, wäre eindeutig angenehmer als diese unwillkommene Begegnung.
»Was zum Teufel machst du denn hier?«
Der winzige Funken Hoffnung, dass es sich um eine Verwechslung handeln könnte, erstirbt in der Sekunde, als er sich umdreht. Der Lagerraum ist schlecht beleuchtet, trotzdem erkenne ich ihn sofort.
Ich habe mich nicht geirrt. Es war wirklich seine tiefe, raue Stimme, die ich eben gehört und aus allen anderen herausgefiltert habe.
»Shae.« Zwei Falten erscheinen zwischen seinen dunklen Augenbrauen. Das tun sie oft, ganz so, als wäre mein Anblick, ach was, meine bloße Existenz Grund genug für ihn, angepisst zu sein.
Nun, das beruht auf Gegenseitigkeit, wie er inzwischen bestens wissen sollte.
»Beck«, ahme ich ihn nach, bis hin zum Gesichtsausdruck und dem verärgerten Tonfall. »Verfolgst du mich jetzt auch noch?«
»Das hättest du wohl gern.«
Er stellt die Getränkekisten ab. Dabei treten die Muskeln in seinen Armen deutlich hervor, und es scheint beinahe so, als würden die bunten Tätowierungen zum Leben erwachen und sich bewegen.
Schnell richte ich den Blick wieder auf sein Gesicht.
Die Falten zwischen seinen Brauen haben sich vertieft. Er mustert mich in dem dunkelgrünen Kleid mit dem Perlenarmband und den Pumps, von denen ich mit Sicherheit schon Blasen habe, und schnaubt abfällig.
»Was willst du hier?« Er klingt so vorwurfsvoll, als hätte er mich dabei erwischt, wie ich heimlich einzubrechen versuche.
»Ähm …« Ich drehe mich halb zur Seite und lasse den Blick durch die Küche schweifen, über die herumwuselnden Leute, die blitzblank polierten Gläser und sorgfältig zurechtgelegten Häppchen auf den Tellern bis hin zu den Scherben auf dem Boden, die gerade hektisch von einer jungen Kellnerin zusammengekehrt werden. Niemand schenkt uns Beachtung. Langsam sehe ich wieder zu Beck zurück. »Ich wohne hier.«
Noch eine Lüge. Na ja, so halb. Als ich nach Golden Bay zurückgekehrt bin, habe ich einige Nächte in dieser Villa geschlafen. Diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei. Mittlerweile verbringe ich die meiste Zeit in dem WG-Zimmer, das ich in Embers altem Elternhaus für mich beansprucht habe. Aber ich rechne nicht damit, dass Beck solche Details interessieren. Wenn es nach ihm geht, wäre ich am anderen Ende der Welt am besten aufgehoben.
Noch eine Sache, die er mit meinen Eltern gemeinsam hat. Hey, vielleicht sollte ich sie einander vorstellen, denn wie es aussieht, haben sie viel zu bereden.
»Außerdem hab ich zuerst gefragt«, schieße ich zurück und stemme die Hände in die Hüften. »Was tust du hier?«
Denn ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass meine Mutter, die Königin der Partyorganisation, die Getränke ausgerechnet von einem Pub liefern lässt. Einem gutbürgerlichen Pub, der von normalen Leuten und Touristen besucht wird. Was für ein Skandal. Man stelle sich nur mal vor, was ihre Gäste denken würden …
»Zion hat mich angerufen. Das Restaurant konnte nicht genug Getränke liefern, also bin ich spontan eingesprungen.«
»Sooo hilfsbereit.« Ich lächle kühl und deute auf die Kisten. »Hast du daran gedacht, Gift reinzumischen?«
Auch Beck lächelt, und ich meine, zum ersten Mal einen Funken Feuer hinter der dicken Schicht aus Eis aufblitzen zu sehen, die er sonst immer zur Schau trägt. »Ich weiß ja, deine Selbstverliebtheit kennt keine Grenzen, aber nicht alles hat was mit dir zu tun, Prinzessin.«
Grrr. Ich hasse es, wenn er mich so nennt.
»Wenn du mich jetzt also meine Arbeit weitermachen lässt? Denn ich werde ganz sicher keinen gut bezahlten Job für jemanden wie dich aufs Spiel setzen.«
Für jemanden wie mich. Nett.
Unwillkürlich frage ich mich, wie er sich mein Leben eigentlich vorstellt. Sitze ich seiner Meinung nach den lieben langen Tag auf einem hübschen Thron mit einer funkelnden Tiara auf dem Kopf und einem Glas Champagner in der Hand, während mir alle zu Füßen liegen und ich meine Gefolgschaft herumkommandiere?
Ja, klar. Die Wahrheit könnte nicht weiter davon entfernt sein. »Du solltest …«
»Shaelynn Mary Stevens!«
Reflexartig zucke ich zusammen und schneide eine Grimasse. Ich habe mich extra von der Party geschlichen, um meiner Mutter aus dem Weg zu gehen – und jetzt erwischt sie mich ausgerechnet in der Küche? Dabei war ich mir sicher, dass sie schon seit Jahren keinen Fuß mehr in diesen Raum gesetzt hat. Dass sie überhaupt weiß, wo die Küche ist, und in der weitläufigen Villa den Weg hierhergefunden hat, ist erstaunlich.
»Was soll das, Shaelynn?«, herrscht sie mich an und kommt überraschend schnell in ihren Jimmy Choos mit Stiletto-Absatz auf mich zumarschiert.
Das Personal, das ihr blitzschnell Platz macht, ignoriert sie ebenso wie Beck hinter mir im Lagerraum. Der macht sogar einen Schritt zurück in die Dunkelheit. Ausnahmsweise klug von ihm.
»Ich suche schon die ganze Zeit nach dir. Hör auf, dich mit den Bediensteten abzugeben, und geh raus zu unseren Gästen!«
Sie wartet nicht mal meine Antwort ab, sondern wendet sich ohne Luft zu holen dem Team in der Küche zu und rattert eine Liste an Beschwerden herunter, bei denen gleich mehrere Leute erblassen.
Scheiße, ich hatte schon eine Menge Jobs, aber bei keinem davon hatte ich so ein Biest zur Chefin wie die einzig wahre Mrs Stevens.
Noch während ich ihr nachsehe, höre ich Schritte und spüre gleich darauf Beck viel zu dicht hinter mir.
»Du hast deine Mommy gehört, Shaelynn Mary Stevens«, zischt er in schneidendem Tonfall in mein Ohr. »Gib dich nicht mit dem Fußvolk ab.«
Ich presse die Lippen fest aufeinander. Allein die Tatsache, dass er mich bei meinem vollen Namen nennt, bringt mein Blut zum Sieden. Aber diese Worte? In diesem Tonfall? Das reicht, um es überkochen zu lassen.
Ich wirbele zu ihm herum. »Fick dich, Beck.«
Sein zynisches Lachen folgt mir, als ich auf dem Absatz kehrtmache. »In deinen Träumen, Prinzessin.«
»Eher in meinen schlimmsten Albträumen.«
Auch wenn ich es hasse, meiner Mutter wie ein braves Töchterchen zu folgen – noch mehr hasse ich es, Beck das letzte Wort zu überlassen. Also zeige ich ihm den Mittelfinger und marschiere aus der Küche.
Lieber sterbe ich, als auch nur eine Sekunde länger in seiner Gegenwart zu verbringen.
Kapitel 5
Shae
»Shaelynn.«
Ich erstarre mitten in der Eingangshalle. Verdammt. Ich hatte damit gerechnet, meine Mutter auf der Party draußen im Garten vorzufinden. Nicht damit, dass sie mir hier und jetzt die Leviten lesen will.
Schnell setze ich meine Maske wieder auf. Dennoch schafft es der tadelnde, enttäuschte Tonfall, mich durch all meine Schutzschilde hindurch genau dort zu treffen, wo es wehtut. Dort, wo sich das kleine Mädchen in mir noch immer nach der Liebe und Anerkennung seiner Eltern sehnt. Nach früher, als alles gut war, auch wenn diese Zeit nicht lange anhielt.
Mom steht mit vor der Brust verschränkten Armen auf dem teuren Teppich und beäugt mich kritisch von oben bis unten. »Was sollte das? Versteckst du dich im Lagerraum vor deiner Familie? Trinkst du heimlich? Bist du jetzt etwa auch noch Alkoholikerin?«
Nur mit Mühe unterdrücke ich den Drang, die Augen zu verdrehen. Die Tatsache, dass sie das allen Ernstes denkt und nicht mal bemerkt hat, dass ich nicht allein im Lager war, spricht Bände.
»Nein, Mom, ich bin keine Alkoholikerin«, sage ich stattdessen und bemühe mich, nicht so genervt zu klingen, wie ich in Wahrheit bin. »Ich hab nur … nach was zu trinken gesucht, was es draußen nicht gab.«
»Ach so?« Ihre perfekt gezupften Brauen wandern in die Höhe. »Also war dir unser Brunch nicht gut genug? Bedienen wir nicht all deine Extrawünsche? Legst du es deswegen darauf an, uns vor all unseren Gästen bloßzustellen, indem du mir nichts, dir nichts von der Bildfläche verschwindest?«
»So war das doch gar nicht gemei…«
»Warum musst du uns ständig das Leben schwer machen?« Ihre Stimme bebt vor kaum verhohlenem Zorn, aber ihre Miene zeigt nicht die geringste Gefühlsregung. Liegt vermutlich am vielen Botox. »Nach allem, was dein Vater und ich für dich getan haben! Hast du es dir zum Ziel gesetzt, uns zu blamieren?«
Manchmal frage ich mich, ob meine Eltern und ich in derselben Realität leben.
»Reg dich ab, Mom«, fahre ich sie an. »Niemand will euch blamieren. Ich hatte einfach Durst. Punkt. Das hatte absolut nichts mit euch zu tun.«
Meine Flucht von der Party schon. Aber das erwähne ich lieber nicht.
»Und du denkst, niemandem wäre aufgefallen, dass du seit über zehn Minuten verschwunden bist? Ich musste gleich zwei Leuten versichern, dass alles in Ordnung ist und es dir gut geht. Leute, die dein Vater extra hierher eingeladen hat, damit sie ihn im Wahlkampf unterstützen. Und du rückst uns alle in ein schlechtes Licht, nur weil du Durst hattest und auf der ganzen Feier, die ich wochenlang akribisch geplant und mühsam ausgerichtet habe, nichts gefunden hast, was deinen sensiblen Geschmack trifft?« Sie fasst sich an die glatte Stirn.
»Ehrlich gesagt bezweifle ich, dass überhaupt jemandem aufgefallen ist, dass ich weg war. Schon gar nicht für zehn kurze Minuten, Mom.«
»Nennst du mich etwa eine Lügnerin? Du bist ein Teil dieser Familie, Shaelynn. Deine Entscheidungen, und mögen sie auch noch so klein sein, haben Konsequenzen für uns alle. Wann wird dir das endlich klar? Wann benimmst du dich entsprechend?«
Ich sehe zur Seite. »Vermutlich niemals.«
»Als hättest du in all den Jahren nicht schon genug Schaden angerichtet. Du kannst froh sein, dass wir uns überhaupt mit dir abgeben, und das auch nur, weil dein Vater und ich ein so gutes Herz haben. Nicht, weil du es verdient hättest.«
Meine Augen brennen. Meine Fingernägel bohren sich in meine Handflächen. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll, darauf zu reagieren. Ich weiß nur, dass ihre Worte ihr Ziel getroffen haben. Wieder mal. Ich fühle mich schuldig, obwohl ich nichts Falsches getan habe. Ich bin nur ins Haus gegangen, verdammt noch mal! Aber in Situationen wie diesen fange ich an, alles infrage zu stellen, was ich für normal und richtig halte – und sogar an meinem eigenen Verstand zu zweifeln.
Das Einzige, was ich in den letzten Jahren zu hören bekommen habe, war, dass ich eine Schande für diese Familie bin. Eine Zumutung. Ein Übel, mit dem sie sich nur herumschlagen, weil sie keine andere Wahl haben, da wir dieselbe DNA teilen. Und mit einem Mal fühle ich mich wieder wie das Mädchen von früher. Das Mädchen, dem niemand geglaubt hat. Das Opfer, das zur Täterin gemacht wurde. Zur Bösen in der Geschichte. Zum Reinfall. Zur absoluten Enttäuschung.
Ich wende mich abrupt ab – und bleibe überrascht stehen, als ich meine Schwester in der Tür sehe. Sie blickt von mir zu unserer Mutter, die mich mit einem enttäuschen Kopfschütteln stehen lässt und zurück zur Party geht.
»Sera …« Ich mache einen Schritt auf sie zu, aber sie rührt sich nicht.
»Ich bin zurückgekommen, weil ich nach dir sehen wollte«, gesteht sie leise. »Und weil es mir leidtat, dass ich einfach gegangen bin. Wir verbringen so wenig Zeit miteinander … aber nach dem, was ich gerade gesehen und gehört habe …« Sie schüttelt den Kopf und wirkt dabei so sehr wie unsere Mutter, dass es wehtut. »Warum bist du so, Shae? Warum kannst du nicht ein einziges Mal Teil dieser Familie sein?« Ohne meine Antwort abzuwarten, macht sie auf dem Absatz kehrt und stapft ebenfalls davon.
Ich schaue ihr sprachlos nach. Wenn Moms Worte wie ein Pfeil waren, dann waren die meiner kleinen Schwester ein Hammer, der diesen Pfeil noch tiefer in meine Brust gerammt hat.
Ich schlucke hart. Zwinge mich dazu, mehrmals tief durchzuatmen. Zu blinzeln, bis meine Sicht wieder klar wird und die Tränen verschwunden sind. Dennoch hallen ihre Worte in mir nach …
Bin in Wahrheit ich das Problem? Sind alle in dieser Familie normal, nur ich nicht? Aber ich kann beim besten Willen nichts finden, was ich falsch gemacht habe. Wie können erst Mom und dann auch noch meine kleine Schwester mir so einen Strick daraus drehen?
Ausgerechnet Sera … Das Mädchen ist sechzehn, verdammt noch mal. Sie sollte sich austoben und ausprobieren, rebellieren und ihre eigene Identität finden, statt mit jedem Tag mehr zu einem Abziehbild unserer Mutter zu werden.
Ich habe keine Ahnung, ob meine Bemühungen überhaupt etwas bringen. Ich versuche, Sera dazu zu kriegen, Dinge zu hinterfragen und über den Tellerrand des privilegierten Lebens zu schauen, das sie führt. Bisher anscheinend ohne viel Erfolg.
Seufzend straffe ich die Schultern und kehre auf die Feier zurück. Ein paar neugierige Blicke folgen mir, als ich über den Rasen gehe und einen freien Stehtisch ansteuere.
Ich erinnere mich an eine Zeit, in der Geld, Ruhm und Macht nicht so wichtig waren. Als es um mehr ging als den schönen Schein, nämlich um unsere Familie. Eine Zeit, in der meine Mutter mit der von Ember befreundet war, was dazu geführt hat, dass wir schon als Babys nebeneinander im Kinderwagen hergeschoben wurden und zusammen aufgewachsen sind. Eine Zeit, in der sich Mom und Dad ehrlich über jedes ihrer Kinder gefreut haben, ohne zu überlegen, wie sie es politisch am geschicktesten einsetzen können. Eine Zeit, die von Lachen und Ausflügen geprägt war, als Dad im Garten mit uns Fangen gespielt und Mom uns mit selbst gemachter Limonade versorgt hat. Lange bevor sie mit uns in diese protzige Villa gezogen sind.
Heute wirkt dieses Leben weiter entfernt als jemals zuvor, aber die Erinnerung bleibt. Die Wehmut. Und die Frage danach, ob alles hätte anders kommen können. Eine Frage, auf die ich wohl nie eine Antwort erhalten werde.
Ein Schatten fällt auf mich.
Als ich den Kopf hebe, sehe ich in ein Paar leuchtend blauer Augen. Ein fremder Typ hat sich zu mir gesellt. Er kann nicht viel älter sein als ich und ist auf eine raue Art Covermodel-mäßig attraktiv. Genau der Typ Mann, auf den ich stehe. Gepflegt, kultiviert, charmant. Ohne Tattoos. Ohne ein Eisblock zu sein, der mich immer wieder zur Weißglut treibt. Und würden wir uns nicht ausgerechnet auf dieser Feier begegnen, wäre ich definitiv interessiert. Aber da er hier ist, muss er meine Eltern kennen, und das allein ist eine gigantische Red Flag.
»Hi. Du musst Shaelynn sein.«
»Shae reicht.«
Niemand außer meinen Eltern nennt mich Shaelynn. Und die vor allem dann, wenn ich ihrer Meinung nach etwas angestellt habe. Was täglich vorkommt. Ach was, mehrmals täglich.
»Freut mich, Shae. Ich bin Gideon.« Er hält mir die Hand hin.
Zögernd greife ich danach und schüttle sie. »Nur Gideon? Kein fancy Nachname, der mich beeindrucken soll?«
Er grinst und entblößt dabei eine Reihe perfekter Zähne in perfektem Weiß, als wäre er einer Zahnpasta-Werbung entstiegen. »Beaumont-Roche. Aber irgendetwas sagt mir, dass dich mein Familienname tatsächlich nicht beeindruckt.«
Einen Moment lang hält er meine Hand fest, dann lässt er sie los.
»Du hast recht. Dein Nachname beeindruckt mich kein Stück.«
Statt beleidigt zu sein, schmunzelt er. »Das ist eine interessante Abwechslung. Normalerweise werden die Leute zu Arschkriechern oder ihnen läuft sofort der Speichel aus dem Mund, sobald sie erfahren, wer meine Familie ist.«
Ich kann nicht anders, als amüsiert zu sein. Und mich zu fragen, wer dieser Typ ist und wo er plötzlich herkommt. War er schon den ganzen Tag da? Oder ist er gerade erst angekommen?
»Übrigens kennen wir uns schon«, erzählt er und nippt an seinem Kaffee. »Aber wahrscheinlich erinnerst du dich nicht an mich. Du warst drei Jahre alt, glaube ich, und ich war acht.«
Ich runzle die Stirn und mustere ihn genauer. Als Dad seine politische Karriere gestartet hat, sind ständig Leute bei uns ein und aus gegangen. Befreundete Familien, Geschäftspartner und Kollegen meines Vaters, potenzielle zukünftige Investoren. Einige von ihnen hatten ihre Kinder dabei, mit denen meine Geschwister und ich gespielt haben. Aber ich kann mich beim besten Willen an keinen Gideon Beaumont-Roche erinnern.
»Tut mir leid«, sage ich daher und hebe die Schultern.
»Macht nichts. Mein Ego verträgt das.« Er zwinkert mir zu. »Dann weißt du wohl auch nicht mehr, dass unsere Eltern uns damals quasi einander versprochen haben?«
Zum ersten Mal an diesem Tag bin ich froh, gerade keinen Schluck Champagner getrunken zu haben, denn ich hätte ihn spätestens jetzt ausgespuckt. Oder mich tödlich daran verschluckt.
»Wie bitte?«, stoße ich hervor.
»Ich weiß. Total absurd.« Gideon lacht leise. »Und so was von aus dem letzten Jahrhundert.«
Er redet weiter, aber ich höre seine Worte kaum noch. Dafür sind meine eigenen Gedanken plötzlich viel zu laut.
![Twisted Fate. Wenn Magie erwacht [Band 1 (Ungekürzt)] - Bianca Iosivoni - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3a5ca8beed0e03eb5b9ec5019f556df5/w200_u90.jpg)


![Twisted Fate. Wenn Liebe zerstört [Band 2 (Ungekürzt)] - Bianca Iosivoni - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3120cf0cd51a7cc2c0f77e86ae0b96a7/w200_u90.jpg)












![Sturmtochter. Für immer vereint [Band 3 (Ungekürzt)] - Bianca Iosivoni - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/661345b7546184504a60a70b5eedeaf1/w200_u90.jpg)












