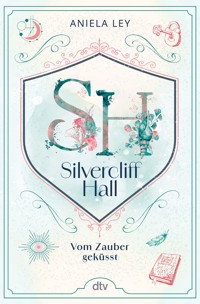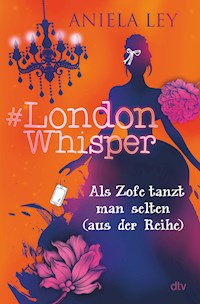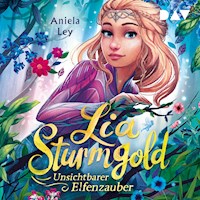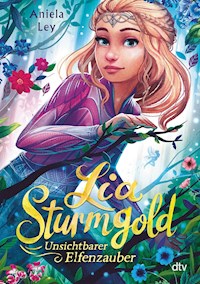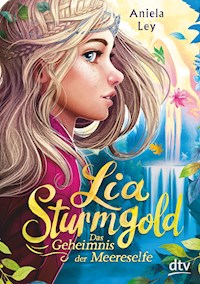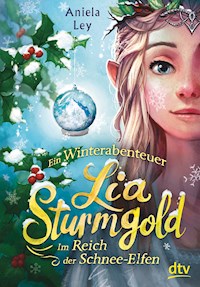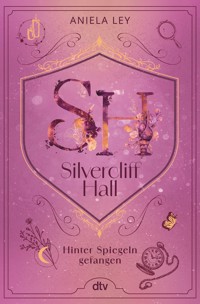
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Silvercliff-Hall-Reihe
- Sprache: Deutsch
Um den zu retten, den sie liebt, muss Emilia alles riskieren! Emilia hört auf ihr Herz und folgt Nathan durch den Spiegel in das mysteriöse Anwesen Morgue Manor. Um ihn zu retten, muss sie den Hausherren in einem Duell besiegen. Nur ist Charles Lafontaine-Boutary niemand, der sich an die Regeln hält. Und wenn Emilia verliert, dann verliert sie nicht nur ihre magischen Kräfte. Als sie dann auch noch erfahren, was sich hinter dem Angriff auf die Silvercliff Hall verbirgt, setzen Emilia und Nathan alles auf eine Karte. Denn nur gemeinsam haben sie eine Chance, die magische Welt zu retten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Um den zu retten, den sie liebt, muss Emilia alles riskieren!
Emilia hört auf ihr Herz und folgt Nathan durch den Spiegel in das mysteriöse Anwesen Morgue Manor. Um ihn zu retten, muss sie den Hausherren in einem Duell besiegen. Nur ist Charles Lafontaine-Boutary niemand, der sich an die Regeln hält. Und wenn Emilia verliert, dann verliert sie nicht nur ihre magischen Kräfte. Als sie dann auch noch erfahren, was sich hinter dem Angriff auf die Silvercliff Hall verbirgt, setzen Emilia und Nathan alles auf eine Karte. Denn nur gemeinsam haben sie eine Chance, die magische Welt zu retten.
Das hinreißende Finale der Silvercliff Hall-Dilogie
Von Aniela Ley ist bei dtv außerdem lieferbar:
Lia Sturmgold – Die Macht der Kristalle (Band 1)
Lia Sturmgold – Das Geheimnis der Meereselfe (Band 2)
Lia Sturmgold – Unsichtbarer Elfenzauber (Band 3)
Lia Sturmgold – Die verzauberte Mitternacht (Band 4)
Lia Sturmgold – Im Reich der Schnee-Elfen (EBook)
Lia Sturmgold und die Zwillingsinsel – Ein Sommerabenteuer (EBook)
#London Whisper – Als Zofe ist man selten online (Band 1)
#London Whisper – Als Zofe tanzt man selten (aus der Reihe) (Band 2)
#London Whisper – Als Zofe küsst man selten den Traumprinz (oder doch?) (Band 3)
Silvercliff Hall – Vom Zauber geküsst (Band 1)
Aniela Ley
Silvercliff Hall
Hinter Spiegeln gefangen
Band 2
Roman
Jenseits des Spiegels — eine Sackgasse
Nathan
Es passierte unfassbar schnell.
Charles Lafon-Boutary schaute mich von der anderen Seite des Spiegels an. Und zwar so, wie man nur etwas betrachtet, das man unbedingt und unter allen Umständen besitzen will. Etwas, das man sich auf keinen Fall entgehen lässt. »Du gehörst jetzt mir«, sagte sein Blick. Was definitiv nichts war, was ich in den Augen eines Erhabenen lesen wollte, der sich gerade als unberechenbarer Scheißkerl entpuppt hatte.
Doch bevor ich reagieren konnte, schoss Charles’ Arm durch den Spiegel.
Ja, durch den Spiegel.
Und zwar ohne ihn dabei zu zerschlagen.
Sobald Magie im Spiel war, war nie etwas so, wie es schien. Doch egal wie absurd ich das fand, ich brachte nicht mal ein gepflegtes »Fuck« über die Lippen, als Charles mich auch schon bei den Revers meines Gehrocks packte.
Hinter mir schrie Emilia auf. Voller Panik.
Meinetwegen.
Spätestens jetzt stand fest, dass ich ein ernsthaftes Problem hatte. Bevor ich Charles jedoch abwehren konnte, riss er mich auch schon zu sich. Mein Gesicht berührte die Oberfläche des Spiegels – und ich vergaß schlagartig die Gefahr, in der ich schwebte. Denn da war ein unsäglicher Schmerz, so als hätte mich ein Blitz getroffen. Mein Körper zersprang in winzigste Partikel, wurde regelrecht atomisiert, um dann unter noch größeren Qualen wieder zusammengesetzt zu werden. Was auch immer Charles mir antun würde, um das brennende Verlangen in seinem Inneren zu stillen, es konnte kaum schlimmer sein als die Durchquerung des Spiegels.
Irgendwann ebbte der Schmerz ab.
Als er so weit nachließ, dass ich wieder einen klaren Gedanken fassen konnte, fand ich mich auf meinen Knien wieder. Keuchend öffnete ich die Augen, in der festen Überzeugung, mich in einem Flammenmeer wiederzufinden. Hineingeworfen von jemandem, der einen auf netten Bekannten gemacht und behauptet hatte, ein Elevierter zu sein. Einer von der hilfsbereiten Sorte. Im Gegensatz zu mir hatte Emilia ein einziger Blick gereicht, um die drohende Gefahr zu erkennen. Sie wusste, was Charles Lafon-Boutary in Wahrheit war.
Im Gegensatz zu mir.
Ich war mal wieder der ahnungslose Ordinary, der nicht den blassesten Schimmer hatte von der magischen Welt und in jede noch so offensichtliche Falle tappte. Ich hatte ja nicht mal kapiert, dass Charles auf der anderen Seite eines Spiegels stand, als er mich in den Keller der Burgruine gelockt hatte.
Eins konnte ich inzwischen jedoch ausschließen: Was auch immer Charles für eine Kreatur war, der Leibhaftige war er nicht. Ich war nämlich nicht in der Hölle gelandet, sondern in einem Zimmer, das so stark in Schatten versunken war, dass ich kaum etwas erkennen konnte. Da waren die Umrisse einer georgianischen Einrichtung, wie die Elevierten sie liebten. Vermutlich befand ich mich in einem Salon oder einem Empfangszimmer.
Das Wichtigste war ohnehin, dass von Charles keine Spur zu entdecken war.
Ich kauerte allein auf einem Teppich, in den ich gepeinigt meine Nägel geschlagen hatte. Ein Blick über meine Schulter verriet, dass hinter mir kein Spiegel aufragte. Damit war das Portal, durch das ich verschleppt worden war, nicht in meiner Nähe. Und somit auch kein Weg zurück. Was bedeutete, dass Emilia allein auf der anderen Seite in der Ruine stand. Vermutlich stinksauer, weil ich mich mal wieder in so eine idiotische Situation gebracht hatte. Als hätten wir nichts Besseres zu tun, nachdem sich gerade herausgestellt hatte, dass sich hinter den rätselhaften Vorgängen in der Silvercliff Hall Academy mehr verbarg als bislang angenommen. Echt, ich hatte keine Zeit für diesen Blödsinn.
Nur leider hatte ich keine Ahnung, wie lange ich mich bereits in diesem Salon befand. Vielleicht sogar seit Stunden? Das würde zumindest erklären, warum durch die Vorhänge spärliches Morgenlicht fiel. Als ich mit Emilia die Burgruine besucht hatte, war es noch mitten in der Nacht gewesen.
Emilia … ihr angsterfüllter Schrei klang mir noch immer in den Ohren. Als hätte Charles ihr in dem Moment das Herz herausgerissen, in dem er mich durch den Spiegel gezerrt hatte. Als wäre ich für immer verloren … Aber das würde ich zu verhindern wissen. Ich hatte dieses Mädchen geküsst – und ich schwöre, ich würde es nicht bei diesem einen Mal belassen.
Als ich nach meiner Auren-Verbindung zu Emilia tastete, war sie wie ausgeschaltet. Aber nicht so wie im Botanischen Garten, als ich mich vor Erschöpfung kaum noch hatte auf den Beinen halten können. Da war ich schlicht zu erledigt gewesen, um an sie ranzukommen. Nein, jetzt war unsere Verbindung tatsächlich komplett weg. Als wären unsere Auren bei meinem Gang durch den Spiegel auseinandergerissen worden.
Die Vorstellung war nicht nur verstörend, es verletzte mich. Die Verbindung zwischen Emilia und mir war zwar durch einen Zufall bei unserem Kennenlern-Zusammenstoß entstanden. Während wir uns noch in den Haaren gelegen hatten, hatte sich meine Aura von Anfang an zu Emilia hingezogen gefühlt und hatte die Chance, sich mit ihr zu verbinden, sofort genutzt. Auf diese Weise waren wir einander nahegekommen, obwohl wir uns doch unbedingt hatten wieder loswerden wollen. Dass die Verbindung ausgerechnet jetzt gekappt wurde, war zum Schreien.
Vermutlich ist es bloß eine Nachwirkung der Spiegeldurchquerung, bestimmt sind unsere Auren dabei einfach durcheinandergeraten, redete ich mir ein. Die Alternative bestand darin, dass ich keine Aura mehr hatte und schlicht tot war. Aber ich bezweifelte, dass tote Jungs wahnsinnige Kopfschmerzen haben.
Mir dröhnte jedenfalls der Schädel, als ich mich in die Senkrechte brachte.
Ein dicker Pluspunkt war, dass die seltsame Benommenheit, die mich auf der Wunderwerk-Soiree so aus dem Takt gebracht hatte, verschwunden war. Nur, was hatte es damit überhaupt auf sich gehabt? Soweit ich mich erinnern konnte, war ich völlig benebelt einer Melodie gefolgt, die mich direkt zu Charles geführt hatte.
Fast glaubte ich, die Melodie wieder zu hören. Diese Musik, tief in meinem Inneren … war das Rauschen meines eigenen Blutes gewesen. Es hatte zu Charles gesungen, als er nach mir rief.
Die Vorstellung war völlig irre. Trotzdem wusste ich mit absoluter Gewissheit, dass es wahr war. Mein eigenes Blut hatte mich verraten. Aber warum?
Ich hatte Charles zum ersten Mal am Botanischen Garten getroffen, draußen, im Schatten vor der Mauer. Da hatte er mir einen kleinen Schnitt beigebracht, für einen Zauber, wie er behauptete. Und schon hatten ein paar Tropfen meines Blutes seine Lippen benetzt.
In diesem Moment war die Verbindung zwischen uns entstanden – durch mein Blut, das ich ihm freiwillig gegeben hatte.
Die ganze Nummer, dass er mir helfen wolle, war bloß ein Trick gewesen, um an mein Blut zu gelangen! Diese Winzigkeit hatte allem Anschein nach ausgereicht, um mich manipulieren zu können.
Verdammte Scheiße!
Da es leider keinen Sandsack gab, an dem ich meinen Frust auslassen konnte, kickte ich mit dem Fuß gegen einen Sessel. Danach fühlte ich mich zwar besser, aber irgendwie auch albern. Wahrscheinlich hätte Emilia mit den Augen gerollt, wenn sie meinen Wutanfall gesehen hätte. Im Gegensatz zu mir war sie immer so fokussiert. Sie hätte bestimmt keine Sekunde mit Rumschmollen verschwendet, sondern alles drangesetzt herauszufinden, wer ihr Gegner war. Ich hingegen hatte nicht einmal geahnt, dass Charles etwas Fieses im Schilde führen könnte, bis er plötzlich die Hand nach mir ausgestreckt hatte. Aber was genau wollte er von einem gewöhnlichen Ordinary wie mir?
Ein dumpfer Verdacht stieg in mir auf. Wer Blut mit Magie vermischte, gehörte bestimmt nicht zu den freundlichsten Exemplaren unter den Elevierten. Wobei Charles möglicherweise gar keiner war, auch wenn er mit seinem ganzen Auftreten geradezu ein Paradebeispiel war für einen aus den erlauchten Kreisen des magischen Hochadels. Allerdings hatte Sir Blessthou mich schließlich gewarnt, dass Oxford eine alte Stadt sei, in deren Schatten sich Geschöpfe tummelten, denen man lieber nicht über den Weg lief. Gehörten dazu vielleicht auch in Ungnade gefallene Elevierte, die üble Dinge mit Blutmagie anstellten und ihre Opfer lebensenergiemäßig leer gepumpt zurückließen? Das würde zumindest erklären, warum ich nach dem Treffen mit Charles völlig geplättet gewesen war.
»Das hast du wirklich großartig hinbekommen, Nathan«, knurrte ich. »Kaum verlierst du den Schutz von Silvercliff Hall, lässt du dich auch schon vom erstbesten Schattenwesen anhauen und spendierst ihm einen Drink aus deinen Adern.«
Was zu der Frage führt, ob Charles sich in der Zwischenzeit noch einmal bei mir bedient hatte. Das Bild, wie er an meiner Vene hing, brannte sich mir ein. Okay, jetzt nur nicht hysterisch werden!
Hektisch tastete ich meinen Hals nach Wunden ab, doch ich konnte keine frischen Male entdecken. Auch fühlte ich mich nicht so abgrundtief erschöpft wie nach unserer ersten Begegnung. Auf der anderen Seite wollte ich lieber nicht abwarten, bis Charles der Magen knurrte und er sich daran erinnerte, dass er einen Snack im Salon zurückgelassen hatte. Mein Bedarf, mich wie eine Mahlzeit auf zwei Beinen zu fühlen, war absolut gedeckt.
Langsam gewöhnten sich meine Augen an das Dämmerlicht.
In dem Salon standen Sessel, eine Chaiselongue und Beistelltische, auf denen ganz im Stil der guten alten Zeit lauter Krimskrams stand. Statt Lampen gab es Kerzenständer und in der Ecke einen offenen Kamin. Charles hatte mich nicht in eine Gruft verschleppt, in deren Mitte ein Altar zur rituellen Opferung bereitstand, sondern offenbar in ein altehrwürdiges Herrenhaus, das vom Look her in Oxford stehen musste. Das erklärte allerdings nicht, warum ich in einem Schwarz-Weiß-Film gefangen war. Um mich herum war alles in eintöniges Grau getaucht, während meine Hand zwar blass, aber doch von der Farbe her ganz natürlich war. Vielleicht befand sich der Salon in einer Schattenausgabe der Stadt, die wie in einem Märchen hinter dem Spiegel lag.
Bevor meine Fantasie endgültig mit mir durchging, beschloss ich, mich umzusehen. Dafür brauchte ich dringend eine bessere Beleuchtung. Hinter den Vorhängen verbarg sich zwar wie erhofft ein Fenster, doch die Außenläden waren geschlossen und durch ihre Lamellen fiel kaum Licht. Es gab keine Griffe, um die Fenster zu öffnen. Wie im Knast.
Ein mulmiges Gefühl stieg in mir auf, doch ich konnte jetzt keine Panikattacke gebrauchen. Die Fenstergriffe fehlten ganz bestimmt nicht, weil dieses Zimmer ein hübsch eingerichtetes Gefängnis für Charles’ Entführungsopfer war, sondern weil die Elevierten nur eine Prise Magie zum Öffnen eines Fensters brauchten. Im Gegensatz zu einem Ordinary, der auf seine Hände angewiesen war.
Letztendlich war es mir egal, wohin Charles mich verschleppt hatte. Mich interessierte bloß der Ausgang! Je schneller ich ihn fand, desto besser. Es musste doch einen Weg hier heraus geben, einen Weg zurück zu Emilia.
Die immer stärker werdende Panik unterdrückend ging ich zur Zimmertür. Wenn die jetzt ebenfalls verschlossen war, würde ich ausflippen. Es war ohnehin schon zu wenig Platz für mich und meine Vorstellungskraft in diesem Raum. Fast wünschte ich mir, dass Charles auftauchte. Dann könnte ich zumindest herausfinden, woran ich war. Und ihn bei Gelegenheit auf eine schlagkräftige Art wissen lassen, was ich von diesem Verschleppungsscheiß hielt.
Zu meiner Erleichterung wies die Tür nicht bloß einen Griff auf, sondern er ließ sich sogar runterdrücken.
Ich gönnte mir ein kleines Stoßgebet, dann zog ich an dem Griff.
Die Tür sprang auf.
Vorsichtig blickte ich durch den sich auftuenden Spalt. Dabei rechnete ich fest damit, gleich von zwei untoten Wächtern angeraunzt zu werden, dass es dem Appetithappen ihres Meisters nicht gestattet sei, sich frei zu bewegen. Offensichtlich hatte die Zeit in Silvercliff Hall, wo hinter jeder Ecke etwas Unvorhergesehenes lauerte, ihre Spuren hinterlassen.
Meine Enttäuschung hielt sich jedoch in Grenzen, als hinter der Salontür bloß ein verlassener Flur lag, dessen Ende von einem diesigen Licht verschluckt wurde. Der Eindruck verstärkte sich, dass es sich um ein altes und sehr vornehm eingerichtetes Gebäude handelte. Die Wände waren mit Stofftapeten voller Ornamente geschmückt, der Dielenboden roch nach Bohnerwachs und es gab keinen einzigen Hinweis auf Elektrizität. Das Licht, das den Flur mehr schlecht als recht beleuchtete, fiel durch einige Oberlichter in der Decke. Allerdings waren sie von Efeuranken überwuchert, sodass ich nicht erkennen konnte, ob es vom anbrechenden Morgen stammte oder es bereits helllichter Tag war.
Falls es mich tatsächlich in ein Spukhaus verschlagen hatte, fühlte es sich nur bedingt unheimlich an. Vielmehr strahlte alles eine zeitvergessenen Ruhe aus, die sich immer weiter ausdehnte wie ein langweiliger Sonntagnachmittag. Es hatte etwas von träge durch die Luft tanzenden Staubflocken und glich dieser speziellen Art von Untätigkeit, die einen ganz dusselig machte. Und doch war da unterschwellig etwas Lauerndes auszumachen, als hätten diese Räume Dinge erlebt, über die man besser den Mantel des Schweigens legte.
So oder so traute ich dem Frieden nicht. Auf alles gefasst schob ich erst mal nur meine Stiefelspitze über die Türschwelle. Als sie weder gegen eine unsichtbare Mauer stieß noch sich dematerialisierte, holte ich tief Atem und trat in den Flur hinaus.
Zu beiden Seiten gingen Türen ab, doch mich interessierte mehr, wohin der Flur führte. Darauf bedacht, möglichst kein Geräusch zu machen, folgte ich ihm um eine Ecke, wo ich auf eine nach unten führende Treppe stieß. Nachdem ich die Stufen hinabgelaufen war, entdeckte ich einen weiteren Flur.
Hier im unteren Geschoss war das Dämmerlicht heller – oder bildete ich mir das nur ein? Nein, ich nahm es als Hinweis darauf, dass ich schon bald in die Empfangshalle gelangen würde. Und von dort aus wäre es dann nur noch ein Katzensprung zur Eingangstür und damit in die Freiheit. Sollte Charles sich ein anderes Opfer für seine Spielchen suchen, ich wollte nur noch zurück zu Emilia und spüren, wie sich unseren Auren wieder miteinander verwoben und diese zarten Bande zwischen uns mir zuflüsterten, dass alles gut war.
Angetrieben von dieser Hoffnung folgte ich dem Flur, ohne auf die abgehenden Zimmertüren zu achten. Falls eine davon plötzlich aufspringen und etwas Unheilvolles auftauchten sollte, dann wäre das eben so. Mich konnte jetzt nichts mehr stoppen.
Bevor ich mich versah, lief ich. Mein Atem klang mir laut in den Ohren, mein Herz pochte überdeutlich in meiner Brust.
Wie lang war dieser verdammte Flur denn noch?
Kurz bevor ich die Nerven verlor, endete er hinter der nächsten Ecke vor einer Tür. Erst als ich meine Hand auf den Griff legte, gestand ich mir den Horror ein, der sich auf meinen letzten Schritten bemerkbar gemacht hatte. Der Verdacht, ein Gefangener zu sein, dessen Aussicht auf eine glückende Flucht jeden Moment verpuffen würde. Aber jetzt hatte ich es geschafft.
Meine Kiefer fest aufeinandergepresst, drückte ich die Klinke runter.
Die Tür schwang auf … und vor mir lag der Salon, in dem ich erwacht war.
Fluchend schmiss ich die Tür zu.
Dann machte ich sie wieder auf.
Ja, es war der gleiche Salon. Die Vorhänge waren noch genauso aufgezogen, wie ich sie zurückgelassen hatte.
Ich nahm eine Vase mit Trockenblumen von einem Beistelltisch und schmiss sie mit aller Kraft gegen das Fenster.
Die Vase zersprang, das Glas der Scheiben klirrte und unzählige Scherben fielen zu Boden.
Dann würde ich eben durch das zerbrochene Fenster hinausklettern. Das Loch war groß genug, um die dahinterliegenden Läden aufzustoßen.
Ich streckte die Hand aus. Doch kaum passierten meine Finger die Bruchstelle, stießen sie auf einen harten Widerstand. Hinter dem beschädigten Glas saß eine weitere, unversehrte Scheibe und hinderte mich daran, die geschlossenen Läden zu erreichen.
Mit der geballten Faust schlug ich dagegen.
Erneutes Klirren und Fallen von Scherben.
Dieses Mal machte ich mir nicht die Mühe, nach den Läden zu greifen. Denn ich konnte die Blutschlieren auf dem Glas, das hinter der zweiten gesprungen Scheibe lag, nur allzu gut sehen. Egal wie oft ich zuschlagen würde, es wäre immer noch eine Glasscheibe da, die mich von der Außenwelt trennte.
Ich saß fest.
Vor Wut ganz taub schaute ich auf meine aufgeplatzten Fingerknöchel. Das frisch hervortretende Blut leuchtete unnatürlich rot. Als wäre es die einzige Farbe in diesem Schwarz-Weiß-Film. Wohin hatte mich Charles bloß gebracht?
Ich biss die Zähne fest aufeinander und ignorierte das Pochen in meiner verletzten Hand. Dann verließ ich erneut den Salon und schlug die andere Richtung auf dem Flur ein. Dieses Mal führte er über eine geschwungene Treppe nach oben, die Luft wurde wärmer und dicker. Doch anstatt auf eine Dachterrasse führte er mich erneut in den Salon zurück.
Alles klar.
Ich marschierte sofort wieder los und griff nach der erstbesten Türklinke auf dem Flur, nur um herauszufinden, dass dahinter ebenfalls »mein« Salon lag.
Egal was ich tat, es endete in einer Sackgasse.
In mir brodelte eine Mischung aus Wut und Frust, aber es hatte wohl kaum einen Sinn, noch mehr Fensterscheiben einzuschlagen.
Absolut entnervt warf ich mich in einen Sessel. Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich schon in diesem Labyrinth feststeckte. Das Licht wurde mal stärker, mal schwächer, ohne jemals die Schatten zu besiegen. Zu meiner Verwunderung verspürte ich weder Hunger noch Durst, während das Blut auf meinen wunden Fingerknöcheln immer noch rot leuchtete, als hätte ich der Fensterscheibe eben erst einen Schlag versetzt. Es war, als wäre die Zeit an diesem Ort aufgehoben, als habe jemand die Pausentaste gedrückt. Ähnlich wie bei Emilias Tempora-Beschwörung, die ebenfalls die Zeit anhielt. Nur ohne blauen Glitzer. Und ohne Emilia.
Irgendwann schloss ich die Augen, weil ich den Anblick des Salons nicht mehr ertrug. Meine Gedanken rasten wild durcheinander, während dieses Gefühlt, festzustecken, immer bedrohlicher wurde. Als es kaum noch auszuhalten war, sprang ich auf, schnappte mir ein paar Zündhölzer von einem der Beistelltischchen und setzte die Vorhänge in Brand.
Seltsam farblos flackerte das Feuer auf, doch es war zweifelsohne heiß – und das war alles, was ich brauchte. Es dauerte nicht lange, bis der Stoff in Flammen stand und die ersten rot glühende Zungen nach der Stofftapete leckten. Funken flogen durch die Luft und versengten Zierdeckchen und einen Sessel, der kurz darauf ebenfalls brannte.
Keine Ahnung, was ich erwartete. Für mich stand bloß fest, dass ich es keine Sekunde länger ertrug, hier zur Untätigkeit verdammt auszuharren. Hinter den mittlerweile lichterloh brennenden Vorhängen barst Glas, doch ich gab mich nicht der Hoffnung hin, dass sich damit ein Fluchtweg auftat.
Rauch breitete sich im Salon aus, während die Flammen begannen, über die Teppiche zu tanzen. Ich wich nur so weit zurück wie nötig, aber der Qualm brannte mir in den Augen und ich konnte kaum noch atmen. Eigentlich war es höchste Zeit, aus dem Zimmer zu fliehen und die Tür hinter mir zuzuschlagen. Aber mein Trotz war stärker als meine Angst. Charles hatte mich eingesperrt und würde mich hier bis in alle Ewigkeit schmoren lassen, während er sich vermutlich darüber kaputtlachte, wie ich umherirrte ohne Aussicht auf Erfolg. Für einen Magier war das bestimmt bloß ein unterhaltsames Spiel. Aber ich war nicht sein Spielzeug, ich würde ihm einen dicken fetten Strich durch die Rechnung machen, egal was es mich kostete.
Inzwischen war der gesamte Salon mit Rauch gefüllt. Ich hörte ein Krachen, dann stürzte auch schon ein brennendes Deckenstück herab, dem ich im letzten Moment auswich. Dabei stolperte ich und fiel der Länge nach hin. Als ich mich wieder aufrappeln wollte, schaffte ich es vor lauter Husterei nicht mal auf alle viere. Ich blieb platt wie ein Käfer auf dem Boden liegen. Mehr war nicht drin, ich bekam einfach nicht genug Sauerstoff. Selbst wenn ich jetzt hätte fliehen wollen, wäre es zu spät gewesen.
Ob Emilia wohl geahnt hatte, dass sie mich nicht wiedersehen würde, als Charles mich durch den Spiegel zog? Wie auch immer, wäre sie jetzt hier, würde sie bestimmt einen Wutanfall bekommen, weil ich so ein unfassbar dummer Ordinary war, der sich aber auch wirklich immer in die schlimmsten Situationen brachte. Eine wütende Emilia war so viel besser als eine verzweifelte oder gar unglückliche. Obwohl ich kaum noch Luft in meine Lungen bekam, musste ich bei dieser Vorstellung lachen. Die zauberhafte Miss Vandercould war das Einzige, was mich von der Tatsache, in einem lichterloh brennenden Salon festzusitzen, ablenken konnte.
Als ein Lachen über meine Lippen kam, hallte es lauter als der Lärm der Flammen.
Dann war es im Salon mit einem Schlag absolut still.
Unnatürlich still.
Ich blinzelte. Meine Augen tränten erst noch, dann war mein Blick frei. Genau wie meine Lunge.
Ungläubig hob ich meinen Kopf. Der Salon war wieder in seinem Originalzustand, wie vor meiner Zündelaktion. Mit einem Unterschied: Ich war nicht länger allein.
Vor mir im Sessel saß Charles Lafon-Boutary mit elegant übereinandergeschlagenen Beinen, die Hände auf den Lehnen. Nur sein auf und ab tanzender Zeigefinger verriet, wie schwer genervt er war.
Meinetwegen.
In aller Ruhe rollte ich mich auf den Rücken und sog erst einmal Luft in meine Lungen. Dabei unterdrückte ich ein Grinsen. So wie es aussah, stand es eins zu null für den dämlichen Ordinary.
Die Geister — die ich dummerweise rief
Nathan
Es gibt verschiedene Arten von Schweigen. Am schwersten auszuhalten ist es, wenn gerade etwas Hammerhartes gesagt wurde und nichts als Stille folgt. Oder wenn man es vor Unsicherheit nicht über sich bringt, das Richtige zu sagen. Bei Charles und mir stand allerdings ein Schweigen von einer Der-Coolere-schweigt-am-längsten-Qualität im Raum. Pardon. Im Salon natürlich. Und ich hatte nicht vor, diese Challenge zu verlieren.
Irgendwann wurde es Charles in seinem Sessel zu blöd und er stand auf, während ich grundentspannt auf dem Teppichboden liegen blieb. Zumindest äußerlich, denn ehrlich gesagt hatte ich einen Heidenschiss vor diesem Kerl. Mit seinem Gentleman-Look mochte Charles wie ein junger Elevierter aus den besten Kreisen aussehen, aber hinter seiner eleganten Fassade verbargen sich Abgründe. Welche genau das waren, konnte ich bloß vermuten. Aber im Großen und Ganzen stieß meine angeborene Neugier an ihre Grenzen, wenn ich mit ihm in einem Zimmer eingesperrt war, aus dem es für mich kein Entkommen gab.
Als Charles sich neben mich stellte, um aus der Adlerperspektive auf mich herabzublicken, erinnerte ich mich daran, wie ich ihm zum ersten Mal begegnet war. Er war aus den Schatten getreten, doch das hatte bei mir keine Alarmglocken läuten lassen. Und auch jetzt sah ich bloß das Gesicht eines gut aussehenden Kerls Anfang zwanzig, dessen goldenes Haar vielleicht etwas zu old fashioned gestylt war. Wenigstens war es in Farbe, ich hatte schon an meinem Sehnerv gezweifelt.
Nach wie vor weckte auf den ersten Blick nichts an Charles meine Instinkte. Er war eher der Typ, mit dem man sofort etwas zusammen trinken wollte. Wahrscheinlich war genau das sein Trick.
»Findest du es nicht würdelos, am Boden zu liegen wie ein trotziges Kind?«, fragte Charles nur eine Spur herablassend.
Ich verschränkte die Hände hinter meinem Kopf. »Nö.«
Mit einem Seufzen kniff Charles sich in den Nasenrücken, eine Reaktion, die ich häufiger bei Leuten hervorrief. »Ich vermute, du hast mich nicht auf diese überraschend radikale Weise gezwungen, dir Gesellschaft zu leisten, nur um mich jetzt zu ignorieren.«
»Mir ging es dabei weniger um deine Gesellschaft als um die klare Botschaft, dass ich mich nicht einsperren lasse. Aber irgendwie sitze ich immer noch in diesem Salon fest.«
Charles zuckte mit der Schulter. »So ist das eben: Gäste gehören in den Besuchersalon. Und du möchtest von mir doch gern wie ein Gast behandelt werden, oder? Falls ja, dann benimm dich gefälligst wie einer. Das ist der einzige Schutz, über den du in meinem Heim als Ordinary verfügst.«
Da schwang eindeutig eine Drohung mit in Charles’ so betont freundlicher Stimme.
»Übrigens, herzlich willkommen in Morgue Manor, dem altehrwürdigen Stammsitz der Familie Lafon-Boutary.« Charles deutete eine Verbeugung an.
Morgue Manor … Mehr Spukschloss ging nicht. Nichts wie weg!, schrien meine Instinkte, aber leider half mir das wenig in diesem Horror-Salon ohne Entrinnen. Wenn ich eins nicht durfte, dann meine Nerven verlieren. Ich war nur so weit gekommen, weil ich mich der Herausforderung gestellt hatte.
Trotz des heftigen Adrenalinschubs setzte ich mich in aller Ruhe auf. Als Charles mir seine Hand hinhielt, um mich hochzuziehen, zwang ich mich, sie zu ergreifen. Sie fühlte sich kühl und seltsam trocken an, irgendwie konserviert. Aber sie war eindeutig lebendig, was mich beruhigte.
Ohne die geringste Kraftanstrengung zog Charles mich in den Stand und hielt meine Hand dann länger fest, als mir lieb war. Aufmerksam musterte er sie. Es war die Hand, mit der ich versucht hatte, die Fensterscheibe einzuschlagen. An meinen aufgesprungenen Knöcheln leuchtete immer noch frisches Blut.
Fast rechnete ich damit, dass Charles sich zu einem Handkuss vorbeugen würde, so wie ihn das Rot faszinierte.
Und dann?
Ich überragte Charles zwar um einen halben Kopf und war auch athletischer gebaut. Trotzdem beschlich mich das ungute Gefühl, dass ich ihm in einer Auseinandersetzung unterlegen sein würde. Nicht nur weil er als Elevierter in einem Kampf über ganz andere Möglichkeiten verfügte. Sondern weil er wegen meines Blutes, das er sich unter den Nagel gerissen hatte, eine Macht über mich hatte, über die ich ungern mehr herausfinden wollte.
»Danke fürs Aufhelfen«, sagte ich.
Und schwups, entzog ich Charles meine Hand, um ihm damit freundschaftlich auf die Schulter zu klopfen. Anschließend ließ ich meine blutigen Finger schnell in meiner Hosentasche verschwinden. Charles nahm es mit dem Hochziehen einer Augenbraue hin, was frei übersetzt vermutlich bedeutete: »So viel Schiss vor mir?«
»Nun, da ich schon einmal hier bin, wie wäre es mit einem Rundgang durch dein Anwesen?«, schlug ich vor. Ich wollte weg – aus diesem verhexten Salon, aber noch mehr von diesem Mann, dessen Absichten ich nicht einschätzen konnte.
Bei meinem Vorschlag rutschte Charles’ Augenbraue noch höher, dann lachte er. »Es gibt viele Gründe, warum ich dich hierhergebracht habe, Nathan. Aber ich muss zugeben, dass einer davon ziemlich gewöhnlich ist: Du gefällst mir, deine Art ist so erfrischend. Aber vielleicht sollte ich dich auf meine ausgesprochen guten Sinne hinweisen. Dank ihnen kann ich deine Angst wie ein unruhiges Wispern wahrnehmen. Und auch deine Zweifel, ob du jemals wieder mein Haus verlassen wirst, beben durch den Raum.«
»Wie reizend. Und was kommt als Nächstes? Übrigens kann ich durch deine Klamotten schauen, Nathan?« Ich funkelte Charles an. »Dann bemerkst du mit deinen Sinnen hoffentlich auch meine Ungeduld, die sich langsam zu einem Unwetter zusammenbraut.«
Anstatt beleidigt zu sein, wirkte Charles amüsiert. »Siehst du, das meine ich. Du bist eine wunderbare Unterhaltung. Dass ich dich so stark wahrnehme, muss dir keineswegs unangenehm sein. Die Angst meiner Gäste ist etwas ganz Gewöhnliches, ich wäre irritiert, wenn dein Puls in meiner Gegenwart nicht beschleunigen würde. Aber im Gegensatz zu den meisten Besuchern, die sich von ihrer Furcht übermannen lassen oder versuchen, sich bei mir lieb Kind zu machen, fängst du an zu pokern. Dieser Stil ist ganz nach meinem Geschmack.«
Ein Kompliment, auf das ich gern verzichtet hätte. Ich hätte einiges dafür gegeben, wenn Charles sich in meiner Gegenwart zu Tode langweilte. »Wenn du meine Pokerei so charmant findest, was hältst du dann davon, wenn wir aus meiner Rückkehr-Karte aus deinem Reich ein Spiel machen?«
Ehrlich, ich drückte mir die Daumen, dass Charles dem Deal zustimmte. Wahrscheinlichkeitsrechnung war eine meiner Stärken, deshalb hatte ich bei uns im Viertel auch ausdrückliches Zockverbot. Ein paar Leute aus gewissen Kreisen hatten ordentlich Geld an mich verloren, aber davon wusste man hinterm Schleier ja nichts. Wenn ich meinen Gastgeber zu einer Runde Blackjack überreden konnte, dann war ich schneller wieder bei Emilia, als sie ihr Irrlicht nach mir ausschicken konnte.
Dummerweise schüttelte Charles nur belustigt seinen Kopf. »So verlockend die Vorstellung, gegen dich zu spielen, auch ist, ich muss dich leider enttäuschen. Für dich ist keine Rückkehr eingeplant, du bist und bleibst mein Gast. Für immer.«
In diesem Moment wünschte ich mir, ich wäre am Boden liegen geblieben. Dann könnte Charles jetzt wenigstens nicht sehen, wie ich in mich zusammensank. »Scheiße, das ist nicht dein Ernst?«, knurrte ich.
»Ich befürchte, doch. Dafür kannst du dich bei deiner Freundin aus der umtriebigen Familie Vandercould und ihresgleichen bedanken. Seit sie euch Ordinarys hinterm Schleier verbergen, ist es für mich zu einer aufreibenden Herausforderung geworden, mein Heim und meine Familie zu unterhalten.«
Das Wort Familie gefiel mir in diesem Zusammenhang gar nicht. Vor mir sah ich eine Horde hungriger Lafon-Boutarys, die Schlange standen, um etwas von mir abzubekommen. Dabei hatte es mich schon fast umgebracht, als Charles lediglich ein paar Tropfen von meinem Blut genommen hatte.
Während ich schreckensstarr dastand, richtete Charles die Revers meines Gehrocks. Als wäre er mein Kumpel und nicht mein Verhängnis in Gentleman-Form. »Da du länger bei uns bleiben wirst, wäre ein Rundgang durchs Haus durchaus angebracht. Normalerweise dürfen unsere Gäste diesen Bereich nicht verlassen, aber bei dir mache ich eine Ausnahme. Es wäre ein Fauxpas, meinen neuen besten Hausfreund hier in diesem doch etwas abgestandenen Salon versauern zu lassen. Was sagst du dazu?«
»Dass ich den verdammten Rundgang schon hinter mir habe, er hat mich immer wieder nur in dieses Zimmer zurückgeführt«, flüsterte ich, als wäre meine Kehle plötzlich wieder mit Rauch gefüllt.
Lässig schlenderte Charles zur Tür und öffnete sie. »Vielleicht gibst du der Sache noch eine Chance. Zu verlieren hast du schließlich nichts. Es sei denn, du begeisterst dich plötzlich für Langeweile.« Damit verließ er den Salon.
Ich blieb unschlüssig zurück.
Sollte den Mistkerl doch der Teufel holen. Andererseits … Wenn sich hinter der Tür nun tatsächlich etwas anderes als das in sich geschlossene Salon-Labyrinth befand, dann hätte sich mein Spielfeld bereits erweitert. Je besser ich das Gelände kannte, desto eher bekam ich eine Chance zur Flucht.
Und ich hatte vor zu fliehen, egal wie mau Charles meine Aussichten darstellte.
Der Flur hinter der Salontür lag immer noch im Dämmerlicht. Der einzige Unterschied zu vorher bestand darin, dass nun ein vornehm zurechtgemachter Elevierter hindurchspazierte.
Das akzeptierte ich als Beweis dafür, dass der Täglich-grüßt-der-immergleiche-Salon-Fluch aufgehoben war.
Sicherheitshalber öffnete ich trotzdem die erstbeste Tür und spähte hindurch. Dahinter befand sich nicht etwa das übliche Arrangement aus Chaiselongue und Beistelltischen, das sich bereits auf meiner Netzhaut eingebrannt hatte. Sondern ein Esszimmer, in dem locker ein Dutzend Gäste an einem mit edlem Porzellan eingedeckten Tisch platziert werden konnten. Ich verkniff mir die Frage, was zum Hauptgang gereicht werden sollte. Ohnehin erweckte die Tafel den Eindruck, schon lange nicht mehr benutzt worden zu sein. Obwohl alles herrschaftlich hergerichtet war, wirkte es, als läge eine dicke Staubschicht darüber. Genau so stellte ich mir das seit Jahrhunderten im Schlummer versunkene Dornröschenschloss vor.
Ohne dass ich es bemerkt hatte, war Charles hinter mich getreten. Dichter, als meine Komfortzone es als angemessen empfand.
»Zufrieden?«, fragte er, wobei ich seinen Atem in meinem Nacken spürte.
»Erleichtert trifft es wohl eher.« Die Zähne fest aufeinanderbeißend zwang ich mich, nicht vor Charles zurückzuweichen. Es war klar, dass er mir nur deshalb auf die Pelle rückte, weil ihn meine Angst belustigte. Und wenn man jemandem Angst machen konnte, dann beherrschte man ihn auch. Aber nicht mit mir.
Ich zählte bis zehn, dann erst betrat ich das Esszimmer.
»Ganz hübsch hier«, sagte ich. Dabei zupfte ich an einer Leinenserviette, die unter meiner Berührung sofort zu Staub zerfiel. Ups. Der Eindruck von hundert Jahren Tiefschlaf war wohl durchaus richtig.
Hastig ging ich weiter – um eine Sekunde später vor Schreck wie angenagelt stehen zu bleiben.
In einer dunklen Zimmerecke stand jemand.
Die Gestalt war kaum auszumachen, weil sie beinahe mit den Schatten verschmolz. Falls sie mich bemerkt haben sollte, kümmerte es sie nicht. Sie stand bloß da und wankte dabei leicht vor und zurück, als wäre sie ein Pappaufsteller in der Zugluft.
»Wer zur Hölle ist das?«, flüsterte ich.
Charles folgte gleichgültig meinem Blick. »Das ist Parzival, unser Butler. Beachte ihn nicht weiter, er steht dort schon etwas länger rum.«
Bei genauerer Betrachtung stellte sich der Schattenmann tatsächlich als livrierter Diener heraus, allerdings komplett farblos, mit eingefallenem Gesicht und toten Augen. Nichts an diesem Parzival wies darauf hin, dass er auch nur einen Funken Leben in sich trug.
»Ich bin offenbar nicht der einzige Dumme, der dir was von seinem Blut gegeben hat«, sagte ich.
Charles schüttelte den Kopf. »Welchen Sinn würde es machen, das eigene Personal anzugehen?«
Dazu fiel mir nichts ein. Wenn keine Blutmagie dahintersteckte, was war dann mit dem Typen los?
»Dann ist Parzival eine Art Statist, damit du dich in deinem Gruselhaus nicht so allein fühlst?«, versuchte ich hinter das Rätsel des unheimlichen Butlers zu kommen.
»Du hast vielleicht Ideen!«, lachte Charles. »Man könnte meinen, dass es dir mit dem Rundgang bereits reicht, obwohl wir gerade erst im Esszimmer angekommen sind. Dem uninteressantesten Raum von allen. Aber falls du möchtest, begleite ich dich natürlich gern zurück in den Salon.«
Von wegen. »Wir haben doch gerade erst losgelegt. Und ich bin ziemlich neugierig, ob es auch einen Garten gibt.«
»Ach ja, ich vergaß. Du interessierst dich für Grünzeug, wie ich ja schon bei unserer ersten Begegnung erfahren durfte.« Charles bedeutete mir, das Esszimmer zu verlassen. Aber ich war ohnehin schon halb zur Tür hinaus, bevor Parzival noch der Länge nach umkippte und reglos mit dem Gesicht nach unten liegen blieb. »Einen botanischen Garten habe ich zwar nicht zu bieten, aber vielleicht etwas Vergleichbares.«
Hauptsache, es befand sich außerhalb dieses Gemäuers. Die allgegenwärtige Leblosigkeit fing langsam an, mir die Stimmung zu vermiesen.
Ich folgte Charles durch ein Foyer, dessen massive Eingangstür mich magisch anzog. Doch ich ahnte, dass sie sich von mir nicht würde öffnen lassen. Bestimmt lag ein ähnlicher Zauber auf ihr wie auf den Fenstern. Mich beschlich der Verdacht, dass einzig und allein mein Gastgeber darüber entschied, was von Morgue Manor ich zu sehen bekam. Also ging ich brav hinter Charles her und schwadronierte darüber, dass es bestimmt kein zweites Haus gab, das so exquisit im Dauerdämmerlicht aussah. Die Auswahl an Grautönen sei wirklich Profiarbeit. Aber auch die anderen Details verrieten den Hang zur Perfektion. Allein wer auch immer dafür gesorgt hatte, dass sogar der Hall meiner Fußtritte nach Vergangenheit klang, hatte seinen Job erstklassig erledigt. Und last but not least: farbloses Kerzenlicht. Dafür musste man doch bestimmt ein paar extraknifflige Tricks auf Lager haben, right?
Charles schwieg zu meinen Ergüssen, mit denen ich ihm zugegebenermaßen bloß auf die Nerven gehen wollte. Als er sich mir jedoch vor einer Flügeltür zuwendete, bemerkte ich sein Schmunzeln. Allem Anschein nach fand er mich überaus unterhaltsam, was mich augenblicklich verstummen ließ. Ich strengte mich schließlich nicht zu seinem Vergnügen an.
Die Hand schon auf der Klinke blieb Charles stehen. »Mein Geburtshaus hat viele Zimmer, mit denen ich die verschiedensten Dinge verbinde. Die meisten sind voller Erinnerungen und ich würde dir nicht raten, sie ohne meine Begleitung zu betreten. Nicht weil ich deine Flucht befürchte, sondern weil ich nicht für deine Sicherheit garantieren könnte. Aber was hinter dieser Tür liegt, ist etwas Besonderes. Darum möchte ich dich um Rücksicht bitten. Es würde mich freuen, wenn du für einen Moment vergessen könntest, dass wir beide uns in einer besonderen Situation befinden.«
»Es würde die Spannung enorm rausnehmen, wenn du einmal ganz konkret aussprechen würdest, was genau das für eine Kiste mit uns ist«, fuhr ich Charles schärfer an, als vermutlich schlau war.
Charles wich meinem Blick nicht aus. »Darüber werden wir noch sprechen, aber ich möchte dir erst etwas zeigen. Dann verstehst du möglicherweise auch besser, warum ich getan habe, was ich tun musste.«
Was hatte ich schon groß zu verlieren, wenn ich ihm zusicherte, mich am Riemen zu reißen? Bloß einen weiteren Aufenthalt im Salon-Knast, bis ich genauso zombimäßig in der Ecke stand wie Butler Parzival.
Ich hielt meine Finger zum Schwur hoch. »Versprochen, ich benehme mich.«
»Das wäre für uns beide von Vorteil. Ich würde nur ungern die Rolle des freundlichen Gastgebers aufgeben.«
Mit dieser kaum verhohlenen Drohung öffnete Charles die Flügeltür.
Dahinter lag ein überdimensionaler Wintergarten, der trotz seiner Glasfronten keinen Ausblick nach draußen gewährte. Hinter den Scheiben rankte Efeu, und wo sich vorne eine Lücke auftat, war dahinter nichts als weiterer Efeu auszumachen.
Willkommen im spooky Oxford einer magischen Parallelwelt.
Der Wintergarten, der von zierlichen Trägern aus Schmiedeeisen gehalten wurde, war jedoch von einem hellen Leuchten erfüllt. Ganz sanft sorgte es für ein heimeliges Gefühl, während alle anderen Räume bislang nur diese bleierne Leblosigkeit ausgestrahlt hatten. Überall standen Kübel mit Pflanzen, die sich bei näherer Betrachtung als kunstvolle Papierarbeiten herausstellten. Auch die Blumensträuße, die dekorativ auf Beistelltischen standen, waren aus Seidenpapier gebunden. Sogar ein paar Origamischmetterlinge saßen auf ihren Blüten. Von irgendwoher erklang leise klassische Musik, offenbar spielte jemand Klavier in einem der angrenzenden Zimmer.
Die Stimmung in diesem Raum war zart, fast unwirklich. Nun verstand ich, warum Charles mich um Zurückhaltung gebeten hatte. Etwas anderes war hier gar nicht möglich.
Als wir die Mitte des Wintergartens erreichten, war ich so vom Zauber dieses Ortes gefangen, dass ich Charles und die Bedrohung, die von ihm ausging, beinahe vergessen hatte. Es war, als könnte man hier einfach alles vergessen und die Zeit verstreichen lassen, als ob man ihrer Wirkung enthoben sei. Ein endloser Dämmertag voller Müßiggang.
Bevor ich mich jedoch völlig in der Stimmung verlor, ließ mich ein Hüsteln herumfahren.
In einer Sitzgruppe aus Gartenmöbeln, die von riesigen Farnen aus Pergamentpapier umrahmt war, saß ein etwa zehnjähriges Mädchen in einem weißen Kleid, das mit einer Seidenschärpe verziert war. Sie hielt sich so kerzengrade, als würde ihre Gouvernante mit einem Lineal hinter ihr stehen und keinen Spaß verstehen. Auf dem Schoß des Mädchens lag ein aufgeschlagenes Buch, das mit seinem blauen Seideneinband das einzig Farbige an ihr war. Wobei die Kleine im Gegensatz zu dem merkwürdigen Diener im Esszimmer trotz ihres Schwarz-Weiß-Looks überaus lebendig wirkte. Doch etwas anderes an ihr war noch viel interessanter: Selbst im Dämmerlicht war die Ähnlichkeit zu Charles nicht zu übersehen. Sie musste seine kleine Schwester sein.
Mit großen Augen schaute das Mädchen mich an. »Wer bist denn du?«
»Madeleine, wenn ich bitten darf! Wo sind deine Manieren?«, wies Charles sie mit gespielter Empörung zurecht.
Beim Klang von Charles’ Stimme fuhr ich zusammen, weil er schon wieder so dicht neben mir stand. Oder sich vielmehr an mich herangeschlichen hatte. Als wäre ich ein Ofen, an dem er sich wärmen wollte. Das wurde langsam echt unangenehm.
Kichernd sprang Madeleine auf und deutete einen Knicks an, ohne jedoch ihr Buch aus der Hand zu legen. Dafür war es eindeutig zu wichtig, sie drückte es an ihre Brust, als wäre es ihr Lieblingskuscheltier.
»Herzlich willkommen im Wintergarten der Familie Lafon-Boutary, verehrter Fremder«, begrüßte sie mich. »Wenn ich mich vorstellen darf? Ich bin Madeleine und meines Zeichens die jüngste Schwester des guten Charles.«
»Wie überaus bezaubernd, Ihre Bekanntschaft zu machen, meine verehrte Madeleine«, hielt ich ganz gesittet dagegen. Man konnte über meine Umgangsformen sagen, was man wollte, aber die Zeit mit Emilia hatte Spuren hinterlassen. »Mein Name ist Nathan und ich bin zu Gast in diesem ehrwürdigen Haus. Deshalb darfst du mich auch duzen.«
Madeleines Lächeln zeigte zwei süße Grübchen – die hatte Charles eindeutig nicht. »Wie nett. Besonders da wir dieser Tage so selten Besuch bekommen. Eigentlich nie. Irgendwie gleicht ein Tag dem anderen in dieser Nebelsuppe. In dem Sinne finde ich es doppelt schön, dass du zu uns gekommen bist. Charles schenkt mir hin und wieder Bücher, sonst hätte ich vor Langeweile bestimmt schon Spinnweben angesetzt.«
»Ich weiß genau, was du meinst«, sagte ich. »Bücher können nicht nur die besten Freunde sein, sondern einem wortwörtlich das Leben retten. Oder auch einen drögen Nachmittag, an dem sonst absolut nichts passiert.« Als Einzelkind mit Eltern, die zeitweise sogar mehrere Jobs gleichzeitig hatten, um uns über Wasser zu halten, wusste ich, wovon ich sprach. Gegen Alleinsein half nichts so sehr wie eine richtig gute Story zwischen zwei Buchdeckeln. »Was für Geschichten magst du denn ganz besonders?«
Damit punktete ich offenbar bei Madeleine, denn sie kam mutig geworden auf mich zu. »Ich liebe fantastische Geschichten!«, platzte es aus ihr raus. »Du weißt schon, solche, in denen lauter Sachen passieren, bei denen man aus dem Staunen gar nicht mehr rauskommt. Obwohl Charles meint, eine derartige Lektüre sei nichts weiter als lächerliche Zeitverschwendung.«
»Charles hat offensichtlich nicht die geringste Ahnung von guten Geschichten. Darf ich mir dein Buch mal anschauen?« Dieses Mädchen hatte etwas an sich, das ich auf Anhieb mochte. Vielleicht lag es auch daran, dass ich mir immer eine kleine Schwester gewünscht hatte. Wobei ich ihr vor allem Comics und keine dicken Wälzer geschenkt hätte.
Entsprechend gerührt war ich, als Madeleine mir ihr blau gebundenes Buch reichte. Es handelte sich um ein Kinderbuch namens ›Lorena im Ordinary-Land – die Abenteuer einer unbedarften Elevierten hinterm Schleier‹ von L.C. Anonymus. Allem Anschein nach das Gegenstück zu ›Alice im Wunderland‹ für Leute, die sich eine Welt ohne Magie kaum vorstellen konnten. Sozusagen abgefahrene Fantasy für Elevierte.
»Klingt richtig spannend«, sagte ich.
»Ist es auch«, stimmte Madeleine mir zu. »Lorena erlebt lauter verrückte Abenteuer hinter dem Schleier. Dort gibt es schwarze, koffergroße Rechtecke, auf denen Theaterstücke gezeigt werden. Kleine Roboter, die den Rasen mähen – aber nicht sprechen können. Und Menschen, die Magie für faulen Zauber halten. Es ist zum Totlachen, wie sie sich eindeutig übersinnliche Phänomene mit allerlei Unsinn erklären. Dieser Anonymus hat eine blühende Fantasie! Wie er sich die Welt der Ordinarys vorstellt, ist so unterhaltsam.«
»Würdest du die Welt der Ordinarys denn gern einmal besuchen?«, fragte ich.
Madeleine schaute mich mit der Offenheit eines Kindes an. »Natürlich, nichts lieber als das. Aber wir, die Toten, dürfen nicht dorthin reisen.«
Die Toten?
Mir fiel das Buch aus den Händen. Krachend schlug es auf den Boden knapp vor Madeleines Ballerinas. Ich schaffte es nicht, mich danach zu bücken. Eigentlich vergaß ich in diesem Moment sogar zu atmen.
Dieses Mädchen hatte sich eben als Tote bezeichnet. Das war doch wohl nicht wahr.
Charles hob das blaue Buch an meiner Stelle auf, wobei er mir einen warnenden Blick zuwarf. Das war wohl der Augenblick, an dem ich Zurückhaltung an den Tag legen sollte.
»Mein Liebes, warum läufst du nicht in die Bibliothek und holst dein Lieblingsbuch über die Tierwelt im Ordinary-Reich?«, schlug er seiner Schwester vor. »Es dürfte Nathan gewiss brennend interessieren, was dort alles an aberwitzigen Kreaturen gezeigt wird.«
Madeleine musterte mich, als wäre sie unsicher, ob sie das wirklich glauben sollte.
Ich rang mir ein Lächeln ab. »Gibt es in deinem Tierbuch auch Nilpferde? Für die habe ich nämlich eine Schwäche.«
Sofort hellte sich Madeleines Miene auf. »Ich liebe Nilpferde auch! Hast du schon mal eins in echt gesehen? Wenn ja, musst du mir alles darüber erzählen. Einen Moment, ich bin gleich wieder mit dem Bildband zurück!« Mit einer Begeisterung, wie sie nur Kinder aufbringen können, sauste sie davon – kein bisschen damenhaft übrigens.
Kaum hatte Madeleine das Gewächshaus verlassen, wurde es bedrückend still. Und düster. Als habe sie das zarte Licht, das eben noch alles in so eine entspannte Stimmung getaucht hatte, mitgenommen. Sogar die Klarviermusik wirkte plötzlich wie lustloses Geklimper.
Charles blätterte in ›Lorena im Ordinary-Land‹, ganz so, als habe seine Schwester eben nicht eine Bombe platzen lassen.
»Madeleine ist tot?« Es hatte ja wohl wenig Sinn, um den heißen Brei zu reden.
Mit verkniffener Miene nickte Charles.
»Dann ist Madeleine ein Geist, genau wie euer Diener im Esszimmer«, hakte ich nach.
»Geister haben keine Körper«, berichtigte mich Charles.
Langsam verlor ich die Geduld. »Also umgibst du dich mit Zombies. Oder seid ihr allesamt Vampire, nur dass du mit Abstand der bestgenährte von ihnen bist und deshalb ganz extravagant Farbe trägst?«
»Rede keinen Unsinn«, zischte Charles mich an. »Dieses Haus wurde von einem Schwarzen Bann getroffen, der jeden, der sich darin befand, getötet hat. Das Ziel des Banns war es, sämtliche Materie – ob belebt oder nicht – binnen eines Augenblicks in nichts aufzulösen. Mir ist es in der wortwörtlich letzten Sekunde gelungen, das Haus und alles, was sich darin befand, der Zeit zu entreißen. Meine Lieben sind gestorben, aber ihre Seelen haben ihre Körper nie verlassen, weil für sie die Zeit stillsteht. Ich konnte sie gerade noch in diesem speziellen Zustand zwischen Leben und Tod konservieren, damit sie bei mir bleiben.«
Klar. Das verstand ich doch total. Ich konnte mir selbstverständlich auch was unter einem Schwarzen Bann vorstellen. Und dass wir Menschen Seelen haben, war für mich als Wissenschaftsnerd natürlich auch eine ausgemachte Sache. Nur dass man die durch Magie irgendwie auch nach dem Tod festhalten konnte, war so eine gruselige Vorstellung, dass ich lieber gar nicht erst darüber nachdachte.
Ich verschränkte die Arme vor der Brust, weil mir plötzlich kalt war. »Nehmen wir mal an, dass ich als Ordinary keine Ahnung habe, wovon du redest. Könnte man in dem Fall sagen, dass du deine Schwester und den Rest eures Haushaltes mit einem Zauber konserviert hast? Und jetzt existiert Morgue Manor in einer dieser Schneekugeln, unberührt vom normalen Zeitgeschehen …«
»Könnte man«, bestätigte Charles. »Madeleine ist nun schon seit über zweihundert Jahren ein zehnjähriges Mädchen. Und sie wird niemals mehr auch nur einen Herzschlag altern. Sobald die von mir beschworene Magie verblasst, wird Madeleine vom Strom der Zeit unweigerlich fortgerissen werden. Und nicht nur meine kleine Schwester, sondern auch der Rest meiner Familie und die Angestellten, die sich bei dem feigen Anschlag damals in unserem Haus befanden. Leider verblassen einige von ihnen trotz meiner Bemühungen zusehends, so wie bereits viele Einrichtungsgegenstände zu Staub zerfallen. Wegen des Schleiers ist es mir so gut wie unmöglich, das nötige Energielevel aufrechtzuerhalten.«
»Dann bist du kein Toter?« Die Frage schien mir durchaus angebracht. Schließlich hatte Charles gesagt, dass er diesen Zauber bereits vor zweihundert Jahren gewirkt hatte.
»Natürlich nicht«, schnaufte Charles abfällig. »Tote verlieren ihre Aura und können deshalb keine Magie mehr wirken. Deshalb ist meine Familie ja auch restlos auf mich angewiesen. Dass du aber auch rein gar nichts über solche grundlegenden Dinge weißt, ihr Ordinarys seid noch ahnungsloser, als euer Ruf besagt. Es ist mir ein Rätsel, wie ihr es schafft, jenseits des Schleiers ohne die Hilfe von uns Elevierten zu überleben.«
»Das schaffen wir sogar so gut, dass ihr Elevierten Bücher über unsere unmagische, aber faszinierende Welt schreibt.« Unter anderen Umständen wäre mir noch der ein oder andere Satz zum überflüssigen Ordinary-Bashing eingefallen. Aber es war viel spannender zu erfahren, wie die kleine Madeleine eine Tote sein konnte, wenn sie auf mich doch so lebendig wirkte. Mal ganz abgesehen davon, dass ich schon gern erfahren wollte, warum genau Charles es auf mein Blut abgesehen hatte. Zumindest konnte ich mir jetzt schon zusammenreimen, dass die von ihm gewirkte Blutmagie seinen verfluchten Familiensitz vor dem Zerfall bewahrte.
»Dann warst du damals unterwegs, als der Schwarze Bann euer Haus getroffen hat«, überlegte ich laut.
Ein Schatten legte sich über Charles’ Gesicht, fast als bereue er, dass er in diesem Augenblick nicht bei seiner Familie gewesen war. »Es war ein sorgfältig vorbereiteter Hinterhalt – und ich wäre normalerweise auch sein Opfer geworden. Nur durchbricht ein Mann manchmal seine Routine. Ich machte einen Gang vor die Tür, um die Abendsonne zu genießen, denn ich wähnte unser Haus gut verborgen hinter einem sorgfältig komponierten Schutzwall. Aber kein Schutzwall hält, wenn seine Grund-Rune verraten wird. Ich war damals ein junger Mann, der seinen angeblichen Freunden blind vertraute. Vielleicht sind sie mir sogar wichtiger gewesen als meine Liebsten, sonst wäre es nie so weit gekommen. Ein Fehler, den ich mir nie verzeihen werde.«
Damit gestand Charles zwei Dinge ein: dass er sich und seine Familie vor Feinden versteckt gehalten hatte. Und dass jemand, dem er vertraut hatte, sich gegen ihn gewandt hatte. Klang ganz so, als ob er einem verbotenen Zirkel angehört hatte, dem der Garaus gemacht worden war. Unwillkürlich musste ich an die Asche am Grund des Bücherturms von Silvercliff Hall denken, unter der angeblich die Gebeine jener Elevierten lagen, die sich vom lichten Weg der Magie abgewandt hatten. Allem Anschein nach war Charles diesem Schicksal nur knapp entgangen. Und das vor über zweihundert Jahren. Welche Art von Magie hielt einen so lange am Leben? Nur Hass und Rachsucht konnten es doch wohl kaum sein.
»Ist das alles passiert, bevor der Schleier unsere Welten geteilt hat, oder erst danach?«, fragte ich.
So wie sich Charles’ Blick verfinsterte, hatte ich ins Schwarze getroffen. »Hätte man mich damals nicht in solch eine verzweifelte Lage gebracht, hätten ich und meine Verbündeten den Schleier zu verhindern gewusst. Du denkst vielleicht, dass der Schleier ein Geschenk für euch Ordinarys war, aber das stimmt nicht. Ihr habt vergessen, dass ihr einer magischen Welt angehört, auch wenn ihr sie nicht beherrschen konntet. Aber ihr wusstet es wenigstens. Als sich der Schleier über euch gesenkt hat, seid ihr auf das Niveau der grauen Vorzeit zurückgeworfen worden. Ihr habt angefangen, euren Kindern Gruselgeschichten über Hexen und Nachtalbe zu erzählen, weil ihr euch nicht anders erklären konntet, dass tief in euch drin ein Wissen sitzt, an das ihr nicht mehr rankommt. Aber auch für uns Elevierte hat die Trennung einen unaufwiegbaren Verlust mit sich gebracht. Denn nun können wir uns nicht länger mit euch verbinden. Dabei wird erst dadurch wahre Magie möglich. Wir Elevierten brauchen euch Ordinarys, um wahrhaft große Werke zu erschaffen, ihr seid unser Anker im Meer der Wilden Magie. Ohne euch konnten wir Elevierten sie nur aussperren und behaupten, dass wir keinen Wert auf diese Kunst legen.«
»Augenblick mal. Wenn du von Verbinden sprichst, meinst du dann eine Auren-Verbindung?« Als ich das Wort laut aussprach, wurde mir wieder bewusst, wie sehr ich es vermisste, Emilia durch die zarten Silberfäden, mit denen unsere Auren verknüpft gewesen waren, zu spüren. Seit Charles mich durch den Spiegel gezerrt hatte, war die Verbindung wie abgeschaltet, vielleicht sogar zerstört. Nach dem, was Charles erzählt hatte, lag es daran, dass Morgue Manor aus der Zeit herausgelöst existierte. Ich hoffte jedenfalls, dass es nur das war.
»Auren-Verbindungen sind eine Möglichkeit des Zusammenspiels zwischen Elevierten und Ordinarys, allerdings sind sie eher romantischer Natur«, sagte Charles. »Es gibt aber noch sehr viel mehr, je nach Ziel und Zweck. Du hast persönlich schon eine andere, viel machtvollere Form der Verbindung kennengelernt.«
»Durch Blutmagie«, flüsterte ich.
Wie aufs Stichwort glomm der Hunger in Charles’ Augen auf. »Dein Blut ist so unfassbar stark, weil es nicht durch die Magie kontaminiert ist. Es fließt ganz rein und kann von dem, der es empfangen darf, in Lebenskraft umgewandelt werden. Ein paar freiwillig von dir gegebene Tropfen haben ausgereicht, um Madeleine wieder so lebendig werden zu lassen, dass ihr Lachen die Räume erfüllt. Darauf habe ich viel zu lange verzichten müssen.«