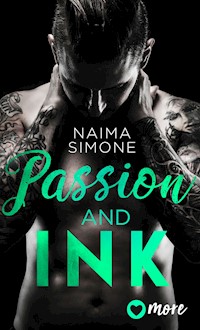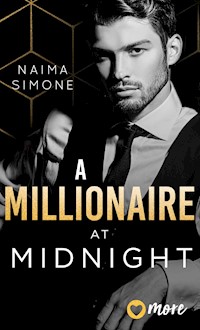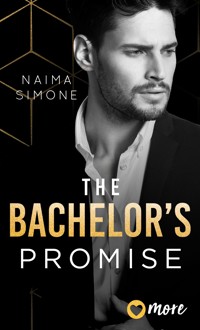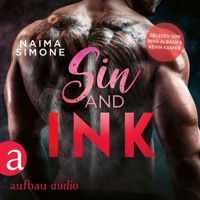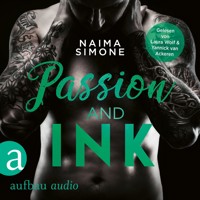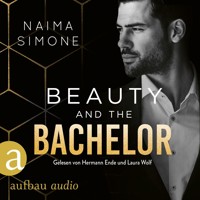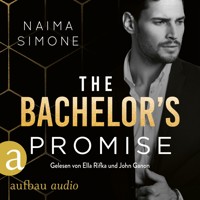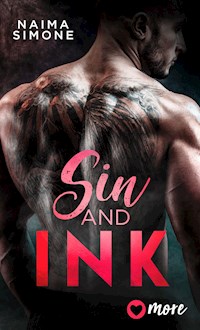
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sweetest Taboo
- Sprache: Deutsch
Es gibt alltägliche Sünden, schlimme Sünden und Sünden, für die man direkt in der Hölle landet. Das ist dann wohl mein Schicksal - denn ich liebe die Frau meines verstorbenen Bruders. Heimlich natürlich, denn keiner in meiner Familie würde diese Liebe tolerieren. Und ich habe geschworen, mich von ihr fernzuhalten. Doch jeden Tag mit Eden zusammenzuarbeiten, sie den ganzen Tag zu sehen, macht es mir unglaublich schwer, meine Gefühle im Griff zu halten. Was tun? Ich habe keine Ahnung. Nach meiner Karriere als MMA Champion habe ich mir mit meinem Tattoo Shop „Hard Knox“ eine neue Existenz aufgebaut. Eden war immer mit dabei, denn sie ist nun mal die Beste in ihrem Job. Deshalb werde ich mir weiterhin nichts anmerken lassen.
Immer öfter frage ich mich, ob manche Sünden es wert sind, dass man alles andere verliert …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Liebe Leserin, lieber Leser,
Danke, dass Sie sich für einen Titel von »more – Immer mit Liebe« entschieden haben.
Unsere Bücher suchen wir mit sehr viel Liebe, Leidenschaft und Begeisterung aus und hoffen, dass sie Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Freude im Herzen bringen.
Wir wünschen viel Vergnügen.
Ihr »more – Immer mit Liebe« –Team
Über das Buch
Es gibt alltägliche Sünden, schlimme Sünden und Sünden, für die man direkt in der Hölle landet. Das ist dann wohl mein Schicksal – denn ich liebe die Frau meines verstorbenen Bruders. Heimlich natürlich, denn keiner in meiner Familie würde diese Liebe tolerieren. Und ich habe geschworen, mich von ihr fernzuhalten. Doch jeden Tag mit Eden zusammenzuarbeiten, sie den ganzen Tag zu sehen, macht es mir unglaublich schwer, meine Gefühle im Griff zu halten. Was tun? Ich habe keine Ahnung. Nach meiner Karriere als MMA Champion habe ich mir mit meinem Tattoo Shop »Hard Knox« eine neue Existenz aufgebaut. Eden war immer mit dabei, denn sie ist nun mal die Beste in ihrem Job. Deshalb werde ich mir weiterhin nichts anmerken lassen.
Immer öfter überlege ich, ob manche Sünden es wert sind, dass man alles andere verliert …
Über Naima Simone
Die USA Today-Bestsellerautorin Naima Simone schreibt seit 2009 Romances und Liebsromane. Sie ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann und ihren Kindenr im Süden der USA.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Danksagungen
Impressum
Lust auf more?
Simone Naima
Sin & Ink
Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Charlotte Petersen
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Danksagungen
Impressum
Für Gary. 143.
»Das Leben bemisst sich nicht in der Zahl unserer Atemzüge, sondern in der Zahl der Augenblicke, die uns den Atem rauben.«
- Maya Angelou
Kapitel 1
KNOX
Es gibt so einige Sünden, für die man in die Hölle kommt.
Blasphemie.
Mord.
Götzenanbetung.
Die Frau deines toten Bruders zu begehren, vor allem, wenn du für seinen Tod mitverantwortlich bist, toppt vielleicht nicht die Blasphemie, steht aber auf jeden Fall auf der Liste.
Was bedeutet, mein Schwanz und ich haben ein One-Way-Ticket für die Fahrt zur Hölle gebucht.
»Sieht prima aus. Gute Arbeit«, lobt mich meine persönliche Todsünde über meine Schulter hinweg. Eden Gordon, meine Schwägerin – oder ehemalige Schwägerin, Scheiße, ich kenne mich mit so was nicht aus –, richtet sich wieder auf. Gott sei Dank. Ich bekomme wieder Luft. Als sie sich über mich gebeugt hat, ist mir ihr Duft in die Nase gestiegen. Wie Pfirsiche unter der Sommersonne – warm, süß, sinnlich und verdammt nochmal zum Reinbeißen.
Während ich die letzten Farbnuancen und Schattierungen auf der Schulter der jungen Frau vollende, die vor mir auf dem Stuhl liegt, beuge ich mich dichter über sie. Nicht etwa, weil ich plötzlich so kurzsichtig wäre wie Mr. Magoo, sondern um ein bisschen mehr Abstand zwischen Eden und mich zu bringen. Abstand zu ihr ist gut.
Schließlich richte ich mich auf, schalte die Maschine aus und sprühe das Tattoo mit einem Gemisch aus Grüner Seife und Wasser ein, um überschüssige Tinte und Blut abzuspülen. Eden hat recht. Der Schmetterling ist wunderschön – ein dreidimensional wirkendes Kunstwerk in Türkis, Violett und Schwarz, das geradewegs von der Haut der Frau loszufliegen scheint.
Wenn ich noch einen verfluchten Schmetterling auf die Haut irgendeiner Studentin tätowieren muss, versetze ich mir selbst einen Schlag in die Eier. In Chicagos »Loop U« sind Zehntausende eingeschrieben, und ich schwöre, jede Studentin, die Hard Knox Ink betritt, um ihre Tattoo-Jungfräulichkeit zu verlieren, will einen Schmetterling.
Dem Quietschen nach zu urteilen, mit dem sie sich vor dem Spiegel hin und her dreht, gefällt dieser Loyola-Studentin das Ergebnis. Angesichts ihrer Freude – so wie bei jedem anderen zufriedenen Kunden auch – durchrieselt mich warme Befriedigung, die mit nichts anderem vergleichbar ist.
»Ich. Liebe. Es.« Breit grinsend wirbelt sie herum.
»Das Abkassieren übernehme ich«, sagt Eden und legt mir eine Hand auf den Rücken. Fuck. Kurz schließe ich die Augen. Die flüchtige Berührung fühlt sich an, als hätte ich einen Schweißbrenner verschluckt. Eigentlich müsste sie sich die Handfläche verbrennen, denn verdammt, die Hitze frisst sich quer durch Haut und Muskeln. Und ich will es so. Ich verzehre mich nach diesem Brennen.
Nickend senke ich den Kopf und gebe vor, mich darauf zu konzentrieren, meine Handschuhe auszuziehen und die gebrauchten Farbkappen zu entsorgen. Mein Kiefer ist so verspannt, dass es mich nicht wundern würde, wenn etwas kaputtginge.
Eden ist sehr berührungsfreudig. Ständig umarmt sie irgendwen, streicht den Leuten sanft über Wangen, Haar und Arme. Zuneigung – und diese zu bekunden – liegt in ihrer Natur. Ihre liebevollen Berührungen sind, als fielen Meisterschaftssiege, Orgasmen und Weihnachten auf einen Tag. Außerdem sind sie die reinste Hölle.
Und ich sehne mich danach, sammle diese Augenblicke.
Ich bin ein gieriger, gottverdammter Masochist.
»Danke. Genau so habe ich es mir vorgestellt«, schwärmt die brünette Studentin weiter und dreht sich wieder zum Spiegel, um noch mal ihr neues Tattoo zu bewundern.
Mit ihrem langen, glänzenden Haar, der Jeans, die offensichtlich schon mit Rissen aus der Fabrik kam, und der Halskette, deren einzelner Diamant auf ihrem Schlüsselbein ruht, sieht sie aus wie eins dieser Mädchen von der Goldküste. Vielleicht stammt sie aber auch aus einer Nordküstenvorstadt mit Villen, Golfplätzen und Country-Clubs.
Ob ihre Eltern überhaupt wissen, dass sie sich im Ukrainischen Dorf rumtreibt und sich von einem früheren MMA-Kämpfer tätowieren lässt? Höchstwahrscheinlich nicht. Die würden sich vor lauter Angst um ihr Töchterchen glatt in die Designerhose scheißen.
»Komm, ich deck’s dir ab.« Ich räume die Farben weg und öffne die zweitoberste Schublade meiner Workstation, in der ich Gaze und Tape aufbewahre.
»Vor ein paar Wochen waren Freunde von mir hier«, sagt sie, kommt zu mir und dreht mir ihren Rücken zu. »Sie haben gesagt, du wärst der Beste.« Sie wirft mir über die Schulter einen raschen Blick zu. Ihr Lächeln veranlasst mein geistiges Ach-du-Scheißometer dazu, einen schrillen Alarmton auszustoßen. Laut ihrem Führerschein ist sie zwanzig, aber ihrem Lächeln und dem Wie-wär’s-mit-uns-Funkeln in ihren Augen nach ist dieses Mädchen in ihrer Vorstadt schon weit rumgekommen. »Jetzt weiß ich, dass es nicht gelogen war. Du bist phantastisch.« Verdammt, sie schnurrt eher, als dass sie spricht.
»Danke. Freut mich, dass es dir gefällt.« Ich schneide ein Stück Gaze ab und lege es behutsam auf ihre Haut, dann fixiere ich es auf beiden Seiten mit Tape. »Lass das mindestens eine Stunde drauf.«
»Mach ich«, verspricht sie und dreht sich zu mir um. »Stimmt es, dass du mal MMA-Kämpfer warst?«
Ich werfe Gaze und Tape zurück in die Schublade. »Jap.«
Die meisten Leute hätten meine knappe Antwort richtig interpretiert und wären so rasch wie möglich verschwunden, doch sie denkt nicht dran. Stattdessen fährt sie mit den Fingerspitzen über die Tattoos auf meinem Unterarm, die freiliegen, weil ich die Ärmel meines schwarzen Henley-Shirts hochgekrempelt habe. Fährt das Familienstammbaum-Tattoo nach, streicht über das verblasste braune Blatt, das vom Zweig abfällt …
Ich unterdrücke den Impuls, zurückzuzucken. Ziehe langsam den Arm weg. Aber sie legt ihre Finger stattdessen flach auf meine Bauchmuskeln. Schiebt die Hand tiefer, lässt sie über den Gürtel gleiten und noch tiefer, bis sie direkt über meinem Schwanz liegt. Krümmt die Finger darum. Und drückt zu.
Es passiert nicht zum ersten Mal, dass eine Kundin mich anbaggert, mir Pussy oder Mund anbietet. Verdammt, es ist nicht mal das erste Mal, dass mir eine Kundin an den Schwanz fasst. Trotzdem durchzuckt mich die Verblüffung wie ein Blitz. Ein kleiner Flirt, ja, damit hab ich gerechnet. Aber ich hab das Mädchen unterschätzt.
»Und noch was, bei dem mich meine Freundinnen nicht belogen haben: Du bist höllisch heiß«, murmelt sie, die blauen Augen dunkel vor Lust.
Ich weiß, was sie sieht, wenn sie mich anblickt: einen großen, tätowierten Scheißkerl, entweder ehemaliger Kämpfer oder Ex-Knacki. Vielleicht auch beides. Sie sieht einen Mann, der jetzt eigentlich die Tür schließen sollte, um sie gegen die Wand zu drücken und erbarmungslos durchzuvögeln, direkt unter der gerahmten Schwarz-Weiß-Fotografie einer Frau, die mein Werk auf dem Rücken trägt.
Ganz falsch liegt sie nicht. Mit beidem. In meinen neunundzwanzig Lebensjahren habe ich ebenso auf der Kampffläche gestanden wie auch auf beiden Seiten des Gesetzes. Und nach einem Kampf, wenn mir noch das Adrenalin durch die Adern toste, hatte ich nie Schwierigkeiten, im Club, in der Bar oder sogar direkt am Rand der Kampffläche eine Frau aufzugabeln, der ich willig meine verbliebene Restenergie schenkte. Auch heute noch bin ich alles andere als ein Heiliger oder Mönch. Sex ist immer noch ein Ventil für mich – vielleicht sogar mehr als früher, als ich meine Kämpfe hatte.
Da hat sie allerdings Pech gehabt. Ich vögle keine Kundinnen. Oder Angestellte. Ich scheiße nicht da, wo ich esse. Das ist, als würde man es geradezu drauf anlegen, in Schwierigkeiten zu geraten.
Doch auch unter anderen Umständen hätte ich die Einladung ihrer streichelnden Hand nicht angenommen. Das Mädchen ist zu verdammt jung.
Sie ist nur ein paar Jahre jünger als Eden.
Ja, und Eden ist noch mehr tabu als diese Studentin.
Behutsam, aber fest nehme ich ihr Handgelenk und ziehe ihre Hand von meinem Schritt weg. »Danke«, antworte ich auf ihr voriges Kompliment. »Du kannst dann vorn zahlen.«
Fast erwarte ich, dass sie rausstürmt und dabei Arschloch zischt oder so was in der Art, irgendeinen dramatischen Abgang. Stattdessen verzieht sie die Lippen zu einem verruchten Lächeln, bei dem die Verbindungsjungs an der Loyola vermutlich direkt in ihren Khaki-Shorts kommen.
Verdammt, in mir regt sich glatt ein Funke Mitgefühl für ihre Eltern. Bestimmt geben sie die ganze Zeit schicke Dinnerpartys in ihrem protzigen, gut eingezäunten Haus und leben in seligem Unwissen, glauben, ihr kostbares, hübsches Töchterchen sei gerade an ihrer Uni, voll und ganz damit beschäftigt, zu lernen und irgendwelchen Schwesternschaft-Mädchenscheiß abzuziehen. In Wirklichkeit steht sie in einem Tattoo-Studio – in einem Viertel, das ihnen Herzrhythmusstörungen bescheren würde –, und bietet einem ehemaligen Profikämpfer einen Handjob an.
Einer der vielen Gründe, weshalb ich keine eigenen Kinder will.
Sie brechen dir auf jeden Fall das Herz.
Wenn jemand auf der Welt das weiß, dann ich, da ich meinen Eltern die Herzen in so viele Einzelteile zerbrochen habe, dass sie an Puzzle erinnern. Mit ein paar fehlenden Teilen.
Der vertraute brennende Schmerz frisst sich in meine Brust wie Säure, umso schmerzhafter dadurch, dass er so vertraut ist.
»Man trifft sich bestimmt mal«, sagt sie, schlendert hinaus und hinterlässt eine Duftspur ihres blumigen Parfums. Riecht verdammt teuer. Kann aber trotzdem nicht mit jenem Duft nach Sommer und Pfirsichen konkurrieren, den ich selbst mitten in einer Parfumfabrik voller geöffneter Flakons noch identifizieren könnte.
Kopfschüttelnd greife ich nach der Flasche mit dem Desinfektionsmittel. In den nächsten Minuten bin ich damit beschäftigt, das schwarze Leder der Sitzfläche und die Armlehnen des Massagestuhls zu putzen, den ich bei Schulter- und Rückentattoos benutze. Dann klappe ich ihn zusammen, schiebe alles an die Wand und gehe zur Tür.
Als ich in den Hauptraum des Studios trete, dröhnt mir eine alles zermalmende Mischung aus Metal, Elektro und Klassik entgegen: Igorrrs Hit ieuD. Das erstklassige Soundsystem habe ich gleich beim Einzug installiert, als ich vor drei Jahren den Laden gekauft habe. Der hämmernde Heavy-Metal-Sound wird vom Surren der Tattoomaschinen und dem Hintergrundsummen von Stimmen untermalt.
Dies ist mein Zuhause. Ein Zuhause, das ich mir geschaffen habe, gemeinsam mit der Familie, in die ich nicht hineingeboren wurde, sondern die ich mir selbst gesucht habe.
Vor Stolz schwillt mir die Brust, so wie immer, wenn ich hereinkomme und mir bewusst wird, welch ein Glück ich habe, das tun zu können, was ich liebe. Durch das große Schaufenster blickt man auf die geschäftige North Western Avenue mit ihren Bars und Cafés hinaus. Eine Wand besteht aus nackten Ziegelsteinen, der Raum ist groß und offen, gesprenkelt mit lauter Arbeitskabinen. An den Wänden hängen Gemälde und Portfolios mit Schablonen, Zeichnungen und Bildern von fertigen Tattoos.
Vor dem langen Tresen stehen mehrere Vitrinen mit Hard-Knox-Ink-Merchandise – T-Shirts, Mützen, Ketten, sonstigem Schmuck. Edens Idee. Nach meinem Abschied aus der BFC, der Bellum Fighter Championship, hatte ich beschlossen, diesen Teil meines Lebens vollkommen hinter mir zu lassen. Teufel auch, den Laden hatte ich nur deshalb nach meinem alten Spitznamen benannt, weil mein Bruder darauf bestanden hatte. Zu mehr Zugeständnissen war ich nicht bereit gewesen.
Aber nachdem ich ein Jahr darauf Eden für den Empfang eingestellt und sie später zur Geschäftsleiterin befördert habe, hat sie mir mitgeteilt, es sei dumm, kein Kapital aus meiner früheren Karriere und Reputation zu schlagen. Sie hat mich so lange bearbeitet, bis ich nachgab. Ehrlich gesagt interessierte es mich nicht, weshalb die Leute herkamen. Die Arbeit von uns allen hier, einschließlich meiner, steht für sich selbst, sobald ein Kunde erst mal bei uns auf dem Stuhl sitzt. Ja, manch einer kommt vielleicht durch diese Tür, weil er wissen will, was wohl aus Hard Knox Gordon geworden sein mag, dem zweimaligen Schwergewichtsmeister der BFC. Aber die meisten kommen deshalb, weil unsere Tattoos die besten in ganz Chicago sind.
»Hey, Knox. Was zum Henker soll das sein, Mann?«, ruft Hakim Alston mir aus seiner Kabine zu. Ich höre, wie sein Stuhl über den Kachelboden rollt, und gleich darauf taucht er in seinem Türrahmen auf, die langen Dreads von einem schwarzen Bandana zurückgehalten. »Also, manches von dem Scheiß, den dein Bruder hört, kann ich ausblenden, aber das? Das ist sogar für seine Verhältnisse übel.«
»Ich kann dich hören, Arschloch«, ruft Jude aus dem Nachbarabteil. »Und ich versuche doch nur, dich mit verschiedenen Musikstilen bekannt zu machen, um deinen Geschmack auf ein höheres Level zu heben.«
»Ich hab da schon was, das sich öfter mal auf ein höheres Level hebt, und da brauch ich von dir bestimmt keine Hilfe«, kontert Hakim.
»Yeah«, sagt Heaven Travers, eine meiner Tätowiererinnen – sie hört ausschließlich auf den Namen V –, und schlendert an uns vorbei in ihre Kabine. »Darum kümmert er sich wirklich selbst. Echte Handarbeit sozusagen.«
»Nein, das ist ja wohl völliger Blödsinn«, brummt Hakim. Dann wird Igorrr von Taylor Swift abgelöst, aus der Kabine von V, unserem hauseigenen Swiftie, dringt Kichern, und er schüttelt den Kopf. »Das ist ja noch schlimmer. Dein Ernst, Knox? Ist es nicht irgendeine Art grausame Bestrafung, unter solchen Umständen arbeiten zu müssen?«
Ich schnaube. »Reich doch Beschwerde ein.« Zufällig mag ich Taylors neueste CD und höre sie manchmal beim Training. Nicht dass ich das vor Hakim oder irgendwem anders zugeben würde. So was nimmt man mit ins Grab.
Auf meinem Weg zum Tresen bleibe ich kurz stehen und spähe bei Hakim durch die Tür, um mir seine Arbeit anzusehen. Daenerys Targaryen und ihre drei Drachen bedecken einen breiten Rücken von den Schultern bis zur Taille. Eden ist ein völlig fanatischer Game-of-Thrones-Fan, nur deshalb erkenne ich die Charaktere. Hakim arbeitet schon seit Wochen an diesem Tattoo; die Outlines sind fertig, und er füllt es gerade mit Farbe auf. Und obwohl es heute in der fünften Sitzung erst zur Hälfte fertig ist, haut es mich glatt um. Wir alle haben uns auf einen bestimmten Stil spezialisiert, und Hakim ist unser Fachmann für Realismus. Das Tattoo sieht aus, als hätte man eine Seite aus einem Kunstbuch gerissen und auf den Rücken dieses Typen übertragen, so detailliert ist es, die Farbe leuchtet richtig auf der Haut.
»Verdammt, das wird echt gut«, murmle ich.
»Ich weiß.« Die Tattoomaschine erwacht in Hakims Hand summend wieder zum Leben, und er grinst mich an. »Das ist eben mein Job.«
Kopfschüttelnd gehe ich weiter Richtung Tresen und wappne mich innerlich.
Drüben in meinem persönlichen Studio habe ich mich zusammengerissen, um mich nicht umzudrehen und Eden anzustarren. Aber jetzt bleibt mir keine andere Wahl. Und da sie mir das Profil zuwendet und diese dunklen Rehaugen nicht auf mich gerichtet sind, halte ich mich nicht zurück.
Ich lasse den Blick an ihr emporwandern, von den Stiefeln hinauf über die schlanken, gut definierten Schenkel in der engen Jeans. Eden ist zierlich, nur knapp über eins sechzig, aber diese Kurven! Ich schlucke das Knurren runter, das in meiner Brust aufsteigt und sich den Weg durch meine Kehle nach draußen bahnen will. Sie hat einen runden, festen Hintern, wie gemacht dafür, sich perfekt in Männerhände zu schmiegen. Die schmale Taille betont den femininen Schwung ihrer Hüften und die vollen Brüste, die einen Hauch zu groß sind für ihre schmale, zarte Gestalt. Mit anderen Worten: Sie ist verdammt makellos.
Mein hungriger Blick wandert weiter, von den Brüsten ihren eleganten Hals hinauf. Zum verführerischen Mund. Zur geraden Nase mit den immer leicht geweiteten Nasenlöchern. Die zimtfarbenen Sommersprossen auf Wangen, Nase, Stirn und den schrägen Wangenknochen sind ein Erbe ihrer polynesischen Großmutter, so wie ihre goldene Haut, die einen unwillkürlich an einen heißen Tag am Strand denken lässt.
Das lange, dicke schwarzbraune Haar fließt ihr über Schultern und Rücken. Die Farbe erinnert mich an die Rinde der Bäume im Japanischen Freundschaftsgarten von San Jose. Intensiv. Satt. Als ich vor Jahren auf der Mixed-Martial-Arts-Schule trainiert habe, bin ich dort immer hingegangen, um nachzudenken und mich auszuruhen. In Edens Nähe fühle ich mich fast in diesen Garten zurückversetzt: Ihre Gegenwart beruhigt mich, obwohl sie mich körperlich in eine Marmorstatue verwandelt – hart wie sonst was.
Selbst in diesem Moment muss ich die Lust unterdrücken, die stets dicht unter der Oberfläche lauert und nur darauf wartet, losgelassen zu werden. Wie eine Feuersbrunst … oder ein wildes Tier. Denn so fühle ich mich in ihrer Nähe. Wie ein eingesperrtes, hungriges Tier, das auf seine Gelegenheit wartet, auf den Moment, da die Tür seines Gefängnisses nicht abgeriegelt ist, so dass es ausbrechen kann. Frei sein.
Sie streicht das Haar über die Schulter zurück, und ich sehe mehr von ihrem Profil. Und als das Tier, das ich bin, beobachte ich ihr typisches hinreißendes Lächeln, während sie der Studentin die Rechnung zum Unterschreiben hinschiebt. Die ganze Zeit stelle ich mir vor, wie die üppigen, sinnlichen Lippen mich mit genau diesem unschuldigen Lächeln beschenken, ehe sie sich im nächsten Moment öffnen und meinen Schwanz umschließen. Von ihrem Mund war ich schon immer besessen. Ich will ihn erobern, bis er wund ist, mit meinem eigenen Mund und mit meinem Schwanz. Ich will darin kommen, zusehen, wie sie alles schluckt bis auf den letzten Tropfen, und dann will ich sie wieder auf die Füße zerren und uns beide auf ihrer Zunge schmecken.
Jap, ich bin das allerdreckigste Stück Scheiße, das man sich nur vorstellen kann, weil ich solche Phantasien über die Frau meines toten Bruders habe. Vor allem, da ein Teil der Schuld an seinem Tod auf meinen Schultern lastet wie die Welt auf den Schultern des Atlas. Wir alle hatten geglaubt, er würde der Erste von uns sein, der sich eine Arbeit sucht, bei der man seinen Kopf gebraucht statt seiner Hände oder Fäuste. Stattdessen ist er mir in die MMA-Welt gefolgt. Und das war sein Tod.
Die Schuld würde mich nicht ganz so tief unter sich begraben, mich zermalmen und mir die Luft abschnüren, wenn ich Eden einfach nur vögeln wollte. Mich komplett in ihr versenken. Wenn das alles wäre, wonach ich mich verzehrte, dann wäre der dunkle Fleck auf meiner Seele vermutlich nicht so tiefschwarz.
Aber das ist nicht das Einzige, wonach ich mich sehne. Ich will alles. Ihren Körper, ihre Zuneigung … ich will, dass sie mich so ansieht wie einst Connor. Mit diesem sanften, geheimnisvollen Glanz in den Augen, der verrät, dass sie etwas miteinander teilen, das allen anderen verborgen bleibt.
Ich will sie. Ich wollte sie von dem Augenblick an, als ich sie vor fünf Jahren zum ersten Mal erblickt habe – wollte sie selbst dann noch, als sie meinen Bruder kennenlernte, sich in ihn verliebte und ihn schließlich heiratete.
Und das macht meine Sünde unverzeihlich.
Ich kann Eden niemals haben; ich darf Connors Frau niemals anrühren. Denn ja, er ist tot, aber sie wird immer seine Frau bleiben. Und ich bin es nicht wert, dieselbe Luft zu atmen wie sie, geschweige denn, sie zu berühren. Das weiß ich. Gott weiß es … meine eigene Mutter weiß es.
Frauen, die wissen, wie der Hase läuft, die bereit sind, mich in der Kabine eines öffentlichen Klos oder im Hinterzimmer einer Bar oder eines Clubs zu vögeln oder mir einen zu blasen, diese Chicks sind meine Liga. Mehr verdiene ich nicht. Schnelle, rein körperliche, namenlose Nummern.
Niemals sie.
Ich habe versprochen, die Finger von Eden zu lassen. Und nachdem ich so vieles in meinem Leben kaputtgemacht habe und in dem von anderen – Hoffnungen, Träume, Herzen –, werde ich nicht auch noch dieses Versprechen brechen.
»Hey.« Sie blickt mich an und hebt eine dunkle Braue. »Wir sind hier so gut wie fertig.«
»Danke.« Ich nicke, nehme das oberste Blatt von dem Stapel unter dem Tresen und reiche es meiner Kundin. »Hier sind die Pflegehinweise. Wie ich dir schon sagte, entferne den Verband in etwa einer Stunde. Halte das Tattoo feucht. Wir verkaufen Salben dafür.« Ich deute mit dem Kopf auf die Merchandise-Vitrinen. »Du kannst auch jede andere Salbe oder Lotion auf Vaselinebasis nehmen. Steht alles hier drin.« Ich tippe auf den Zettel. »Solltest du irgendwelche Fragen haben, ruf jederzeit an, aber eigentlich müsste die Liste alles abdecken.«
Die Anweisungen gehen mir leicht über die Lippen; im Lauf der Jahre habe ich diese Sätze mehrere Hundert Mal gesagt. Und immerhin ist es für diese Frau das erste Tattoo. Doch sie hört gar nicht hin. Stattdessen schnappt sie sich Edens Stift vom Tresen, reißt eine Ecke des Zettels ab und kritzelt etwas darauf. Ich brauche weder einen Magic-8-Ball noch ein alles sehendes Drittes Auge, um zu erraten, was sie da schreibt.
»Danke, Knox. Bis hoffentlich bald.« Mit einem Grinsen schiebt sie mir den Schnipsel hin. Eden und ich sehen zu, wie sie aus dem Laden schreitet.
»Lass mich raten.« Eden dreht sich schmunzelnd zu mir um. »Sie hat dir für deine phantastische Arbeit mehr angeboten als nur ein Trinkgeld.«
Kopfschüttelnd nehme ich den Zettel mit Namen und Telefonnummer drauf und werfe ihn in den Mülleimer. Ich werde sie nicht anrufen.
Eden schnaubt, öffnet die Kasse und legt den Kreditkartenbeleg hinein. »Hey, kann ich mal kurz mit dir reden?«, fragt sie dann und streicht sich mit einer Hand das Haar aus dem Gesicht.
Ich kneife die Augen zusammen und mustere sie. Irgendwas ist los. Ihre Mimik ist leicht zu durchschauen. Wenn sie nervös ist, weicht sie meinem Blick aus oder nimmt die Schultern zurück und drückt zugleich die Brust raus, als wollte sie sich wappnen. Oder sie stellt einen Fuß vor den anderen – es erinnert eigenartig an eine Ballettpose. Welche wäre das? Dritte oder vierte? Meine Stiefschwester hat Ballettstunden genommen, und Dan und Mom haben uns gezwungen, all ihre Aufführungen anzusehen. Es war die reinste Hölle.
Gerade beobachte ich an Eden alle drei verräterischen Anzeichen. Über was auch immer sie mit mir reden will, es muss was Ernstes sein.
»Jap«, stimme ich zu. »Hey Jude, passt du hier vorn ’ne Weile auf?«
Mein Bruder, mit summender Tattoomaschine über seinen Kunden gebeugt, sieht hoch. Der Blick seiner Augen, so grün wie meine – wie die unseres Vaters –, wandert zwischen Eden und mir hin und her. Jude und ich standen uns unter uns drei Brüdern immer am nächsten. Vielleicht weil uns nur zwei Jahre trennen. Als ich jetzt ganz leicht das Kinn hebe, versteht er mich sofort: Frag mich später.
»Klar«, sagt er.
»Komm, wir gehen in den Pausenraum.« Ich mache mich auf den Weg in den hinteren Teil des Ladens.
»Können wir lieber in dein Studio gehen?«, fragt sie in meinem Rücken, ihre Finger streifen meine Hüfte.
Bei der leichten Berührung verkrampfen sich meine Eingeweide, alle Muskeln ziehen sich zusammen. Was würde sie wohl tun, wenn sie wüsste, welch eine Wirkung sie auf mich hat? Wie würde sie darauf reagieren, wenn ihr bewusst wäre, dass ich immer, wenn ich sie ansehe, ihren Duft rieche, ihre heisere 0900-nimm-mich-Stimme höre, gegen den Impuls ankämpfen muss, sie gegen die nächstbeste Wand zu drücken und mich tief in ihr zu versenken, zuzustoßen, bis mir von ihren Schreien die Ohren klingeln und ihre Fingernägel Spuren auf meiner Haut hinterlassen?
Würde sie zusehen, dass sie so schnell wie möglich wegkommt? Mich angewidert anstarren? Dafür sorgen, dass sie niemals mit mir allein ist?
Wie sie es jetzt ist.
Ja, wenn Eden auch nur die leiseste Ahnung hätte, was für schmutzige Gedanken ich habe, würde sie mich nie im Leben darum bitten, dass wir hinter einer geschlossenen Tür allein sind, geschützt vor neugierigen Blicken.
Aber in Wirklichkeit könnte sie nirgendwo sicherer sein als bei mir. Und das nicht nur, weil sie Connors Frau ist oder weil mich ein Versprechen bindet. Sondern weil Eden mich nicht will. Schon damals vor fünf Jahren, als ich sie zum ersten Mal sah und sofort begehrte, hat sie an mir vorbeigesehen und für keinen anderen Mann Augen gehabt als für Connor.
Ich schüttle den Kopf, um die Erinnerungen und die altvertraute brennende Bitterkeit loszuwerden, die mir in die Brust zu kriechen droht. Gehe in mein Studio und warte mit verschränkten Armen darauf, dass sie die Tür schließt.
»Warum die Geheimnistuerei?«, bringe ich heraus und konzentriere mich mit aller Kraft auf ihr Gesicht und die hinreißenden Sommersprossen statt auf die Wölbung ihrer Brüste unter dem eng anliegenden schwarzen Pulli. Weil sie gerade wieder mit diesem Schultern-zurück-Brust-raus-Ding anfängt, zeichnen sie sich besonders deutlich ab. Seufzend lege ich den Kopf schief. »Warum bist du denn so nervös, Eden?«
Sie runzelt die Stirn, als hätte ich sie beleidigt. Ich unterdrücke ein Schnauben. Wohl eher: sie ertappt. »Ich bin nicht nervös«, behauptet sie und kommt näher. So nah, dass mir ihr fruchtiger Sonnenscheinduft in die Nase steigt.
Ob dieser Duft schwerer wird, satter – so wie regenfeuchte Erde –, wenn sie erregt ist? Wenn sie feucht ist?
Fuck, konzentrier dich.
»Worum geht es denn nun?«, will ich wissen, und die widerstreitenden Impulse, ihr näherzukommen und schnell hier zu verschwinden, lassen meine Stimme ganz rau klingen. »Irgendwas hast du doch.«
»Na schön«, murmelt sie und stößt die Luft aus. »Ich hab mir deine Planung angesehen, und du hast heute Abend keine Termine mehr.«
»Okay.« Wenig überraschend. Es ist Dienstag, und der Anfang der Woche ist immer ruhiger. »Und?«
»Ich …« Sie unterbricht sich, fährt sich durchs Haar und gibt ein leises Lachen von sich, zart wie Seide. »Keine Ahnung, wieso mir das so schwerfällt. Ich bin vierundzwanzig, verdammt, nicht vier.« Sie sieht mir in die Augen. »Ich will ein Tattoo.«
Verblüffung durchfährt mich. Ja, ich hab irgendwie mehr erwartet, so wie sie sich verhalten hat. Irgendwas, ich weiß nicht … Dramatischeres. Aber ich bin auch deshalb überrascht, weil Eden in Bezug auf Tattoos noch völlig jungfräulich ist. Und obwohl sie seit über einem Jahr bei mir arbeitet und ständig von Leuten umgeben ist, die mehr Tinte auf der Haut tragen als Kleidung am Leib, hat sie nie Interesse daran bekundet, daran etwas zu ändern.
»Und ich will, dass du es mir stichst«, fügt sie hinzu. »Machst du das?«
Meine Hände an ihrem Körper? Haut an Haut? Nein, zum Teufel. »Jap.«
Die Erleichterung ist ihr deutlich anzusehen, und sie nickt. Doch da ist noch mehr, sie ist noch nicht fertig. Das sehe ich an der Ballettposition ihrer Füße. Unbehagen steigt in mir auf, windet sich in meinem Bauch hin und her. Fast hätte ich ihr gesagt, dass sie es einfach gut sein lassen soll.
»Ich ziehe bei deinen Eltern aus.«
Tja. Scheiße.
Ob wir hier von einer echten Katastrophe reden, weiß ich nicht, aber ganz eindeutig wird uns ordentlich die Scheiße um die Ohren fliegen.
Kapitel 2
EDEN
Knox starrt mich an. Blinzelt. Starrt noch ein bisschen weiter.
Anscheinend hab ich ihm einen ernsthaften Schock verpasst. Dieses Blinzeln ist ein eindeutiges Zeichen. Bei Knox, der normalerweise so viele Emotionen zeigt wie die Sphinx, ist diese winzige Regung ungefähr das Äquivalent zu einem dramatischen Gefühlsausbruch.
»Und?«, bringe ich mühsam heraus und versuche nach Kräften, nicht die Hände zu wringen wie eine holde Maid in Nöten. Oder ein Teenager, der von seinen Eltern zu einem Anschiss gerufen wird. Ich bin mit einem alkoholkranken Vater aufgewachsen, früher war ich ständig so angespannt wie die Ex eines Rappers, der gerade eine neue Single veröffentlicht. Die Hände zu wringen, ist nur eine meiner vielen nervösen Angewohnheiten. Ich hasse diese deutlichen Anzeichen von Schwäche, und im Lauf der Jahre hab ich sie in den Griff bekommen. Außer in Knox’ Gegenwart. Nichts – oder vielmehr niemand – macht mich so nervös wie Knox. Er kann … einschüchternd sein. Dennoch gibt es niemanden, dem ich mehr vertraue als ihm. »Sag doch was.«
Noch ein Blinzeln. »Was.«
Ein verblüfftes Auflachen kommt mir über die Lippen, ehe ich mich bremsen kann. Manchmal scheint es mir, als wäre Knox ein paar Jahrhunderte zu spät geboren worden. Mit dem riesigen, mächtigen Körper eines Kriegers, rasiermesserscharfer Intensität und seiner kurz angebundenen lakonischen Art könnte er glatt ein Spartaner sein. Und deshalb erwischt mich sein manchmal aufblitzender trockener Humor immer wie aus dem Nichts und entzückt mich, ohne dass ich es erklären könnte. Während meine Gefühle ständig in alle Richtungen explodieren und alles und jeden beklecksen wie Schüsse aus einer Paintball-Gun, ist Knox ein Tresor, sämtliche Gefühle sind sicher hinter dieser breiten Brust weggeschlossen. Nicht einmal Connors Tod hat diese stoische Fassade bröckeln lassen. Damals habe ich ihn halb dafür gehasst, halb darum beneidet. Nur bei zwei Gelegenheiten habe ich je gesehen, wie diese steinerne Reglosigkeit von ihm abfiel. Beim Kampf … und in dem denkwürdigen Moment, als ich ihn versehentlich beim Sex beobachtet habe.
Bei der Erinnerung wandert ein glühendes Kribbeln in meinen Unterleib.
Es ist wahnsinnig unangemessen, mich so sehr von meinem Schwager angezogen zu fühlen.
»Ich weiß, es ist …« Ich zucke mit den Schultern, suche nach einem passenden Wort und finde nur ein lahmes. »Überraschend.«
Er hebt eine dunkle Braue. »Überraschend?«, wiederholt er. »Nicht ganz das Wort, mit dem ich’s beschreiben würde. Was zum Henker würde schon eher passen.«
»Das sind drei Wörter«, murmle ich, und dann seufze ich, denn ja, ich weiche aus. Himmel, manchmal fühle ich mich immer noch wie das verängstigte Kind von früher, das sich nicht traute, seine Meinung zu sagen, um bloß niemanden zu enttäuschen. Oder jemanden wütend zu machen. Schlimmes kann geschehen, wenn man einen Betrunkenen wütend macht oder auch nur reizt. Aber Knox ist nicht mein Vater. Erstens habe ich ihn niemals mehr als zwei Bier an demselben Abend trinken sehen. Und zweitens habe ich über meinen Erzeuger niemals phantasiert und mich dabei angefasst. Brrrr.
Ich kopiere Knox’ Körperhaltung, verschränke ebenfalls die Arme vor der Brust. Doch während seine Pose Zoll für Zoll die eines harten Typen ist, strahlt meine vermutlich nur Ich versuche verzweifelt, nicht die Fassung zu verlieren aus. »Ich kann ja nicht für immer bei Dan und Katherine wohnen«, sage ich und höre selbst, wie defensiv ich klinge.
»Das sehe ich auch so.«
Das nimmt mir ein bisschen den Wind aus den Segeln. Ich wische mir die Hände an den Oberschenkeln ab, bringe die paar Schritte zum schwarzen, ledernen Tattoostuhl hinter mich und lasse mich darauf fallen.
»So werden sie das nicht sehen«, murmle ich und muss nicht erklären, wen ich mit »sie« meine. Seine Mutter, sein Stiefvater und ich, wir stehen uns nah – ganz besonders seit Connors Tod. Ich schließe die Augen und atme langsam aus. Es gab eine Zeit, da hätte ich diese Worte nicht einmal denken können – Connors Tod. Connor ist gestorben. Connor. Damals hätte mich der Schmerz in Stücke gerissen, mich lebendig gehäutet. Ich hätte nicht laut geschrien, aber in mir würden Schreie nachhallen wie die einer wahnsinnigen Banshee. Jetzt, zwei Jahre später, ist die Qual zu einem ziehenden Schmerz geworden. Noch immer spürbar, jedoch erträglich. Eine Erinnerung an eine Verletzung. Manchmal, ganz kurz, denke ich gar nicht daran.
Katherines Leid hat sich nicht abgeschwächt. Ihr Schmerz ist noch immer so rasiermesserscharf wie an dem Tag, als sie erfuhr, dass ihr Sohn in der Stadionumkleide an einem aufgeplatzten Hirnaneurysma gestorben ist. Connor war – ist – ihr Sohn, und ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, ein Kind zu verlieren, ganz gleich in welchem Alter. Seitdem klammert sie sich an ihre Familie, um irgendwie durchzuhalten. Na ja – ich sehe kurz zu Knox und begegne seinem verschlossenen Blick aus grünen Augen –, an den Großteil ihrer Familie. Sie betrachtet mich als letzte lebende Verbindung zu Connor, und dass ich fortgehe, wird sie tief treffen. Sehr tief.
Aber ich kann deshalb ja nicht weiter in diesem … diesem Halbleben verharren. Auszuziehen ist nur der allererste Schritt. Als ich Connor kennengelernt habe, bin ich mit ihm zusammengezogen und habe mein Studium geschmissen, um ihn bei seiner Karriere zu unterstützen. Um einfach mit ihm zusammen zu sein. Jetzt bin ich eine vierundzwanzigjährige Witwe ohne College-Abschluss, die bei ihren Schwiegereltern wohnt. Nicht gerade das Leben, das ich mir vorgestellt hatte. Ich arbeite gern als Geschäftsführerin hier – ich liebe es sogar. Ich bin gut darin, und ich habe so viele Ideen, wie Knox noch erfolgreicher werden, seine Marke ausbauen, vielleicht sogar weitere Studios eröffnen kann. Aber um den Mut aufzubringen, ihm meine Ideen zu unterbreiten, muss ich mehr über Marketing, Werbung und das ganze Geschäft lernen. Und deshalb muss ich wieder aufs College.
Das ist Schritt zwei.
Ja, ich will endlich richtig erwachsen werden.
»Nein, werden sie nicht«, stimmt er mir erneut zu. Seine Stimme klingt weder liebevoll noch behutsam, aber das könnte ich im Augenblick auch gar nicht gebrauchen. Wenn er jetzt weicher klingen würde, wäre es möglich, dass ich einknicke, die Idee verwerfe, so wie ich es seit Monaten immer wieder tue. »Und du bist bereit, es auszuhalten?«
Wieder sind wir ganz auf einer Wellenlänge, und eigentlich muss ich nicht fragen, was er meint. »Ihre Traurigkeit? Ihre Kränkung? Das Gefühl, es wäre Verrat?« Ich schüttle den Kopf und breite die Hände aus, Handflächen nach oben. Spüre meinen eigenen donnernden Herzschlag in der Kehle, als müsste ich es ihnen jetzt sagen, genau in diesem Moment. »Wie soll ich mich bloß darauf vorbereiten?«
Knox schnappt sich seinen Stuhl und lässt den riesigen Körper darauf nieder, ohne den unverwandten, durchdringenden Blick von mir abzuwenden. Verdammt, er ist so … nein, attraktiv trifft es nicht mal im Entferntesten. An den Schatten um seine Augen und der Art, wie sich die Haut über seinen schräg stehenden Wangenknochen spannt, erkenne ich, dass er eine kurze Nacht hinter sich hat. Trotzdem wohnt seinen kantigen, grimmigen Zügen eine Wildheit inne, eine schroffe Rohheit, die auch von der üppigen Fülle seiner Lippen oder dem dunkelbraunen Bart – nur einen Hauch mehr als ein Dreitagebart – nicht abgemildert wird. Er besitzt dieselbe wilde Schönheit wie ein Panther, kraftvoll und gefährlich, nichts als geschmeidige Muskeln. Und die Konzentration, die Intensität. Wenn er diesen Blick auf eine Frau richtet, mit der er gerade schläft, muss das großartig und furchterregend zugleich sein. Ehe ich es verhindern kann, flammt vor meinem geistigen Auge ein Bild auf.
Seine kantigen, kompromisslos männlichen Gesichtszüge haben sich verdunkelt vor Lust, zugleich erbarmungslos und sinnlich. Die grünen Augen sind verhangen, die Haut spannt sich über seinen scharf geschnittenen Wangenknochen; die vollen, sinnlichen Lippen wirken sogar noch voller, noch sinnlicher, ein Mundwinkel ist wie zu einem Knurren verzogen.
Verdammt.
Ich versuche, einfach ruhig stehen zu bleiben, aber Pustekuchen. Meine Hüfte bewegt sich wie von selbst, nur um eine winzige Nuance, und schon scheint eine Flammenzunge zwischen meinen Beinen entlangzulecken, schnippt gegen meinen Kitzler. Bitte, Gott, mach, dass er meine verräterische Bewegung als Nervosität interpretiert, nicht als Erregung. Die Demütigung wäre mit dem Wort entsetzlich nicht mal ansatzweise beschrieben, es risse mich vor Scham in Stücke, wenn er begreifen würde, wie krankhaft fasziniert ich von ihm bin, wie sehr er mich beschäftigt.
Ja, mit ihm beschäftigt klingt viel besser als von ihm besessen. Andererseits ist es eigentlich egal, wie man es nennt. Faszination, Beschäftigung, Besessenheit – das alles ist einfach nur fürchterlich falsch, wenn es um den Bruder deines toten Mannes geht.
In den Augen einiger Leute wäre ich deshalb eine Schlampe. Im besten Fall. Im schlimmsten Fall eine Perverse. Oder gleich eine perverse Schlampe.
Und genau so würden es wohl auch Katherine und Dan sehen.
Der Gedanke, sie zu verletzen, noch mehr Kummer auf Katherines ohnehin schon so zerbrechliche Schultern zu laden … ich würde lieber sterben, als der Frau, die mir mehr eine Mutter ist als die Frau, die mich geboren hat, so etwas anzutun.
»Kannst du nicht«, beantwortet er meine Frage. »Tu es einfach und steh die anschließende Katastrophe durch.« Mit zusammengekniffenen Augen betrachtet er mich. »Bist du dafür denn schon bereit, Eden? Dafür, auszuziehen und allein zu leben?«
Bei jedem anderen hätte ich die Frage womöglich als Kränkung empfunden. Womöglich? Nein, ich hätte sie definitiv als Kränkung empfunden. Bei der bloßen Andeutung, ich wäre schwach, könnte nicht für mich selbst einstehen, sträuben sich mir die Haare. Ich habe etwas überlebt, das die meisten Leute nur aus Filmdramen kennen – einen ständig besoffenen Vater, eine übergeschnappte Mutter, Obdachlosigkeit mit achtzehn, den Tod meines Mannes. Mag sein, dass ich aussehe, als könnte mich eine anständige Chicagoer Windbö umwerfen, doch ich bin stärker als alles, was das Leben mir bisher ins Gesicht geworfen hat.
Aber das hat er gar nicht gemeint. Ich habe fünf Jahre lang nicht mehr allein gelebt. Schon drei Monate nach unserem Kennenlernen bin ich zu Connor gezogen, in seine vollgestopfte, enge Einzimmerwohnung. Und nach seinem Tod habe ich bei seinen Eltern gelebt. Bin ich bereit für die Einsamkeit, oder frisst sie mich bei lebendigem Leibe? Bereit für die Stille, oder wird sie mich zermalmen?
Die Wahrheit?
Ich weiß es nicht.
Aber ich bin bereit, es herauszufinden.
Auszuziehen ist nur der allererste Schritt. Jedoch der wichtigste.
»Wenn ich es nicht jetzt tu, dann vielleicht nie«, antworte ich, und meine Aufmerksamkeit wandert zu seinen muskulösen Unterarmen weiter, die auf den gewaltigen Oberschenkeln ruhen. Die Hände hat er ineinander verschränkt. »Es wäre leichter, einfach bei Katherine und Dan zu bleiben. Aber ich muss …« Mein Leben weiterleben will mir nicht über die Lippen. Es klingt so kalt, so wegwerfend. Als meinte ich in Wirklichkeit: Über Connor hinwegkommen. Und vielleicht … vielleicht stimmt tatsächlich beides. Ich werde Connor niemals vergessen – wie könnte ich meine erste große Liebe vergessen, meinen Mann? –, doch in diesem Schwebezustand will ich nicht weiterleben.
Meine Finger verschränken sich wie von allein, und obwohl es mich wütend macht, was ich damit offenbare, kann ich nichts dagegen tun, dass sie sich rastlos und nervös umeinanderschlingen. »Das Haus. Es ist …« Die Worte bleiben mir im Hals stecken, und ich schlucke, ehe ich sie über meine Lippen zwinge. »Ich liebe deine Eltern, allerdings habe ich das Gefühl, als ob ich dort nicht weiterkomme. Am Anfang musste ich bei ihnen sein, das war für sie genauso wichtig wie für mich selbst. Aber manchmal fühle ich mich, als ob … als ob ich ersticke.« Entsetzt darüber, was ich über seine Eltern gesagt habe, reiße ich den Kopf hoch und sehe ihm in die Augen. »Es tut mir leid«, flüstere ich. »Ich meinte nicht …«
Sofort fühle ich mich schuldig, denn ich habe es so gemeint. Auch wenn das bedeutet, dass ich ein selbstsüchtiges Miststück bin.
»Entschuldige dich nicht dafür, ehrlich zu sein.« Seine Finger krümmen sich, und mir stockt der Atem, als ich ganz kurz glaube, er würde nach meinen Händen greifen, mich in den Arm nehmen. Bis auf eine einzige Umarmung und dieses eine Mal, als ich in seinen Armen geweint habe, hat Knox mich nicht berührt. Und auch jetzt tut er es nicht, sondern richtet sich auf, drückt den Rücken gegen die Stuhllehne. »Ich weiß, dass sie sich an dir mehr festhalten als an uns anderen. Besonders Mom. Für sie bist du alles, was ihr noch von Connor geblieben ist, und sie klammert sich an dir fest. Sie ist …« Er unterbricht sich kurz, seine Lippen werden kaum merklich schmaler. »… noch sehr zerbrechlich. Um des lieben Friedens willen und um sie nicht vollends aus der Bahn zu werfen, haben wir alle es geduldet. Und das war dir gegenüber nicht fair. Also nein, entschuldige dich nicht dafür. Es bedeutet ja nur, dass wir mehr einspringen müssen.«
Ich starre ihn an und habe alle Mühe, den Mund geschlossen zu halten. Ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals zuvor so viel am Stück gesagt hat.
»Also, äh …« Ich räuspere mich. »Kann ich dich um einen Gefallen bitten?«
Eine seiner dunklen Brauen wölbt sich nach oben.
»Ich will es ihnen am Sonntag sagen.« Sonntagabends ist immer gemeinsames Familienessen. Eine Tradition, in die ich einfach integriert worden bin, als ich mit Connor zusammenkam. Seit seinem Tod allerdings sind diese Abende nicht mehr so ausgelassen und von Lachen erfüllt wie früher, und Knox war nur ganz selten mal dabei. »Könntest du zum Essen vorbeikommen? Ich weiß, das ist viel verlangt«, spreche ich hastig weiter, weil klar ist, welchen Preis ihm diese Begegnungen abverlangen. Doch insbesondere im Lauf des letzten Jahrs ist Knox mein Fels in der Brandung geworden. Nicht dass ich ihm das je sagen würde. Es würde ihm nicht gefallen. Nein … ich korrigiere mich: Er würde diese Bürde nicht wollen. »Aber ich könnte deine Unterstützung wirklich gut gebrauchen.«
Eine ganze Weile lang bleibt er mir eine Antwort schuldig, sieht mich nur unverwandt an mit diesem durchdringenden Blick aus smaragdgrünen Augen, der einem glatt ein Loch in den Schädel brennen könnte. Endlich nickt er. »Ich werde da sein.«
Mir entschlüpft ein erleichterter Seufzer. Ich hatte mich innerlich schon darauf eingestellt, dass er meine Bitte ablehnen würde. Und ich hätte es gut verstanden.
»Danke.« Ich beuge mich vor und lege ihm eine Hand aufs Bein. Unter dem Denim spannen sich die Muskeln, und mir stockt der Atem. Ehe ich es verhindern kann, graben sich meine Finger in diesen gewaltigen Oberschenkel, drücken zu. Ich schlucke ein Aufstöhnen runter, in Bann geschlagen von der Stärke, von der … Kraft, die er verströmt, als vibrierte sie förmlich unter meiner Hand. Mir ist zumute, als würde ich einen Löwen am Schwanz packen und atemlos abwarten, ob er sich streicheln und liebkosen lässt. Oder ob er mit der Pranke zuschlägt und die gewaltigen Kiefer um meinen Hals schließt. Verstört es mich, dass ich nicht weiß, was von beidem ich mir sehnlicher wünsche?
Ja. Es verstört mich.
Und macht mich an. Und zwar nicht gerade wenig.
Es ist zwei Jahre her, dass ich mit jemandem geschlafen habe. Ach, scheiß drauf. Mit jemandem geschlafen ist viel zu euphemistisch. Zwei Jahre, seit ich Sex hatte.
Seit ich gevögelt habe.
Es ist fast, als ob sich mein Körper abgeschaltet, sich nach Connors Tod in eine Art Kälteschlaf begeben hätte. Sechs Monate lang war ich völlig erstarrt, habe nichts empfunden, nichts vom Leben gewollt. Es war Knox, der mich ins Land der Lebenden zurückgeholt hat. Eines Nachmittags war er auf seine nüchterne, kompromisslose Art einfach in mein Zimmer in seinem Elternhaus marschiert, hatte mich wortwörtlich aus dem Bett gezerrt und ins Bad getragen, mich unter die Dusche gesetzt und das Wasser eingeschaltet. Nach einer Menge Gezeter und Geschrei meinerseits hatte er mir ganz ruhig mitgeteilt, dass ich ab sofort in seinem Tattoostudio am Tresen arbeitete. Wenn ich morgen nicht auftauchte, würde er wiederkommen. Ich tauchte auf. Und als ich am Abend dieses ersten Tags zusammenbrach, wild schluchzend, weil Trauer und Zorn mich überwältigten, hat er mich schweigend im Arm gehalten, mich schreien und weinen lassen, bis ich heiser war und mein Kopf schmerzte. Das war der Beginn meiner Heilung gewesen. Dafür gebührte ihm mein Dank.
Und außerdem gebührte ihm der Dank für das Wiederaufleben meines Sextriebs.
Auch wenn ich wieder angefangen hatte, zu lächeln und zu lachen, hat sich dieser Teil von mir – die Lust, die Erregung – weiterhin im Tiefschlaf befunden. Dann aber, als ich schon fast ein Jahr lang im Studio arbeitete, waren wir alle zusammen losgezogen, um in einer Bar meine Beförderung zur Geschäftsleiterin zu feiern. Nach ein paar Stunden ging ich auf Toilette, und auf dem Weg zurück kam ich an einer angelehnten Tür vorbei. Bis heute weiß ich nicht, weshalb ich stehen geblieben bin und durch den Spalt gespäht habe. Vielleicht war trotz der hämmernden Musik, der lauten Rufe und des Stimmengewirrs ein verräterischer Laut an mein Ohr gedrungen? Vielleicht war es einfach eine instinktive Eingebung? Wie auch immer, jedenfalls hatte ein kurzer Blick in den dunklen, vollgestopften Lagerraum gereicht, und der Panzer aus Eis, der meinen Körper so lange umschlossen hatte, schmolz unter einem Meteoriten aus brennender Lust.
Knox.