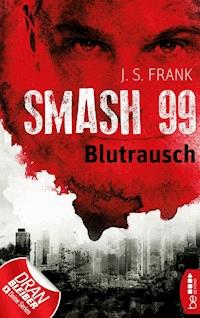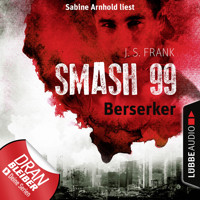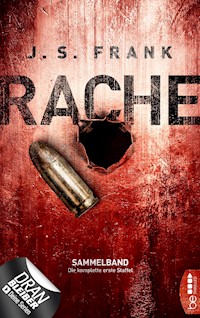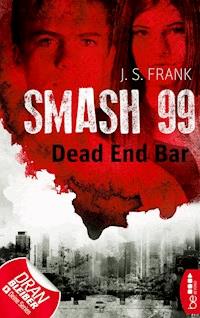
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beBEYOND
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Smash99-Dystopie
- Sprache: Deutsch
FOLGE 5 - DEAD END BAR: Während Tom in der Security-Firma seines Vaters einen Job als Sniper annimmt, kümmert sich Lara um Hardy Stalmann, ihren ehemaligen Lehrer, der seit seiner Smash-Vergiftung im Koma liegt. Doch als Tom dahinterkommt, dass die Security-Firma selbst massenhaft Menschen mit Smash vergiftet, um Sniper-Prämien zu kassieren, warnt er seine alte Schulfreundin, dass auch Stalmann im Visier der Sniper ist. Für Lara gibt es bald nur noch einen sicheren Ort: Die Dead End Bar in ZONE 0 ...
DIE SERIE: Ein fremdartiges Toxin verbreitet sich rasend schnell - Smash. Wer damit infiziert wird, verwandelt sich innerhalb von Sekunden in einen vor Wut rasenden Smasher, der seine Mitmenschen anfällt und zerfetzt, bevor er selbst stirbt. Niemand weiß, wer hinter der Verbreitung des Gifts steckt. Klar aber ist: In einer Gesellschaft am Rande des Zusammenbruchs sind Smasher nicht dein größer Feind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Die Serie
Folge 5: Dead End Bar
Über den Autor
Titel
Impressum
1. Kapitel: Smasher-Jagd
2. Kapitel: Sniper und andere Menschen
3. Kapitel: Leben unter Geiern
4. Kapitel: Die Koma-Station
5. Kapitel: Die Securitate
6. Kapitel: Das Geständnis
7. Kapitel: Smash im Sonderangebot
8. Kapitel: Smash frei Haus
9. Kapitel: Die Smash-Station
10. Kapitel: Der Tod ist nicht das Ende
Epilog
Die Serie
Ein fremdartiges Toxin verbreitet sich rasend schnell – Smash. Wer damit infiziert wird, verwandelt sich innerhalb von Sekunden in einen vor Wut rasenden Smasher, der seine Mitmenschen anfällt und zerfetzt, bevor er selbst stirbt. Niemand weiß, wer hinter der Verbreitung des Gifts steckt. Klar aber ist: In einer Gesellschaft am Rande des Zusammenbruchs sind Smasher nicht dein größer Feind.
Folge 5: Dead End Bar
Während Tom in der Security-Firma seines Vaters einen Job als Sniper annimmt, kümmert sich Lara um Hardy Stalmann, ihren ehemaligen Lehrer, der seit seiner Smash-Vergiftung im Koma liegt. Doch als Tom dahinterkommt, dass die Security-Firma selbst massenhaft Menschen mit Smash vergiftet, um Sniper-Prämien zu kassieren, warnt er seine alte Schulfreundin, dass auch Stalmann im Visier der Sniper ist. Für Lara gibt es bald nur noch einen sicheren Ort: Die Dead End Bar in ZONE 0 …
Über den Autor
J.S. Frank hat nach seinem Germanistik-Studium mehr als zwanzig Jahre für ein internationales Medien-Unternehmen gearbeitet. Seit 2013 ist er freier Autor mit einem ungebrochenen Faible für die anglo-amerikanische und französische Literatur. J.S. Frank ist ein Pseudonym des Autors Joachim Speidel, der mit seinen Kurzgeschichten bereits zweimal für den Agatha-Christie-Krimipreis nominiert war.
J.S. Frank
Smash99
FOLGE 5
Dead End Bar
beBEYOND
Digitale Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Uwe Voehl
Projektmanagement: Stephan Trinius
Covergestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von Motiven © shutterstock/501room; © shutterstock/Molodec; © shutterstock/Bildagentur Zoonar GmbH; © shutterstock/SoWoW; © shutterstock/Shooting Star Studio
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-3728-0
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1. Kapitel: Smasher-Jagd
TOMIch bin ein Millenniumskind. Im Jahr 2000 geboren. Manche sagen, Millenniumskinder seien Glückskinder. Andere behaupten genau das Gegenteil.
Ich hatte mich immer der ersten Fraktion zugehörig gefühlt.
Das änderte sich allerdings, als meine Freundin letzten Januar vor meinen Augen von einem Smasher getötet wurde. Da wusste ich, dass das Glück nichts war, was man in die Wiege gelegt bekam und einen das ganze Leben lang begleitete. Mit dem Begriff Glück konnte ich seither nichts mehr anfangen. Vielleicht reichte es ja auch, wenn man einfach nur zufrieden war. Zufrieden mit dem Leben, zufrieden damit, dass man was Sinnvolles und Nützliches tat.
Zum Beispiel: Smasher erschießen.
Samstag, 6. Februar. Ich lag auf dem Flachdach des zwölfstöckigen Wohngebäudes, überblickte die Straße durch mein Zielfernrohr und fühlte mich auf einmal ganz leicht, fast schwerelos. Körperliche Enge, Begrenztheit, Verkrampfungen, Verspannungen – alles war weg. Ich habe keine Ahnung, welcher verrückte Hormon-Cocktail den Flash ausgelöst hatte. Ich weiß nur, dass man mit einem Mk-11-Scharfschützengewehr leicht Gefahr läuft, abzuheben und überheblich zu werden. Man fühlt sich unverletzlich, unangreifbar, unbezwingbar.Ich hatteschon oft ein Mk-11 in Händen gehalten und auch schon oft damit geschossen. Aber bisher immer nur auf Schießständen. Ich war jedes Mal verblüfft, wie einfach es war, ins Ziel zu treffen. Nicht nur beim ersten Schuss, auch beim zweiten und selbst noch beim fünfzigsten.Wenn man aber den drögen Schießstand verlassen hat und mit dem Mk-11 auf die Straße geht, wenn man Patrouille läuft, wenn man Menschengruppen entgegenschreitet und wenn sie sich vor einem teilen wie das Rote Meer oder wenn man aus einem siebten oder siebzehnten oder siebenundzwanzigsten Stockwerk die Stadt von oben durchs Zielfernrohr überblickt, dann fühlt man sich ein wenig wie Gott. Wie Herr über Leben und Tod.
So suchst du dir heute zum Beispiel einen Jung-Banker aus, die Entfernung beträgt zwischen zweihundertdreißig und zweihundertfünfzig Metern. Er hat ein langes Gesicht, große Augen, er fährt sich immer wieder durch seine gegelten Haare, während er am Eingang eines Feinkostladens steht und in ein Gespräch vertieft ist. Die Frau neben ihm könnte dem Alter nach seine Mutter sein. Du zielst genau zwischen seine Augen. Dein Zeigefinger liegt am Abzug, bei dem du einen extrem leichten Widerstand eingestellt hast: achthundert Gramm. Ein vorsichtiges Antippen, und eine Kugel mit dem Kaliber 7,62 mm verlässt mit einer Geschwindigkeit von 785 Metern in der Sekunde den Lauf. Die Kugel zerschlägt das Stirnbein des Jungbankers, dringt tief in das dahinterliegende Hirn ein, zerreißt es und tritt am Hinterkopf wieder aus, wobei das Austrittsloch deutlich größer als das Eintrittsloch ist.
Aber ohne Grund erschießt du den Jung-Banker nicht, auch wenn er dir auf Anhieb nicht sonderlich sympathisch ist. Du fühlst, wie der Kontakt deines Zeigefingers zu dem Abzug langsam nachlässt. Du suchst dir ein neues Ziel.
Wie wäre es etwa mit der jungen Frau, die sich zu ihrem Baby im Kinderwagen herunterbeugt und wild gestikulierend schimpft. Du visierst ihren Scheitel an. Eine zentrale Stelle an ihrem Schädeldach. Der Finger legt sich wieder um den Abzug. Aber letztendlich drückst du auch hier nicht ab.
Zwei junge, bärtige Männer in Designerklamotten schlendern den Bürgersteig entlang, unterhalten sich trotz der Smartphones, die sie auf den Handflächen schaukeln, rege miteinander. Du legst das Fadenkreuz zuerst auf die Stirn des einen, dann des anderen. In nicht einmal einer Sekunde könntest du sie töten.
Aber du tust es nicht.
An diesem Samstag konnte man meinen, dass der Frühling sich ankündigte, so sonnig war es. Allerdings war es arschkalt. Mein Vater und mein jüngerer Bruder Bobby lagen neben mir. Jeder von uns hatte einen winterlich gefütterten Camouflage-Kampfanzug an, ein Auge am Zielfernrohr und den Finger am Abzug. Mein Vater hatte wie ich eine Mk-11 gegen die Schulter gepresst und mein Bruder eine schwere Hambrusch-Elefantenbüchse, Kaliber 17,8 mm.
Es war kurz vor dreizehn Uhr. Wir warteten seit fast fünf Stunden darauf, dass sich hier was tat. Es hatte Hinweise gegeben, dass es in der Straße heute noch zu einem Terroranschlag mit Smash kommen würde. Informanten, die mit der Polizei, aber auch mit den Sicherheitsdiensten zusammenarbeiteten, hatten es ausgeplaudert. Wir gehörten der Security-Firma Securitate an. Dieses lateinische Wort für Sicherheit passte natürlich zu uns, aber ein Teil der Medien machte sich einen Spaß daraus, bei der Erwähnung unserer Firma immer auch an den gleichnamigen mörderischen Geheimdienst des letzten rumänischen Diktators Ceaușescu zu erinnern.
Ich war erst einen Monat bei der Truppe und ziemlich schnell in der Abteilung der Sniper gelandet. Nach dem Tod von Jenna, meiner Freundin, hatte ich das Studium geschmissen und war wieder nach Hause gekommen. Mein Vater – einer der Gesellschafter der SecuritateGmbH – hatte mir gleich einen Job in der Firma besorgt. Der dreimonatige Aufenthalt in einem Bootcamp war mir erspart geblieben. Mein Bruder und ich hatten von klein auf Schießen gelernt. Unser Vater – ein Waffennarr, wie er im Buch stand – hatte uns den Umgang erst mit Luftpistolen, dann mit Kleinkalibergewehren und schließlich mit richtigen Waffen gelehrt. Ich hatte schon am ersten Tag der Ausbildung bei der Securitate sämtliche Schießprüfungen problemlos bestanden. Auch der körperliche Eignungstest bereitete mir keine Schwierigkeiten. In unserer Familie hatte Fitness immer schon eine große Rolle gespielt. Unser Vater hatte uns mit Hammer-Workouts getrimmt, bis uns manchmal schwindlig wurde.
Die letzten Wochen hatte ich dazu genutzt, die Hierarchie- und Kommandostrukturen der Securitate GmbH kennenzulernen und mich in das Strafrecht und die Aufgaben, Pflichten und Rechte einer Security in einem Land einzuarbeiten, in dem seit mehr als einem Jahr der Ausnahmezustand herrschte.
Die Aktion auf dem Flachdach war der erste richtige Einsatz vor Ort für mich. Mein Vater und mein Bruder, der von Anfang an bei der Securitate dabei war, hatten mich, das Greenhorn, unter ihre Fittiche genommen. Natürlich hätten sie es am liebsten gesehen, wenn ich gleich am ersten Tag einen Smasher vor den Lauf bekäme. Sie wollten sehen, ob ich nicht nur gut auf Zielscheiben schießen konnte, sondern auch auf Menschen.
Das Dumme war nur, dass hier nichts passierte. In einer Woche war Karneval, und normalerweise bevölkerten die Leute an einem Samstagnachmittag die Straßen, um einkaufen zu gehen oder den sonnigen Tag zu genießen. Taten sie vielleicht, aber nicht hier. Hier war tote Hose!
»Verdammt, Dad«, begann mein Bruder Bobby zu maulen, »da ist nichts. Hier ist’s ruhig wie im Paradies.« Er nahm das Auge vom Zielfernrohr und fing an, sich die Nasenwurzel zu massieren.
Wir nannten unseren Vater »Dad«, so lange ich zurückdenken konnte. Er bestand auf der Anrede. Sie klang in seinen Ohren irgendwie amerikanisch, und er stand auf alles, was aus den USA kam.
»Scheint so, Bobby«, knurrte mein Vater. »Dem Scheißer, der uns hierhergeschickt hat, sollte man das Hirn zudübeln. Der ist doch nicht ganz dicht.« Er blickte auf seine Armbanduhr. »Noch zwei Minuten, Jungs, dann ist Ablösung. Wir machen danach erst mal Pause bis fünfzehn Uhr, verstanden?«
»Verstanden, Dad«, sagte mein Bruder.
Ich nickte nur.
Ich hatte einen Juwelierladen im Visier, in dessen Schaufenster entweder tolle Einzelstücke oder exklusive Sonderangebote ausgestellt waren. Jedenfalls blieben immer wieder Leute davor stehen und schauten sich interessiert die Auslage an.
Als ein Mädchen mit violetten Haaren aus dem Laden trat – durch das Zielfernrohr sah ich jede Menge Stecker und Ringe in ihren Lippen, Augenbrauen und Nasenflügeln –, verharrte ich eine Weile bei ihr. Eigentlich passte sie gar nicht hierher. Sie machte einen recht grimmigen Eindruck. Sie blickte die Straße hoch und runter und war sich offensichtlich nicht ganz schlüssig, wohin sie sich wenden sollte. Sie hatte eine abgewetzte Tasche über der Schulter hängen. Je länger ich sie betrachtete, desto bekannter kam sie mir vor.
Ich fing in meinem Gedächtnis an zu wühlen, als auf einmal das Schaufenster des Ladens genau hinter dem Mädchen explodierte. Glasscherben spritzten in alle Richtungen, das Mädchen duckte sich, und im nächsten Augenblick landete neben ihr ein mittelgroßer Mann im weißen Hemd und beigem Pullunder auf dem Bürgersteig. Er fiel auf sein Gesicht, seine Brille zerbrach, eine Scherbe bohrte sich in seine rechte Wange. Mit seinen Händen drückte er sich von dem mit Glassplittern übersäten Asphalt hoch. Blut rann ihm das Gesicht herunter, und Blut troff auch von seinen Händen. Doch er schien von alldem nichts zu spüren. Die wenigen Menschen auf der Straße fingen augenblicklich an zu schreien und suchten das Weite.
»Ein Smasher!«, rief ich und nahm den Mann im Pullunder ins Visier. Er krümmte sich, so als würde er innerlich zerfressen werden, fing an zu brüllen und sprang dann auf. Dad und Bobby drückten den Waffenkolben an die Schulter.
»Knall ihn ab, Tommy!«, sagte mein Vater mit ruhiger Stimme neben mir.
»LOS, MANN!«, schrie mein Bruder.
Ich spürte, wie mein Finger den Abzug ganz leicht berührte. Mein Puls raste. Mein Herz hämmerte mit stakkatohaften Trommelschlägen gegen die Innenseite meines Brustkorbs. Das Blut rauschte in meinen Ohren. Ich zwang mich zur Ruhe. Beim letzten Ausatmen hielt ich die Luft an und dann …
Nichts!
Nada!
Niente!
Mir fehlte der Mumm, die Kraft, die Energie, ich weiß nicht was. Das Fadenkreuz lag auf der linken Schläfe des Smashers, und in meinem Inneren schrie es: »DRÜCK DEN VERDAMMTEN ABZUG!« Aber dem Befehl kam mein Zeigefinger einfach nicht nach.
Die Anspannung, die Konzentration, die absolute Fokussierung war weg. Ich sah durch mein Zielfernrohr, dass sich das Mädchen mit den violetten Haaren umdrehte und wegrannte. Ich sah aber auch, wie der Smasher hinter ihr herjagte. Und er war schnell.
Verdammt schnell!
Und ich konnte nichts machen!
LARADas Juweliergeschäft »Opal« hatte ich noch nie als meine erste Adresse angesehen, wenn ich mal wieder nach neuem Piercing-Schmuck suchte. Ich ging aber trotzdem gerne hin, weil meine Freundin Alexa, die nach der Zehnten die Schule verlassen hatte, dort manchmal im Laden aushalf. Das Geschäft gehörte ihrem Vater, einem großen, schwammigen Kerl mit schütterem Haar und stechenden Augen. Auch wenn ich Alexa in der Schule nicht mehr traf, so hing ich noch ab und zu ganz gerne hier mit ihr rum. Aber nur, wenn ihr Alter nicht da war.
Für diesen Samstag hatten Alexa und ich kein Date ausgemacht, aber so um die Mittagszeit war sie dort eigentlich immer anzutreffen. Ich also rein – doch sie war nicht zu sehen. Dafür ihr Vater, der ein junges Pärchen – sie im stylischen Designkleid und edlen Trenchcoat, er im schicken Anzug und leichtem Wollmantel – volllaberte. Ich widmete mich eingehend den Auslagen und Vitrinen, aber mir entging nicht, wie Alexas Vater mir verstohlene Blicke zuwarf. Er konnte mich auf den Tod nicht ausstehen. Ich hatte Alexa zwar über mehrere Jahre Nachhilfe gegeben und ihr geholfen, dass sie noch eine ganz ansehnliche mittlere Reife schaffte, aber das hatte alles ihre Mutter an ihm vorbei arrangiert.
Das Pärchen genoss es sichtlich, wie sich der Alte für sie abstrampelte. Kein Schmuckstück, kein Juwel, kein Diamant, keinen goldenen Armreif jenseits der zwanzigtausend Euro gab es, den er ihnen nicht präsentierte, erklärte und anpries.
Als sie sich schließlich schnurrend und kichernd für seine »Mühe« bedankten und ihm versicherten, sie würden noch die eine oder andere Nacht darüber schlafen, ging ihm auf, dass seine ganzen Anstrengungen für den Arsch waren. Aber er wahrte eine höfliche Miene. Reichte ihnen förmlich zum Abschied die Hand. Der junge Schnösel in seinem Wollmantel nahm die Gelegenheit wahr und schüttelte sie so heftig, bis Alexas Vater bleich wurde. Dann huschte das Pärchen aus dem Laden.
Im nächsten Moment stand der Alte vor mir. Seine Augen hinter seiner Goldrahmen-Brille waren weit aufgerissen, sein Unterkiefer bebte.
»Was willst du hier? Du hast hier nichts verloren! Also verschwinde! Dort ist die Tür!«
»Wo ist Alexa?«
Er legte den Kopf schief. Bellte mich an: »Hast du nicht gehört, was ich dir gesagt habe?«
»Und haben Sie nicht gehört, was ich gefragt habe? Wo ist Alexa?«
Er lächelte höhnisch. »In London! Bei ihrem Onkel. Meinem Bruder. Sie lernt dort einen anständigen Beruf. Sie ist heute Morgen geflogen. Ja, da staunst du! Das ist was, von dem du nur träumen kannst.«
Alexa – einfach abgereist? Ohne mir was zu sagen. Das sah ihr eigentlich gar nicht ähnlich. Aber okay – vielleicht steckte ja ihr Alter dahinter. Bei dem Arschloch musste man mit allem rechnen.
»Und jetzt – raus hier!« Er packte mich am Arm. Zog mich hinter sich her. Dabei rutschte mir meine Umhängetasche herunter.
Ich bockte. Das konnte ich recht gut. Ich zischte ihn an: »Fassen Sie mich nicht an! Oder wollen Sie vielleicht was Spezielles von mir?«
Sein Unterkiefer bebte jetzt noch stärker. »Verlass sofort meinen Laden!«
»Hand weg, Arschloch!«
Er ließ meinen Arm los, als habe er gerade einen elektrischen Stromschlag bekommen. Rückte die Brille auf seiner Nase zurecht. Starrte mich ungläubig und gleichzeitig wütend an: »Das sagst du nicht noch einmal!«
»Was? Hand weg? Oder Arschloch? Willst du mich jetzt schlagen? Na, los, hau zu!« Ich hängte mir meine Tasche wieder über die Schulter.
Sein Arm ging hoch. Der Zeigefinger zielte auf die Tür. »Raus!«
»Ich bin eine Kundin wie jede andere auch. Und ich habe schon den einen oder anderen Euro hier liegen lassen.«
Er ließ seinen Arm fallen. Baute sich vor mir auf. Ja, er war wirklich eine imposante Erscheinung! Etwa eins neunzig groß, mehr als zwei Zentner schwer, schmale Brust, breite Hüften. Cordhose, weißes Hemd, beiger Pullunder.
»Du bist keine Kundin wie jede andere auch! Du erschreckst meine Kundschaft. Ich könnte ja gleich eine Vogelscheuche hier aufstellen. Oder eine Wasserleiche hier rumliegen lassen. Etliche meiner Stammkunden kommen nicht mehr, weil so eine … wie du hier immer herumstreunt. Du hast meine Tochter um den Finger gewickelt. Sie hat dir Ohrstecker um den halben Preis verkauft. Denkst du, das habe ich nicht mitbekommen? Dabei trägst du die Ohrstecker gar nicht. Wahrscheinlich verhökerst du sie im Internet. Denkst du, ich weiß nicht, wie so eine wie du tickt?«
Bei den letzten Worten musste ich ein wenig in Deckung gehen. Er fing an, die einzelnen Silben richtiggehend auszuspucken. Ich hatte nicht die Absicht, klein beizugeben.
»So eine wie ich? Was wollen Sie damit sagen?«
Seine Blicke wanderten angewidert an mir herunter und wieder hoch. »Schau dich doch an! Sieht so eine … anständige junge Frau aus? Wen willst du beeindrucken mit deinem … Gehabe, deinem Äußeren? Irgendwelche betrunkenen Männer an Bahnhofskiosken? Drogenabhängige?«
Ich ballte meine Fäuste. »Noch ein Wort, und du kriegst eine in die Fresse!«
»Ah, eine gewalttätige Jugendliche! Nur zu. Ich ruf die Polizei an, die holt dich ab. Ich hoffe, es gibt noch Besserungsanstalten für so eine wie dich.«
»Nur zu! Los!«
Er war im ersten Moment verblüfft. Fing dann an, mit den Augen zu rollen. »Vielleicht sollte ich ja den Alteisenhändler anrufen? Oder den Schrotthändler. Wenn ich mir dich so ansehe, könntest du ja doch noch was wert sein. Bei dem ganzen Metall in deiner Visage.«
»Du würdest dich wundern, wo ich sonst noch Metall in meinem Körper stecken habe«, fauchte ich ihn an.
Sein Unterkiefer klappte nach unten. Seine Augen wuchsen ihm aus dem Schädel.
Bevor er was sagen konnte, schrie ich ihn an: »FICK DICH!« Und stieß ihn mit den Fäusten von mir weg.
Er plusterte sich auf, schnappte nach Luft. »Raus! Du verkommenes Wrack!« Sein Zeigefinger wies mir erneut die Tür.
Ich stellte mir für einen kurzen Moment vor, wie es wohl wäre, wenn ich meine rechte Schulter leicht zurücknehmen, Schwung holen und ihm eine in seine fiese Fresse donnern würde. Am besten auf seine protzige Goldrahmen-Brille. Aber ich müsste mich vielleicht dabei auf die Zehenspitzen stellen, denn das Arschloch war verdammt groß. Und he – ob dann noch ordentlich Wucht hinter dem Schlag saß?