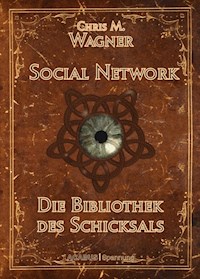
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Das Netz kennt dich. Es weiß, was du willst und es gibt dir, was du brauchst. Es spielt mit dir, wie mit einer Marionette. Und ohne dass du es bemerkst, spielt es auch mit deinem Leben. Schicksal? Ein Leben besteht aus einer Kette von Ereignissen, ein einzelnes Ereignis aus Ursache und Wirkung. Alle Ereignisse dieser Welt können zu einem großen Flechtwerk zusammengefasst werden - Wirkung des einen ist die Ursache des Nächsten. Was wäre, wenn man in dieses Netz eingreifen und es nach belieben formen könnte? Rosemarie von Wards wird bewusstlos im Heizungskeller ihres Strandhauses aufgefunden. Trotz notärztlicher Behandlung verstirbt sie noch im Krankenhaus. Doch warum war der Keller verschlossen? Ist es Zufall, dass sich die lebensnotwendige Infusion lockerte? Dies alles ist ein schwerer Schock für Rosemaries Verlobten, Daniel Lang. Er möchte das Erlebte am liebsten hinter sich lassen und beginnt ein neues Leben in München. Der Job bei einem Unternehmen mit dem Namen FaTec ist ihm so gut wie sicher. Da holen ihn die Ereignisse ein. Er wird in einen Unfall verwickelt, der Taxifahrer wird erschossen, und niemand glaubt Daniel, als er von dem mysteriösen Priester mit dem schwarzen Kollarkragen spricht - bis auf seine scheinbar geistesgestörte Nachbarin Grace Owen aus dem dritten Stock. Was Daniel nicht weiß: Zu diesem Zeitpunkt befindet er sich bereits in den Klauen der Hüter des Schicksals.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CHRIS M. WAGNER
SOCIAL NETWORK
DIE BIBLIOTHEK DES SCHICKSALS
Wagner, Chris M.: Social Network. Die Bibliothek des Schicksals, Hamburg, ACABUS Verlag 2011
Originalausgabe
PDF-ebook: ISBN 978-3-86282-016-0
ePub-ebook: ISBN 978-3-86282-118-1
Print: ISBN 978-3-86282-015-3
Lektorat: Julia Boege, ACABUS Verlag
Umschlaggestaltung: ds, ACABUS Verlag
Covermotiv: © lolloj - Fotolia.com, © Svetlana Ivanova - Fotolia.com, © Lukas Lüttgen - Fotolia.com
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der ACABUS Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
© ACABUS Verlag, Hamburg 2011
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
FÜR MANU
VORSPIEL
1
„Taxi.“
„Hallo, ist da jemand?“
„Si, Taxi.“
„Ich bräuchte ein Fahrzeug zur Amalien …“
„Si, Taxi.“
„Taxi?“, quakte die Stimme unsicher aus dem Hörer des Mobiltelefons.
„Si, Taxi. Taxi wohin?“
„Mein – Na – me – ist – Lang.“
„Si, Lang, wohin Taxi? … Straße?“
„Am – ma –li – en – stra – ße – Num – mer – Drei. Hören Sie? Bitte kommen Sie schnell.“
„Taxi kommen.“ Der Taxifahrer drückte eine Taste seines Handys und zuckelte gemütlich zum Fahrzeug.
Antonio Betani beförderte erst seit fünf Monaten Gäste mit dem Taxi durch die Stadt. Er kämpfte mit dem Zündschlüssel, dem Schlüsselloch und seinen grobgelenkigen Fingern – Zeugen eines Lebens am Bau. Nach 40 Jahren Alltagstrott hatte die Baufirma den Sechser im Lotto für jeden Beschäftigten versprochen. Mit hohen Prämien sollte man die karge Wintersaison künftig im sonnigen Süden verleben können: Ein Großauftrag war im Anmarsch.
Endlich sprang der Wagen an. Amalienstraße – wo war die bloß? Antonio zog den Stadtplan aus der Türablage. Sein Fahrzeug hustete Ruß aus dem Auspuffrohr. Ein Tag wollte ihm nicht aus dem Kopf gehen: Als er morgens stolz mit seinem funkelnagelneuen Nokia in der Brusttasche zur Arbeit fuhr – die erste Prämie konnte jeden Tag eintrudeln. Bereits zu Mittag musste er mit dem Gerät seine Frau anrufen – ob sie ihn abholen könnte; er war arbeitslos. Die Firma hatte viel investiert, doch der Auftrag war geplatzt.
„Betani, sind Sie frei?“, kreischte eine Stimme aus dem Fahrzeugfunk. Er drückte irgendeine Taste und sprach: „No. Amalie Straße fahren.“
„Richtig. Herr Daniel Lang wartet dort auf Sie. Wissen Sie wohin?“ Wegen des Rauschens und Knackens verstand er den Satz nur schwer. Hatte der Kerl noch mal in der Zentrale angerufen? Als ob er nicht längst unterwegs wäre.
„Sagte Amalie Straße, si.“
„Ja, das ist nördlich von Ihnen. Kreuzt die Ungererstraße.“
Achtlos warf er den Stadtplan auf den Beifahrersitz und drückte aufs Gaspedal. „Ich lang schon unterwegs. Ende.“
Er wollte nie Taxi fahren. Man muss viel mit Menschen reden, braucht gute Ortskenntnis und vor allem benötigt man dafür einen Personenbeförderungsschein. Doch irgendwie fügte sich eins ins andere, ohne dass er einen großen Einfluss darauf gehabt hätte.
Wie so oft war seine Ehefrau die treibende Kraft. Giulia hatte gelesen, dass Autofahren und Leichenbemalen Berufe mit Zukunft seien. Noch in derselben Woche brachte ihre Freundin einen Zeitungsausschnitt mit: TAXI-UNTERNEHMEN SUCHT MITARBEITER – AUSBILDUNG WIRD FINANZIERT. Nur ein Mensch hatte noch größeren Einfluss auf Giulia als ihre Freundin – Nonna Emma, ihre Mutter. Und die gab ihren Segen zu Antonios neuem Beruf, noch bevor er selbst davon wusste. (Erst neulich half ihr ein Taxifahrer, die Einkaufssachen in den Kofferraum zu laden – so ein netter Mann.)
Antonio bog in die Amalienstraße. Zwischen den Hausnummern 1 und 5 zwängte sich ein Mehrparteienhaus; der Putz bröckelte an mehreren Stellen von den Außenwänden. Davor winkte ein dunkelhaariger Mann nach dem Fahrzeug. Mit der anderen Hand schob er die langen Strähnen aus dem Gesicht. Das Hemd und die Krawatte passten um keinen Preis zu der verwaschenen Blue Jeans. Antonio verabscheute junge Leute, die ihre Hemden nicht ordentlich in die Hose stecken konnten. Wo soll das noch hinführen?, dachte er und rückte den Schlapphut zurecht – auch den hatte Giulia längst parat, als sie ihm die Stellenanzeige präsentierte. Und schon war aus ihm ein Taxifahrer geworden.
Er kam vor dem Fahrgast zum Stehen und versuchte es mit gestellter Höflichkeit: „Wohin Taxi?“
2
„Poccistraße 165. Aber schnell, bitte. Bin eh schon zu spät. Da müssen wir nicht auch noch rumtrödeln.“
Der Taxifahrer stoppte den Motor. Das Fahrzeug machte einen Satz nach vorne, sodass es Daniel den Türgriff aus der Hand riss. Erschrocken trat er einen Schritt zurück. Erst als er sicher war, dass der Pkw ruhig auf dem Asphalt stand, stieg er hinten zu. Es roch nach kaltem Rauch. Egal, jetzt aber los.
Auf dem Lenkrad lag ein Stadtplan. Der Taxifahrer kratzte sich mit der linken Hand die schwitzigen Locken unter der Mütze und fuhr mit dem Zeigefinger der rechten auf der Karte herum.
„Was machen Sie denn da?“, rief Daniel entgeistert.
„Poccistraße.“
„Weg mit der Karte. Ich sag wohin.“ Wütend schob Daniel sich auf den mittleren Sitzplatz, die Hände an den Kopfstützen. Warum fährt er nicht?
„Na los. Gas.“
„Anschnalle … bitteschön.“ Der Fahrer schaltete das Abblendlicht ein, obwohl es so spät am Vormittag längst nicht mehr nötig war.
„Ja, ist ja gut. Aber fahren Sie.“
Der Motor tuckerte. Daniel knipste den Beckengurt fest. „Erst mal geradeaus.“
„Geradeaus“, wiederholte der Taxifahrer und bewegte den Benz knapp unter der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Er drehte das Radio an – Schlagerwelle. Das wird ja eine heitere Fahrt.
Eine rauchige Stimme brummte „Azzurro“ aus den Lautsprechern.
„Jetzt nach rechts.“
„Rechts“, sagte der Fahrer. Er schob den Schlapphut aus der Stirn und begann mitzusingen: „…e lungo per me …“
„Hören Sie bitte auf.“
„Singen?“
„Noch mal rechts.“
„Is verliebte Mann … singt von Geld für Frau.“ Mit der flachen Hand betonte er den Satz. „Muss Leben machen für Frau, nicht für Geld.“ Tiefe Furchen zogen sich durch das Gesicht des Italieners – Zeugen eines gutmütigen aber abgearbeiteten Wesens. Und die zuvor nervenraubende Ruhe wirkte mit einem Mal beruhigend auf Daniel.
Ein paar Tage war er jetzt schon in der Stadt. Genug Zeit, um zu wissen, wo es Chips und Cola gab. Und genug um das nächste Fastfood Restaurant zu kennen. Er kam recht gut allein durch den Tag. Nur abends, wenn er im Bett lag und der Lüfter seines Rechners den Betrieb einstellte, wenn die Wände in der Dunkelheit unscharf wurden, dann roch er sie. Er war tausend Kilometer von dem Ort entfernt, wo er sie zum letzten Mal gerochen hatte. Und doch – es war ihr Parfüm. Er schluckte.
„Ich möchte nicht mit Ihnen reden. Und schon gar nicht über Frauen.“ Er deutete mit dem Finger durch die Windschutzscheibe. „Da, über die Brücke.“
Da krachte es.
Daniel spürte einen Schlag in den Rücken. Die linke Seite des Benz hob sich. Irgendwo wurde Blech zerdrückt; ein Geräusch, als ob sich eine Mülltonne durch eine Schrottpresse schiebt. Splitter spritzten in sein Gesicht und die Welt drehte sich.
Noch ein Stoß. Jetzt durch den ganzen Körper. Die Stimme des Fahrers formte einen unverständlichen Schrei. Daniels Gleichgewichtssinn setzte aus. Die Fahrzeugwände drückten von mehreren Seiten nach innen. Und das Chaos kam nicht zur Ruhe.
Krampfhaft wollte sich Daniels Bewusstsein von diesem Ereignis lösen. Ihr Duft … er konnte ihn riechen.
Er öffnete die Augen. Polster drückten gegen seine rechte Körperseite. An der Stirn spürte er Metall. Warme Flüssigkeit rann ihm aus der Nase ins Auge. Er hob die Schulter, wollte es abwischen. Schmerzen. Der Schädel des Taxifahrers klemmte bizarr zwischen Kopfstütze und Lenkrad; die Lider halb geöffnet.
Daniels Psyche weigerte sich, die Situation zu akzeptieren. Er drehte den Kopf.
Und Rose lächelte ihm zu.
Auf einmal war der Unfall nur noch eine wage Erinnerung; die Welt um ihn herum verschwamm und die Schmerzen zogen fort, wie Gewitterwolken im Sturmwind.
„Es liegt bei dir, was du tun möchtest“, neckte sie ihn.
So war es immer. Er sprach von einem Job und sie suchte sorgfältig die Zweideutigkeiten in seinen Worten und ärgerte ihn damit. Daniel schaute aus dem Fenster. Das Meerwasser schwappte kraftvoll gegen die Felsen.
„Du könntest deinen Urlaub hier verbringen. Und ich komme hin und wieder zu dir nach München“, sagte sie.
Das konnte sie doch niemals ernst meinen!
Die beiden hatten ihre Sturmzeit; daraus hatte sich ein sorgloser Alltag
entwickelt. Und Daniel lies sie in sich graben. Sie fand Liebe – seine Liebe zu ihr und zur Costa del Luz. Und jetzt stand der nächste Schritt an. Er genoss es, in ihre Augen einzutauchen.
„Deine Eltern wären froh, wenn ich verschwinde“, sagte er und setzte einen Kuss in ihr Haar. Es duftete wundervoll.
Daniel hörte eine Sirene. Aus dem Radio dröhnte: „… troppo azzurro …“ Sein Kopf pochte. Er konnte nur verschleiert sehen. Ein Auge war verklebt.
Der Taxifahrer stöhnte: „Helfer komme.“ Blutige Masse tropfte aus seinem Mund.
Beißender Qualm drängte sich in Daniels Nase. Doch so scharf der Geruch in seiner Nase ätzte, so schmerzhaft der Dampf in den Augen brannte, beides konnte nicht Rose’ süßen Duft verdrängen.
„Die Firma bietet dir einen Haufen Geld. Das ist deine Chance.“ „Geldsorgen haben wir ja nun wirklich nicht“, sagte er.
„Es wäre DEIN Geld. Und du würdest mal was Sinnvolles tun.“ „Möchtest mich loswerden, was?“ Er schmiegte sich an ihren warmen
Körper und knabberte am Ohrläppchen.
„Du nimmst mich nicht ernst. Diese Firma …“
„FaTec“, warf er ein.
„Ja. Du könntest groß rauskommen. Ein Mensch braucht Bestätigung.“ „Ich weiß, was ich brauche“, sagte er und schloss ihren Mund mit einem
Kuss. Er lauschte der Brandung …
… und hörte die letzten Worte der rauen Stimme singen „all’incontrario va“ bevor das Radio verstummte.
„Rose“, jammerte Daniel. Er wollte weinen, doch die Schmerzen hinderten seinen Körper selbst an dieser Bewegung.
„Hilfe da“, sagte der Taxifahrer.
Ein Mann trat an das Unfallfahrzeug heran, gekleidet in Rot und Weiß. Ein
Arzt. Er bewegte sich über Kopf. Jetzt erst begriff Daniel, dass das Fahrzeug auf dem Dach lag. Er tastete nach dem Beckengurt. Der Gurt muss weg,dachte er, unbedingt, sofort. Mit einem Mal durchzog ihn ein Gefühl der Panik. Wo ist der Verschluss? Er muss … auf. Dieser verdammte Gurt muss weg, jetzt! Er spürte das bewegliche Teil zwischen den Fingern. Dann einen Schlag auf den Kopf und Schmerzen.
Eine Glasscheibe zerplatzte. Als Daniel die Augen aufschlug, schaute er dem Mediziner ins Gesicht. Der Mann hielt eine Waffe auf den Kopf des Taxifahrers gerichtet und drückte ab. Flüssigkeit spritzte. Daniel brüllte und warf die Arme vors Gesicht. Er konnte nicht mehr denken. Sein Bewusstsein wollte ihn zurück in die Tiefe ziehen. Er hob die Lider. Der Kopf des Taxifahrers hing leblos und unkenntlich am Körper. Der Arzt war verschwunden.
Dann war alles dunkel.
Ein aufmerksamer Beobachter hätte unter den Schaulustigen eine dunkle Gestalt ausgemacht – sein Körper unterschied sich nur wenig von seinem Schatten, war er doch schwarz wie ein Priester gekleidet. Und er lächelte.
ERSTER TEIL –
URSACHE UND WIRKUNG
KAPITEL 1 – DAS GARN ROLLT
1
Die Glocke spielte eine Melodie auf drei unterschiedlich hohen Tönen. Ein uniformiertes Mädchen – schwarzes Kleid, weiße Schürze, weiße Haube – öffnete. „Oh, hallo“, grüßte sie.
Der Besucher – ein älterer Herr, ordentlich gekleidet und mit auffällig grauen Schläfen im dunklen Haar – zwinkerte neckisch. „Leni, hallo.“
Da rief die Haushaltshilfe ins Treppenhaus: „Du hattest recht, Daniel.“
„Er ist also hier.“ Der Besucher verzog abschätzig das Gesicht.
„Rein mit Ihnen, alter Herr.“
„Etwas mehr Respekt, junge Dame“, schäkerte er und deutete mit breitem Grinsen und hochgezogenen Brauen nach draußen. In der Auffahrt parkte ein schwarzer Kombi, die Heckklappe stand offen.
Leni schmunzelte. „Schon unterwegs.“
Eine Mädchenstimme rief: „Daniel hat dich am Gang erkannt, Paps.“ Der ältere Herr nahm die Treppe in den ersten Stock. Ihn empfing eine Unmenge von Kleidern in allen Farben, Formen und Größen. Sie hingen an Schränken, Stühlen und selbst an der Vorhangstange. Es roch nach gebratenem Speck. An einem Tisch in der Mitte des Raumes kämpfte Rosemarie von Wards mit ihrer Nähmaschine.
„Hallo meine Süße“, sagte der Mann.
Rosemarie zog mit jeder Hand an einem Faden, der Dritte hing seitlich aus einem glänzenden Kleid. In Gedanken versunken kaute sie auf der Lippe.
„Wo ist dein legendäres Lächeln?“
Und Rosemarie strahlte.
Typisch Vater. Er konnte ihr in jeder Situation ein Lachen entlocken, auch wenn sie dazu überhaupt nicht in der Stimmung war. Dieses Kleid raubte ihr schon den ganzen Vormittag und nichts ging voran.
Er lachte: „So kenn ich dich.“
„Heute ist nicht ihr Tag“, schmatzte irgendwo eine Männerstimme.
„Jeder Tag ist Rosemaries Tag“, setzte Vater leise dagegen.
Die Haushälterin schnaufte die Treppe hinauf. „Du wirst dich wundern, Rosi.“
„Paps, was hast du wieder mitgebracht?“
„Er sorgt dafür, dass dir die Arbeit nicht ausgeht“, rief die Männerstimme.
Vater verzog mürrisch das Gesicht. „Und er könnte sich mal nützlich machen.“
„Vater“, fiel sie ihm ins Wort. „Das ist meine Sache.“
Rose wusste, so lieb Daniel war – wenn man ihm einen Faden in die Hand gab, bekam man einen Knoten zurück.
Ein sprechender Kleiderberg betrat den Raum. „Schau dir das an.“
Rosemarie schnaufte angestrengt. „Ich hoffe, du findest noch irgendwo Platz.“
Vater ließ sich jedoch nicht abbringen: „Sitzt nur rum und zieht dir das Geld aus der Tasche. Hättest …“
Ein dunkelhaariger Mann, Mitte zwanzig, ausgewaschene Jeans, die Ärmel seines Hemdes knittrig hochgeschoben, betrat den Raum. Er leckte sich die Finger.
„Daniel. Könntest du Leni zur Hand gehen, bitte?“ Rose schenkte ihm ein bezauberndes Lächeln.
Vater griff ihn direkt an: „Glück für dich, dass sie dich gefunden hat.“
Daniel fasste nach den Kleidern. „Ja, Glück.“ In seinen Worten klang es völlig anders – sanft und zufrieden.
„Schicksal, mein Schatz“, widersprach Rosemarie.
„Dann meint’s das Schicksal nicht gut mit dir“, sagte Vater.
Rose verstand es, seine abschätzigen Bemerkungen zu überhören. Er konnte sich nicht damit abfinden, dass sie mit dem gewöhnlichen Jungen von der Straße zusammen sein wollte.
Endlich hatte sie die Fäden entwirrt.
„Das Schicksal ist nicht aufzuhalten“, sagte sie. „Es rollt dahin wie diese beiden Garnrollen.“ Sie warf die Rolle mit dem beigefarbenen Oberfaden auf den Tisch. Das kleine Holzrad drehte sich. Der Faden wickelte sich ab. Dann warf sie die Spule mit dem schwarzen Faden hinterher.
„Es bringt uns hin, wo immer es will.“
Flink drehten sich die beiden Holzrädchen auf das Ende der Arbeitsplatte zu.
2
Ich bin ein guter Mensch. Gerold sagte sich das unentwegt vor. Die letzte Nacht war grausam gewesen. Eine dieser Nächte, die mit der Frage endeten, ob man überhaupt ein Auge zugemacht hatte? Natürlich hat man. Wo sonst waren die Stunden geblieben? Nur die Erholung, die blieb aus.
Er quälte sich vom Blümchensofa und spürte jedes seiner weit über fünfzig Lebensjahre schmerzhaft in den Knochen. Ein Porzellanpüppchen fiel auf den Boden. Die Kleine sah unbeschädigt aus. Sie lächelte noch immer. Natürlich tat sie das. Er war ja auch ein guter Mensch. Auch wenn Kirstin etwas anderes behauptet hatte. Was weiß sie schon, was ich für ein Mensch bin?, dachte er. Im letzten Jahr habe ich selbst Mutter öfter gesehen. Ich hätte auf meine Freunde hören sollen. Liebe zieht einen Grauschleier über die Wahrheit, bis die Erkenntnis zuschlägt. Dann ist man 58 und mit einer 20 Jahre jüngeren Frau verheiratet, die ihre Kreditkarten mehr liebt, als den Mann, der die Konten füttert.
„Ist alles in Ordnung?“, krächzte eine Stimme aus dem Nebenzimmer.
„Ja, Mutter.“
„Ich dachte, ich hätte etwas pumpern gehört?“
„Schlaf weiter.“
Eigentlich wollte er die Wohnung längst verlassen haben, bevor sie aus dem Bett kam. Er hatte keine Lust sich ihre Ratschläge anzuhören. Und ,Das hab ich dir schon immer gesagt‘ wollte er erst recht nicht hören. Gerold war dankbar, dass er gestern Abend bei ihr untergekommen war. Jetzt aber wollte er die Ausnahmesituation beenden und in einen gewöhnlichen Arbeitstag starten. So konnte er sich auf andere Dinge konzentrieren. Und er würde allen zeigen, was für ein guter Mensch er war.
Im Bad roch es nach Frühlingsbrise – oder so, wie die Chemiker eines billigen Aromakonzerns sich den Frühling vorstellten. Er hasste es, unrasiert auf der Station zu erscheinen.
Es klopfte an die Badtür. „Bist du da drin, Gerold?“
Wer sonst pinkelt in dein Klo?
„Bin gleich weg.“
Er strich sich die strähnigen Haare nach hinten und blickte in den Spiegel. Sonst sah er dort noch immer den Draufgänger der 10. Klasse. Doch heute erschienen ihm das Deckhaar besonders licht und die Gesichtshaut fahl und fleckig.
Als er auf leisen Sohlen zur Wohnungstür schlich, wartete die alte Dame mit einem Apfel in der Hand.
„Wir haben eine Kantine“, maulte er.
„Ohne etwas im Bauch geht man nicht aus dem Haus.“
„Mutter. Ich …“ Er zögerte.
Sie presste die Lippen verständnislos aufeinander und atmete laut durch die Nase aus. Er kannte diesen Blick. Darum fügte er sich. Schließlich war sie seine Mutter. Und er war ein guter Mensch.
Als er gestern Abend seinen Wagen direkt vor dem Imbiss geparkt hatte, hatte er nicht damit gerechnet, dass sich sämtliche Handwerker aus der Gegend morgens exakt an dieser Stelle zur Neunuhr-Brotzeit trafen. Vier standen um einen Tisch herum und grölten.
„Entschuldigen Sie. Wissen Sie, wem der Wagen gehört?“ Gerold deutete auf einen windschiefen Kleinlaster, der in zweiter Reihe seinen BMW behinderte.
„Nö“, bekam er zur Antwort. Die anderen drei blickten ausdruckslos drein.
Gerold schaute auf die Uhr. Seit neun erwartete man ihn. Und er saß hier fest. Ein Taxi rollte durch die Straße. Er winkte dem Fahrer zu. Der winkte zurück und fuhr weiter. Verdammt! Am Imbissstand lachte jemand.
Jetzt war’s genug. Er setzte sich in sein Fahrzeug, startete den Motor und trat ausgekuppelt ins Gaspedal. Der Motor heulte auf. Dann drückte er auf die Hupe. Einmal, zweimal, dreimal. Passanten blieben stehen, einer tippte sich an die Stirn. Eine junge Frau klopfte gegen die Seitenscheibe. Er ließ von der Hupe ab.
„Spinner“, sagte sie ihm ins Gesicht.
Es reichte.
Jetzt hämmerte er auf das Lenkrad und ließ nicht mehr von der Hupe ab.
„Was ist denn los?“, rief eine krächzende Stimme von oben. Mutter. Siesoll nur sehen, in was für einer beschissenen Gegend sie wohnt.
Die Handwerker hatten aufgegessen und liefen um Gerolds Wagen herum. Ein breitschultriger Kerl klatschte mit der flachen Hand auf die Motorhaube. „’s ja gut“, brummte er und stieg in den Lieferwagen, die anderen hinterher. Diese Bastarde. Er drückte noch einmal penetrant auf die Hupe. Das haben sie jetzt davon. Warum SIND Leute nur so? Ich bin doch ein guter Mensch!
Jetzt rauschte er durch die kleinsten Gassen. Das war der kürzeste Weg. Es durfte ihm nur niemand vor den Wagen laufen. Wird schon gut gehen.
Beinahe wäre er in einen Motorroller gekracht, der auf seinem Stellplatz geparkt war. „Welches Arschloch …?“, brüllte er und donnerte mit der Faust aufs Lenkrad. Mit quietschenden Reifen setzte er rückwärts auf einen Besucherparkplatz.
Er lief auf die automatische Tür zu, über welcher der Schriftzug: „Klinikum Nord-West“ leuchtete.
„Herr Doktor“, rief eine Stimme, als er auf Station 2b aus dem Aufzug hastete.
Margit, pfff. Was will die denn?, dachte er und tat so, als hätte er nichts gehört. Er verschwand hinter einer Tür.
Das Büro war beengend. Sein breiter Schreibtisch war mit Ordnern und Büchern überladen und rund um den Drehstuhl lagerten Kisten, gefüllte Akten und Papierberge. Als Stationsleiter musste man selbst nicht mehr Hand anlegen. Damals erschien ihm das als Vorteil. Patienten können unangenehm sein. Doch irgendwann kam er zu der Erkenntnis, dass Dienstpläne stärker an den Nerven zerrten, als Patienten es je getan hätten.
Es klopfte zweimal und schon war die Tür offen. Schwester Margit. Kann die nicht warten, bis ich rufe?
„Herr Doktor Altmann, gut, dass ich Sie erwische.“
Ansichtssache.
„Was ist?“
Die Krankenschwester wirkte gehetzt. Sie zupfte die Uniform zurecht. Vor vielen Jahren hatte ihr Körper noch ausreichend Platz in der Arbeitskleidung gehabt. Doch heute spannte sich der ausgeblichene Stoff über die Rundungen ihres Körpers.
„Lars hat heute seinen letzten Tag.“
„Hmm“, knurrte er. Der Arzt erinnerte sich – die Beurteilung. Seit Tagen schob er das lästige Papier vor sich her. Es war schwer, neutral zu bleiben, wenn man denjenigen nicht ausstehen konnte.
„Meine Aufgabe“, sagte er. „Noch was?“ Er machte sich keine Mühe, seine schlechte Laune zu verbergen.
Die Krankenschwester verschwand wortlos.
Zuerst trödelt der Kerl ein paar Wochen auf meiner Station herum unddann erwartet er von mir nette Worte für seine Zukunft. Der hat sie doch nicht alle. Schickt die alte Margit vor. Ich werd ihm zeigen, was für ein guter Mensch ich bin. So wie ich’s Kirstin gestern gezeigt hab. Geheult hat sie. Aber ich hab mich nicht kleinkriegen lassen. Weil’s mir egal ist. Ich bin ein viel zu guter Mensch, um mich mit IHR rumzuärgern. Und diesem Lars verpass ich eine Abreibung.
Und so rollte die Spule immer näher auf die Kante der Arbeitsplatte zu. Wie ein Fingerzeig deutete der Faden in eine vorbestimmte Zukunft – das Schicksal war vorhersehbar.
3
Ein knallroter Mini-Lkw tuckerte wackelig in die Einfahrt. Der Motor summte hell wie ein Rasenmäher. Die Fahrerkabine stand nur auf einem Rad. Als der Wagen zum Stehen kam, wankte die Ladefläche hin und her. Kurioserweise fielen weder Spaten, Besen, Rechen noch die elektrische Heckenschere oder das Laubgebläse vom Transporter. Die Fahrertür schnappte auf und ein Mann schlüpfte durch die viel zu kleine Öffnung.
Sergio zog den überdimensionalen Schlüsselbund aus der Hose. Er wusste sofort, welcher Schlüssel sperrte. Schließlich gehörte der Rundgang zu seinen täglichen Aufgaben, egal ob das Objekt derzeit bewohnt war oder nicht.
„Madame … Sergio hier“, rief er. Keine Antwort. Trotzdem klopfte er an die Toilettentür, bevor er öffnete. Geübt huschte sein Blick durch den Raum – Rohre, Boden, alles trocken. Dann schloss er die Tür sorgsam. Wie wichtig es war, alle Türen geschlossen zu halten, hatte er vor kurzem in der Tageszeitung gelesen: Drei Kinder und die Mutter – verbrannt. Hätte nicht passieren müssen, wären alle Türen geschlossen gewesen. Brandschutz.
Die Küche mit dem zentralen Kochbereich, das weitläufige Wohnzimmer und die Räume im ersten Stock: Schlafzimmer, Büro und das Zimmer mit den vielen Stoffen – überall dasselbe Muster: Klopfen, Tür auf, Kontrolle und Tür wieder zu.
Zuletzt betrat er den Durchgang zu den Kellerräumen. Sergios Kunden hatten großes Vertrauen in den Hausmeister. Aus dieser Zuversicht entsprangen die Empfehlungen, die seinen Lebensunterhalt sicherten. Das war ihm durchaus bewusst. Und so ging er seiner Arbeit äußerst gewissenhaft nach.
Sergio wunderte sich nicht über die unverschlossene Kellertür. Schließlich lag es in seiner Verantwortung abzuschließen. Darauf konnten sich seine Kunden verlassen – und so überließen viele das Abschließen am Abreisetag vertrauensvoll Herrn Garcia-Álvarez.
Er wunderte sich auch nicht, dass das Kellerlicht brannte. Die jährliche Stromrechnung lag in seinem Aufgabenbereich. Ein paar Euro hin oder her interessierten die Kunden nicht. Wichtig war, dass das Licht funktionierte, wenn es draußen dunkel war. Ausschalten konnte es Herr Garcia-Álvarez.
Schritt für Schritt stieg er die Betonstufen hinab. Sie waren ihm schon immer ein Dorn im Auge gewesen. Rutschig und viel zu schmal konnten sie leicht zur Gefahr werden. Er kam nur langsam voran. Irgendwann würde er auf den Stiegen ausrutschen und hilflos in Frau von Wards Keller liegen. Tagelang würde ihn niemand finden. Das Anwesen lag einsam; das Nachbarhaus war zwei Kilometer entfernt. Und der Einzige, der regelmäßig nach dem Rechten sah, war Herr Garcia-Álvarez.
Der Elektroraum. Ein kurzer Blick auf die Sicherungen – alles in Ordnung.
Was er nicht bemerkte, war der Lichtstrahl, der unter der Tür des Heizungskellers hindurch schien, nachdem er abgesperrt hatte. Frau von Wards nutzte die Wärme der Warmwasserrohre, um Stoffe zu trocknen, die sie frisch gewaschen für ihre Arbeit benötigte. Darum kümmerte sie sich selbst.
Es kann sein, dass er ihre zarte Stimme hätte hören müssen, als er den Keller bereits verlassen und sorgfältig abgeschlossen hatte.
„Herr Garcia, sind Sie das?“
Später würde man sich wundern, wieso der Hausmeister an den Folgetagen das Anwesen nicht betreten hatte. Und er würde eine aufregende Geschichte zu erzählen haben: Wie die Polizei ihn hinter Schloss und Riegel brachte, weil ein Kunde aufgrund von Indizien Herrn Garcia-Álvarez des Kunstdiebstahls verdächtigte; nur er kannte den Code zur Alarmanlage.
Es würde zwei Jahre dauern, bis Sergio seinen Beruf aufgeben müsste, da sein kurzer Aufenthalt in der Untersuchungshaft für seine Kunden langfristig gesehen nicht mehr tragbar wäre. Dann würde man ihn an der Costa del Sol wiederfinden – abends, wenn die Menschen verschwunden waren und die Schirme verrückt werden mussten.
Und so fiel die Garnspindel über die Tischkante und riss am schwarzen Faden, noch bevor das zweite Holzrädchen seinen Weg vollendet hatte.
4
Eine Tür knallte. Jemand murmelte: „Arschloch.“
Mit festen Schritten stampfte der Pfleger durch Station 2b. Zwei lange Monate hatte er sich mit jedem gut gestellt, zu keiner Schicht NEIN gesagt, ist Personal und Patienten in den Arsch gekrochen und das alles in der Überzeugung, er würde mit einer ordentlichen Beurteilung hier rausgehen. Mehr wollte er nicht. Kein Geld, kein Schulterklopfen – nur respektable Zeilen auf einem bescheuerten Blatt Papier. Schließlich muss er damit hausieren gehen. Doch wer wird ihn schon einstellen, wenn er sich FÜR ALLES ZU VIEL ZEIT nimmt?
Lars irrte durch den Flur. Seine Gedanken spielten verrückt. Er war ein sorgfältiger Mensch. Und das hatte er auch zu lesen erwartet: SORGFÄLTIG und nicht FÜR ALLES ZU VIEL ZEIT. Sein Magen rebellierte.
Die große Schwingtür öffnete sich und ein leeres Krankenbett rumpelte hindurch, Schwester Margit hinten nach.
„Klar nehme ich mir Zeit“, brüllte er sie an. „Bin doch kein Pfuscher.“
Die Oberschwester riss entsetzt die Augen auf.
„Ihr könnt mich mal, der ganze Scheißladen.“ Er stampfte über den Flur. „Bin froh, wenn ich keinen von euch mehr sehen muss.“
Margit löste sich aus der Schreckstarre. „Lars. Was ist?“
Eine Tür schlug ins Schloss und der Pfleger war ins nächste Patientenzimmer verschwunden.
Hier lag eine junge Dame. EXSIKKOSE stand auf dem Schildchen am Krankenbett. Aber das interessierte Lars nicht mehr. Warum war er überhaupt noch hier? Für ihn war die Sache erledigt.
AKUTE DEHYDRATION konnte man lesen, wenn man genauer hinsah. Aber Lars sah nicht hin. Wozu auch? Er würde sich keine Zeit mehr nehmen – nicht in diesem Scheißladen.
An einem normalen Arbeitstag wäre ihm sofort aufgefallen, dass die Infusionsnadel aus der Vene der bewusstlosen Patientin gerutscht war. Nicht heute.
So rollte auch die zweite Spule über die Tischkante und zog ihren Faden hinten nach. Das Schicksal hatte entschieden.
Ein geheimnisvoller Besucher trottete am Krankenzimmer vorbei. Er war wie ein Priester mit einem Kollarhemd, dunkler Hose und einem schwarzen Kollarkragen gekleidet. Er blieb stehen. Lächelnd. Beinahe könnte man annehmen, er wüsste, was in Zimmer 2011 vor sich ging. Als hätte er es schon vorher gewusst – gewusst, wann die Spulen fallen.
5
Ein junger Mann stolperte aus dem Aufzug. Schneeflocken hingen in seinen Haaren. Trotz der dichten Verwehungen draußen kam nicht oft jemand bis in die chirurgische Abteilung, der aussah, als herrschte das Unwetter auch im Fahrstuhl. Schwester Margit schüttelte den Kopf. Es war ihr Boden, auf den das Wasser von seinen Haaren tropfte. Im Geiste sah sie sich schon gestürzte Patienten versorgen und mit dem Wischmob retten, was zu retten war.
„Nein“, rief sie in einem Tonfall, der jedes Lebewesen im Umkreis von 50 Metern innehalten ließ – zu Recht. Mittlerweile war sie die herrschende Kraft auf 2b. Und das hatte jeder hinzunehmen, der die Station betrat; egal ob Mitarbeiter, Patient oder Besucher.
Verunsichert zog der junge Mann einen Papierfetzen aus der Hosentasche. „2011. Bin ich da richtig?“ Er machte einen verstörten Eindruck.
„Ich sag Ihnen was. Da ist die Toilette. Sie trocknen sich ab und dann reden wir weiter.“ Erwartungsvoll betrachtete sie den Besucher. Er rührte sich nicht. Seine Augen waren glasig, die Unterlippe zitterte.
„Frau von Wards. Geht’s ihr gut?“, flüsterte er.
Jetzt packte sie der Stolz.
„Auf meiner Station bekommt jeder Patient die Behandlung die er …“
„Wo liegt sie?“, schrie er. Offensichtlich war er einem Nervenzusammenbruch nahe. Der Schnee war geschmolzen und das Wasser lief aus den langen Haarsträhnen in kleinen Rinnsalen über Kopf und Hals des Besuchers.
Irgendwo öffnete sich eine Tür – 2011. Ein hochgewachsener Mann mit grauen Schläfen trat auf den Flur, verfolgt von mehreren geröteten Augenpaaren. Sein Kopf war hochrot.
„Diese Stimme kenne ich“, zischte er und ging geradewegs auf den Besucher zu.
„Wie geht’s ihr?“ Hoffnung klang in seiner Stimme mit.
Da kehrte ihm der Mann aus 2011 den Rücken. „Frau Oberschwester, lassen Sie diesen Kerl entfernen … bitte. Er belästigt uns.“
„Aber … Vater?“
Es war offensichtlich, dass sich die beiden nicht zum ersten Mal begegneten. Routiniert nahm sich Margit die Zeit, ihre Gedanken zu ordnen. Verschiedene Gesichter lugten abwechselnd aus 2011. Sie erinnerte sich an einen Satzfetzen des heutigen Übergabeprotokolls:
2011 räumen. Der Blinddarm möchte ein Einzelzimmer.
Da der junge Mann offensichtlich nicht zur Familie gehörte, war die Entscheidung prompt gefällt.
„Sie hören es. Verlassen Sie die Station.“ Es war ihr nur recht, den tropfnassen Kerl zurück in den Aufzug zu befördern.
„Sag mir doch wenigstens, was los ist!“, sagte er mit zittriger Stimme.
Stumm drehte sich der Mann aus 2011 um. Schwester Margit baute sich neben ihm auf, die Arme verschränkt.
Die beiden Männer sahen sich in die Augen. In 2011 schluchzte jemand. Niemand sprach ein Wort.
Da sackte der Körper des jungen Kerls in sich zusammen; er fiel auf die Knie und brach in Tränen aus.
KAPITEL 2 – NEBEN DEM SYSTEM
1
Jeder Umzugskarton, der im Hänger verschwand, war ein eigener Abschied. Je mehr sich der Anhänger füllte, umso schwerer fiel es dem jungen Mann, weitere Kartons aus dem Wohnhaus zu holen. Schließlich konnte er nicht mehr hinsehen – der Rest seines Lebens, gestapelt in einem einzelnen Anhänger.
Bye-bye Costa del Luz.
Beim Einräumen in München hielten sich die unguten Gefühle zurück. Oder Daniel verstand es, sie zu verdrängen. Er hatte sich keinen Plan zurechtgelegt; alles rein in die Wohnung, egal wie. Ein Zimmer mit Kochnische und Bad – das sollte reichen. Auch sonst hatte er keine großen Ansprüche an sein Umfeld gestellt. Hauptsache er fand einen Platz für den Rechner: Strom, Internet, fertig.
Er schleppte den Bücherkarton zum Treppenhaus. Wie konnte er nur so bescheuert sein und in den 4. Stock ziehen – ohne Aufzug? Das Wohnhaus sah aus, als hätte es sich nachträglich zwischen die beiden Reihenhäuser gezwängt. Der lebenserweckende Narzissenduft aus dem Nachbarsgarten spornte ihn an. Er saugte die Luft in seine Lungenflügel und stapfte die Stufen hinauf.
Oben knallte er die Kiste auf den Boden und wischte mit dem Ärmel den Schweiß aus den Augen. Der Ausblick war angenehm. Viel Zukunft, keine Vergangenheit. Was hält die Stadt für Geheimnisse bereit?, grübelte er, den Blick auf die Straße gerichtet.
Das Namensschild war schon angebracht. Telefon gab es keins. Wozu auch? Egal wie lange er an einem Ort gelebt hatte, er war stets ein Fremder geblieben.
Daniel hob die nächste Kiste aus dem Anhänger. Da plärrte ihm eine Stimme ins Ohr: „Tun Sie doch nicht so.“ Erschrocken drehte er sich um.
Vor ihm stand ein Mädchen, so um die 20, die Hände in die Hüften gestemmt, Brust rausgestreckt. Daniel hatte keine Lust, sich mit irgendwem zu unterhalten, ob er irgendein Halteverbotsschild gesehen hatte oder ob er den Keil in der Wohnungstür lassen durfte. Wortlos ging er an ihr vorbei.
Er betrat das Treppenhaus. Sie folgte ihm.
„Sagen Sie den Männern, von mir gibt’s kein Geld, dass das klar ist.“
Herrgott, was will die?, dachte er. Eine Verwechslung? Er drehte sich um.
„Mein Name ist Lang. 4. Stock. Ab heute.“ Er schob den Karton unter einen Arm und streckte ihr die Hand entgegen.
Sie kippte den Kopf, zog die Lippe hoch und wickelte das schulterlange, blonde Haar um den Zeigefinger. Auf Daniel wirkte sie wie ein trotziges Schulmädchen, das ihn beschuldigte, ihren Füller versteckt zu haben.
„Sie wollen mir also weismachen, in der Kiste sind keine Steuerbescheide?“
„Ganz sicher nicht“, sagte er und wollte schon weitergehen, als das Mädchen mit einer weiteren Behauptung nach ihm schoss: „Ich habe den schwarzen Mann gesehen. Sie können das Versteckspiel sein lassen … Sie sind durchschaut.“
Genug. Er machte eine abfällige Handbewegung und lief kopfschüttelnd die Treppe hinauf.
Kurioserweise blieb es still hinter ihm. Keine Schritte, keine Stimme. Und als er aus dem Fenster sah, war das Mädchen verschwunden.
Am folgenden Morgen wird sich Daniel Lang mit dem Taxi auf den Weg zum Vorstellungsgespräch machen. Doch das Fahrzeug wird niemals ankommen.
2
TODESFALLE KRANKENHAUS
Pannenserie reißt nicht ab. Vater setzte all seine Hoffnungen auf eine deutsche Klinik und musste dafür mit dem Leben seiner Tochter bezahlen.
MÜNCHEN Für das Klinikum Nord-West hat der Tod einer 26-jährigen Patientin ein unangenehmes Nachspiel. Nach Aussage eines Pflegers, wurde die Frau in einem lebensbedrohlichen Zustand eingeliefert, dann aber nur unzureichend überwacht. Nun verklagt ihr Vater die behandelnden Ärzte.
Rosemarie W. (26) war für drei Nächte in einem Heizungskeller in ihrem Haus in Spanien eingeschlossen. Als ihr Vater sie fand, lag sie bewusstlos zwischen Stofflaken und Wäschekörben. Sofort wurde sie auf dem Luftweg in das Münchner Klinikum ausgeflogen und schon auf dem Flug ärztlich versorgt. „Ich dachte, die deutschen Ärzte seien die besten“, sagte der Vater hinterher.
In den letzten beiden Monaten waren bereits 6 Patienten in deutschen Krankenhäusern unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. „Ob man hierfür die Ärzte allein verantwortlich machen kann, oder ob ein Einfluss von außen den Regelbetrieb stört, kann nach dem momentanen Stand der Ermittlungen nicht eindeutig gesagt werden“, erklärte ein Pressesprecher der hiesigen Polizei.
„Die Versicherte ist in einem stabilen Zustand“, heißt es im Einlieferungsprotokoll. Rosemarie W. musste Flüssigkeit zugeführt werden. Alle anderen Werte waren stabil.
Die Patientin wurde auf ein Zimmer gebracht. Laut Angabe des Pflegers wurde sie dort allein gelassen. „Sie nehmen sich nicht genug Zeit für ihre Patienten“, behauptet Pfleger Lars. Zwei Stunden lag die Patientin auf ihrem Zimmer, ohne dass jemandem die lose Infusion aufgefallen wäre. Die lebensnotwendige Flüssigkeit lief auf den Boden. Rosemarie W. starb, ohne ihr Bewusstsein wiedererlangt zu haben.
Rechtsanwalt Adolf Robrov, der die Familie seit Jahren vertritt, wird die Klinikärzte wegen Behandlungsfehlern verklagen. Ob die Staatsanwaltschaft auch Strafanzeige wegen fahrlässiger Tötung stellt, ist noch offen.
Bernd Reismann
3
Die Zeitung wurde geschlossen.
Der Mann schaute wieder auf das Datum. Unmöglich. Heute Morgen wäre er beinahe über den Bollerwagen des Zeitungsjungen gefallen, hätte der das Gefährt nicht in letzter Sekunde unter Richards Füßen weggezogen. Dann griff der Bub in den Stapel und drückte ihm einen Abdruck in die Hand. Und jetzt lag die Februarausgabe vor ihm. Wie kann es einer Druckerei passieren, eine veraltete Zeitung auszuliefern? Wurde sie frisch gedruckt? Oder lagern dort alte Exemplare stapelweise?
Das Boot schaukelte. Irgendwer lief über den Anlegesteg.
Er griff nach seinem Mobiltelefon und wählte eine Nummer. „Vater, hallo … ja, Richard hier.“
Dann kniff er stirnrunzelnd die Augen zusammen und nahm einen Schluck aus der Kaffeetasse.
„Ich wollte dir etwas … tatsächlich?“ Jetzt lauschte er aufmerksam.
Eine junge Frau kletterte die Stufen in die Kajüte hinab. Sie steckte in Matrosenkleidung und trug ein weißes Hütchen in Form eines Papierbootes auf dem Kopf. Auf der Kopfbedeckung konnte man WARDS AM SEE … YACHTRESTAURANT lesen. Sie positionierte sich neben Richard und nahm die Hände hinter den Rücken.
Er riss die Augen auf. „Nicht wahr! Wie bei mir! Das kann kein Zufall sein. Hast du ihn gelesen?“
Am anderen Ende der Leitung wurde gesprochen. Richard konnte es kaum fassen. Auch sein Vater hatte heute diese falsche Ausgabe in der Tagespost.
„Das ist kein Zufall. Jemand möchte uns etwas mitteilen.“
Während sein Vater ihm erzählte, dass er wegen des Artikels heute schon verstört durch die Straße gelaufen war … die Nachbarn haben alle diese Ausgabe bekommen! … zog Richard einen Notizblock aus der Brusttasche seines Hemdes und schrieb ein paar Anweisungen auf:
- einkaufen, was nicht da ist
- Servietten?
- Anruf Weinhändler / GROSSE Flasche!
- Tisch decken
- dass alles fertig ist, wenn der Koch kommt
Er drückte dem Mädchen den Abriss in die Hand und flüsterte ihr „Muss dringend weg“ ins Ohr.
Richard von Wards hatte sein Hobby zum Beruf gemacht. Schon als junger Kerl war er mit Vaters Segelyacht über den Chiemsee geglitten, mit seinen Kumpels und ihren Freundinnen im Schlepptau. Eines Tages kam ihm die Idee, Menschen für Rundfahrten auf seinem Boot inklusive Bewirtung bezahlen zu lassen. Auch Vater war der Idee nicht abgeneigt. Auf diese Weise konnte man Kontakte zur gehobenen Gesellschaftsschicht knüpfen und dabei noch ein Zubrot verdienen. Die „Wards am See“ schrieb zwar bisher nur rote Zahlen, aber das war Vater egal. Hauptsache der Junge hatte eine Beschäftigung.
Soeben sprach Vater davon, wie sehr er seine Tochter vermisste und dass Daniel … er nannte ihn Scheißkerl … zum wiederholten Male angerufen hatte. „Er hat noch Sachen, die er der Familie zukommen lassen will.“
„Vater, ich schau mir das jetzt an“, sagte er. „Ich meld mich bei dir.“ Er steckte das Handy weg.
4
„Ein Herr Richard von Wards möchte mit Ihnen sprechen.“
Die Krankenschwester hatte Herrn Doktor Altmann am Telefon. Richard wartete neben ihr. Er hatte seinen Wagen auf direktem Weg zum Klinikum gelenkt, weil ihn der Verdacht nicht mehr losließ, dass bei der Sache um Rosi noch etliche Leichen mehr im Keller waren, als bisher vermutet.
„Ja, verstehe … mache ich.“ Sie hängte ein. Dann schnaufte sie einmal tief durch.
„Er spricht nicht mit mir?“, riet Richard ins Blaue und traf ins Schwarze.
„Wissen Sie …“
„Mein Name ist in diesem Haus nicht willkommen. Damit habe ich gerechnet.“
Sie nickte.
„Warum ich hier bin … ich brauche Informationen.“
„Es tut mir leid. Ich habe viel zu tun.“
Richard sah sich um. Er war nicht dabei gewesen, als die Familie sich um den Leichnam versammelt hatte. Trotzdem fühlte er Unbehagen. Seine Schwester war in diesen Räumen gestorben. Sie hätte ebenso weiterleben können. Der Gedanke machte ihn wütend. Was stimmte hier bloß nicht?
„Zeigen Sie mir bitte, wo …“ Er suchte nach den richtigen Worten. GESTORBEN drückte ihm einen Kloß in den Hals. „… wo es passierte.“
Schwester Margit warf einen prüfenden Blick zur Tür des Ärztezimmers.
„Bitte“, sagte er.
„Das da.“ Sie deutete auf ein Zimmer. Nummer 2011.
Da war sie also gestorben. Es trieb ihm die Tränen in die Augen. Er wollte auf den Raum zugehen. Doch etwas hielt ihn davon ab. Es war, als erwartete er, seine tote Schwester hinter der Tür vorzufinden; Angst, als wartete der Tod persönlich auf ihn.
Überraschung. Hier ist dein Schwesterlein. Schau sie dir genau an. Vertrocknet wie ein alter Apfel, die Arme.
„Sie dürfen da nicht rein“, sagte die Krankenschwester. „Ist ein Patient drin.“
Einerseits war er erleichtert, das Zimmer nicht betreten zu können – zu müssen. Andererseits machte ihn das Verbot noch wütender. Seine Schwester war an diesem Ort gestorben. Doch für das Krankenhaus nahm alles seinen gewohnten Lauf. Als sei es völlig normal.
Etwas brüllte in seinem Geist: Rosi ist tot. Dann kehrt mal jemand bitte den Boden, und schon ist der nächste Patient im Zimmer – zack und fertig.
Nur schwer konnte er seinen Zorn verbergen.
„Irgendwelche Unterlagen?“, fragte er.
Wieder zögerte sie.
„Aber Doktor Altmann …“ Sie sah ihn an.
Offensichtlich war sie in einem Zwiespalt. Richard erwartete, im nächsten Moment rausgeworfen zu werden. Hatte die Klinik etwas zu verbergen?
Dann plötzlich: „Kommen Sie.“
Er folgte ihr ins Schwesternzimmer – eine kleine Kammer vollgestopft mit Unterlagen, einem PC und einer Kaffeemaschine.
Am Computer drückte sie ein paar Tasten. „Die Patientenakte. Ist alles elektronisch.“
Richard las Fachbegriffe und verstand kein Wort. Nur eine Sache stach ihm ins Auge: Am Ende der Bildschirmmaske war ein Feld mit der Bezeichnung BESUCHER aufgeführt. Dort las er nur einen Namen: Daniel Lang. Es schoss ihm heiß und kalt durch den Körper. Er biss die Zähne zusammen. Die Wangenmuskulatur arbeitete.
„Mehr kann ich nicht für Sie tun“, sagte die Krankenschwester.
„Sie haben genug für mich getan.“
Sofort stampfte er ins Treppenhaus und schlug die Schwingtür hinter sich zu. Die Schwester sah ihm verwundert nach.
Im Fahrzeug angekommen, stieß Richard einen ungezügelten Schrei aus. Er brüllte wie ein wild gewordenes Tier, schlug mit den Armen um sich und trat mit den Füßen gegen den Fahrzeugboden. Doch die Wut wollte nicht raus – sie wollte verdammt noch mal einfach nicht aus seinem beschissenen Körper raus.
5
Rauch stieg über dem Herd auf. In der Pfanne brutzelte und knackte es laut. Der Duft von gebratenen Eiern erfüllte die Luft. Grace wedelte mit den Armen durch den würzigen Dampf. Das Küchenradio spielte ausgefallene Hits der 80er.
„Some people get …“, sang eine tiefe Männerstimme zu harten Gitarrenriffs.
Ihre Hand griff nach dem Schalter des Dunstabzugs. Sie zögerte.
„Nein, lass es“, sprach die Stimme.
Die Stimme war mittlerweile zu einem alten Bekannten, ja, fast zu einem guten Freund geworden. Sie begleitete das Mädchen seit langem überall hin. Und sie gab ihr gute Ratschläge in jeder Situation.
„Man kann die Abluft riechen. Möchtest du, dass jeder im Umkreis von einem Kilometer weiß, dass Grace Owen sich in ihrer Küche aufhält? Möchtest du das?“
Natürlich wollte sie das nicht. Nicht auffallen, das war vorrangig. Da hatte die Stimme schon recht. So wie sie immer recht hatte. Grace nahm den Finger vom Schalter und wedelte mit einem alten Tagesboten über dem heißen Fett herum.
Sie erinnerte sich an den Tag, als sie die Stimme zum ersten Mal gehört hatte. Sie hatte den Schulranzen auf den Rücken geschnallt und war am zweiten Schultag stolz in die kanadische Einheitsschule marschiert. Endlich war sie ein großes Mädchen. Man muss mich nicht mehr bringen, dachte sie mit hochgestreckter Nasenspitze. Auch wenn mich der Ranzen nach hinten zieht, ich kann das. Mein Rücken ist kräftig. Ich trage die Bücher bis zur Schule, nehme den Weg, den Mama mir gestern gezeigt hat, dann wird sie stolz auf mich sein.
Vor dem Schulhaus wuselten hunderte Kinder in alle Richtungen, schrien herum und warfen mit Papierbällen oder schossen Spuckepapierfetzen durch zweckentfremdete Filzstiftrohre. Die kleine Gracie marschierte zielstrebig auf den Kinderhaufen zu – nur noch vorbei an der stämmigen Eiche – als sie angesprochen wurde: „Grace, magst du einen Lolli?“
Das Mädchen sah sich um. Ein größeres Mädel mit pinken Glitzerschuhen rannte an ihr vorbei, drei weitere hinterher; die Schulranzen sprangen ausgelassen auf den Kinderrücken.
„Oder magst du so schöne Schuhe wie die da vorne?“, fragte die Stimme. Sie klang warm und angenehm.
„Wo bist du?“, fragte Grace, lief um den verwitterten Eichenstamm herum und erwartete, dahinter einen Lehrer oder den netten Herrn Hausmeister anzutreffen. Aber da war niemand.
Sanft umwarb die Stimme ihre Gedanken. „Was hättest du denn gern? Dann sag ich dir, wo ich bin.“
„Weiß nicht?“, sagte sie. Sie stellte sich stramm, die Nase hoch. „Kuck mal, was ich hab. Einen Schulranzen. Da sind ganz viele Bücher drin.“ Sie dachte sich nichts dabei, mit einem Unsichtbaren zu sprechen. Endlich war da jemand, der zuhörte. Und sie hatte doch so viel zu erzählen.
Und die Stimme sprach voller Bewunderung: „Na, das ist aber ein schöner Schulranzen.“
Ihr Herz machte Luftsprünge. Ein netter Mensch. „Sag mal, hast du denn solche Schuhe für mich?“
Keine Antwort.
Noch einmal umrundete sie den Stamm der Eiche. Der Schulgong gab sein Zeichen. Wenn der Gong schlägt, dann geht man in die Schule. Und wenn er noch mal schlägt, dann sitzen alle braven Kinder auf ihren Plätzen, die Hände auf dem Tisch. Das hatte sie gestern gelernt. Na logisch war sie ein braves Mädchen. Obwohl diese rosafarbenen Schuhe gut zu dem Schulranzen passen würden.
„Hörst du, wo bist du? Ich will schon solche Schuhe haben“, sagte sie. Sie stellte sich vor, wie sie morgen mit ihrem tollen Schulranzen zur Schule lief und dabei ihre Füße betrachtete; und da waren die neuen Schuhe, rosa und glitzernd. Jeder würde ihre Schuhe bewundern. So wie Gracie das andere Mädchen mit den Glitzerschuhen bewundert hatte.
„MAN NIMMT NICHTS VON FREMDEN AN. NIEMALS!“ Da war die Stimme wieder. Doch auf einmal klang sie gar nicht mehr so freundlich. Und was sie da sagte, passte überhaupt nicht in Gracies wundervollen Tagtraum.
„Aber du hast doch gesagt …?“
„Beweg deinen Arsch in die Schule, SOFORT! Und dass du mir mit niemandem sprichst. Ich weiß, wie das sonst mit dir endet. Kaum spricht man dich an, schon säufst du Rattengift. Wird Zeit, dass sich jemand um dich kümmert. Schließlich kann man ein Mädchen wie dich nicht unbeaufsichtigt herumspazieren lassen. Gerade noch rechtzeitig … sei froh, meine Kleine. Jetzt aber los, bevor du zu spät kommst. Oder möchtest du, dass die Lehrerin dich ins Lehrerzimmer mitnimmt und dir eine Tracht Prügel verpasst? Das passiert nämlich mit Kindern, die nicht folgen. Der Lehrer nimmt sie mit. Und hinterher können sie nicht mehr richtig sprechen. Möchte nicht wissen, was da mit ihnen passiert. Also los.“
Der Mann im Radio sang gerade: „D’you get scared …?“
Grace aß gern am Beistelltisch in der Küche. Hier konnte sie es sich schmecken lassen und musste keine Angst haben, beobachtet zu werden. Der Raum hatte kein Fenster. Die Lampe blieb trotzdem aus, denn Licht verbreitet sich in der ganzen Wohnung. Und dann sah man, wenn sie anwesend war.
Das sagte die Stimme.
„Oder sollen die Leute von der Finanzbehörde dich finden?“ Unzählige Male hatte die Stimme ihr diese Frage bereits gestellt. Es war ihre Entscheidung gewesen, das Land zu verlassen. Im Internet hatte sie einen Artikel über Kanada gefunden. Der beschrieb die Nation als das Land mit den offenen Haustüren. Zu diesem Zeitpunkt wurde ihr bewusst: Es ist nicht überall so. Woanders sperrten die Menschen ihre Türen ab. Sie lebten zwar gemeinsam in einem Haus, sprachen aber kein Wort miteinander. Nachbarn wohnten viele Jahre Wand an Wand, ohne sich überhaupt beim Namen zu kennen. Eine wunderbare Vorstellung. Graces Vater war in Deutschland geboren – ihr Sprungbrett in eine versperrte Welt.
Die Stimme fand die Idee gut. Auch wenn sie Einwände hatte. Trotzdem war es Graces Entscheidung. Dieser Punkt war ihr wichtig.
In ihrer neuen Heimat fühlte sie sich wohl. Endlich konnte sie ein Leben beginnen, ohne die schleichende Angst, jemand könnte ihr Glitzerschuhe schenken wollen – oder einen Lolli.
Sie nahm ihren ganzen Mut zusammen und fragte gerade heraus: „Was hältst du von dem neuen Mieter im Vierten?“
Die Stimme schwieg – kein gutes Zeichen. Normalerweise folgte einer Frage entweder eine schlagfertige Antwort oder ein klares NEIN. Stille hatte meist einen donnernden Ausbruch zur Folge – wie damals, als sie nach den Schuhen fragte.
Und wahrhaftig. „DU HURE! Du gottverdammte Hure. Möchtest dich dem Scheißkerl hingeben, nur weil du ihm einmal in die Augen gesehen hast?“
Ihr Magen krampfte.
„… siehst du das denn nicht? Er ist einer von denen. Was habe ich dir erklärt? Sie wollen dein Geld. Wie konntest du nur das Land verlassen? Ich sagte dir: Es wird Folgen haben. Da hast du’s.“
Obwohl sie den Ausbruch erwartet hatte, stand ihr Körper im ersten Moment unter Strom. Dann löste sich die Spannung und ihre Schultern senkten sich. Die Mundwinkel sackten ab. Die Stimme hatte recht. Das kanadische Finanzamt war ihr auf den Versen. Unverzeihbar, das Land einfach so zu verlassen. Der Fiskus will seine Gelder – egal, wo man sich aufhält. Die Stimme hatte sie gewarnt. Aber dass die Beamten so findig vorgehen würden, einen Spion ins Haus einzuschleusen, das hätte sie nicht erwartet.
Der junge Mann machte so einen netten Eindruck. Sie seufzte. Sie wollte nur mal schauen. Seine Wohnung lag direkt über ihrer. Nur das Namensschild betrachten und lauschen, ob jemand zu Hause war. Mehr nicht.
Sie stieg die Stufen hinauf.
„Lass es sein, Grace. Vertrau mir. Sie haben ihn auf dich angesetzt. Du wirst in eine Falle tappen.“
Sie beachtete die Stimme nicht. Im Laufe der Jahre hatte sie gelernt, die Stimme hin und wieder zu ignorieren. Und je intensiver man sie missachtete, desto ruhiger wurde sie. Sie verstummte zwar niemals ganz, aber es wurde erträglicher.
Schon oft spielte sie mit dem Gedanken: Was, wenn die Stimme sich irrt? Als kleines Mädchen ist das Wort eines Erwachsenen Wahrheit. Dann wird man selbst groß und erkennt, dass auch Erwachsene lügen – mehr noch, als die meisten Kinder. Und Erwachsene irren. Aber irren sich Stimmen möglicherweise auch?
Sanft fuhr sie mit Zeige- und Mittelfinger über das Namensschild: DANIEL LANG. Klingt nicht wie der Name eines kanadischen Finanzbeamten.
Da schnappte ein Schloss.
Fix huschte sie die Stufen hinab.
Sie rumpelte gegen die Wohnungstür. Verschlossen. Zuvor war sie offen.Bestimmt!
„Sie war offen. Jetzt ist sie zu“, sprach die Stimme, schon etwas lauter. Der hässliche Unterton war nicht zu überhören. Grace riss die Augen auf.
Wie ein kleines Kind an Vaters Hemdzipfel wimmerte sie: „Was jetzt?“ Doch niemand bot ihr Schutz. Sie war allein; und sie fürchtete sich.
„Ich hab dir gesagt, du sollst in der Wohnung bleiben. Hab ich dir das nicht gesagt? Tausend Mal schon? Aber das Mädchen hört ja nicht auf mich. Sie sind in deiner Wohnung. Was wirst du jetzt machen?“
Er fragt mich, was ich machen soll? Wieso mich? Sie fühlte sich im Stich gelassen. Als ob die Stimme es darauf anlegte, die Leine loszulassen und zuzusehen, wie Grace in den Abgrund stürzte. Schließlich würde sie Grace auffangen und in Zukunft würden die Fesseln noch enger gezogen. Das konnte sie nicht zulassen. Sie steckte den Schlüssel ins Schloss und drehte ihn herum.
In der Wohnung war es dunkel. Es roch nach Fett. Und es war still. Sie ließ die Tür offen stehen und ging leise durch den Flur. Ein kalter Luftzug schickte Gänsehaut über ihren Körper. Sie vermied jedes Geräusch. Die Badtür stand offen. War schon offen. Todsicher. Ein Blick hinein – leer. Weiter den Flur hinunter. Ihre Nerven spielten verrückt.
Die Stimme flüsterte: „Er ist hier irgendwo. Du tapst in seine Falle. Das Radio ist aus.“
Das Radio ist aus.
Ihr Atem zitterte.
Rechts, der Durchgang zur Küche. Für jeden weiteren Schritt fehlte ihr der Mut.
„GRACE OWEN.“
Es war eine tiefe Grabesstimme, ähnlich dem Geräusch einer Marmorplatte, die über den Boden geschleift wurde. Grace war nicht mehr fähig, auch nur einen einzigen Schritt zu tun. So konnte sie nur dabei zusehen, wie ein restlos in Schwarz gekleideter Mann vor ihr aus der Dunkelheit trat. Ein Priester? Er war einen ganzen Kopf größer als sie. Ihre Augen bissen sich an seinem Kragen fest. Priester tragen weiße Kragen. Seiner ist schwarz – schwarz wie der Tod.
Ihre innere Stimme rief: „Er hat dich, Grace.“
Ja, er hat mich, dachte sie und fühlte sich dabei unendlich hilflos.
„Du bist ein Problem für uns … Grace“, sprach der schwarze Mann. Seine Lippen bewegten sich nicht.
Sie suchte etwas in seinen Augen, woran sie sich festhalten konnte. Was sie sah, war endlose Leblosigkeit.
Die Stimme befahl: „Gib ihm die Unterlagen.“
Und ihr Verstand sagte: Renn so schnell du kannst.
Sie wollte sprechen, formte die Worte „Was wollen Sie?“, brachte jedoch keinen Ton heraus.
Da spürte sie die Stimme des Priesters in ihrem Brustkorb. „Du bist neben dem System.“ Und sie vernahm mit einem Mal einen intensiven Rußgeruch, als wäre der Speck in der Pfanne zu Kohle verbrannt.
„Gib’s ihm schon. Jetzt, Grace! Dann lässt er dich in Ruhe.“
Sie wusste nicht mehr, was sie tun sollte. Hilflos warf sie den Kopf hin und her und ballte die Hände. Dann handelte sie. Sie schlug die Faust gegen seine Brust, schubste ihn weg, drehte sich um und rannte.
„Flucht ist sinnlos“, sagte die Grabesstimme, und obwohl der Priester die Worte kühl und kaum hörbar von sich gab, verstand Grace jede Silbe klar und deutlich.
„Bleib stehen“, befahl ihre innere Stimme.
Doch Grace rannte. Durchs Treppenhaus, durch die Wohnungstür, schrammte sich am Briefkasten, lief den Weg hinunter, atemlos. Und je weiter sie rannte, desto leiser wurde die innere Stimme. Nur der Rußgestank blieb fest und intensiv in der Nase haften, als ob er etwas zu bedeuten hätte.





























