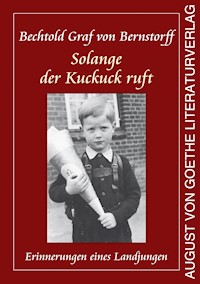
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Lehrer „mit Herz und Seele“ berichtet rückblickend über seine Herkunft als Flüchtlingskind, seinen außergewöhnlichen Werdegang sowie über seinen bunten Schulalltag, der sich nicht immer ganz einfach gestaltete, dem leidenschaftlichen Geisteswissenschaftler aber nie seine inbrünstige Hingabe und seine immense Freude am Unterrichten nehmen konnte. Darüber hinaus lässt der Autor seine Leser an seinen zahlreichen interessanten Kultur- und Studienreisen teilhaben – eine überaus wertvolle Schatzkiste für alle Wissensdurstigen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bechtold Graf von Bernstorff
Solange der Kuckuck ruft
Erinnerungen eines Landjungen
AUGUST VON GOETHE LITERATURVERLAG
FRANKFURT A.M. • LONDON • NEW YORK
Die neue Literatur, die – in Erinnerung an die Zusammenarbeit Heinrich Heines und Annette von Droste-Hülshoffs mit der Herausgeberin Elise von Hohenhausen – ein Wagnis ist, steht im Mittelpunkt der Verlagsarbeit.Das Lektorat nimmt daher Manuskripte an, um deren Einsendung das gebildete Publikum gebeten wird.
©2021 FRANKFURTER LITERATURVERLAG
Ein Unternehmen der
FRANKFURTER VERLAGSGRUPPE GMBH
Mainstraße 143
D-63065 Offenbach
Tel. 069-40-894-0 ▪ Fax 069-40-894-194
E-Mail [email protected]
Medien- und Buchverlage
DR. VON HÄNSEL-HOHENHAUSEN
seit 1987
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.d-nb.de.
Websites der Verlagshäuser der
Frankfurter Verlagsgruppe:
www.frankfurter-verlagsgruppe.de
www.frankfurter-literaturverlag.de
www.frankfurter-taschenbuchverlag.de
www.public-book-media.de
www.august-goethe-von-literaturverlag.de
www.fouque-verlag.de
www.weimarer-schiller-presse.de
www.deutsche-hochschulschriften.de
www.prinz-von-hohenzollern-emden.de
Dieses Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck, Speicherung, Sendung und Vervielfältigung in jeder Form, insbesondere Kopieren, Digitalisieren, Smoothing, Komprimierung, Konvertierung in andere Formate, Farbverfremdung sowie Bearbeitung und Übertragung des Werkes oder von Teilen desselben in andere Medien und Speicher sind ohne vorhergehende schriftliche Zustimmung des Verlags unzulässig und werden auch strafrechtlich verfolgt.
Lektorat: Alexandra Eryiğit-Klos
ISBN 978-3-8372-2546-4
Meinen Eltern gewidmet
VORBEMERKUNGEN
Oft habe ich meinen Vater, seine Brüder und meine Mutter gefragt, ob sie nicht mal ihre interessanten und wertvollen Lebenserinnerungen zu Papier bringen könnten, damit nicht alles in Vergessenheit gerate. Leider ohne Erfolg. So versuche ich hier aus meiner Erinnerung das aufzuschreiben, was mir aus ihren Erzählungen im Gedächtnis geblieben ist. Zugleich erzähle ich meine eigene Geschichte. Dabei beginne ich mit einer sehr weiten Perspektive:
Wir als Sternenstaub erinnern uns an den Anfang – nein, wir wissen vom Anfang vor circa 14 Milliarden Jahren aus den Naturwissenschaften. Wie James Low, Psychologe und Buddhist der tibetischen Tradition der Nyingma- oder Alten Schule, in seinem Buch „Hier und jetzt sein“ ausführt: „Wenn sie [unsere Natur] keinen Anfang besitzt, dann wird sie auch kein Ende haben. Ohne einen Anfang oder ein Ende kann sie keine Entität sein.“
Wir sind also nach dieser Auffassung sogar schon vor dem Urknall gewesen, aber nicht als Individuen, sondern als Essenz.
Nun, jedenfalls begann mein Leben am 2. Dezember 1944, in einer wenig lichtvollen Zeit, geboren unter dem Sternzeichen Schütze mit dem Aszendenten Krebs. Hier streitet sich das Feuerelement mit dem Wasserelement, ein Grund vielleicht für die zwei Seelen in der Brust – der Schütze geht voran, der Krebs zieht sich zurück. Die Konstellation ist also nicht so günstig wie bei dem großen Goethe, der ja in „Dichtung und Wahrheit“ über seine fast ideale Konstellation spricht, wobei nur die Platzierung des Mondes im Horoskop nach seiner Aussage ihm Schwierigkeiten bereiten sollte.
------------------------------------------
(Low, James: Hier und jetzt sein, Gutenstein 2005, 1. Auflage, S. 21)
BEGINN
In einem kleinen Dorf in Ost-Mecklenburg in der Nähe von Neubrandenburg bei einer Hausgeburt kam ich dann an, wohl ohne recht zu wollen, wie mir später erzählt wurde. War es, dass möglicherweise zuvor ein Zwillingsbruder tot geboren wurde und ich ihm folgen wollte, oder war es die Ahnung, dass diese Welt nicht nur aus Zuckerschlecken besteht – buddhistisch ausgedrückt würde man sagen, die Welt des Samsara stand mir bevor.
Denn partout wollte ich nicht von der Brust der Mutter trinken, sodass diese eine Brustentzündung bekam und operiert wurde und ich mit einer Amme vorliebnehmen musste. Wie diese mich behandelte, weiß ich nicht, aber ich denke, dass hier etwas passiert zu sein scheint, was später und bis heute mein Leben nachhaltig geprägt hat – der Mangel an Urvertrauen und damit verbunden die Angst beziehungsweise eine gewisse Ängstlichkeit vor nicht sicheren Lebenssituationen.
Herrenhaus in Beseritz (gebaut 1889)
DIE FAMILIE DES VATERS
Aber nun einmal auf der Welt, fing alles an. Und zwar in dem Herrenhaus in Beseritz bei Neubrandenburg in Mecklenburg, das 1889 von meinem Urgroßvater im neogotischen Backsteinstil gebaut worden war, ein ziemlicher Kasten mit einem hoch aufragenden Turm mit eingebauter Terrasse am rechten Rand des Gebäudes.
Mein Großvater Ludwig, Jurist und Landwirt und zeitweise im Mecklenburgischen Landtag wirkend, bewirtschaftete das Gut Beseritz bis 1922, starb dann nach einem zu anstrengenden und kräftezehrenden Ausritt wenig später an einer Lungenentzündung und ließ seine Frau, eine geborene Charlotte von Döring, mit sieben Kindern zurück. Eine bittere Situation für die Ehefrau, die dann zusammen mit einem der Familie befreundeten Berater und dem Steuerberater Herrn Schuhmacher das Gut durch die schweren Zeiten der Zwanziger- und Dreißigerjahre hindurchführte.
Großvater Ludwig (1871-1922)
Großmutter Sophie-Charlotte geb. von Döring (1881-1962)
Mit ungefähr fünfzehn Jahren trat mein Vater Christian-Ludwig sein Erbe an, galt doch damals noch das Fideikommiss-Recht, welches besagt, dass der Älteste Alleinerbe wurde, um so den Familienbesitz, der von der Familie von Lepel gekauft worden war, nicht zu zersplittern. Die Last der Verantwortung wird nicht gerade gering gewesen sein. Mein Vater erhielt anfangs Privatunterricht, was damals in Gutshäusern üblich war, man denke an Kant, der in Ostpreußen auf Gütern des Adels Hauslehrer war. Später dann besuchte mein Vater eine Internatsschule in Bad Dobberan, wo viele der adeligen Sprösslinge zur Schule gingen. Erzählungen aus der Schulzeit erfreuten später uns Kinder, meine Schwester Elisabeth, meinen Bruder Christian und mich sehr. Besonders hervorgehoben wurde der Lehrer Otto Glöde, der Französisch lehrte und die Schüler den Satz übersetzen ließ, der fragmentarisch lautete: „Obwohl sich die Pferde weigerten, die Austern zu fressen …“ Er war ein skurriler Typ, der von den Schülern permanent auf die Schippe genommen wurde.
Der Vater mit seinen Geschwistern (ca 1920)
Eine Szene war, jedenfalls von meinem Vater so geschildert, dass der besagte Lehrer ihm in einer bestimmten Sache drohend entgegenkam und er als Schüler sein Taschenmesser zückte, es in die Schulbank rammte und sagte: „Wage es nur!“ Wie die Szene zu Ende ging, entzieht sich meiner Kenntnis, jedenfalls waren so in etwa die Sitten und Gebräuche bei den jungen Junkern im Mecklenburg der Zwanzigerjahre. Frank und frei – jedenfalls frei von jeglichem Duckmäusertum, welches sich ja bis heute durch die Gesellschaft hindurchzieht. Nach Beendigung der Schulzeit studierte mein Vater dann später als Gasthörer an der Universität Halle Landwirtschaft, der Stadt, die ja später Christa Wolf zum Schauplatz ihres Romans „Der geteilte Himmel“ machte; in DDR-Zeiten ein von Chemieschwaden heimgesuchter Ort. Mit dem Studium fertig, machte mein Vater dann eine landwirtschaftliche Lehre bei einer Familie in Mecklenburg und schloss dieselbe mit Erfolg ab, um danach das väterliche Gut zu übernehmen. Sein ganzer Stolz und Schatz waren sechzig Pferde, die damals durchaus zur Feldarbeit eingesetzt wurden, von denen einige auch als Kutsch- oder Reitpferde benutzt wurden. Während der Erntezeit kamen sogenannte Schnitter auf den Betrieb, die bei der Getreideernte halfen, die wesentlich noch mit Pferden und Bindern erfolgte. Die gebundenen Korngarben wurden in Hocken zusammengestellt, die dann mit Pferd und Wagen zum Dreschen transportiert wurden, ein eher mühseliges Verfahren, das durch die später entwickelten Mähdrescher abgelöst wurde.
Es stellt sich hier nun der Begriff der berühmt-berüchtigten Ausbeutung ein, der so gerne von marxistischen Kreisen verwendet wird: die Junker, die Ausbeuter, die Leuteschinder. Davon kann eigentlich, aus damaliger Sicht, kaum die Rede sein. Es mag den fiesen, stiefeltragenden Junker gegeben haben, hier auf dem Gut Beseritz war davon eher nichts zu bemerken. Man könnte sagen, es herrschte Arbeitsteilung. Und es gab natürlich eine ständische Ordnung, aber innerhalb dieser Ordnung und dieser Hierarchie ging es menschlicher zu als später in den sozialistisch-kommunistischen Strukturen à la Stalin oder Ulbricht. Nicht zuletzt lässt sich das bereits in dem Roman „Effi Briest“ von Theodor Fontane ablesen, wenn man einmal von dem herben Schicksal der Effi absieht, die aber ja letztlich auch nicht im Stich gelassen wurde.
Meine Großmutter jedenfalls kümmerte sich um die Tagelöhner und Landarbeiter, besonders auch im Krankheitsfall, schickte Essen und wärmende Kleidung, es war eher eine große Familie, allerdings deutlich hierarchisch strukturiert.
Man mag sich fragen, woher diese Sorge und Hilfsbereitschaft kamen – hier sicherlich aus christlicher Verantwortung. Hierarchie ja, aber die Sorge für den Nächsten, auch wenn er sozial viel tiefer gestellt war, war elementar als Prinzip auf diesem Gut. Die Feldsteinkirche, die heute noch steht, bildete nicht zuletzt die tragende Säule für die Gutsgemeinschaft.
Bis heute prangt an der Eingangstür der Spruch: „Kommet herbei, es ist alles bereitet“ und über dem Portal ein Christuskopf, der die Eintretenden von oben her mustert. Ein Hinweis auf das Abendmahl, bis heute ein Mysterium, das selbst oft Hartgesottene weich werden lässt.
Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass mit Beginn der Naziherrschaft mein Vater zusehends in den Blick der Kreisparteileitung geriet, war dieser doch klar, dass sie es mit einem Mann zu tun hatte, der den Parolen des NS-Regimes äußerst skeptisch gegenüberstand.
Das hatte zur Folge, dass mein Vater 1943, nachdem er meine Mutter, eine geborene Siegrid von Bülow, geheiratet hatte, die aus der Mark Brandenburg kam, zum Militär eingezogen wurde, obwohl er als Landwirt eigentlich als unabkömmlich galt wegen der notwendigen einheimischen Nahrungsproduktion in Kriegszeiten. Veranlasst wurde der Befehl an die Front natürlich durch den Kreisleiter der NSDAP in Friedland oder Neubrandenburg. Dem konnte sich niemand widersetzen, auch mein Vater nicht.
Christian-Ludwig Graf von Bernstorff (1907-1979)
Sigrid geb. von Bülow (1921-2010)
So kam es, dass er 1943 auf irgendeinem Bahnhof landete und eigentlich, natürlich ohne Ausbildung, als Kanonenfutter mit einem Zug an die Ostfront transportiert werden sollte.
Aber, wie das Schicksal so spielt, auf dem Bahnhof traf er auf einen ehemaligen Klassenkameraden, der einen Offiziersrang hatte und dessen Namen wir Kinder oft hörten, wenn unser Vater erzählte: Hermann Bolten. Der soll gesagt haben: „Aber Krischan“, so der Spitzname meines Vaters, „willst du dich denn noch so kurz vor dem Ende totschießen lassen?“ Mein Vater verneinte natürlich und Bolten änderte den Marschbefehl, indem er seinen Klassenkameraden in ein Bahnhofshäuschen geleitete und dort den Befehl umschrieb: Ziel war nun der Armee-Pferdepark in der Tschechoslowakei – man könnte sagen ein Glücksfall für meinen Vater, liebte er doch Pferde und hatte dort ein Betätigungsfeld, das ihm auf den Leib geschnitten war. Er bestellte mit diesen Pferden und zum Teil zusammen mit tschechischen Bauern die Felder, zur Gewinnung von Korn etc. für die Kriegsführung der Nazis. Was für uns Kinder später wichtig wurde, war die Tatsache, dass er nie einen Schuss auf den Feind abgeben musste.
Mein Vater geriet in Kriegsgefangenschaft und wurde in die Gegend von Memel in Ostpreußen transportiert, um in einer Baracke mit anderen deren Los zu teilen. Wie er später erzählte, hatte er eine Bibel und las oft darin, einige verspotteten ihn wegen seiner Gläubigkeit, andere hingegen zeigten Interesse, wohl auch, weil mein Vater Hoffnung und Glauben verkörperte, die die meisten nicht mehr hatten. Dann bekam er eine eitrige Entzündung an der Hand. Sein Zustand war kritisch. Er wurde von einem russischen Arzt mit Messer und Klopapier operiert, woraufhin er bald entlassen wurde und im Jahre 1946, auf vierzig Kilogramm abgemagert, in Hamburg ankam, nachdem er durch Feldpost erfahren hatte, dass meine Mutter und ich bei der Architektenfamilie Amsinck in Hamburg-Othmarschen in der Eichenallee 17 Unterkunft gefunden hatten.
Mein Vater hatte sieben Geschwister, zu denen etwas gesagt werden soll. Der zweite in der Reihe der Brüder war der eher kernige Peter mit einem Gesicht, das dem eines Sioux-Indianers ähnelte, ein wilder Reiter, emotional stark bis wild, und ein begeisterter Jäger, später mit einer reichen Kinderschar gesegnet. Auch er wurde Landwirt und bewirtschaftete dann das Gut Klein Pritz im Mecklenburgischen. Die Kriegswirren verschlugen ihn nach Frankreich und Russland, wo er in härtestes Kriegsgeschehen verwickelt wurde. Nach dem Krieg kam seine Familie nach Bergholz, einem kleinen Nest im Lauenburgischen, wo er im Holzhandel tätig war. Später zog seine Familie in die Nähe von Bad Segeberg, wo mein Onkel eine kleine landwirtschaftliche Siedlung übernahm und seine geliebten Trakehner-Pferde züchtete. Er war eine sehr authentische Person.
Der dritte Bruder war Bechtold. Er fiel 1943 in Stalingrad bei einer Panzerattacke. Er galt in der Familie als besonders integer und moralisch hochstehend. Ihre Lieblinge holen die Götter früh, wie das Sprichwort so sagt. Er hatte noch im Krieg geheiratet, eine Erika von Tresckow, sie bekamen eine Tochter, unsere sehr geschätzte, liebenswerte und zudem noch sehr hübsche Cousine Marie-Louise, in die die meisten Vettern und auch ich sich jugendlich verliebten.
Der Reihenfolge nach ist dann der Bruder Joachim, genannt Achim, zu erwähnen, ein „Teufelskerl“ mit dem Zeichen Skorpion. Offizier der Luftwaffe, war er im Einsatz um Kreta beteiligt und suchte nach dem Krieg häufig die Insel Zypern auf, die er liebte und in das sie umrauschende Mittelmeer er seine Asche nach seinem Tode hat streuen lassen, wohl auch in Erinnerung an seine Kreta-Einsätze.
Er war sozusagen der Intellektuelle in der Familie, zeugte mit drei Frauen drei Kinder und arbeitete nach dem Kriege als freier Journalist beim Bayrischen Rundfunk. Ich habe ihn einmal in München besucht. Vor seinem Haus stand ein schnittiger Alfa Romeo Spider, und von seiner Wohnung aus sah man in einen weitläufigen Garten, in dem riesige Buchen standen.
Zuweilen malte und zeichnete er sehr individuelle Kunstwerke, bei deren Anfertigung er wohl den Berufsstress kompensierte. Ein wenig auch Hypochonder, der ansonsten nichts „anbrennen“ ließ, wie man so sagt. Auch er war eine starke Persönlichkeit, wie es sie heute in dem nivellierenden Computerzeitalter mit seinen angepassten Apparatschiks nicht mehr gibt, was schade ist. Mit fällt hier unserer Familienwappenspruch ein: „Fürchte Gott und scheue niemand.“ In Diskussionen war er gefürchtet, legte er doch meistens fast unbarmherzig den Finger in die Wunde. Aber auch das eigene Verhalten während der NS-Zeit sah er später sehr kritisch, was in Briefen zum Ausdruck kommt, die er an seine Schwester Elisabeth und an Max Bondy, den Internatsleiter von Marienau, geschrieben hatte. In diesen Briefen kommt unmissverständlich zum Ausdruck, in welcher politisch schwierigen Lage sich Joachim sah. Seine Schulzeit verbrachte er im Landschulheim Marienau, und mit der Machtübernahme der Nazis war es Pflicht, morgens zum Fahnenappell anzutreten. Er weigerte sich, die Fahne zu grüßen, und drehte ihr seinen Hintern zu, was zur Folge hatte, dass er nach dem Abitur in Deutschland nicht studieren konnte, woraufhin er in die Schweiz ging. Er überlegte dann später, in der Schweiz zu bleiben, entschied sich aber, doch nach Deutschland zurückzukehren. Da er wehrtauglich war, gab es für ihn einen Einberufungsbefehl, dem er Folge leisten musste, einerseits unter Gewissensbissen, andererseits sich der deutschen Gesellschaft verpflichtet fühlend. Bei einem Flugeinsatz in der Nähe von Riga sah er von oben Gruppen von Menschen, die in geordneten Reihen, nicht aber militärisch standen. Er fragte seinen Nebenmann, was sich dort unten abspiele. Dieser antwortete durch den Motorenlärm, das seien Massenerschießungen von Politischen. Er ging dem nach und erfuhr, dass es ein Massaker an Juden war. In einem Brief an Bondy schrieb er später Folgendes: „Was ich am Abend des 07.01.1942 erfuhr, war furchtbar. Ich will davon kein Wort schreiben; denn die Welt weiß es und wird es immer wissen. Ich hatte damals das Gefühl, zur Pistole greifen zu müssen. Ich sah keinen Sinn mehr in meinem Leben; denn ich wusste, dass jede Handlung, die ich als Soldat noch unternehmen müsste, indirekt diesem Verbrechen dienen würde. War es Feigheit oder Liebe zum Leben und zu meinen Angehörigen, was mich von diesem Schritt der Verzweiflung abhielt? Oder waren es religiöse Motive? Alles zusammen mag mitgespielt haben.“ (Aus: Max Bondy: Reden an junge Deutsche [1926–1947], hrsg. von Schülern der Schule Marienau 1998, S. 176). Die Not Joachims angesichts der Nazidiktatur kann wohl deutlicher nicht zum Ausdruck kommen. Achim starb im hohen Alter, gepflegt von einer ehemaligen Salemer Schülerin, die heute noch in seinem Haus in München wohnt.
Der jüngste der Brüder meines Vaters war Hartwig, schon als Junge sehr begabt, wie seine Mutter erzählte. Er soll oft die Schule geschwänzt haben, war aber dennoch gut in der Schule, ging später auf die Ritterakademie in Liegnitz in Schlesien und machte dort dann das Abitur. Im Zweiten Weltkrieg wurde er Soldat, anfangs wohl leider ein wenig in den Bann des „Führers“ gezogen, und brachte es zum Offizier. Er heiratete Ingeborg von Borgstede-Jordan, die ihm die Kinder Andreas, Bettina, Christiane und Hartwig gebar. Nach dem Kriege begann er mit einer kleinen Landwirtschaft und trat dann in den Fünfzigerjahren als Major in die Bundeswehr ein und brachte es dort zum Oberstleutnant. Eine neue Aufgabe bot sich ihm in der Schule Schloss Salem, wo er in den Sechzigerjahren eine Zeit lang Internatsleiter war. Sein Spitzname war „Krimi“, was „christlich-militärisch“ bedeutete, kein Wunder bei Schülern, die ja sehr häufig aus dem süddeutschen Raum kamen und denen das norddeutsch-preußische Temperament eher fremd war. Unter seiner Leitung gab es Schwierigkeiten mit dem Markgrafen von Baden, der wohl fand, dass der Geist der Achtundsechziger zu sehr nach Salem übergeschwappt wäre, begann doch zu dieser Zeit so etwas wie der Konsum von Haschisch etc., gegen den sich der Leiter zwar zur Wehr setzte, den er aber wohl doch nicht ganz unterbinden konnte. Aufgrund mir nicht weiter bekannter Zerwürfnisse gab mein Onkel dann die Leitung auf und wurde Leiter der Evangelischen Akademie in Bad Segeberg, in der er eine Reihe von Jahren tätig war. Leider starb er dann an Lymphdrüsenkrebs. Sein Motto auch für Salem ist der Leitsatz „Erziehung zur Verantwortung“ gewesen. Seine Frau Ingeborg, eine begeisterte Leserin und an Religion interessierte Frau, kam leider bei einem Schwimmunfall am Warder See ums Leben.
Die älteste Schwester meines Vaters, Sophie-Charlotte, Lilott genannt, soll von Kindheit an sehr mitfühlend und sozial engagiert gewesen sein. Sie war ein Frieden verbreitender Geist im Hause Beseritz, sehr zuverlässig und liebenswert. Sie heiratete den Forstmeister von Prollius, genannt wurde er das „plumeau“, wegen seiner erheblichen Korpulenz. Das Ehepaar hatte zwei Kinder, Tochter Lini und Sohn Johann, der später ebenfalls Forstmann wurde. In den Wirren des Zweiten Weltkrieges wurde meine Tante von russischen Soldaten vergewaltigt, worüber sie, sanftmütig geblieben, erst kurz vor ihrem Tod gesprochen hat. Nach dem Kriege wohnte sie mit ihren Kindern in Büchen im Lauenburgischen und kümmerte sich bei der Bahnhofsmission aufopferungsvoll um Spätheimkehrer und Flüchtlinge aus der damaligen sowjetischen Besatzungszone. Sie erreichte ein hohes Alter und starb dann in Bad Bevensen in einem Pflegeheim, betreut von ihrer Tochter Lini. Lilott war eine ganz aus dem Geist christlicher Nächstenliebe lebende Frau, wie man es heute so kaum noch findet.
Ihre Schwester Elisabeth, genannt Hase, war von ganz anderem Temperament, ähnlich eher ihrem Bruder Joachim, eine streitbare Frau, die sich schon als Mädchen gegen den allzu traditionellen Geist und die eher engen Moralvorstellungen ihrer Familie auflehnte. Ganz schlimm fand ihre Mutter wohl, dass sie sich später mit einem Bürgerlichen aus Hamburg verheiratete, einem Herrn Darboven, der im Hutgeschäft tätig war und der von der feudalen Mentalität der Mutter nicht akzeptiert wurde. Meine Tante hatte zwei Kinder mit ihrem Mann, Sohn Thomas, der später in Hamburg ein bekannter Bildhauer wurde, und Tochter Sylvia, die eine begabte Grafikerin und Malerin wurde und noch ist. Meine Tante habe ich des Öfteren in Hamburg besucht, sie war schon lange geschieden und dann neu verbunden mit dem bekannten Architekten Professor Nissen, mit dem sie den Sohn Gotber hatte, der auch Architekt wurde. Sie wohnte in einem kleinen, sehr schönen Haus in Övelgönne, von dem man einen wunderschönen Blick auf die Elbe hatte. Hase war sehr naturverbunden, hatte also ihre ländliche Prägung nicht verloren und telefonierte oft mit ihrem Bruder in München, bei denen sie über die Themen Stockenten, Fischreiher und botanische Fragen aller Art sprachen. Besonders fiel ihre Erzählkunst auf. Sie erzählte in leuchtenden Farben viele Geschichten aus der Vergangenheit, schmückte diese dann auch noch weiter aus, sodass mein Vater manchmal lakonisch und auf Plattdeutsch sagte: „De lücht“ – was so viel heißt wie „Die lügt“. Eine markante Persönlichkeit war sie, besonders im Alter, auch hier könnte man sagen „frank und frei“ – das Gegenteil von einem Duckmäuser und am Geschehen um sie herum und am Weltgeschehen immer stark interessiert. Sie starb leider später an Krebs, wohl nicht zuletzt durch Behandlungsfehler in einem Hamburger Krankenhaus, das in die Schlagzeilen geriet wegen einer Überdosierung bei der Strahlentherapie.
Die jüngste Schwester meines Vaters, genannt Wiwi, machte eine Ausbildung als Gutssekretärin und arbeitete später im Sozialbereich der Shell AG in Hamburg. Sie engagierte sich bei der SPD und heiratete im fortgeschrittenen Alter Herrn Koch, der ebenfalls bei der Shell AG arbeitete. Auch sie starb in hohem Alter.
Man kann sagen, dass eigentlich alle Geschwister meines Vaters, er eingeschlossen, Persönlichkeiten waren, wie es sie heute kaum noch gibt: wenig ängstlich, sehr frei erzogen, unabhängig und großzügig denkend und handelnd. Es ist nicht leicht zu sagen, wie es zu solchen Persönlichkeiten kommt. Jedenfalls sehe ich heutzutage kaum Menschen, von denen ich sagen könnte, sie hätten diese Eigenschaften in vollem Ausmaß – mir fällt spontan da nur der Altbundeskanzler Helmut Schmidt ein.
DIE FAMILIE DER MUTTER
Großvater Friedrich von Bülow (1886-1977)
Großmutter Barbara geb. von Müller(1893-1986)
Nun zu den Eltern meiner Mutter: Mein Großvater Friedrich von Bülow, mit Spitznamen „Fritz“ genannt, war Besitzer des Gutes Groß-Ziethen in der Nähe von Berlin. Ein sehr humorvoller und bisweilen lustiger Mann, den wir Enkel besonders wegen seiner Freundlichkeit und eben seines Humors immer besonders schätzten. Der Betrieb basierte wohl wesentlich auf der Milchwirtschaft und der Züchtung von Rindern, aber natürlich spielte die Feldwirtschaft auch eine Rolle. Seine Erziehung hatte er im Kadettenchor in Potsdam genossen und das Preußische war ihm in Fleisch und Blut übergegangen, was seinem Humor aber niemals Abbruch tat. Jedenfalls hatte er eine enorme Selbstdisziplin, konnte aber auch „fünfe gerade sein lassen“. Er zog 1914 als Dragoner in den Ersten Weltkrieg, geriet in russische Gefangenschaft und wurde nach Sibirien transportiert. Eine wohl schlimme Erfahrung, über die er nie sprach. Allerdings gelang ihm eine abenteuerliche Flucht, wohl unter anderem mit der Eisenbahn, über die er auch nicht sprach. Das Einzige, was sozusagen an die Oberfläche kam, und das auch erst in hohem Alter, war der Satz: „Dieser verdammte weiße Dreck!“ Gemeint war der Schnee, wenn es ihn denn gab. Was wohl hinreichend ausdrückt, was er auf seiner Flucht erlebt haben musste. Seine Frau, Barbara von Müller, lernte er im Lazarett kennen, in das er nach seiner gelungenen Flucht kam.
Sie war sanftmütig und schön und umsorgte ihren Mann bis ins hohe Alter. Aufgewachsen war sie auf dem Gut Lunow in Mecklenburg. Oma Munna, wie wir sie nannten, mit richtigem Namen Barbara, war eine musisch begabte Frau (sie zeichnete und malte gerne) mit einem riesengroßen Herz, das besonders für ihre Enkel schlug. Sie konnte auch sorgenvoll sein und wurde von der Familie meines Vaters oft „Frau Sorge“ genannt. Ich denke, sie hatte viel slawisches Blut und eben auch deshalb sehr viel Gefühl. Ihr Mann, obwohl in der Regel munter und lustig, wies sie dann auch oft zurecht und verlangte mehr preußische Attitude im Hinblick auf das Meer der Emotionen, das in ihr zu Hause war. Nach dem Motto „Ein Preuße kennt keinen Schmerz“.
Meine Großeltern mütterlicherseits hatten fünf Kinder: Curt-Ulrich, Joachim, Hans-Dietrich, meine Mutter Sigrid und ihre Schwester Ilse, die alle in Groß-Ziethen bei Berlin aufwuchsen, damals vor dem Zweiten Weltkrieg relativ noch in einem Idyll. War die Ernte gut gewesen, fuhr mein Großvater in seinem Horch mit der gesamten Familie nach Berlin ins „Café Kranzler“, damals noch sehr gemütlich, mit Stühlen und Tischen auf der Flaniermeile des Kurfürstendammes.
Der Älteste, Curt-Ulrich, machte sein Abitur in Misdroy, einem Internat, und zog später in den Zweiten Weltkrieg, in welchem er, aus einer Panzerluke schauend, einen Streifschuss ins Genick erhielt, welcher ihm zeitlebens zu schaffen machte. Oft hatte er stechende Kopfschmerzen, was ich selbst miterlebte, als ich als Student eine Zeit lang in der Sierichstraße in Hamburg bei meinem Onkel wohnte. Dort machte ich dann auch 1971 mein Erstes Staatsexamen an der Universität. Er hatte aus erster Ehe den Sohn Kai, aus zweiter die Töchter Antoinette und Friederike, die mit mir, ihrem älteren Vetter, allerlei Schabernack trieben. Die Frau meines Onkels, Tante Elisabeth, arbeitete halbtags im Bereich der Universität Hamburg und war eine begeisterte Pferdeliebhaberin, war dann häufig nicht zu Hause, sondern bewegte ihr Pferd. Sie war eine Zeit lang Schauspielerin gewesen und auch im fortgeschrittenen Alter noch sehr schön anzusehen. Mein Onkel arbeitete für längere Zeit bei British Petroleum, wechselte später in deren Rennleitung und war aus beruflichen Gründen eher selten zu Hause. Später, nach Berufsende, zog die Familie aufs Land nach Döle in Niedersachsen. Mein Onkel starb dann bald und seine Frau einige Jahre später. Die Zweite in der Reihenfolge der Geschwister war meine Mutter Sigrid, die 1943 meinen Vater in Groß-Ziethen heiratete. Sie war eher praktisch veranlagt mit einem guten Sinn für Realitäten und absolvierte in der Lette-Schule in Berlin eine Ausbildung zur Gutssekretärin. Später dann lernte sie in einer Landfrauenschule in Obernkirchen die Hauswirtschaft, wovon wir später sehr profitierten, war sie doch eine ausgezeichnete Köchin und konnte stricken und stopfen, was besonders in der Zeit nach dem Kriege äußerst hilfreich war, sodass wir Pudelmützen, Schals und dicke Strümpfe für die Winter, die damals ja durchaus härter waren als heute, bekamen und die unseren Weg zur Schule (zwei Kilometer) durch Eis und Schnee, und das zu Fuß, einigermaßen erträglich machten. Sie war der Liebling ihres Vaters, weil sie zuverlässig und ernsthaft war und die Mentalität ihres Vaters so gut verstand. Verheiratet zog sie nach Beseritz auf das Gut meines Vaters und brachte 1944 mich auf die Welt. 1945 floh sie, gewarnt von einem Verwandten von Döring, der General war, dass die Russen vorrücken würden, mit mir ins Lauenburgische zu Verwandten meines Vaters.
Ihre Schwester Ilse war von ganz anderem Temperament. Beide erhielten ihre Schulausbildung in der Internatsschule Heiligengrabe, wurden dort recht preußisch-spartanisch erzogen.





























