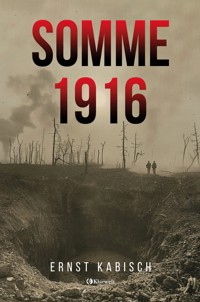
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Hunderte Kolonnen britischer und französischer Soldaten nähern sich unbemerkt in einer mondlosen Sommernacht den deutschen Stellungen. Die deutsche Artillerie schweigt. Die siebentägige Beschießung der deutschen Schützengräben scheint ganze Arbeit geleistet zu haben. Die Alliierten sind der festen Überzeugung, dass die Drahthindernisse zerschossen, alle Verteidigungsanlagen vernichtet und das Leben in Batterien und Gräben so gut wie erloschen ist. Sie ahnen nichts von der doppelten Überraschung, die diesmal die Deutschen vorbereitet haben. In tief ausgehöhlten Unterständen, teilweise mit zwei Stockwerken unter dem Boden überstanden sie das Bombardement. Als die alliierten Soldaten in den frühen Morgenstunden zum Sturmangriff übergehen, erkennen sie voller Entsetzen, dass der Weg in den Tod führt. In atemberaubendem Tempo führt uns der Autor sofort an die Front und zwingt uns ohne Atempause unmittelbar in die Schrecken der menschen- und ressourcenverschlingenden Maschinerie des Ersten Weltkrieges einzutauchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Somme 1916
Ernst Kabisch
_______
Erstmals erschienen im
Vorhut Verlag Otto Schlegel,
Berlin, 1937
__________
Vollständig überarbeitete Ausgabe.
Ungekürzte Fassung.
Klarwelt-Verlag, Leipzig, 2022
© Alle Rechte vorbehalten.
www.klarweltverlag.de
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Erster Teil: Vorbereitungen
Der französische Feldherr
Schwere Wetter
Materialschlacht
Minen und Gegenminen
Zweiter Teil: Die Schlacht im Zeitraffer
Englisch-französische Angriffe bis Ende Juli
Verteidigungsschlacht der Heeresgruppe Gallwitz
Englisch-französische Angriffe bis Ende September
Schlacht der Heeresgruppe Rupprecht
Dritter Teil: Die Schlacht in der Zeitlupe
Bei den Frontkämpfern
Das Luftringen
Vierter Teil: Ausklang
Der letzte Großkampf
Schlachtergebnis
Rückblick
Vorwort
Für die Darstellung der Sommeschlacht habe ich ganz besondere Unterstützung gefunden bei dem Herrn Chef der Geschichtlichen Abteilung des Britischen Reichsverteidigungsausschusses (Comittee Of Imperial Defence), Brigadegeneral i. R. Sir James E. Edmonds. In großzügigster Weise hat er mir die Manuskript-Entwürfe zu dem Band ,,1916, Schlachten an der Somme“ des offiziellen englischen Kriegswerkes zur Einsichtnahme überlassen. Dadurch konnte ich Entstehung und Verlauf dieser Kämpfe vom englischen Standpunkt aus genau verfolgen und so für die Leistungen der deutschen Verteidigung neue, sichere Grundlagen gewinnen, die uns bisher fehlten. Für dies außergewöhnliche Entgegenkommen möchte ich hier meinen ganz besonderen Dank aussprechen.
Stuttgart-Cannstadt, im Oktober 1937
Ernst Kabisch
Erster Teil: Vorbereitungen
Der französische Feldherr
Joffre — der große Schweiger! Man hat ihn durchaus nicht immer als solchen gelobt, hat ihn verspottet als das „moderne delphische Orakel”, sein Schweigen auf geistige Armut zurückgeführt. Der Engländer Liddell Hart gefällt sich in Anekdoten, die das beweisen wollen; eine davon wird genügen. Ein Offizier, der einige Jahre vor dem Krieg in die „englische Sektion” des französischen Kriegsministeriums versetzt ist, meldet sich bei ihm. Joffre schweigt lange. Endlich nach mehrfachem Räuspern: „Sie sind in der englischen Sektion?” Neues Schweigen, dann: „So so. Sie pflegten unsere Feinde zu sein, jetzt sind sie unsere guten Freunde. Auf Wiedersehen.” „Was für ein Orakel!” spottet Liddell Hart. Dagegen der Franzose René Benjamin: „Er ist der Sieg selbst!” Malt sich aus, wie ein Fremder, eine Frau aus dem Volk, wie ein kleines Kind beim Überschreiten des Marsfeldes gepackt sein würde, wenn es dort nur die Kriegsschule sähe, die Worte hörte: „Da weilt Er! Gerade in der Mitte!”
Erstaunlich für einen Franzosen, noch dazu einen Südfranzosen, seine unerschütterliche Ruhe. Aber war Joffre überhaupt ein echter Franzose? Sein Biograph Raymond Recouly sagt, er gehöre zu den „kalten” Südländern. Wahrscheinlich stammt seine Familie von jenseits der Pyrenäen, ist katalanischer Abkunft. Am 12. Januar 1852 ist er in Rivesaltes, einem großen Flecken der Ostpyrenäen, 7 Kilometer von Perpignan entfernt, geboren und auf die Namen Joseph, Jakob, Cäsar (!) getauft worden. Eine enge, kleine Straße war es, wo das Häuschen lag, in dem der Vater sein Gewerbe als Küfer betrieb. Der Raum, in dem er am meisten als Kind geweilt hat, war die Wohnküche. Die Verhältnisse waren recht einfach, wenn auch die Mutter ein kleines Vermögen mitgebracht hatte. Nur unter großen Entbehrungen ist es den Eltern möglich gewesen, alle fünf Söhne etwas Ordentliches lernen zu lassen. Von ihnen war Joffre der Älteste — zwei vor ihm waren im ersten Lebensjahre gestorben. Als der junge Joseph Joffre auf die Schule in Perpignan kommt, beginnt er sich auszuzeichnen, erhält die ersten Preise. Wächst hier eine große Begabung heran? Der Leiter eines Privatinstituts in Paris, in jener Gegend beheimatet, nimmt ihn in der Hoffnung, mit diesem Schüler seiner Anstalt Ruf zu schaffen, unter sehr günstigen Bedingungen auf: lebenswichtig, denn sonst hätten die Eltern das nie erschwingen können, und —eigenes Verdienst. So kommt er in das Lyceum „Karl der Große” und im Jahre 1869 als 14. unter 132 Prüflingen und gleichzeitig als Jüngster des Jahrganges auf das Polytechnikum, jene in Frankreich höchstgeschützte wissenschaftliche Vorbereitungsakademie für Beamte und Offiziere. Der Krieg 1870 bringt dem jungen Polytechniker die Einberufung als Unterleutnant zur Armee, aber sich aktiv zu betätigen, dazu kommt er nicht mehr. Er kehrt aufs Polytechnikum zurück und beginnt von da aus 1871 seine militärische Laufbahn als Ingenieuroffizier. Als solcher wird er bald verwendet beim Bau von Sperrforts im Jura und in den Pyrenäen. Mag sein, dass seine spätere große Schweigsamkeit neben natürlicher Anlage auch dadurch entwickelt ist, dass er mehrere Jahre in einem kleinen Dörfchen 1600 Meter hoch in den Pyrenäen hat weilen müssen und später ein Dutzend Jahre in den Kolonien nur auf seine eigene Gesellschaft angewiesen war.
Eine scheinbar normale Jugendlaufbahn — wenn man vergisst, dass dieser echte Sohn des Volkes in der Werkstatt des Vaters aufwuchs und sich an dem Herd wärmte, auf dem die Mutter das Essen bereitete. Ungewöhnliches Pflichtgefühl, Pünktlichkeit in der Erfüllung seiner Aufgaben, Fleiß, Gewissenhaftigkeit — wer glaubt, dass sie allein die Stufen seines Aufstieges gezimmert hätten, wenn nicht eine große Begabung den Grundstoff hergab? Ganz gewiss: dem Ältesten des kleinen Küfers, der seine Fässer für die französischen Südweine baute, — nicht wie der Endsieger im Nennen der französischen Feldherrn, Joch, schon seit einem Jahrhundert durch Ahnen mit Beamten- und Heeresdienst verflochten, — hätte niemand prophezeit, dass er die ganze soziale Leiter ersteigen würde bis zur höchsten militärischen Würde, die Frankreich zu verschenken und die in der dritten Republik er als Erster erreicht hat. Kein Wunder, dass er sein ganzes Leben lang ausgesprochener Demokrat geblieben ist. Er hat nie das Geringste übrig gehabt für den Klerikalismus, war Freidenker bis zu seiner letzten Krankheit. Dann hat auch er, wie so viele französische Freidenker, den Weg zur Kirche gefunden.
Joffre ist glücklich verheiratet. Da stirbt 1884 seine junge Frau, und nun vermag der Zweiunddreißigjährige es nicht länger in seiner Einsamkeit in den Pyrenäen auszuhalten. Er bittet um Verwendung in den Kolonien und wird nach dem Fernen Osten gesandt. Der General, dem er dort unterstellt war, berichtet über ihn: „Hauptmann Joffre hat alle Eigenschaften eines vortrefflichen Frontoffiziers sowohl bei der Leitung von Belagerungsarbeiten, wie beim Kommando einer wichtigen Gruppe bewiesen.” 1888 kehrt er nach Frankreich zurück und wird mit 37 Jahren Bataillonskommandeur unter gleichzeitiger Versetzung in das neugebildete Eisenbahnregiment. Traurige persönliche Erlebnisse veranlassen ihn, aufs Neue um Verwendung in den Kolonien zu bitten. Dieser Schritt hat über seine künftige Laufbahn entschieden.
Er kam in den Sudan, um dort Eisenbahnbauten vorzubereiten. Ein Bekannter vom Polytechnikum, Oberst Archinard, hatte ausdrücklich um ihn gebeten und ihm versprochen, ihn nicht nur als Techniker, sondern auch als Truppenoffizier zu verwenden. Gelegenheit hierzu fand sich bald. Schon seit längerer Zeit im Besitz, des Senegal, sahen sich die Franzosen veranlasst, allmählich auch das Hinterland zu unterwerfen. Dort winkte im Innern die sagenhafte Stadt Timbuktu — ein richtiges Räubernest. Ein Leutnant, der die kleine Flotte auf dem Niger kommandierte, machte sich eines schönen Tages auf eigene Faust gegen den Willen seines Chefs auf, mit seinen Fahrzeugen nigerabwärts zu dampfen und Timbuktu zu erobern. Der stellvertretende Gouverneur des Sudan, Oberstleutnant Bonnier, erkannte die Gefahr, in die der Unvorsichtige sich gestürzt hatte, und traf Ende Dezember mit 3 Kompanien Infanterie und I Batterie auf einer Anzahl von großen Flussbooten die Fahrt nach Timbuktu an, um jenem den nötigen Rückhalt zu geben; die ganze Bagage dieses Detachements mit der zugehörigen Bedeckung musste unter Überwindung großer Schwierigkeiten von Klima, Überschwemmungen und Feindseligkeiten der Eingeborenen den Landweg von 820 Kilometer nehmen.
Als Kommandeur dieser Landkolonne bestimmte er Joffre, der dabei alles in allem etwa 400 Soldaten mit einem Tross von 700 Menschen (Führer, Bedienung, Träger) und 200 Pferden und Maultieren unter seinem Befehl hatte. Der erste Teil des Marsches führte noch durch französisch beherrschtes Gebiet, die zweite Hälfte musste erst in Besitz genommen werden.
Joffre ist hier marschiert, wie einst in ihren guten Zeiten die Römer marschierten. Nie hat er sich einer Überraschung ausgesetzt. Kommandos zum Holen von Lebensmitteln aus den Dörfern wurden stets militärisch gedeckt. Stets rückte er in drei Kolonnen nebeneinander bei kurzen Zwischenräumen in voller Kampfbereitschaft vor. Für die Nacht wurde, wenn irgend möglich, eine Seite des Lagers an den Niger gelehnt und so gedeckt; die übrigen drei Seiten wurden durch Dornverhaue geschützt, schwache Vorposten einige hundert Meter über das Hindernis vorgeschoben und ein ununterbrochener Patrouillen- und Rundendienst dazwischen eingerichtet. Dank dieser bis ins Einzelne durchdachten Vorsichtsmaßregeln hat Joffre sein Ziel Timbuktu am 12. Februar erreicht, ohne einen Mann verloren zu haben. Drei Tagemärsche vor Timbuktu fand er die Leichen der ganzen Gruppe Bonnier: beim Versuch, ihm entgegenzurücken, war sie einem Überfall der Tuaregs erlegen.
In Timbuktu erhält er vom inzwischen in Senegambien eingetroffenen neuen Gouverneur den Befehl, sofort zurückzukommen, ein Befehl, abgegangen ohne Kenntnis von der Vernichtung der Abteilung Bonniers. Das würde von den Eingeborenen als offenes Eingeständnis einer Niederlage, als Preisgabe von Timbuktu aufgefasst werden! Aber die Disziplin? Ein kurzer Kampf, dann meldet er auf dem Wasserwege: „So ist die Lage; ich bleibe”, — und beginnt mit der Befestigung von Timbuktu. Sein erstes Werk ist ein kräftiges Fort, in dem die Besatzung Sicherheit, Ruhe, Unterkunft und Verpflegung findet; kleinere Werke und Blockhäuser folgen. Er unternimmt scharfe Streifzüge gegen die räuberischen Nomaden und beschützt gleichzeitig die sesshafte Bevölkerung und die Kaufleute. Der Gouverneur billigt sein Verhalten. Nach verhältnismäßig kurzer Zeit hat er das Land in Ordnung gebracht und beruhigt, kehrt zurück, wird belohnt durch die Beförderung zum Oberstleutnant und Verleihung des Offizierkreuzes der Ehrenlegion. Zum ersten Mal selbständiger Truppenführer, hat er sich sofort unter schwierigen Umständen durch Einsicht, Charakter und Energie ausgezeichnet. — Ein kurzer Aufenthalt im Kriegsministerium in Paris, dann fordert ihn der General Gallieni, Gouverneur von Madagaskar, an. Der Kolonialminister zögert, den eben zum Oberst Beförderten zu schicken, aber Gallieni besteht darauf. „Joffre hat unter den kritischsten Umständen”, schreibt er, im Sudan bewiesen, dass er die Charaktereigenschaften und das seelische Gleichgewicht besitzt, die den Führer machen. Die ihm unterstellten Leute können einer bis ins Einzelnste gehenden Sorgfalt und der ausgiebigsten Vorsichtsmaßregeln sicher sein; sie werden von vornherein unter besten gesundheitlichen Bedingungen, unter pflegsamer Behandlung und in praktischem Sinne eingesetzt werden. Bei ihm hat man keine unerwarteten Unfälle zu fürchten. Ich habe ihn nicht gewählt, weil er zu diesem oder jenem Departement gehört, sondern weil er der geeignete Mann ist.”
Joffre hat Gallienis Vertrauen in jeder Weise gerechtfertigt. Mit 49 Jahren steht er vor der Beförderung zum General. Für seine Maßnahmen zur Überwindung der zahlreichen Schwierigkeiten, die die Herstellung der Ordnung und die Organisation des Landes machen, werden die Mittel verweigert; da schickt ihn Gallieni selbst nach Paris, und schnell sind die Hindernisse beseitigt. Für ein letztes Jahr kommt er nach Madagaskar zurück, dann beendet er im Jahr 1902 endgültig seine Koloniallaufbahn. Er erhält im Kriegsministerium das Pionierdepartement, wird 1905 Divisionskommandeur, 1908 Kommandierender General in Amiens und kommt 1910 in den „Obersten Kriegsrat” mit der besonderen Aufgabe, den Eisenbahnaufmarsch und die rückwärtigen Verbindungen des Kriegsheeres zu bearbeiten.
Der „Oberste Kriegsrat” ist die verantwortliche Stelle für die Vorbereitungen auf einen Krieg. Präsident ist der jeweilige Ministerpräsident, Vizepräsident der General, der für den Kriegsfall als Oberfeldherr in Aussicht genommen ist. Damals war es General Michel. Er musste im Juli 1911 zurücktreten, am 28. Juli wurde Joffre sein Nachfolger. Der Sohn des Volkes hatte die höchste Stelle erreicht, die ein französischer Soldat im Frieden erreichen konnte.
Seine weitere Tätigkeit in der Vorbereitung auf den Krieg zu schildern, würde uns hier zu weit führen. Darüber und über den Marnefeldzug ist an anderer Stelle berichtet. Für sein Charakterbild sind aus den ersten Kriegsmonaten wesentlich die Rücksichtslosigkeit, mit der er nach den Grenzschlachten Generale, die er nicht für geeignet hielt, nach Hause schickte, die Umsicht, mit der er frühzeitig begann, Divisionen aus den Armeen in den Reichslanden nach seinem linken Heeresflügel zu überführen, die Ruhe, mit der er die Niederlagen ertrug und dabei das Vertrauen von Heer und Volk aufrechtzuerhalten wusste, schließlich die energische Durchführung des Gegenangriffs an der Marne, nachdem er sich einmal dazu entschlossen hatte. Er ist Optimist; wäre er das nicht, so hätte er die schweren Rückschläge, die seinen ganzen Operationsplan in wenig Tagen umwarfen, nicht mit solcher Ruhe ertragen und hätte nicht vermocht, bei seinen Unterführern die Zuversicht auf eine Wendung zum Besseren zu erhalten. Derselbe Optimismus ließ ihn aber nun den Sieg überschätzen: er verwechselt den im Namen der deutschen Obersten Heeresleitung diktierten, von der Truppe mit Widerstreben angetretenen deutschen Rückzug mit einem erzwungenen, glaubt an eine entscheidende Niederlage des deutschen Heeres, sieht bereits die Deutschen in wenigen Wochen aus Frankreich und Belgien vertrieben und sich am Rhein stehen. — Schnell genug musste er erkennen, dass davon keine Rede war; seine Offensive kam schon an der Aisne und Yser zum Stehen. Auch für ihn begann jetzt, wie für das deutsche Heer, die Zeit schwerer Munitionsnot. In der Winterschlacht in der Champagne setzte er am 16. Februar 1915 zu neuem Angriff gemeinsam mit den Engländern an — sein Angriff misslang. Am 9. Mai, 1 ½ Monate nach Beendigung dieser Winterschlacht, stürmte er wieder zusammen mit den Engländern im Artois gegen die deutsche Front, verführt durch die Hoffnung, während des Angriffs der Zentralmächte bei Gorlice eine günstige Lage ausnutzen zu können. Die Schlacht währte bis zum 18. Juni 1915; er schlug sie mit einer Überlegenheit von 600 Bataillonen, musste aber gleichwohl nach einem Verlust von 132 000 Mann wiederum ohne einen irgendwie im Verhältnis dazu stehenden Gewinn ablassen.
Dreimal hatte er die Erwartung erweckt, die Deutschen aus Frankreich zu vertreiben: nach der Marneschlacht, vor der Winterschlacht in der Champagne und jetzt vor der Frühjahrsschlacht im Artois. Dreimal war seine Voraussage falsch gewesen. Frankreich wurde unruhig über die Verluste, konnte nicht verstehen, wie die Deutschen es fertigbrächten, im Osten die Russen Hunderte von Kilometern vor sich herzufegen und Hunderttausende von Gefangenen zu machen, während man selbst um den kleinsten Raumgewinn wochenlang ringen und ihn mit größtem Materialaufwand, mit ungeheuren Blutopfern bezahlen musste. Dass der deutsche Soldat dem französischen überlegen sei, konnte man nicht zugeben; also musste die Schuld am Führer liegen! — In den Fehler, Joffre zu unterschätzen, verfiel General von Falkenhayn nicht, aber er erlag einer ähnlichen Täuschung, wie Joffre nach der Marneschlacht, folgerte aus dem Misslingen der französisch-englischen Angriffe (und wohl auch aus Agentennachrichten aus Paris über die dort aufquellende Missstimmung), dass den Franzosen die Kraft, ernsthaft anzugreifen, nicht mehr zuzutrauen sei.
Durch die Herbstschlacht in der Champagne musste er in empfindlichster Weise über seine Täuschung in dieser Hinsicht aufklären lassen. Joffre wollte die immer noch anhaltende Bindung starker deutscher Kräfte an der Ostfront zu einem Entscheidungsangriff hier und im Artois ausnutzen, bei Reims und Arrus durchstoßend Falkenhayns Westfront zerbrechen und dann den ganzen rechten deutschen Heeresflügel in Belgien von Süden aufrollen. Er vertraute auf sein neues Angriffsverfahren, die Ausgangsgräben möglichst nah an die deutsche Stellung heranzuschieben und sie durch Zwischengräben zu verbinden, so dass ein Bild ähnlich dem der Bienenwaben entstand und den Deutschen die Meldung: „Wabengräben!” bald als sicheres Vorzeichen von Angriffsabsichten des Gegners geläufig wurde. Es gelang ihm, für den gemeinsamen Angriff mit den Engländern eine überwältigende Überlegenheit an Zahl der Divisionen und an Artillerie zusammenzubringen. Der Anfang war vielversprechend; dann aber scheiterte auch dieser dritte französisch-englische Angriff des Jahres 1915 mit einem Gesamtverlust der Briten und Franzosen von 250 000 Mann gegenüber 150 000 auf deutscher Seite — trotzdem 52 französische und 12 britische Divisionen mit 30 deutschen gekämpft hatten. Als dabei die Deutschen noch die Möglichkeit fanden, im Verein mit den Österreichern und Bulgaren die Serben niederzuwerfen, während Gallipoli von den Ententetruppen geräumt werden musste, da wuchs die Missstimmung in Paris gegen den französischen Oberfeldherrn immer mehr an. —
Wenn Joffres Durchbruchsversuche misslangen, so lag das nicht daran, dass er sie nicht sorgfältig genug bedacht und befohlen hätte. Er war hierin so wenig leichtsinnig gewesen, wie seinerzeit beim Vormarsch gegen Timbuktu — es war ganz derselbe Joffre, der alles aufs gründlichste vorbereitete und in gewissenhaftester Organisation das Mittel zum Siege suchte. Auch strategisch waren die Einbruchsstellen gut gewählt gewesen: er scheiterte an der unvergleichlichen Tapferkeit und Zähigkeit des damals noch unerschütterten deutschen Westheeres. Aber es rächte sich jetzt an ihm der Ruhm der Marneschlacht. Man hatte von ihm das Unmögliche erwartet, und er selbst hatte das Unmögliche erhofft — jetzt stand er vor dem Trümmerfeld im Osten, erlebte große Enttäuschungen an der italienisch-österreichischen Front, konnte im Westen seinen Landsleuten keinen anderen Trost geben, als dass er allmählich die deutsche Front zernagen würde — und darauf wollte man in Frankreich nicht warten. Als unentwegter Demokrat hatte er es immer verstanden, mit den Männern der Linksregierung, die damals die Zügel führten, auf gutem Fuß zu stehen. Noch hielten sie zu ihm. Wird es ihm gelingen, im Jahre 1916 endlich einen entscheidenden Sieg zu erringen? Das ist die Forderung, die Frankreich an ihn stellt!
Schwere Wetter
Am 23. Juni 1916 entlädt sich ein starkes Gewitter über den Stellungen der deutschen 2. Armee, die beiderseits der Somme südlich Franzosen, nördlich Engländern gegenübersteht und von dem General Fritz, von Below geführt wird: Frucht zeugendes Walten der Natur! Furchtbarer antwortet am nächsten Morgen ein anderes Gewitter: Vernichtung wirkendes Tun des Menschen!
Um 5 Uhr betäubt das Ohr der deutschen Frontkämpfer ein Brüllen und Zischen, ein Heulen und Krachen, dass die Erde bebt.
Sprengwolken von Schrapnells, Rauch und Staub, giftgrüne Gase, wohin das Auge schaut. „In die Drahthindernisse reißen Torpedominen meterbreite Gassen, wühlen Trichter, verschüttet Gräben. Steinschlag und Eisensplitter schwirren durch die Luft” (R.-Felda. 26). Schwere Geschosse fallen bis in den Sitz des Generalkommandos nach Bapaume. Fliegerbomben vollenden das Werk da, wohin die Artillerie nicht reicht. Ins Elend flüchten von Haus und Hof die Bewohner. So geht es ununterbrochen vom Morgen bis zum Abend und vom Abend bis zum Morgen — bis zum Abend des 30. Juni. Weit überlegene Fliegerscharen beherrschen die Luft, zwingen die deutschen Flieger zur Erde, vernichten am 25. Juni zahlreiche deutsche Fesselballone.
Die deutsche Artillerie ist geblendet, während die feindliche reiche Meldungen von ihrer Luftbeobachtung erhält. „Schweres, wohlgezieltes Feuer liegt auf der deutschen Artillerie. Batterie um Batterie wird regelrecht bearbeitet.
Der Boden wird vor und hinter den Geschützen aufgerissen. Dazwischen fegen leichtere Granaten mit scharfkantigen Splittern aus feinstem Stahl.” Vermögen bei solchem Feuer noch Kämpfer der Infanterie und Artillerie zu dauern?
Wo wachsame Vorgesetzte Jahr und Tag — immer voraussehend, dass einmal die große Ernstprobe kommen würde — tief in den Kalkfels, der unter lehmiger Oberschicht hier verborgen ist, haben Stollen treiben und durch mächtige Decken geschützte Unterstände bauen lassen, da versagt die Macht des feindlichen Feuers. Nicht umsonst hatte General der Infanterie von Soden bei der württembergischen 26. Reserve-Division Tag für Tag die Schützengräben durchwandert: „Baut tiefe Stollen!” —, hatte bei der rechts anschließenden 52. Infanterie-Division der Anfang Mai neuernannte Brigadekommandeur General Lequis für sichere Maschinengewehrflankierung, reiche Fernsprechverbindung, Heranhalten der Reserven, hatten nördlich der Ancre alle Divisionskommandeure für das Bereitstellen von Verpflegung und namentlich auch von Getränk in sicheren Kasematten gesorgt. In Tiefen bis zu 10 m unter dem gewachsenen Boden vermögen selbst die dicksten Kaliber nicht zu dringen. Mit Sicherheit und Ruhe, selbst mit Humor harren da die bewährten Kämpfer der Stunde des Angriffs. Furchtlos und treu stehen die Leuchtkugelposten, rufen zum Alarm, wenn Leuchtkugeln steigen, wenn Gas- und Nebelwolken gegen den Graben branden. Und mag auch da und dort ein Volltreffer einzelne Geschütze zerschmettern oder weit fortschleudern — die Unterstände halten auch in den Batterien stand, schützen Bedienung und Munition. Unerschüttert wachen im Eisenhagel Beobachtungsoffiziere und Batterieposten, und so oft das Kommando ruft, tun die braven Kanoniere ihre Pflicht, trotz der Linken, die der Tod in ihre Reihen reißt.
Die feindliche Artillerie liegt auch auf den Zufahrtsstraßen. Schwerste Kaliber machen metertiefe Löcher. Und doch: Munition und Verpflegung müssen in die Batterien. Wie aus Erz gegossene Helden sitzen die Fahrer auf den schnaubenden Rossen und folgen dem Kommando ihrer Führer, gehorchen der inneren unerbittlichen Stimme der Pflicht. Und die schwere Fahrt auf Tod und Leben gelingt — die Batterien sind wieder versorgt. Wie wird’s das nächste Mal? Wie oft noch führt der Weg in diesen Feuerrachen? Wird die Infanterie dem Höhepunkt des Unwetters standhalten?
„Die harte Bauarbeit, über die man so oft gescholten”, heißt es beim R.-I.-R. 119, „hatte sich gelohnt. 20 Tote, 83 Verwundete hatte das siebentägige Trommelfeuer gekostet. In Sekunden ist die Besatzung der Gräben alarmiert, als nun um 8.30 Uhr Welle auf Welle den feindlichen Gräben entsteigt und im Schritt herankommt. Die Bajonette glitzerten im Sonnenschein, geschlossene Kolonnen bewegten sich von den Höhen von Auchonvillers herab, Brücken und Stege zum Überschreiten der Gräben mit sich tragend.” Da wird der Boden lebendig. „Es quillt aus Höhlen, kriecht aus Löchern, erdfarbene Echsen schmiegen sich an die zernarbte Erde. Zerschlissen die Kleider, voll Staub und Schutt, rußgeschwärzt die Gesichter — doch hell das Auge, die Waffe blank — so hocken kampfbereit gespenstische, feldgraue Gestalten in den Trichtern. Gewehre rattern, Maschinengewehre hämmern, Handgranaten krachen, das Sperrfeuer der Artillerie setzt ein. Furchtbar wütet der Tod. Stöhnend und ächzend stürzen Tausende, die Blüte der englischen 4. Armee sinkt dahin” (R.-Felda. 26).
Wo die Stürmenden an einzelnen Stellen in den Graben des R.-I.-R. 119 eindringen, werden sie durch Gegenstoß wieder vertrieben. Um 10 Uhr ist der Angriff auf das I. Bataillon abgeschlagen. Beim III. Bataillon macht eine Minensprengung eine Lücke offen. In erbitterten Nahkämpfen wird auch hier bis 13 Uhr der Angriff endgültig zurückgewiesen. Dieser eine Tag der Nahkämpfe aber hat dem Regiment fünfmal so viel Tote, zweieinhalbmal so viel Verwundete gekostet, wie das siebentägige Trommelfeuer!
Die Hauptgefahr kommt vom linken Flügel. Truppeneinschiebungen im Juni haben der 28. Res.-Div. teilweise einen neuen Gefechtsstreifen gegeben, links begrenzt von der Linie Cornoy— Montauban (Kirche) — östlich Longueval. Auf dem linken Flügel steht jetzt R.-I.-R. 109, das Jahr und Tag die Stellung von Ovillers musterhaft ausgebaut hatte. Hier findet es zu wenig Unterstände für die wiederaufgefüllten Kompanien, ziemlich dürftigen Ausbau, unzureichende Fernsprechverbindungen, keine eisernen Bestände an Lebensmitteln und Munition. „So hat die außerordentlich geringe Verteidigungsfähigkeit dieses Frontkeils viel zu den schweren Verlusten beigetragen, die das Regiment unter der bald eintretenden schweren Beschießung erlitt” (R. 109). — Mametz ist Zentrum dieser Stellung, dorthin ist am 24. Juni der Regimentskommandeur, Oberstleutnant v. Baumbach, mit seinem Stab übergesiedelt — noch nicht 1000 m hinter den vordersten Gräben. Um Mametz ringt die englische 7. Div., links von ihr rennt sich die 21. an der Abwehr der Regimentsreserve in Fricourt den Schädel ein; weiter südöstlich aber findet die englische 30. Div. im Vordringen auf Montauban das Drahthindernis so gut wie völlig beseitigt, die Stützpunkte vernichtet. Ihre Überlegenheit drängt Bayern vom Res. 6 und 62er zurück, während die 18. englische Division hart zu kämpfen hat, tun R. 109 die „Pommernschanze” zu entreißen. Montauban fällt. Gegen 13 Uhr erreicht sie die Straße Mametz—Montauban; Hornzeichen eines Verbindungsflugzeuges melden das erreichte Ziel. Sorgfältiges Erproben, wohin das deutsche Sperrfeuer gelegt wird, durch vorhergehende Scheinangriffe und rasches Überschreiten des Trichterfeldes hat dem englischen XIII. A.K. den Weg gebahnt. Dazu kommt, dass rechts vom XIII. Korps auch das französische XX. Korps um 8.30 Uhr erfolgreich einbrechen konnte, unterstützt durch Ufernebel, der die Maschinengewehrschützen des Verteidigers blind machte; nur im Waldstückchen westlich Hardecourt halten sich die Bayern vom 6. R.-R. noch mehrere Tage. Am liebsten hätte der Kommandeur der französischen 39. Division mittags noch Hardecourt selbst angegriffen, aber die 30. englische Division will nicht mitmachen; so gibt er den Gedanken auf. Gegen Abend wird von der französischen II. Division nach mehrstündigem heißem Ortskampf Curlu genommen.
Schweres Ringen tobt um Mametz. Wohl hatte der umfassende Bogen, mit dem das englische XV. A.-K. Mametz und Fricourt umspannte, den ersten Einbruch erleichtert; war doch hier, wohin die feindlichen Batterien aus verschiedenen Richtungen wirken konnten, ihr Feuer besonders schwer zu ertragen gewesen, wurden deshalb um 9 Uhr die Trümmer von Mametz erreicht, wurde in die Südwestecke des Dorfes eingedrungen. Dann aber versteift sich der Widerstand von Minute zu Minute. Um 10.30 Uhr werden zwei englische Unterstützungsbataillone eingesetzt — auch sie kommen nicht vorwärts. Von 11—11.30 Uhr wird Mametz zum zweiten Mal unter Trommelfeuer genommen: der erneute Angriff bleibt wieder erfolglos! 12.15 Uhr befiehlt der Kommandierende General eine dritte Beschießung von 13.25 Uhr bis 13.50 Uhr — das erst bringt den Erfolg. Umsonst trotzt eine kleine vorgeschobene Feldartilleriegruppe aus offenes: Stellung mit ihrem Feuer den Stürmern, bis die ganze Bedienung zusammengeschossen ist: bald nach 14 Uhr ist der Graben östlich Mametz genommen, kann der Gewinn im Handgranatenkampf nach Westen und Norden erweitert werden. Aber immer noch bleibt der Nordteil in deutscher Hand. Am Abend gelingt es Oberstleutnant c. Baumbach, mit seinem Stabe und den Resten der Verteidiger nach Norden durchzuschlagen; der Regimentsadjutant wurde dabei tödlich verwundet und starb in Feindeshand.
Weit bedenklicher für die deutsche Verteidigung sind die Ereignisse südlich der Somme. Nördlich der Somme, im Abschnitt des deutschen XIV. Ref.-K. ist schließlich der englische Angriff von Héuaterne bis zur Straße Albert—Bapaume so gut wie gescheitert, hat der englisch-französische Angriff von südlich la Boisselle bis zur Somme einen Geländestreifen gewonnen, der nur an einigen Stellen über 1 km Tiefe hatte. Südlich der Somme konnten sich die Sturmdivisionen der französischen 6. Armee (2. und 9. Kolonial-Div., 61. I.-D.) am Abend rühmen, von östlich Foucaucourt bis an den Westrand von Assevillers und von dort nach Norden bis Feuillères fast 3 km tief ohne große Verluste die ganze deutsche erste Stellung überrannt zu haben und in engster Fühlung mit der zweiten zu sein. Hier, wo das XVII. als verantwortliches Gruppenkommando trotz der Warnungen der Luftbeobachtung sich, wie General v. Hoeppner bekundet, nicht rechtzeitig entschließen konnte, an den bevorstehenden Angriff zu glauben, zeigten die französischen Patrouillenmeldungen vom 30. Juni als Ergebnis der Artillerievorbereitung, dass die Drahthindernisse an der befohlenen Einbruchsstelle zwischen Somme und Römerstraße größtenteils fortgeblasen, statt der Gräben nur noch Trichter vorhanden sind. Der Morgen des 1. Juli zwar scheint die Auffassung des Generals v. Pannewitz, dass es hier beim Artillerieangriff bleiben soll, zu bestätigen: als um 8.30 Uhr der Sturm nördlich der Somme ansetzt, bleibt südlich der Somme alles unverändert; nur das Heulen, Zischen und Krachen der Granaten geht ununterbrochen weiter — Trommelfeuer bis Vermandovillers, 4km südlich der Römerstraße. Aber um 10.30 Uhr lüftet sich plötzlich der Schleier: da brechen nördlich der Römerstraße die drei Sturmdivisionen aus den Gräben, überrennen unter schwachem deutschem Sperrfeuer die erste deutsche Stellung, und bereits um 12 Uhr tasten die Patrouillen der 2. und 9. Kolonial-Div. die deutsche zweite Stellung von Feuilleres bis Assevillers ab, während die 61. Div. sich in einer starken Flanke vom Ostrand von Foucaucourt nach Assevillers hinüber einzurichten beginnt.
Die Divisionen des Kolonial-Korps haben das Glück gehabt, in der 121.I.-D. einen Gegner zu finden, der erst kürzlich, durch lange, schwere Kämpfe bei Verdun ernstlich mitgenommen, hier eingesetzt und kaum in der Lage ist, einen Großkampf zu führen. Foch hat freilich befohlen, „systematisch” vorzugehen, sich nicht durch scheinbar günstige Möglichkeiten verführen zu lassen, das gestellte Ziel zu überlaufen — aber es sieht doch so aus, als wollten die Deutschen noch weiter zurückgehen. Darf das ungenutzt bleiben? Zwischen 15 und 19 Uhr dringen in Herbècourt und Assevillers Truppen der 2. und 3. Kolonial-Div. ein. Schon aber ist auf deutscher Seite eine Änderung der Lage eingetreten.
Heftige Gegenangriffe der 11. Grenadiere, die über Herbècourt, und der 38er, die über Belloy vorgehen, werfen sie mit empfindlichen Verlusten aus der zweiten Stellung zurück, und die 61. Div. muss zur Ausführung ihrer Aufgabe, die Verteidigungsflanke zu schaffen, artilleristische Hilfe vom A.-D.-R. erbitten.
Wir kehren zum rechten deutschen Flügel zurück, wo das englische VIII., X. und III. A.-K. von Hèbuterne bis la Boisselle angreifen. Mit der Überzeugung, vor einem großen Siege zu stehen, rücken die Divisionen der englischen 4. Armee in der Nacht vom 30. Juni zum 1. Juli in ihre Sturmstellungen. „Nie haben tapferere und entschlossenere Männer dem Feind ins Auge gesehen”, schreibt das britische Generalstabswerk, „niemals vorher hatten die Reihen einer britischen Armee auf dem Schlachtfelde die Besten aller Schichten der Nation nach Körper, Geist und Erziehung vereinigt. Freiwillige, keine Ausgehobenen! In der Helle einer mondlosen Sommernacht hatte der Annäherungsmarsch begonnen. Hunderte von Kolonnen auf sorgfältig erkundeten und bezeichneten Wegen. Das gewöhnliche nächtliche Feuer übertönt alles Geräusch — der Feind stört wenig.” Über das offene Gelände können die Truppen marschieren, mit ganz geringen Verlusten. Um 6.15 Uhr sind alle an den befohlenen Plätzen. Das Schweigen der deutschen Artillerie befestigt die Hoffnung, dass die siebentägige Beschießung ihr Werk getan hat. Auch die späte Angriffsstunde, — vom englischen Armeeführer nur ungern den Franzosen zugestanden, weil ihm Morgendämmerung zur Minderung feindlichen Abwehrfeuers günstiger schien, — beunruhigt die Truppe kaum. Sie denkt die Drahthindernisse zerschossen, alle Verteidigungsanlagen vernichtet, das Leben in Batterien und Gräben so gut wie erloschen, ist nicht gefasst auf die doppelte Überraschung, die diesmal die Deutschen vorbereitet haben: tief ausgehöhlte Unterstände, teilweise mit zwei Stockwerken unter dem Boden, die Maschinengewehre und Bedienung während des Bombardements schützen, sodass die Besatzungen eng zusammengepökelt, knapp genährt, seelisch mitgenommen, aber immer noch kampfbereit sind; und die zweite Überraschung: Batterien, die bisher geschwiegen hatten und erst beim Sturm auftauchten.
Von 7.25 Uhr ab gab es nur noch ein ununterbrochenes Toben von Artilleriefeuer mit dem Gellen, Pfeifen und Krachen der in der deutschen Stellung detonierenden Granaten. 8.22 Uhr setzen die Minenwerfer mit ihrem Feuerorkan ein. 8.30 Uhr kommt die Krisis. Als die Feuerwalze den feindlichen Frontgraben verließ, da stieg unter einem wolkenlosen blauen Himmel, der einen heißen Mittsommertag versprach, Welle auf Welle der britischen Infanterie aus den Gräben und bewegte sich langsam über das schwer gangbare Trichtergelände in ein Ungewisses von Rauch und Nebel. Fast in demselben Augenblick ließen die deutschen Batterien vom Artilleriekampf ab und vereinigten ihr Feuer auf den Angriff. Minensprengungen 8.20 Uhr haben auch die Grabenbesatzung vergewissert, dass jetzt der Sturm kommt; sofort erschienen Deutsche in der Frontlinie — und während eben noch eine britische Granate oder ein britisches Schrapnell die Gräben berührte, standen schon die meisten von ihnen aufrecht in diesen und feuerten. Mit direktem, gezieltem Feuer aus Gewehr und Maschinengewehr empfingen sie die vordersten Sturmwellen, die sich bemühten, die schreckliche Zone zu durchschreiten, während ihre eigene Feuerwalze viel schneller, als die Infanterie folgen konnte, fortlief und jene zu ihrer Verzweiflung ihrem Schicksal überließ” (H. G. W.).
Vom englischen West-Yorkshire-Regiment haben 9 Bataillone bei verschiedenen Divisionen den Angriff mitgemacht. „Kurz vor der Angriffszeit”, schreibt ihre Regimentsgeschichte, „verließen die Mannschaften von Middlesex und Devon ihre Sammelgräben. Ein Hagel von Maschinengewehr- und Gewehrkugeln brauste ihnen entgegen, wobei ein großer Teil des Feuere sie von der Seite her aus der Richtung la Boisselle und Ovillers fasste. 450—650m mussten durchquert werden — eine schreckliche Entfernung in solchem Kugelregen. Auch das Sperrfeuer wurde schneller. Bald schlugen 4 Granaten in der Minute in das Niemandsland und in die britischen Gräben ein. Um 8.20 Uhr wurde das Gebrüll der Geschütze von den lauten Explosionen zweier Minen unter dem Vorsprung von la Boisselle überdröhnt, die den Erdboden schwanken machten. Um 8.30 Uhr hörte unser Feuer auf, und die Mannschaften stürzten auf die feindlichen Gräben. Die drei ersten Wellen beider Bataillone wurden in Stärke geschossen; von der ersten Welle erreichten nur einige wenige tapfere Überlebende die deutsche Linie; einige Leute von Middlesex kamen durch die Front hindurch bis in die zweite Linie und wurden nicht mehr gesehen. Etwa 8.50 Uhr folgte die zweite Staffel, während schon ein scharfes Schrapnellfeuer vor der ganzen deutschen Front hinfegte. Um 9.25 Uhr schien das nervenzerrüttende Rat-tat-tat der feindlichen Maschinengewehre erstorben zu sein. Die dritte Staffel meldete nach rückwärts: „Alles fertig.”
Als jedoch die Frontgräben erreicht waren, wurde es auf einmal klar, warum das feindliche Maschinengewehrfeuer aufgehört hatte: es gab im Niemandsland nichts mehr, was sich noch bewegte. Der Raum — jener schreckliche tote Raum zwischen den Stellungen — war besät mit unbeweglichen Gestalten. Die erste Welle der zweiten Staffel war augenscheinlich zu den feindlichen Gräben hindurchgedrungen; ihre Helme waren auf der Brustwehr zu sehen, und stille, leblose Körper hingen über dem feindlichen Draht; die Überlebenden lagen in Granatlöchern dicht vor den beschossenen Hindernissen. Alles war still, die Lebenden gleich Toten, denn die geringste Bewegung hatte sofort einen Hagel von Maschinengewehr- und Gewehrkugeln zur Folge. Von den 21 Offizieren und 702 Mann, die am Morgen gefrühstückt hatten, sind nur 5 Offiziere und 212 Mann zurückgekehrt. Von der tapferen zweiten Staffel, die durch die feindlichen Gräben gedrungen war, kamen von 169 Leuten nur 23 zurück. —
Die Nacht vom 1. auf den 2. Juli glich einem schrecklichen Alptraum. Der Wald von Thiepval war eine wahrhafte Hölle. Vor dem Angriff am frühen Morgen war er noch dicht mit Bäumen bestanden, die ausgiebigen Schutz gewährten, den ganzen Tag aber war er von Granaten und Schrapnells zerfetzt worden, und als die Nacht anbrach, bedeckten zahllose gebrochene Äste den Boden, hagere Baumstümpfe ragten ihrer Schönheit beraubt kahl zum Himmel. Der feuchte und aufgewühlte Boden rauchte von Gasen und Dämpfen; Leute, die in der Dunkelheit unterwegs befanden und Gasmasken trugen, stolperten vergeblich umher, um ihre Truppenteile und deren Aufenthaltsorte zu finden. Die Frontgräben und viele Verbindungsgräben waren angefüllt mit versprengten und ermatteten Leuten. Überall lagen die Toten und die den Abtransport erwartenden Verwundeten. Der Verladeplatz für diese bot einen schrecklichen Anblick. Wenn man sich ihm näherte, hörte man ein unmenschliches Lärmen. Ein Klagelaut war vernehmbar, wie wenn riesenhafte nasse Finger über ein riesenhaftes Glas hinstrichen; ein Klagelaut, der sich erhob und abebbte, unermesslich und unerträglich. Dann merkte man plötzlich, woher er kam: den ganzen schmutzigen Weg entlang lagen sie, die Verwundeten; nach Hunderten; Gestalten in braunen Mänteln; einige rufend, einige jammernd, einige im Delirium singend, einige ganz still.
60 000 Mann Verlust meldeten die am Angriff des 1. Juli beteiligten 5 britischen Korps. Gewinn: ein Streifen Land, 5 km breit, 1,5 km tief, und 24 Offiziere, 2000 Mann unverwundete Gefangene. Bei den Franzosen waren die Gefangenenzahlen größer, der Geländegewinn tiefer, die Verluste der beteiligten 5 Divisionen 11 000 Mann. Das war der Beginn von Joffres großem Ringen um den entscheidenden Sieg. Ob er befriedigt gewesen ist?
Materialschlacht
Bei den Franzosen waren die Verluste im Jahre 1915 auf fast 2 Millionen Männer gestiegen, von denen 1 Million — Tote und Vermisste — für den Krieg endgültig ausfallen. Solchen Verlusten ist ihre Ersatzlage nicht gewachsen. Nur unter verfrühter Heranziehung der Nachwuchsjahrgänge ist es möglich, bis Mitte 1916 unter Voraussetzung normalen Verbrauches die Stärke des französischen Heeres weiter zu steigern. Von da ab wird unweigerlich ein Sinken der französischen Kampfkraft eintreten müssen.
In England hatte der Kriegsminister Lord Kitchener im August 1914 den Aufbau eines Massenheeres aus den wenigen Divisionen des Friedensberufsheeres durch Einstellung von Freiwilligen in die Wege geleitet. Bevor aber die von ihm für erforderlich erachtete Heeresstärke erreicht ist, beginnt im Herbst 1915 der Zufluss weiterer Freiwilliger zu stocken. England hat bis Ende 1915 über 500 000 Mann verloren, es wird sich entschließen müssen, trotz innerlicher Ablehnung der Bevölkerung und der Unmöglichkeit, die unsicheren Iren gewaltsam heranzuziehen, zur allgemeinen Wehrpflicht überzugehen. Tatsächlich wird sie am 27. Januar für die Junggesellen, am 25. Mai auch für die Verheirateten Gesetz — immer unter Ausnahme von Irland. Nachdem aber durch die Einstellung der Freiwilligen der Rahm abgeschöpft ist, kann von dieser Zwangseinstellung nicht mehr allzu viel erwartet werden; die Erfahrung hat es bald bestätigt. Wohl wird es gelingen, bis zur Jahresmitte alle Fehlbeträge in der Heeresstärke zu decken — fehlen aber wird es auch bei den Engländern dann an ausreichendem Nachersatz, wenn neue verlustreiche Kämpfe eintreten.
Ein weiterer Übelstand bei beiden Alliierten ist die Munitionsfrage. Trotz der hohen Entwicklung der Industrie beider Länder, der reichen Kohlenlager Englands, der Möglichkeit, auf die Geschütz- und Munitionsfabriken der Vereinigten Staaten und Japans zurückzugreifen, will es immer noch nicht gelingen, die Fabrikation von Treibstoff, Sprengstoff, Granaten, Zündern und Geschützen auf die Höhe zu bringen, die nach den Erfahrungen der verfehlten Angriffe des Jahres 1915 erforderlich sein wird, um dem deutschen Heer in Frankreich eine entscheidende Niederlage beizubringen. Dass die Russen im Sommer 1915 einen großen Teil ihrer Waffenrüstung eingebüßt haben und nur durch Mithilfe ihrer Verbündeten wieder kampfkräftig gemacht werden können, ist dabei mit in Anschlag zu bringen.
Die Betrachtungen über die gefahrdrohende Entwicklung in der Zahlenstärke des französischen Heeres, mehr noch als das Drängen der Pariser politischen Kreise, lösen im Dezember 1915 bei Joffre den Entschluss aus, die Entscheidung im kommenden Jahre zu erzwingen. Haben bisher schon Engländer und Franzosen sich eifrig bemüht, mit ihren Rüstungen voranzukommen, so muß nunmehr mit äußerster Kraft eine Erweiterung der Leistungen erreicht werden. Material, Organisation und Taktik müssen zusammenwirken, um der Führung die Siegesmöglichkeit zu schaffen. Zu diesem Zweck legen die Engländer im Frühjahr die Munitionsherstellung in die Hand einer ersten Kraft: Lloyd George wird Munitionsminister. Seine Leistung wird dadurch gekennzeichnet, dass die englischen Fabriken 19I6 im Ganzen Granaten im Gewicht von 50 Millionen Tonnen (50 Milliarden Kilogramm!) gefertigt haben, und dass im Oktober 1916 die englischen Feldkanonen als Monatsrate 1 200 000, die 15-cm-Haubitzen 275 000 Geschosse verfeuern konnten: was für die große Entscheidungsschlacht gefordert war, wurde erfüllt. Freilich war die Munition infolge des Drängens zum Teil minderwertig, Granaten, die Wald und Heide in Brand stecken sollten, zündeten nicht, Früh- und Rohrzerscheller in unzulässig hoher Zahl bedrohten die Bedienung, ganze Lieferungsserien endeten als Blindgänger, Kartuschen verbrannten unvollständig und machten Auswischen nach jedem Schuss erforderlich, Rohrrücklaufbremsen versagten.





























