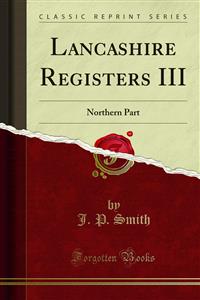4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Blut im Pool ist nur der Anfang. Jemand treibt Alex Mason in den Wahnsinn – oder in den Tod ...
Alle sieben Jahre, so erzählen sich die Kinder am Lagerfeuer, verschwindet aus dem Feriencamp ein Junge. Jetzt ist es wieder soweit. Und tatsächlich fehlt von Joey Proctor plötzlich jede Spur. Das ängstliche Kind war von einem Betreuer allein auf einem Floß im See zurückgelassen worden. Seither wird Joey vermisst – und bleibt es. Zwanzig Jahre später ist aus Alex Mason, dem Betreuer von damals, ein millionenschwerer Immobilieninvestor geworden. Von den Ereignissen jenes Sommers hat Alex niemandem erzählt. Aber wie kommt auf einmal Blut ins Wasser seines Pools? Wer filmt nachts seine Familie im Schlaf? Und das ist erst der Anfang des Albtraums. Ist Joey zurückgekommen, um sich zu rächen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Alle sieben Jahre, so geht das Gerücht im Ferienlager, verschwindet hier ein Junge. Und dann wird tatsächlich ein Kind vermisst: Joey Proctor. Der kleine Joey wagte sich nie ins tiefe Wasser, trotzdem ließ Alex Mason – ein Student, der im Sommercamp als Schwimmcoach jobbt – den Jungen auf einem kleinen Holzponton mitten im See zurück. Alex wollte Joey nur einen Schrecken einjagen. Er wollte ihn nicht auf dem Floß vergessen. Doch als er endlich nach Joey schaut, ist dieser verschwunden. Und er bleibt es.
Mehr als zwanzig Jahre später ist Alex Mason ein erfolgreicher Immobilieninvestor. Von den Ereignissen in jenem lang zurückliegenden Sommer weiß niemand. Zumindest sollte niemand davon wissen. Doch was steckt hinter dem blutigen Wasser in Alex’ Swimmingpool? Hinter dem Video, das ein Eindringling nachts in seinem Haus aufgenommen hat und das Alex und seine Familie im Schlaf zeigt? Und das ist erst der Anfang einer Reihe bedrohlicher Vorfälle. Es sieht ganz so aus, als wäre Joey zurückgekommen, um sich zu rächen …
Autor
J. P. Smith wurde in New York City geboren, begann seine Karriere als Schriftsteller allerdings in England. Dort lebte er mehrere Jahre mit seiner Familie und veröffentlichte seinen ersten Roman. J. P. Smith arbeitet zudem als Drehbuchautor. Mit »Sommertod« erscheint erstmals eines seiner Werke auf Deutsch.
J. P. Smith
Sommertod
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Rainer Schmidt
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »The Drowning« bei Sourcebooks, Inc.
Der Abdruck des Zitats Eoin McNamee, Requiem, in der Übersetzung von Hansjörg Schertenleib erfolgt mit freundlicherGenehmigung des Deutschen Taschenbuch Verlags, München.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung Juni 2019
Copyright © der Originalausgabe
2018 by J. P. Smith
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Westend61/Getty Images
Redaktion: Marion Voigt
AB · Herstellung: kw
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-24319-7V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Sophie
Er sah ihre Umrisse im Schein des Feuers. Sie
schliefen nie, wanderten verloren durch ihre eigene
Geschichte. Kinder der Nacht, die niemand kennt.
Eoin McNamee, Requiem
Stellen Sie sich vor: eine stille, sternklare Nacht im August, so warm und klar, wie der ganze Tag war und der Tag davor, und genau so, wie der nächste sein wird. Ein offenes Feld, umgeben von einem Kiefernwald, so dicht und dunkel, dass die Grenze zwischen Himmel und Erde verschwunden ist. Bald werden die Camper ihre T-Shirts und Shorts einpacken, ihre Tennisschläger und Baseballhandschuhe und Säcke voll schmutziger Wäsche und nach Hause fahren, nach New York, nach Connecticut, New Jersey und weiter.
Lagerfeuer beleuchten die Gesichter der Jungen, die im Kreis sitzen, die jüngeren näher an der Mitte des Kreises, die älteren Camper außen am Rand, näher am Wald. Das Abendessen – Hotdogs, auf Stöcke gespießt und über dem offenen Feuer gebraten, Kartoffeln, in Folie unter der Asche gebacken, und Marshmallows, auf Zweige gesteckt und schwarz geröstet – ist vorbei. Die Flammen brennen herunter, versinken in der Glut, und die Betreuer gehen außen um die Kreise herum und erzählen die gleiche Geschichte, die sie Jahr für Jahr erzählen, leise und ehrfürchtig, als wäre sie ein Geheimnis, das für alle Zeit bewahrt werden muss. Eine Geschichte, die inzwischen mit der Kultur des Camps so verwoben ist wie die Lieder, die sie im Versammlungssaal gesungen haben – Oden an das Leben unter freiem Himmel, an den Teamgeist, an den Echo Lake und die Berge dahinter. Die Jungen starren in die ersterbende Glut und sehen, wie die Worte zum Leben erwachen, oder sie halten die Augen geschlossen, als wünschten sie, das Camp wäre schon vorbei und sie wären zu Hause, wo nichts Böses sie je erreichen kann.
»In einer Nacht, wie alle sieben Jahre seit der Gründung von Camp Waukeelo 1937«, beginnt einer der Betreuer, »schlich sich lange nach dem Zapfenstreich ein Mann aus der Gegend, John Otis, durch den Wald hinter den Schlafbaracken ins Camp und holte einen der kleineren Jungen.« Er schweigt, damit seine Worte in den Köpfen der Jungen besser Wurzeln schlagen können. »Die Leute aus dem Dorf sagten, John sei einer, der in einer Menschenmenge nicht auffallen würde, ein Durchschnittskerl nach Größe und Gewicht, aber«, und der Erzähler schweigt für einen Moment, »mit den Augen eines Toten. Wer da hineinschaute, fing an zu frieren.«
Ein anderer Betreuer ist schon weiter mit der Geschichte. Auch er wandert außen um den Kreis seiner Camper herum. »… denn Sieben- und Acht- und Neunjährige – ihr wisst, wen ich meine – sind leicht zu packen. Leicht zum Schweigen zu bringen. Leicht verschwinden zu lassen …«
Ein Dritter sagt: »… und so verschwand der Erste im Juli 1944, im Krieg, in einer warmen Nacht wie heute.« Ein paar der jüngsten Camper kämpfen mit den Tränen. Der Betreuer redet weiter. »Der Nächste verschwand sieben Jahre später, 1951, und zufällig genau am heutigen Datum.«
Ein vierter Betreuer sagt, John Otis sei immer auf seinem Ausguck auf den Höhen hinter den Schlafbaracken und beobachte, wie die Jungen sich morgens zum Flaggenappell aufstellen und wie sie vom Bootsanleger in den See springen, und dabei überlege er, welchen er als Nächsten holen sollte. »Vielleicht ist er sogar jetzt da oben im Wald«, sagt der Betreuer, und acht Augenpaare spähen hinauf. »Beobachtet. Überlegt. Trifft seine Wahl.«
Abgesehen von den gedämpften Stimmen der Betreuer und dem Knistern der Lagerfeuer ist es still. Die Camper sind gepackt von der Erzählung, eingefangen von Wörtern, ihrer Fantasie ausgeliefert.
»Er nimmt sich immer den Einzelgänger vor«, erzählt ein anderer Betreuer jetzt, und ein paar Jungen schauen sich um und fragen sich, wer von ihnen wohl gemeint sein könnte. »Ihr wisst schon, wen ich meine … den Jungen, der nie richtig mitmacht, der immer für sich bleibt.« Ein paar Camper schauen eingeschüchtert zu Boden, denn sie wissen, er beschreibt sie.
Die Geschichte endet immer damit, dass die anderen Camper in der Baracke des Jungen seine leere Pritsche sehen und sich fragen, wohin er verschwunden ist, ohne eine Spur oder einen Hinweis zu hinterlassen. Ist er ermordet worden, oder ist er bei all den anderen, die der Mann geholt hat, der hoch oben in den Bergen wohnt, an einem Ort, den keiner von ihnen kennt? Im Laufe der Zeit hat die Legende von John Otis an Einzelheiten gewonnen, und auch die werden Jahr um Jahr an die Camper weitergegeben.
So heißt es, dass John gegen Ende der Dreißigerjahre, als er in dem Haus aufwuchs, das sein Vater gebaut hatte, etwas sehr Schlimmes zustieß. Seine Mutter war kurz nach der Geburt ihres einzigen Sohnes verschwunden, und man munkelte von einer älteren Schwester, die aber vermutlich, da eine Geburtsurkunde fehlte, zu Hause entbunden worden und wohl auch dort gestorben war.
An einem Tag war John noch in der Schule, ein zurückgezogenes, unzugängliches und mürrisches Kind, das den Lehrern Widerworte gab und ständig Streit suchte, und am nächsten Tag war er plötzlich nicht da, und auch nicht am übernächsten und am Tag danach und an allen folgenden. Jeder Versuch der Polizeibehörden oder der Schulverwaltung, ihn zu Hause zu erreichen, endete vor zwei Wachhunden und mehr als einmal auch vor Johns Vater, der mit einer Schrotflinte in der Hand in der Tür stand.
Die Gemeinde gelangte zu der Auffassung, dass das, was aus dem jungen John geworden war, nicht mehr von Interesse sei. Entweder war er tot, oder er wurde außerhalb der Gesellschaft von seinem Vater großgezogen, der in den Berkshires im Ruf der Streitsucht und offenen Gewalttätigkeit stand. Die Leute gingen dem Alten aus dem Weg, wenn er, was selten vorkam, in den Nachbarstädtchen auftauchte, um große Stücke Fleisch und billigen Whisky sowie Kartons mit Babynahrung zu kaufen. Die Jahre vergingen, der Vater musste längst tot sein, und alle nahmen an, sein Sohn wäre auch nicht mehr da. John Otis verschwand in einer Art bösartigem Nachleben und wurde zu einem Gerücht, das in den Bergen rund um den See gefangen war. Manchmal behaupteten Camper, sie hätten ihn als Erwachsenen gesehen, in einem Ruderboot mitten auf dem See bei Sonnenuntergang, und er habe aus dem Schatten unter seiner Hutkrempe zu ihnen herübergeschaut. Oder er habe am Rand des Baseballfelds unter den Bäumen gestanden, geraucht und sie beobachtet, und er sei verschwunden, als sie sich abgewandt hätten, um den Betreuer zu rufen.
Das Rascheln im Wald hinter den Schlafbaracken war John Otis, und die leuchtenden Glühwürmchen waren Johns Augen. Der bloße Gedanke an ihn bedeutete, er stand hinter dir.
Diese Geschichten, die erzählt und wieder erzählt und im Laufe der Jahre an Lagerfeuern und später in der Nacht immer weiter ausgeschmückt wurden, ließen John Otis immer lebendiger werden. Auf die Fragen eines Campers, der die Geschichte schon im Jahr zuvor gehört hatte, antworteten die Betreuer nur, sie hätten sich verzählt, und dies sei das siebente Jahr.
Dieselben Namen wiederholten sich. Da war Scott Gardner, der Junge mit dem stachligen schwarzen Haar. Sieben Jahre bevor Scott verschwand, war Jake Kaufman mitten in der Nacht von seiner Pritsche geholt worden, und keiner in seiner Baracke hatte etwas gehört oder gesehen, aber wie die Betreuer genussvoll erzählten, war seine Pritsche am nächsten Morgen so ordentlich gemacht wie am Tag zuvor, nur lag an seinem Platz eine alte Puppe, der jemand beide Augen herausgequetscht hatte. Anfang August 1972 war Billy Olsen einem Ball in das dichte Waldstück gefolgt, das man »The Pines« nannte, und nie zurückgekommen. Hielt der Mann sie dort gefangen? Hatte er sie gefoltert? Ermordet? Waren sie immer noch da, und niemand hörte sie schreien, wenn John Otis die Treppe in den Erdkeller seines morschen Hauses hinunterstieg?
Manchmal zeigten die Betreuer den Jungen Fotos der angeblich verschollenen Camper in den verstaubten Lederbänden auf einem Regal im Gemeinschaftssaal, auf denen der Name des Camps in Blattgold geprägt zu lesen war. Da war der blasse blonde siebenjährige Henry Cassidy im Sommer 1944, der verblichene, der in der vordersten Reihe saß und ein bisschen verloren aussah. Da war der pummelige lächelnde Aaron Blume, der verschwunden war, zwei Tage nach Entstehen des Fotos im August 1958. Und der magere Richard Ivory, eckig und mit eingefallenen Wangen, der seit 1965 verschollen war.
Jetzt ist es Zeit zu gehen. Stumm folgen die Jungen dem Licht der Taschenlampen, mit denen ihre Betreuer sie auf dem Pfad durch den Wald zu ihren Baracken führen. Wenn sie doch einmal etwas sagen, tun sie es leise und staunend, denn die Angst hat einen Namen bekommen, eine Wirklichkeit ganz für sich allein.
»Glaubst du irgendwas davon?«, fragt einer der Achtjährigen, und der Junge neben ihm, Joey Proctor, sagt, es könnte möglicherweise wahr sein. Am nächsten Tag verschwindet Joey, und man wird ihn nie wiedersehen.
Eines Tages, viele Jahre später, zeigt ein Betreuer auf Joeys Gesicht auf dem Gruppenfoto und erzählt von John Otis und von Joey, der an einem Tag da war und am nächsten nicht mehr. Joey ist Teil der Legende geworden, und er lebt darin von dem Tag, an dem er verschwand, bis zu dem Morgen einundzwanzig Jahre später, an dem er anscheinend wieder zum Leben erwacht.
ERSTER TEIL
1
Am ersten Camptag in dem Sommer, der sein letzter sein sollte, fuhren Joey Proctors Eltern ihn mit dem Mercedes seines Vaters hinauf und hielten gleich hinter der Grenze von Massachusetts an einem Schnellrestaurant namens Little Dee’s an. Das Schild über dem Eingang war sicher schon seit mindestens dreißig Jahren da: ein lächelndes Mädchen mit einer Baumwollschürze, das ein voll beladenes Essenstablett trug. Während der Fahrt hatte Joey die meiste Zeit versucht, sich auf ein Buch zu konzentrieren, das er auf dem Rücksitz las. Aber jetzt, da sie kaum noch eine Stunde zu fahren hatten, krampfte sich sein Magen zusammen, und der Mund wurde ihm trocken.
Das Camp war eine abstrakte Idee wie der Tod oder das Ich oder das Erwachsensein: für Joey unvorstellbar und ohne Dimension, ein Wort, das nichts bezeichnete außer einem Daseinszustand, in den er bald eintreten würde. Er wusste nur, dass seine Eltern in letzter Zeit viel gestritten hatten; sie sagten, sie brauchten ein wenig Zeit, um alles zu klären – und das bedeutete Zeit ohne ihn. Sie warfen ihn hinaus. Kürzten ihn weg aus der Familiengleichung. Es war alles sehr schnell gegangen.
Er starrte die Speisekarte an, ohne sie zu lesen. Als die Kellnerin mit ihrem Block und dem Bleistiftstummel und dem breiten aufgemalten Lächeln zu ihnen kam, zögerte er und bestellte dann einen Cheeseburger mit Pommes frites und Orangensaft, weil er nichts mit Kohlensäure trinken durfte. Er war nicht mal hungrig. Kopfschmerzen hatte er, und was er schon beim Verlassen der Stadt empfunden hatte, das Gefühl von Unbehagen und Zweifel, hatte sich auf der zweistündigen Fahrt zu einem hohlen, schmerzhaften Grauen verfestigt. Während sie auf das Essen warteten, sprachen seine Eltern kein Wort – als hätten sie einander noch nie gesehen, wie Leute in der U-Bahn, die überall hinschauten, nur nicht in die Augen eines Fremden. Stattdessen starrten sie aus dem Fenster oder auf die gerahmten Bilder an den Wänden: Waldlandschaften und Wasserfälle und Teddy Roosevelt mit seinem Rough-Rider-Hut, der mit breitem Cowboygrinsen irgendwohin zeigte.
Sein Vater verschwand auf die Toilette, und seine Mutter erhob sich unvermittelt und ging hinaus zu dem Münztelefon auf dem Parkplatz. Sie nahm den Hörer ab und warf Kleingeld in den Schlitz. Joey sah zu, wie sie in der Luft gestikulierte, als ob sie darin herumrührte, und dann die Hand an die Stirn legte, als müsste sie angestrengt über etwas nachdenken. Sie stemmte die Faust in die Hüfte und lächelte auf ihre schiefe Art, den einen Mundwinkel etwas höher gezogen als den anderen. Langsam zog sie die Schuhspitze durch den Kies und zeichnete einen Bogen in die Welt, die Erinnerung an einen längst aufgegebenen Beruf. Wie sein Vater war sie einigermaßen rätselhaft. Sie waren zwei Menschen, die so vollständig im Widerspruch zueinander standen, dass Joey in ihrer Familie vom Mitglied zum Beobachter geworden war. Ein Fremder im eigenen Haushalt. Jemand, der zwischen zwei Klippen schwebte, ständig in Gefahr abzustürzen.
Am Nachbartisch saß ein Mann mit einer Baseballmütze, auf der John Deere stand. Er lächelte Joey an und nickte dauernd, als gäbe er einer Stimme in seinem Kopf recht. Er trank seinen Kaffee, und dann stand er auf und beugte sich über Joey. »Ganz allein, kleiner Mann?«
»Meine Mom ist draußen, und mein Dad ist …«
»Ja, ja, ich weiß schon.« Der Mann schaute aus dem Fenster, dann stützte er sich mit den Händen auf den Tisch und beugte sich tief herunter. Seine Hände bestanden aus lauter Knöcheln, rot und wund, und einer seiner Fingernägel war schwarz gehämmert. »Ich wette, du fährst in das Camp da, was?«
Joey nickte.
»Die machen alle hier halt. Kleine Jungs. Große Jungs. Väter. Mütter. Sogar Schwestern manchmal. Das ist deine Mutter da draußen?«
Joey nickte wieder.
»Kesses kleines Ding, was?«, sagte er. »Wie alt bist du denn?«
»Achteinhalb.«
Der Mann richtete sich auf und schaute lächelnd auf Joey herunter, als ob er eine mächtige Mahlzeit betrachtete, die er mit seinen schmutzigen, aufgeschürften Fingern in sich hineinstopfen würde. Joeys Vater kam an den Tisch zurück, und der Mann ging, ohne sich noch einmal umzuschauen. Joey sah zu, wie er an der Kasse seine Rechnung bezahlte, ein paar Worte mit der Frau wechselte, die ihm das Wechselgeld herausgab, und dann hinausging. Als er an Joeys Mutter vorbeiging, sagte er etwas. Sie riss den Kopf herum, und er stieg in seinen Pick-up und fuhr mit einem Lächeln auf dem Gesicht davon.
»Was hat der Kerl gewollt?«, fragte Joeys Vater.
Joey zuckte die Achseln. »Nichts.«
»Niemand will nichts.«
2
Joey sah den Mann mit der Mütze ein paarmal im Camp; er mähte den Rasen auf dem Baseballfeld und sammelte nach dem mächtigen Platzregen gegen Ende Juli herabgefallene Äste auf. Nur einmal schien er Joey zu erkennen, als er auf dem Weg zu seinem Truck vor der Kunsthandwerkshütte stehen blieb und ihn anlächelte. Er legte zwei Finger unter die Augen und richtete sie dann auf Joey. Die Geste sagte Joey nichts, und als er in seine Baracke kam und im Bad vor dem Spiegel stand, probierte er sie aus. Weil sie da immer noch keinen Sinn ergab, vermutete er, sie habe wohl mit etwas Dunklem, Okkultem und fraglos Verbotenem zu tun.
»Telefoniert deine Mutter wieder?«, fragte sein Vater.
»Ich glaube.« Sie war noch draußen und rieb sich den Kopf, und sie lächelte nicht mehr. Es sah aus, als denke sie angestrengt über etwas nach und versuche, sich eine Idee oder ein Wort aus dem Kopf zu pressen.
Sein Vater lächelte bei sich, als wisse er genau, wer da am anderen Ende der Leitung war. Er schüttelte den Kopf und sagte leise: »Mannomann.« Dann kam Joeys Mutter wieder herein, und das Essen wurde serviert. »Das konnte nicht warten?«, fragte sein Vater.
»Du weißt doch gar nicht, worum es ging und mit wem ich gesprochen habe.«
»Ich kann es mir aber denken.«
Sie aßen wie immer schweigend, und als es Zeit war zu gehen, endete das Schweigen nicht, wie auch eine Uhr weiterläuft, wenn man eingeschlafen ist.
Eine halbe Stunde später schickte das Navi seines Vaters sie auf eine nicht gekennzeichnete Straße, die kein Ende zu nehmen schien. Vor einem Feldweg, der davon abzweigte, hing ein handgemaltes Schild an einer Kette, auf dem stand: DURCHFAHRT VERBOTEN!!! UNBEFUGTE WERDEN ERSCHOSSEN!!! Sie fuhren noch ein Stück weiter, bis der Wald sich zu teilen schien und das Camp sich vor ihnen entfaltete. Eine Frauenstimme sagte: »Sie haben Ihren Zielort erreicht.« Am Straßenrand und auf dem Gras vor dem Eingang parkten viele Autos mit Kennzeichen aus New York, Connecticut und New Jersey. Ein älterer Junge mit einem Klemmbrett kam zum Mercedes und hakte Joeys Namen ab. »Baracke zwölf«, sagte er und deutete in die entsprechende Richtung. Sie konnten den See sehen, tiefblau unter einem strahlenden Sommerhimmel, blauer als der Himmel in New York. Blauer als blau, tiefer als tief.
Als sie auf die Baracke zugingen, sagte seine Mutter: »Sieht nett aus.« Sie sah Joey an. »Was meinst du?«
»Ist okay.«
»Nur okay?«
»Er ist gerade zwei Minuten hier, und du willst eine Meinung von ihm hören?«, sagte sein Vater, und Joey betete zum Himmel, dass sie jetzt nicht anfingen zu streiten – nicht hier, nicht jetzt. Als Joey seine Mutter einmal gefragt hatte, warum sein Vater immer so wütend sei, hatte sie nur gesagt, er habe es bei der wirtschaftlichen Situation in letzter Zeit schwer, und das Geld werde knapp. Vor ein paar Tagen hatte Joey gehört, wie sein Vater mit seinem Anwalt Leonard Rubicon telefonierte; er stritt leise mit ihm, hob dabei die Faust und senkte sie wieder. Hob und senkte sie. Dann schloss er die Tür seines Arbeitszimmers und stritt lauter weiter.
Sie wohnten Ecke Ninetieth und Park Avenue, und sein Vater fuhr Mercedes und trug immer einen Anzug. Seine Mutter war Balletttänzerin gewesen, bis sie mit siebenundzwanzig Jahren nach einer Verletzung damit aufgehört hatte. Zu Hause hingen ein paar gerahmte Fotos von ihr an den Wänden: seine Mutter en pointe, ein Schwan unter vielen in Schwanensee. Sie kam ihm vor wie eine ganz andere Frau als die, die bei ihnen wohnte. Auf den Fotos war sie geheimnisvoll. Ihr Gesicht war ausdruckslos, und sie hatte lange Arme und Beine, die sich streckten und ins Weite dehnten, als ziehe etwas Unsichtbares an ihnen. Wenn er die Bilder anschaute, spürte er, dass Menschen noch ein ganz anderes Leben hatten als das, welches er kannte. Dass die Fotos gerade diesen anderen Menschen zeigten, mit erhobenem Arm, balancierend auf den Zehenspitzen des einen Fußes.
Jetzt restaurierte seine Mutter Möbel in einem gemieteten Atelier im East Village, aber in letzter Zeit hatten dort nicht mehr so viele Kunden um einen Termin gebeten. Sein Vater sagte, die Konjunktur sei schlecht für alle, selbst für die Multimillionäre mit ihren Chippendale-Stühlen und dem Regency-Irgendwas. Ein paar Wochen nachdem sein Vater mit dem Anwalt und dann mit seinem Steuerberater gesprochen hatte, waren Männer mit weißen Handschuhen gekommen und hatten einige Gemälde, die der Familie gehörten, in Holzkisten verpackt. Joeys Familie flog in den Weihnachtsferien nicht mehr hinunter auf die Inseln, und sein Vater fing an, Linienflugzeuge statt Firmenjets zu benutzen. Anderen ging es ganz ähnlich, hatte seine Mutter ihm erzählt. Sie waren nicht allein auf der Welt. Wenn das Geld zu Ende wäre, dachte Joey, was würde dann aus ihnen werden?
Drei der Jungen in seiner Baracke kannten einander schon und hatten angefangen zu raufen, kaum dass sie angekommen waren. Sie schubsten einander herum und wälzten sich auf dem Rasen vor der Baracke mit ihren Fliegentüren und der Veranda und dem Wald dahinter. Wenn sie miteinander redeten, klang es fast, als benutzten sie eine Geheimsprache, und einer nannte einen anderen Bitch!, aber das hörte keiner der Eltern. Als ihr Betreuer, Steve, ihn mit den anderen Jungen bekannt machte, wusste Joey, dass er sich hier niemals einfügen würde. Er war nicht wie die anderen. Er war klein und sah jünger aus als acht, und sie waren mehr wie die älteren Jungen in der Schule mit ihrer großspurigen Wildheit.
Seine Mutter hatte ihm in einem Laden im Village nahe ihrem Atelier eine Campdecke mit roten und gelben Streifen gekauft. Die anderen Jungen, sah Joey, hatten einfache Decken in Grau oder Blau oder ausgefallenere mit den Logos von Sportvereinen, und es genierte ihn, dass seine Decke hervorstach, weil sie anders war. Er meinte, dass einer der Jungs schon darauf gezeigt und gelacht hatte. Seine Mutter faltete sie auseinander und machte sein Bett für ihn, aber Steve sagte, die Betten im Camp hießen Pritschen, und vom nächsten Morgen an sei Joey dafür verantwortlich, seine Pritsche selbst zu machen, und zwar mit sorgfältig eingeschlagener Decke. Der nächste Morgen, das klang in seinen Ohren wie ein fremdes Land mit eigener Sprache und eigenen Sitten. Dass er so lange hier überleben würde, kam ihm unmöglich vor.
Steve zeigte ihm seine eigene Pritsche, und dann zog er die eingeschlagene Decke halb heraus und machte alles neu, damit Joey sehen könnte, wie es ging, obwohl Joey in seinem ganzen Leben noch nie sein Bett gemacht hatte. Das hatte immer ihre Haushälterin Daniela getan, genau wie sie auch immer die Wohnung putzte, das Geschirr spülte, einkaufen ging und Joey eine Kleinigkeit zu essen machte, wenn er aus der Schule kam. Sie wird auch nicht mehr lange zu halten sein, hatte er seinen Vater erst in der vergangenen Woche sagen hören, und tatsächlich bekam sie, eine Woche nachdem Joey im Camp abgesetzt worden war, ihre Kündigung.
Der Junge auf der Pritsche neben Joeys war nur mit seiner Mutter gekommen, und er sah aus, als habe er auf dem Weg hinauf zum Camp die ganze Zeit geweint. Die Mutter des Jungen sprach mit Joeys Mutter, und er hörte, wie sie sagte, ihr Mann, der am Barnard College gelehrt habe, sei Anfang des Jahres an Krebs gestorben. Als er das hörte, schaute Joey die Mutter an und sah alles in ihren Augen: die Trauer, den Verlust. Der Junge hieß Greg, und er wohnte Joey gegenüber auf der anderen Seite des Central Park. Vielleicht würden sie Freunde werden. Aber wie sich zeigte, überstand Greg nicht einmal eine Woche. Er hatte zu großes Heimweh, um länger als bis Donnerstag zu bleiben, er hatte es satt, von den drei Jungen, die einander schon kannten, drangsaliert zu werden, und so kam seine Mutter und holte ihn nach Hause. Danach war die Matratze auf seiner Pritsche hochgeschlagen, als hätte er nicht einfach das Camp verlassen, sondern wäre an seinem Schlafplatz gestorben.
3
An dem Tag, als Joey Proctor verschwand, fünfWochen nach dem ersten Tag im Camp, fragte Steve ihn auf dem Weg vom Speisesaal zur Baracke, wie es denn so gehe. Er sprach leise, und die Worte waren nur für sie beide bestimmt. Joey sagte, es sei alles okay, und Steve erinnerte ihn daran, dass er sich im Laufe des Sommers wirklich gut gehalten habe: Er habe das Problem mit dem rothaarigen Ethan Daniels überstanden, der am ersten Tag nach der Eröffnung des Camps angefangen hatte, ihn zu schikanieren. Aber Joey wusste, dass es nur Steve zu verdanken war, denn der hatte ein langes Gespräch mit Ethan geführt und ihm gesagt, er solle Joey in Ruhe lassen. Andernfalls … Es war dieses andernfalls, das Joeys Vertrauen zu Steve gefestigt hatte.
In zwanzig Minuten sollte die Mittagsruhe beginnen, in der die Jungen auf ihrer Pritsche liegen und lesen oder Briefe nach Hause schreiben konnten. Joey wollte gern jeden Tag schreiben, aber es gab nichts Neues zu erzählen. Er hatte wenige Freunde gefunden, manche Unternehmungen machten ihm Spaß, er mochte seinen Betreuer, aber in seinen Briefen standen auch Lügen, um seinen Eltern weiszumachen, dass es ihm gut ging, damit sie nicht noch einen Grund zum Streiten hätten.
Alex, der Schwimmbetreuer, kam mit strammen Schritten vorbei und sagte »Hi«, und obwohl Steve lächelte, wirkte er auch schmerzlich berührt, als er Alex sah … als hätte ihn eine Wespe gestochen. Joey hatte das Gefühl, einen kurzen Blick auf einen anderen Steve geworfen zu haben. Der Betreuer fragte: »Schwimmst du gern?«
Joey schob die Hände in die Taschen und schaute zu Steve auf. »Manchmal.«
»Und magst du Alex?« Offenbar hatte er Joeys Gesichtsausdruck gelesen, denn er lachte. »Anscheinend nicht.«
»Er ist okay.« Joey wusste nicht genau, warum er Alex Mason nicht leiden konnte, aber er wusste, es hatte mehr mit seiner Angst vor dem Wasser zu tun als mit irgendetwas Persönlichem. Er schaute Steve an. »Was machst du, wenn du kein Betreuer bist?«
Steve lachte wieder. »Meistens studiere ich. Jura. An der Columbia University.«
Joey lächelte. Also waren sie beide New Yorker, und das hob seine Stimmung: Er hatte einen Betreuer, aber jetzt hatte er auch einen Freund. Er erzählte Steve, wo er wohnte, und Steve sagte, er wohne in Morningside Heights, nahe der Universität.
Sie kamen an einer Gruppe von Kids vorbei, die Frisbee spielten, und Joey blieb einen Moment stehen, um zuzusehen, wie ein Junge die Scheibe aus der Luft fing.
»Schon mal Frisbee gespielt?«
Joey zuckte die Achseln. »Manchmal. Aber nicht zu Hause.«
»Mit den anderen Jungs aus der Baracke?«
Joey zuckte wieder die Achseln. »Wahrscheinlich.«
Die Frisbeescheibe flog weit über die Jungen hinaus, die auf sie warteten. Steve fing sie und ließ Joey ein Stück zurücklaufen. Dann ließ Steve sie fliegen, und sie landete weich in Joeys Hand. Steve lächelte, und Joey warf die Scheibe zu den anderen Jungen zurück.
»Freust du dich, dass du bald nach Hause fährst?«, fragte der Betreuer, als sie weitergingen.
Joeys Laune verdüsterte sich wieder. »Ja. Vielleicht.«
Und er fing an zu erzählen. Wie seine Eltern ständig Streit hatten, und dass es wirklich, wirklich schwer für ihn sei, und weil die Worte bald einfach aus seinem Mund sprudelten, erzählte er auch, was seine Eltern zueinander sagten, und von der lastenden Stille bei den Mahlzeiten.
»Hast du eine Schwester oder einen Bruder, mit dem du reden kannst?«
Joey schüttelte den Kopf. »Da bin nur ich.« Verlegen merkte er, dass ihm die Tränen kamen.
Steve dachte darüber nach und nickte ein bisschen, fast wie der Mann mit der Mütze in dem Schnellrestaurant. Wie es Joey damit gehe, fragte er, so allein zu sein und zu hören, wie seine Eltern sich stritten, und Joey sagte, es sei, als hätte er gar keine Familie und nichts, wozu er heimkehren könne. Genau so drückte er sich aus: nichts, wozu er heimkehren könne. Zu Hause fühle er sich manchmal, als ob er etwas schrecklich falsch gemacht hätte, etwas, wovor niemand ihn gewarnt, ja, worüber niemand je gesprochen hatte, und als ob seine Eltern wegen ihres ganzen Unglücks wütend auf ihn und nicht nur aufeinander wären. Steve legte einen Arm um Joeys Schultern und drückte ihn kurz an sich. Dann nahm er den Arm wieder weg und sagte, das sei hart, und hoffentlich werde es bald besser werden, und schon als er diese Worte von Steve hörte, bekam Joey das Gefühl, es könne vielleicht wirklich besser werden. Wenn das Camp in einer Woche vorbei war und wenn seine Sachen in den Bus geladen wurden, der ihn zurück nach New York brachte, dann würde er vielleicht sehen, dass seine Eltern wieder Freunde geworden waren, dass sie einander liebten und sich freuten, ihn wiederzusehen, und dass es ihnen leidtat, ihn die ganze Zeit hier alleingelassen zu haben. Jetzt freute er sich darauf, nach Hause zu kommen, denn es war möglich, dass alles wieder so war, wie es sein sollte, und nicht so, wie es immer gewesen war. Manchmal musste man einfach an Zauberei glauben.
Der Abend vor diesem Gespräch war der Abend der Lagerfeuer gewesen, an dem alle die Geschichte von John Otis hörten, und Joey fragte Steve, ob das alles wahr sei. Steve sagte, es sei nur ein Schauermärchen. Außerdem, wenn John Otis jemanden holen sollte – und hier senkte er die Stimme und lächelte –, dann würde er wahrscheinlich Ethan Daniels nehmen, und über diese Antwort musste Joey laut lachen. Steve fragte, was nach der Mittagsstunde auf seinem Stundenplan stehe, und Joey sagte, er habe dann Schwimmen.
Unten am Seeufer konnte Joey sehen, wie Alex in seiner blauen Badehose ins tiefe Wasser sprang. Er sah zu, wie Alex’ Arme sich geschmeidig und mühelos aus dem Wasser hoben und er dann für mehrere Sekunden verschwand, bis er am Badefloß wieder auftauchte. Sein rötlich blondes Haar bildete einen starken Kontrast zum dunklen Wasser. Er stemmte sich auf das Floß, setzte sich auf den Rand und schaute zum Camp herauf, zu den Jungen, die Frisbee spielten, und weiter zu Steve und Joey.
Alex war Student wie die meisten Betreuer, und manchmal trug er nicht sein »Camp Waukeelo«-T-Shirt mit dem Bild eines im Kanu paddelnden Jungen auf dem See wie alle anderen, sondern ein Shirt mit abgeschnittenen Ärmeln und der Aufschrift »Sigma Alpha Epsilon«, wie er es auch an diesem Tag beim Mittagessen im Speisesaal getragen hatte, nur ein paar Tische von Joey entfernt. Ihre Blicke hatten sich kurz getroffen, und seine Augen waren völlig ausdruckslos gewesen. Joey würde sich immer an diesen Blick erinnern. Bis zu dem Moment, als Alex ans Ufer schwamm und ihn dem Tod überließ.
4
Es war Alex Masons erstes Jahr als Betreuer, wie es Joeys erstes Jahr als Camper war, und für beide sollte es auch das letzte sein. Bis zu diesem Tag durften die guten Schwimmer hinaus ins tiefe Wasser, während die Übrigen mit ihren sicheren Kickboards im mitteltiefen Wasser bleiben mussten. Aber mit diesem Tag änderte sich das alles.
»Okay, Leute, das Camp ist fast zu Ende, und es wird Zeit, in die Oberliga zu wechseln«, verkündete Alex, und Joey sah, dass der rothaarige Ethan breit grinste, als ob er wüsste, was jetzt kam.
»Also stellt euch auf dem Steg auf. Genau hier, okay? Du auch, Joey, komm schon.«
Nur zwanzig Minuten zuvor hatte Joey einen Brief an seine Eltern geschrieben: Er freue sich darauf, nach Hause zu kommen, denn nach seinem Gespräch mit Steve hatte er zum ersten Mal seit langer Zeit das Gefühl, alles werde gut. Er würde glücklich sein. Seine Eltern würden sich freuen, ihn zu sehen, und sie alle wären zusammen glücklich.
Joey wollte Alex fragen, was jetzt passieren werde, aber etwas in ihm kannte die Antwort bereits. Ihm war plötzlich sehr kalt, obwohl es heißer war als die ganze Woche bisher. Er schaute in das Wasser vor dem Anleger, und unter den funkelnden Reflexen des Sonnenlichts sah er nichts als Dunkelheit und Tiefe und Geheimnis. Er war nie in so tiefem Wasser gewesen, hatte nie erforscht, was dort lebte. Er wusste, was kam. All die Wochen im Camp, in denen er in Wasser geschwommen war, das ihm keine Angst machte, in dem er jederzeit mit den Füßen den Grund erreichen konnte … all diese Wochen hatten hierhergeführt. Das war es, was Alex von ihnen erwartete. Es war der Augenblick des Übergangs, in dem jeder Junge ein Schwimmer im tiefen Wasser werden würde … die ultimative Erprobung der Fähigkeiten, die Alex als Betreuer besaß. Einen Moment lang dachte Joey daran, umzudrehen und wegzulaufen und weiterzulaufen, an seiner Baracke vorbei und in den Wald, wo sie ihn nach ein oder zwei Stunden finden und dafür sorgen würden, dass er sich niemals ins tiefe Wasser begeben musste. Nicht jetzt und überhaupt nie.
»Wenn ich pfeife, möchte ich, dass ihr hineinspringt und zum Floß und wieder zurück zum Steg schwimmt, okay? Schlagt am Floß an, wendet und schwimmt zurück, dann sind wir fertig für heute. Wie ich es euch immer gesagt habe: Überlasst euch dem Instinkt. Eure Arme und Beine werden die ganze Arbeit übernehmen, und es wird gut gehen. Ihr werdet richtige Schwimmer werden. Alle bereit?«
Joey war nicht bereit, und er wusste, er würde es niemals sein. Er sah die anderen Jungen im Wasser, als Alex sich zu ihm umdrehte. Wild gestikulierend wie eine Filmfigur, die um ihr liebes Leben bettelte, verschränkte er die Hände, bitte, bitte, bitte, und er beschwor Alex: Er könne nicht schwimmen, er habe Angst vor dem tiefen Wasser – und das war die Wahrheit –, und er hatte immer gedacht, wenn er die Wahrheit sagte, werde man ihn verstehen, und jetzt kamen ihm die Tränen in die Augen, und sein Gesicht schien zu zerfallen, denn er war erst acht, und noch nie im Leben hatte er einer solchen Gefahr ins Auge sehen müssen. Dieses Gesicht eines hilflosen Kindes schien Alex Macht zu verleihen. Statt Mitgefühl zu wecken, entfachte es etwas Feuriges, Tödliches in ihm, etwas, das Joey in seinen Augen sofort sehen konnte. Alex verlor die Geduld, und er hob Joey auf und warf ihn ins Wasser. Da gab es kein Oben, kein Unten, nichts, wonach man greifen konnte, keinen Halt für Füße oder Hände, nichts als die fließende Ungewissheit des eigenen Todes, ein schreckliches Rauschen in den Ohren und das Wasser, das in die Lunge strömte.
Joey war dabei zu ertrinken.
Alex sprang zu ihm herein und versuchte, ihn zu packen, während er um sich schlug und strampelte. »Hey, bleib ruhig, lass es einfach laufen. So lernt man schwimmen.«
Aber Joey hörte ihn nicht. Er griff nach der Kette mit der silbernen Pfeife am Hals des Betreuers, schlang sie fest um die Finger, damit sie nicht entglitt, aber dann riss sie und sank auf den Grund des Sees, und Alex’ Gesichtsausdruck war der eines Mannes, der sich verärgert und herausgefordert sah. Er hielt Joey fest im Arm und schwamm mit wütenden Zügen weg vom Steg, vom Camp, vom sicheren trockenen Boden, und als sie das kleine Badefloß erreicht hatten, das auf dem Grund des Sees verankert war, hob er Joey hinauf.
Rot vor Wut rief er, Joey werde dort sitzen bleiben, bis er entweder starb oder allein zurückschwamm. »Willst du wieder zurück nach drüben? Deine Freunde sehen und auf deiner Pritsche schlafen und zu Abend essen? Ich habe geschworen, dass jeder einzelne meiner Camper am Ende dieses Sommers schwimmen kann. Und du wirst es mir nicht verderben. Jetzt werde erwachsen und tu, was du sollst.«
Joey sah Alex nach, wie er mit langen eleganten Zügen zurückschwamm, fast ohne die Beine zu benutzen, und sich auf den Steg hinaufstemmte. Er schaute sich nicht um, nicht ein einziges Mal. Joey schloss die Augen, und die Welt verschwand. Es gab keinen Alex Mason, kein Floß, keine Angst, keinen Tod. Als er die Augen wieder öffnete, war er immer noch auf dem Floß, und die letzten Stunden des Tages verebbten um ihn herum.
Es gab einen besonders schönen Sonnenuntergang an diesem Abend; mild hätten manche ihn vielleicht genannt. Die Wärme und ein sanfter Wind hoben jedermanns Stimmung. Die Betreuer hatten Informationsblätter bekommen, auf denen stand, wie sie ihre Camper für die Abreise in der kommenden Woche vorbereiten sollten, um sicherzustellen, dass alles gepackt war und die Jungen zur richtigen Zeit am richtigen Bus standen, und alle atmeten durch, als der Zapfenstreich über die Lautsprecher gespielt wurde.
Als Steve die Fliegentür öffnete und den Jungen verkündete, dass es Zeit war, das Licht auszumachen, sah er, dass Joeys Pritsche mit der gestreiften Decke leer war. Ob jemand Joey gesehen habe, fragte er.
Einer der Jungen sagte, Joey sei nicht beim Abendessen gewesen.
»Bist du sicher?«
Andere bestätigten es. Er hatte nicht an ihrem Tisch gesessen. Vielleicht, meinten sie, habe er sich auf der Krankenstation gemeldet oder so etwas. Steve hatte das Abendessen ebenfalls versäumt, weil er sich beim Zahnarzt im Dorf eine Füllung ersetzen lassen musste. Er ging zum Waschraum am hinteren Ende der Baracke. Den vier Waschbecken gegenüber waren zwei Toilettenkabinen, deren Sperrholztüren offen standen. Niemand war da.
»Keine Aufregung«, sagte er zu seinen Campern. »Ich komme gleich wieder.«
Als er weg war, spekulierten die anderen Jungen über das, was Joey zugestoßen sein konnte, und der Name John Otis fiel. Man hatte ihnen von diesem Ungeheuer erzählt, und jetzt war einer von ihnen verschwunden. Einer der Jungen, Kevin Butcher, fing an zu wimmern und hörte erst wieder auf, als Ethan ihn eine Heulsuse nannte.
Vier Betreuer, unter ihnen Alex Mason, saßen am Tisch im Mitarbeiterraum und tranken Kaffee – Studenten mit Freizeit. Alex’ Fuß im Sneaker lag auf dem Tisch, als gäbe es nicht den geringsten Anlass zur Sorge. Steve kam herein und fragte, ob jemand Joey Proctor gesehen habe, aber die Betreuer schauten ihn nur an, achselzuckend hier, kopfschüttelnd da. Weiter nichts.
»Er war auch nicht beim Abendessen.«
Alex stand auf und schob seinen Stuhl geräuschvoll über den rauen Holzboden. »Ich muss mal pinkeln.« Bevor er hinausgehen konnte, fragte Steve: »Er hatte Schwimmen bei dir, um vier – oder wann?«
Alex nickte. »Eher um halb vier.«
»Und da war alles okay?«
»Ja. Er war super.«
Fünf Minuten später war Alex unterwegs zum Seeufer, mit der Taschenlampe in der Hand und mit klopfendem Herzen. Schwimmen um halb vier, und jetzt war es halb neun. Alles in Ordnung, sagte er sich, der Junge war wahrscheinlich auf dem Floß eingeschlafen. Er würde mit dem Ruderboot hinausfahren und ihn holen. Lektion gelernt. Für sie beide.
Er knipste die Lampe an und richtete sie auf das Floß, das sanft im Wasser dümpelte.
5
Bei Anbruch eines Tages, der grau und dunstig heraufdämmerte, ließen sich zwei Polizeitaucher in Neoprenanzügen vom Steg in den See fallen, und eine Kette von Polizisten aus dem Ort und aus den beiden Nachbarstädtchen durchkämmte das hohe Gras am Rand des großen Feldes, bevor sie weiter ausschwärmten und im Kiefernwald nach Spuren suchte. Ein Hubschrauber der State Police flog tief über dem Wasser am Ufer entlang.
Dave Jensen, der Eigentümer des Camps, hatte die Polizei gebeten, die Presse nicht zu informieren, solange er und seine Frau Nancy noch überlegten, wie sie mit der Situation umgehen sollten, so etwas passiere ihm zum ersten Mal in seinen drei Jahren in Waukeelo.
Er stand mit Alex, Steve und ein paar anderen Betreuern am Ufer und wartete darauf, dass die Taucher hochkamen. Seine vorzeitige Glatze kompensierte Dave mit Schnauzer und Ziegenbart, beides grau gesträhnt. Nervös strich er daran herunter. Seine Arbeit beschränkte sich nicht auf das Camp. Während des Schuljahres leitete er dreißig Meilen weit weg eine Mittelschule. Er und seine Familie wohnten nur vier Meilen vom Camp entfernt. Als Waukeelo zum Verkauf stand, war das eine Gelegenheit, die er nicht verstreichen lassen konnte. Als Schulleiter war er für die Arbeit gelobt worden, die er für seine Schüler und die Gemeinde leistete, und mit der Leitung des Camps im Sommer dehnte er seinen Einsatz auf das ganze Jahr aus.
»Ich habe heute Morgen um fünf die Eltern angerufen«, sagte er. »Ich hatte gedacht, wir finden ihn über Nacht.« Er schüttelte den Kopf. »Sie kommen von New York herauf. Mein Gott, das ist wirklich ein Albtraum.«
»Was ist, wenn sie ihn nicht finden?«, fragte Steve. »Ich meine, wir werden den Kids irgendwas sagen müssen. Die werden ja merken, dass Joey nicht da ist.«
»Ich dachte mir, vielleicht müssen wir die Saison abkürzen und sie alle nach Hause schicken. Aber es sind ja nur noch – wie viele? – fünf Tage übrig. Vielleicht suchen sie ihn noch in einer Woche. All die Wälder rund um den See.« Dave schüttelte den Kopf, nahm die goldgeränderte Brille ab und polierte sie mit seinem Hemd. Kinder spazierten nicht einfach vom Camp weg in eine Gegend, die sie nicht kannten. Und die Vorstellung, jemand könnte heraufgefahren sein, um ihn zu entführen, war lächerlich. Warum Joey? Warum nicht irgendeinen anderen Jungen? Warum nicht Daves eigenen Sohn?
Steve drehte sich um und schaute zu den Baracken hinauf. Ein paar Jungen, die auf dem Weg zu irgendeiner Freizeitaktivität waren, hatten gesehen, dass etwas im Gange war. Sie waren stehen geblieben und gafften, und bald kamen weitere Camper dazu. »Ich kümmere mich um sie«, sagte er. »Was soll ich ihnen sagen?«
»Irgendetwas, nur nicht, dass wir Joey Proctor suchen. Vielleicht, dass wir glauben, jemand hat ein Kanu gestohlen. Aber nicht die Wahrheit.«
Steve ging zu den Kids hinauf.
Dave sah Alex an. »Du bist absolut sicher, dass er heil aus dem Wasser gekommen ist?«
»Ja. Auf jeden Fall. Er war super.«
»Kann jemand sich erinnern, dass er von hier nach oben gegangen ist?«
Alex schwieg.
»Irgendjemand sonst? Nicht? Nein?«
Alex sah aus, als sei ihm jetzt erst klar, dass der Mann mit ihm redete. »Ich weiß es nicht, Dave.«
Die Taucher kamen aus dem Wasser und nahmen ihre Masken ab. Sie schüttelten den Kopf.
»Herrgott noch mal«, sagte Dave. »Er ist nirgendwo.«
6
Joeys Eltern saßen Dave, Nancy und Steve gegenüberim Büro des Eigentümers in der Hütte, in der Dave und Nancy während der Campsaison wohnten, ein Stück weit abseits der Baracken, am Hang unterhalb des Speisesaals. Alan und Diane Proctor waren kurz vor elf angekommen und wurden jetzt über die Suchaktion und deren geplante Fortsetzung informiert.
Der Anruf am Morgen hatte sie aus einem tiefen Schlaf gerissen. Sie schliefen nicht mehr in einem gemeinsamen Bett, zumal jetzt nicht, da Joey im Camp war; Diane hatte in den sechs Wochen seiner Abwesenheit bereitwillig im Zimmer ihres Sohnes geschlafen. Sie ging immer noch zu ihrer Therapeutin, und gemeinsam waren sie zu dem Schluss gekommen, dass ihre Ehe nicht mehr zu retten sei. Sie konnte zwar nichts beweisen, aber sie hatte den Verdacht, dass ihr Mann in irgendwelche illegalen Aktivitäten verwickelt war, die die Familie ruinieren und ihn ins Gefängnis bringen konnten. Es gab einen russischen Geschäftsmann, mit dem er manchmal zu tun hatte und der ihn zu unmöglichen Zeiten aus Moskau, London oder sonst woher anrief. Immer wieder diese Anrufe. Immer wieder geschlossene Türen. Aber ihre eigentliche Sorge galt Joey. Wie würde er mit der bevorstehenden Trennung und schließlich mit der Scheidung zurechtkommen?
»Bevor Sie losgehen und mit einem Anwalt sprechen, denken Sie an die guten Zeiten, die Sie mit Ihrem Mann hatten«, hatte die Therapeutin ihr geraten.
»Warum sollte ich das tun?«
»Ich möchte etwas finden, das wenigstens einen kleinen Rest dieser Beziehung retten kann. Um Ihres Sohnes willen. Erst recht, wenn Sie sich scheiden lassen. Denn Joey ist der einzige Mensch, an den Sie beide denken sollten. Und er muss wissen, dass er Eltern hat, die immer noch höflich miteinander umgehen können.«
Gute Zeiten hatte es gegeben. Die beste war die um Joeys Geburt gewesen, aber dann war alles schnell schal geworden. Sie hatte an postnatalen Depressionen gelitten, und ihr Mann brachte keine Geduld dafür auf, erst recht, als er wegen der Wirtschaftskrise einen Kunden nach dem anderen verlor.
Sie schaute die Therapeutin an. »Nach der Hochzeit waren wir in Europa.«
»Flitterwochen?«
»Drei Wochen.«
»Und das war gut?«
»Es war wunderbar. Ich war aus dem Ballettensemble ausgeschieden, meinem Rücken ging es nach dem Unfall allmählich besser, und ich fand, es sei an der Zeit, eine Familie zu gründen.«
»Und Ihrem Mann war das recht?«
»Er war begeistert. Joey wurde in Paris gezeugt.«
Alle glücklichen Augenblicke, an die sie sich erinnern konnte, hatten also mit Joey zu tun. Die Pläne. Die Schwangerschaft. Das Baby. Und jetzt, da er verschwunden war und sie in dieser Hütte saß und sich anhörte, dass niemand wisse, wo er sei, da war es, als sei ihr ganzes Leben nichts mehr wert. Am liebsten wäre sie nach Hause gefahren, hätte das Apartment angezündet, ihr Geschäft zertrümmert und sich selbst großen Schaden angetan.
»Alle örtlichen Instanzen sind alarmiert worden«, berichtete Dave Jensen ihnen. »Die Polizeibehörden von Lenox, Lee, Pittsfield und Stockbridge koordinieren ihre Bemühungen. Straßensperren sind auf allen Haupt- und Neben…«
»Ein paar davon haben wir auf dem Weg hierher gesehen«, sagte Joeys Vater. Dann fuhr er sich mit beiden Händen durch das schüttere Haar und ließ sie dort, während er zu Boden starrte.