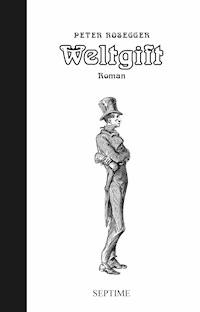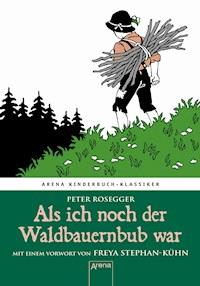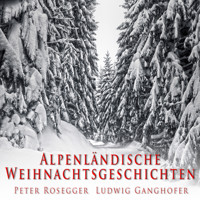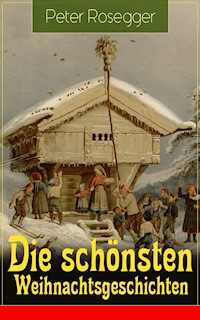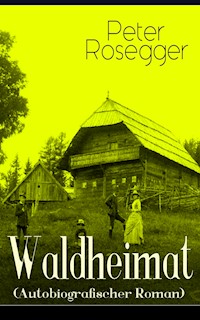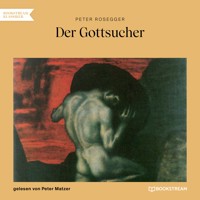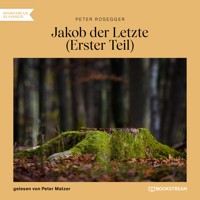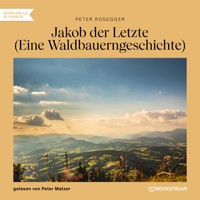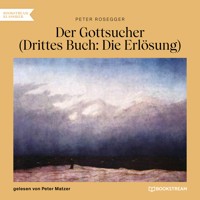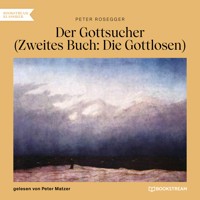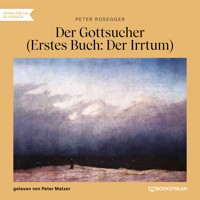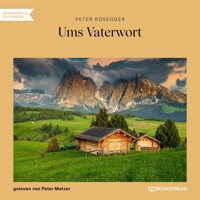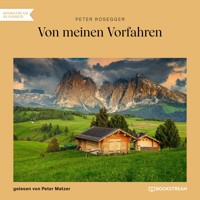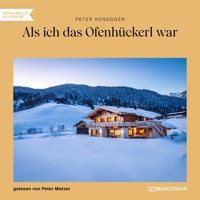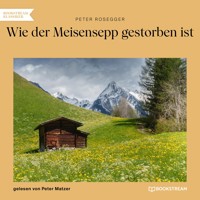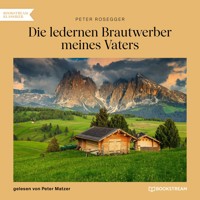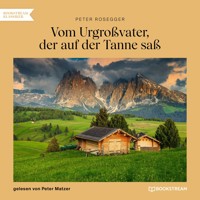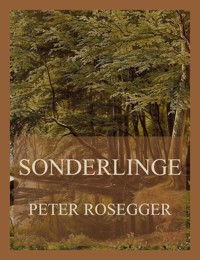
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Sonderlinge" von Peter Rosegger ist eine Auswahl von Charakterstudien, die er zu Ende des 19. Jahrhunderts verfasste und in drei Bänden veröffentlichte. Die hier vorliegende Auswahl wurde 1922 veröffentlicht. Das Werk präsentiert eine Vielzahl einzigartiger und exzentrischer Figuren, die als 'Sonderlinge' bezeichnet werden und unterschiedliche Lebenserfahrungen, Eigenheiten und Philosophien verkörpern. Mit Humor und Mitgefühl erforscht der Autor die Tiefen der menschlichen Natur und Beziehungen und zeigt sowohl die liebenswerten als auch die eigentümlichen Aspekte dieser Individuen auf. Oft reflektiert der Autor über die kollektive Natur der Menschheit und stellt fest, dass viele Menschen aus der Ferne zwar ähnlich erscheinen, aber jeder Einzelne ein Original mit individuellen Merkmalen ist, die durch persönliche Umstände geprägt sind. Das Werk bietet über 30 der schönsten Geschichten Roseggers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sonderlinge
PETER ROSEGGER
Sonderlinge, P. Rosegger
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988681997
Quelle: https://www.gutenberg.org/cache/epub/75532/pg75532-images.html
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Vorwort.1
Karl der Große.2
Der Fischer im Olymp.9
Der Geistbrenner.18
Der ordentliche Augustin.24
Meister Sani.30
Der falsche Himmelträger.35
Der unglückliche Kammerdiener.41
Die Einsiedler.46
Ein Wildling Christi.55
Der missratene Evangelist.67
Der alte Adam.75
Der Sämann.81
Der scheltend' Schuster.85
Herr Trotzkopf, der Heiratsbeflissene.89
Der Samer-Sim.94
Der Zillacher-Anderl.97
's Guderl.102
Der Figurlmacher.114
Der junge Geigenspieler.121
Der singende Schabelwirt.132
Das reiche Waldschulmeisterlein.141
Der Orgler zu Sankt Thomas.152
Der Naturfreund.156
Der lange Rauk.163
Hans Johanns Hauptsache.170
Der Himmelherrgottswirt.176
Herr v. Florin.182
Der Steinschädel.189
Der Feuermann Balthasar.195
Herr Meyer, der Belehrende.201
Ein Mann, ein Wort.208
Hauptmann Alles.216
Die Tafelrunde der Berühmten.222
Der Mann mit den dreizehn Talern.230
Der glücklichste Mann von Graz.255
Der Waldteufel.258
Vorwort.
Wenn man die Menge betrachtet, sind fast alle Leute gleich. Und wenn man in den Einzelnen schaut, ist fast jeder ein Original. Man soll auf allen Bäumen der Welt ja nicht zwei Blätter finden, die ganz gleich sind, und im unermesslichen Menschenwald ja nicht zwei Gesichter, die in gar nichts verschieden wären. Jeder Mensch existiert nur in einem einzigen Exemplar.
Ganz so sind die Sonderlinge dieses Buches nicht gemeint. Das sind vielmehr wunderliche Charaktere, durch Naturanlage, äußere Verhältnisse, besondere Weltanschauungen und Leidenschaften so gebildet. Bevorzugt habe ich die Harmlosen, Humorvollen, Gut- und Edelherzigen, besonders die froh verzichtenden Weltabweisenden, die meine Lieblinge sind. Aber es gibt auch finstere, dämonische Gesellen darunter; dann solche mit genialer Begabung und solche, die im Volk »halbe Narren« genannt werden, weil sie ganze Weise sind. Oft auch Menschen, die ihren Beruf verfehlt haben, oder die so eckig sind, dass sie sich in keinen einordnen lassen. Solche grollen dann gerne mit der Welt, führen ein verkümmertes, wunderliches Dasein. Manche machen sich aus Kleinlichkeit ein absonderliches Leben, manche aus Weltüberlegenheit.
Gefunden habe ich derlei Leute nicht, denn ich habe nie nach ihnen gesucht. Auf langem, reichlich gewundenem Lebensweg und mit einem Auge für innere Eigenarten begegnet man ihnen auch so. Manche, die Plaudersamen, sich selbst Ausspielenden machen es einem leicht, sie zu fassen; nur darf man sich nicht zu sehr foppen lassen. Dann hängt man ihnen gern einmal ein anekdotisches Mäntlein um. Etliche sind mir bloß erzählt worden und ein paar sind mir im Traume untergekommen, weniger aus der Umwelt, als aus mir selbst hervorgegangen.
Und so ist eine wunderliche, gemischte Gesellschaft zusammengekommen, die sich gewiss nirgends anders als im duldsamen Buche miteinander vertragen würde.
Der Verfasser.
Karl der Große.
Karl Oberbergbreitebner war so groß, das der Witz seiner Dorfgenossen zwei aus ihm machen wollte, einen Langen und einen Dicken. Wäre noch auf einen Dritten etwas übrig geblieben, so hätte ich für einen Klugen gestimmt. Karls Gehirn war entweder so klein, wie bei einem Huhn, oder so groß, wie bei einem Büffel. Doch hatte er sein Lebtag nie etwas Dummes gesagt, denn er sprach nicht viel, hatte nie etwas Albernes gedacht, denn er dachte nicht, er handelte bloß. Er hätte aber auch das tollste Zeug schwatzen können, seine Körperstärke war so groß, dass er kaum viel Widerspruch erfahren haben dürfte. Zwei derbe Arme sind eine doppelte Beweisführung.
Karl war der Sohn des Dorfschneidermeisters, hatte das ehrwürdige — nein, das ist zu viel — das ehrsame Handwerk des Vaters gelernt und ging mit diesem, einem kümmerlich kleinen und hageren Männl, auf der Ster um, von Hof zu Hof. Seit sein Karl groß geworden war, konnte das Meisterlein die entlegensten Höfe auch zur Winterszeit bei Schnee und Sturm besuchen. »Pack mich, Karl!« sagte er, und Karl nahm ihn auf den Rücken oder unter die Achsel und trug ihn gemächlich bergauf und talab; doch musste der kleine Alte dem großen Jungen fortwährend den Weg zeigen. Karl konnte nicht Kleider anmessen, nicht zuschneiden, überhaupt selbständig nichts fertig machen. »Das nähe!« sagte sein Vater, und er nähte es, aber auch um keinen Stich mehr und keinen weniger. »Das bügle!« sagte sein Vater, und wenn er ihm eine lebendige Katze hingehalten, so hätte er sie gebügelt. Wozu das Nähen und wozu das Bügeln? Ich glaube nicht, dass Karl jemals auch nur im Gedanken danach gefragt hatte. Warum auch?
Aber die Leute schätzten seinen Wert. Wenn irgendwo ein großer Holzblock zu schleifen, ein schwerer Stein zu wälzen oder eine Kohlentracht zu schleppen oder eine andere Last zu bewältigen war, so schickte man nach dem Schneider.
Da kam eines Tages eine Stadtherrschaft ins Dorf gefahren, mit der Absicht, den Hochstandel zu besteigen. Nun war aber der Hochstandel ein stattlicher Berg und die Dame der Herrschaft eine stattliche Frau, ein Gleich und Gleich, das sich nicht gerne gesellt. Ein alter, magerer Herr und die zwei munteren Töchterlein waren mutig, die stattliche Frau jedoch ließ Umfrage halten nach einem Wagen, um auf den Hochstandel zu fahren. Wägen leide der Berg nicht, wurde ihr gesagt; Maultiere, Esel oder dergleichen zum Reiten seien auch nicht vorhanden, hingegen lebe im Orte ein Schneider, der die Stelle genannter Vierfüßler recht gern übernehme und die Frau auf den schönen Berg tragen wolle. — Ein Schneider! Die vierfältige Herrschaft rümpfte ihre Nasen, ließ aber doch den Mann holen. Der erschien mit seinem riesigen Kohlenkorbe, dessen Boden er mit Reisig bedeckt hatte, so dass ein gar einladendes Nest ward. Als ihm dargetan ward, um was es sich handle, nahm er zuerst den großen Pack mit Esswaren, legte ihn hinein, dann nahm er ohne Umstände die Dame und hob sie in den Korb; nahm hierauf eines der Fräulein und hob es in den Korb, nahm hernach das andere Fräulein und hob es in den Korb. »So,« murmelte er, »jetzt tut sich's, jetzt brauch ich nur noch etwas zum Festkeilen.« Nahm auch den alten Herrn her und steckte ihn zu seiner werten Familie in den Korb. Dann packte er sich die ganze Bergpartie auf den Rücken und stieg langsam an.
Die beiden Stadtfräulein gehörten zur Gattung der Backfische, sie fürchteten sich daher gleich anfangs vor dem Riesen und hatten Angst davor, dass er sie unterwegs ermorden würde. Das Ungetüm zeigte sich jedoch überraschend harmlos, es ging mit dem Rückkorbe sachte den sonnigen Hang hinan und pflückte Erdbeeren. Ohne mündliche Artigkeiten warf er zwei Erdbeersträußchen hinter sich in den Korb. Die Fräulein verstanden das so, als sollte es für sie eine kleine Aufmerksamkeit sein, sie naschten daher die Beeren von dem Strauß und überlegten jedes für sich, ob man sich in diesen gewaltigen und doch so netten Mann nicht verlieben könne? Mittlerweile wimmerte die Frau Mama in ihrer Einpfropfung und der Herr Papa hielt eine Vorlesung über die Naturkraft.
Nach drei Stunden waren sie dort, wo es nach allen Seiten abwärts geht, und wo man stehen muss, wenn man nachträglich will sagen können, wir standen zweitausend Meter hoch über dem Meere. — Karl Oberbergbreitebner ging immer vorwärts, als ob er ohne Säumen in die freien Lüfte weiter steigen oder ohne weiteres auf der anderen Bergseite wieder hinabgehen wollte. Die Bergpartie im Korbe musste ihm ein vierfach donnerndes Halt! zurufen, bis er stehen blieb. Also stellte er den Korb auf das Gestein, die Insassen stiegen mit vieler Umständlichkeit aus und rieben sich die Beine. Während Karl zurückblieb beim Korb, suchte die Herrschaft den schönsten Aussichtspunkt, und das würdige Oberhaupt erklärte die Fernsicht. Sie wäre furchtbar hübsch, erklärte Frau Mama, während die Fräulein auf Steinblöcken saßen und auf Ansichtskarten kritzelten, wie das reizend gewesen wäre auf dem Hochstandel, ein junger schöner Mann habe sie alle zusammen hinaufgetragen, oben hätten sie dann die Aussicht angesehen und einen guten, reichlichen Imbiss eingenommen.
Auch Frau Mama erinnerte sich daran, dass es Zeit wäre zum Imbiss, und sie riefen den Karl, der hinter einer Felswand gelegen war, dass er mit dem Korbe herüberkommen solle. Karl kam mit dem Korbe herüber, aber es war nichts drinnen, als Reisig.
»Wo ist der Pack mit den Speisen?« fragte die Dame.
Karl schaute sie mit einigem Befremden an und antwortete: »Der Pack? Der ist nicht mehr.«
»Um Gottes willen, er war ja im Korbe!«
»Ich habe ihn herausgetan,« sagte Karl.
»So hole ihn!«
»Er ist halt nicht mehr.«
»Was ist mit ihm geschehen?«
»Weiter nichts,« antwortete Karl, »aufgegessen habe ich ihn.«
»Ungeheuer!« Ein vierfacher Schreckensruf war's, grässlich genug, dass Karl der Große vor Grauen umfallen konnte; aber er stand. Ganz ruhig und schlicht stand er da und blickte so treuherzig drein, als ob nichts geschehen wäre.
Die Fräulein fielen den Eltern um den Hals und riefen: »Vater! Mutter! Wir müssen Hungers sterben auf diesem Berge!«
Nun war Karl schier verzagt und meinte, er habe nicht gewusst, dass das Essen für die anderen wäre. Sie sollten aber nur rasch wieder in den Korb steigen, dass er sie hinabbringen könne, bevor sie verhungerten.
Na, das war doch klug! Und also ist es auch geschehen. Da die Herrschaft glücklich in das Dorfwirtshaus zurückgekommen war und der Papa den Karl nach dem Trägerlohn fragte, bedeutete der Große, es sei nichts, es zähle sich nicht aus.
Es waren sehr vornehme Leute aus der Stadt, und so gering waren sie in ihrem Leben nicht geschätzt worden, als von diesem Schneider.
Wenn Karl sechs Tage lang bei der Nadel gesessen war, wusste er am Samstag nicht mehr, wohin mit seiner Kraft. Da fiel es ihm ein, dass es eine ganz gute Erholung sein müsse, wenn er am Sonntag Steine auf den hohen Standel tragen würde. Die Steine waren vom Berge ja herabgekollert, weshalb sollten sie nicht wieder hinaufgetragen werden? Als er jedoch mit seiner Ladung zu den Almen hinaufgekommen war, brach der Kohlenkorb, und die Steine kollerten wieder talwärts. Als sie in hohen Sätzen dahinsausten und bei ihrem Auffallen tief in den Boden schlugen, dass hier Sand emporsprang, dort Funken aufstoben, erscholl ein Schrei. Karl blickte hin und sah eine kleine Sennerin, die Gras schnitt. Das Dirnlein war so niedlich und zart, dass die Arbeit nur mit Mühe und Anstrengung von statten ging. Nun geschah es, dass Karl zu ihm hintrat, aber nicht um die Kleine in den Sack zu stecken, sondern um unter Stottern und Mühen zu fragen, ob sie sein Schatz sein wolle?
Das Dirnlein antwortete natürlich, dass er ihr für einen zu viel sei, und dass sie zwei nicht brauche.
Als sie hernach in die Sennhütte ging, schlich ihr der Große trotzdem nach. Aber als er zur Tür kam, da plagte es. Diese war nicht allein viel zu niedrig, sondern auch zu schmal; er wand sich zwar hinein, aber die Türpfosten ächzten. Drinnen stand er mit gebeugtem Haupte vor der Kleinen, denn aufrecht stehend hätte sein Kopf durch die morschen Bodenbretter ein Loch gebohrt hinauf in den Dachraum, wo er nichts zu tun hatte. Also in demütiger Haltung fragte er sie noch einmal, und sie antwortete ihm spottweise, ein Schneider sei ihr zu windig.
Karl setzte sich ruhig auf einen Schemel, da knickte dieser ein, mit zwei Füßen zugleich, und Karl der Große lag mit gekrümmten Beinen ungefüge auf der Erde. Die Sennerin war ein gescheites Dirnlein und dachte: Die schwersten Baumstämme können ihm nichts anhaben, und ein armseliges Fußschemlein bringt ihn zum Falle. So steht es mit diesen starken Männern. — Sie foppte ihn weiter, da meinte er lächelnd, er würde ihr noch einmal etwas Schlimmes antun, wenn sie so arg gegen ihn wäre.
»Hascherlein, was kannst denn du mir antun?« fragte die Kleine den Großen.
»Ich?« sagte er, »dieweilen du einmal auf der Wiesen bist, trag' ich dir deine Hütten davon. Christel, was tust denn nachher, he?!«
»Ja,« rief sie, »nachher lauf' ich dir mit einer Brennnessel nach, bis du die Hütten fallen lasst!«
Karl schwieg. Vor Brennnesseln hatte er immer Grauen empfunden, und er beschloss, das Dirnlein nicht mehr zu reizen.
»Nein, ich tu' dir nichts,« sagte er gutmütig, »mich kränkt es recht, dass du mich nicht magst, aber tun tu' ich dir deswegen doch nichts.«
»Da bist du wohl brav,« antwortete sie, »und hat auch der Elefant zur Mücke gesagt, die lustig in den Lüften summt: Mückerl, fürcht' dich nit, ich tu' dir nichts. — Bist wohl brav, Karl!«
Sie hat gesagt, ich bin brav. So mag sie mich ja. — Mit diesem tröstlichen und wirklich logischen Gedankenanflug stieg er vom Berge herab.
Als das Gerede umging, der Schneider Karl wolle heiraten, rief sein Vater, das Meisterlein: »Wie soll denn der heiraten! Kann ja kein Weib ernähren.«
»Wer eins ertragen kann, wird auch eins ernähren können,« antwortete der Pfarrer, der gegen Heiraten, Kindstaufen und Todesfälle selten was einzuwenden hatte.
»Er kann nichts als tragen, ziehen und schieben,« gestand der Vater.
Hierauf ein Nachbar: »Das ist ja genug. Kann mein Ochse auch nit mehr und baut mir doch den Acker an. Halt geleitet muss er werden.«
Wie? Der Karl Oberbergbreitebner will sich beweiben? Da wollen wir den baumstarken Kerl doch besser nutzen. Soldat werden! so sagt die Militärbehörde. Vaterland verteidigen! sagt sie. In das Feld marschieren! sagt sie. Der Recke hebt an zu zagen. Im Felde tun sie ja schießen und stechen! Ist es nicht so? Tun sie im Felde nicht schießen und stechen? Und wir sind ja in einer viel größeren Gefahr, als jeder andere, weil wir sehr leicht zu treffen sind. — Und da sage man noch einmal, dass Karl nicht tiefsinnig denken könne!
Drei Wochen war er bei den Soldaten, als endlich der Hauptmann laut ward: »Mit diesem Lümmel ist nichts anzufangen! Er hat in keiner Montur Platz und beim Exerzieren! Gott, beim Exerzieren ist er viel zu stabil. Wo er steht, da steht er, und es bedarf zu vieler Kraft und Taktik, um ihn in Bewegung zu setzen. Marschiert er, so marschiert er und findet nicht leicht einen hinreichenden Grund, um nach rechts oder links kehrtzumachen, oder gar stehenzubleiben. Wenn sich der alte Herkules einmal pensionieren lässt, so mag der Karl Oberbergbreitebner angestellt werden zum Weltkugeltragen — bei den Soldaten können wir ihn nicht brauchen.«
Nun kam Karl wieder heim und klagte es seiner kleinen Sennerin: »Sie sagen, sie könnten mich nicht brauchen.«
»Das will ich doch sehen!« rief die Kleine, »spute dich zum Pfarrer und sag', ich wollt' dich heiraten in vierzehn Tagen. Marsch!«
Die Leute schüttelten den Kopf, und warum sollten sie es nicht, es war ja der ihrige, und nicht der des kleinen Almdirndels, in welchem besondere Pläne webten. Wer pachtete jetzt das Straßenhäusel am Fuße des Sattelberges? Die kleine Christel pachtete. Wer vertröstete den Eigentümer mit dem Pachte auf das nächste Jahr, bis man sich mit dem Vorspannfuhrwerk Geld verdient haben würde? Die kleine Christel vertröstete. Und wer hatte kein Pferd und keinen Ochsen, als er Vorspann leisten sollte über den Sattelberg? Die kleine Christel hatte nicht. Wer aber spannte den Kohlen- und Roheisenfuhrwerken ihren jungen Ehemann vor über den Sattelberg? Die kleine Christel spannte vor. Jawohl, die kleine Frau Oberbergbreitebner spannte den Oberbergbreitebner vor, und der zog im Vereine mit Pferden und Ochsen tapfer an; die Pferde und Ochsen waren höchst verwundert, einen zweibeinigen Genossen an ihrem Gespann zu sehen, und sie mussten sich sehr zusammennehmen, um von ihm nicht beschämt zu werden.
Die Löhnung, welche Klein-Christel für solche Vorspann einzog, berechnete sie auf zwei Pferdekraft, und sie begegnete damit keinem Widerspruche.
Hatte sie den Karl zu Hause, so hegte und pflegte sie ihn mit allem Notwendigen, damit er gesund und stark bliebe. Er war ihr Kapital, und Karl fühlte sich sehr gehoben, nun eine seiner Natur entsprechende Tätigkeit gefunden zu haben. Christel mietete auch einen Acker, und da konnte man sehen, wie sie hinten am Pfluge drein ging, ihn führte und das Zuggespann mit Hi und Hott leitete. Das Zuggespann war ihr Karl.
Also ging es nun in Eintracht und gemeinnütziger Wirksamkeit voran. Da geschah etwas Unerwartetes. Zwischen dem Heimatsdorfe des Karl Oberbergbreitebner, das Lehbach hieß, und dem Nachbarsorte Standelegg war ein Streit ausgebrochen. Es lag nämlich zwischen diesen Orten die kleine Gemeinde Hüttel, deren Insassen »lebendige Lehbacher und tote Standelegger« waren. Mit ihren Kirchengängen, Hochzeiten, Taufen, Geschäften usw. kamen sie nämlich nach Lehbach herüber, ihre Leichen gehörten jedoch auf den Kirchhof des kleinen und näher gelegenen Standelegg. Als durch die Gemeinde-Autonomie die Dörfer zum Gebrauche ihrer Vernunft kamen, sagten die Standelegger: Wenn die Hüttler lebendigerweise nach Lehbach neigen, so brauchen wir sie auch toterweise nicht. Mit den Behörden ließ sich nichts anfangen, die sagten, es habe zu bleiben, wie es bisher gewesen, und so sahen die beiden Ortschaften, sie müssten die Angelegenheit unter sich entscheiden. Mit Reden und Schreien ging es nicht, das hatten sie schon erfahren; also schlug ein kluger Kopf vor, Lehbach und Standelegg sollten durch Krieg entscheiden, wie Deutschland und Frankreich entschieden hätten, nämlich tapfer miteinander raufen, und der Stärkere sei der Sieger. Aber nicht etwa so dumm, wie es die Reiche machen, wo ganze Völker aneinanderprallen und sich gegenseitig durch Mord und Brand schreckbar zugrunde richten, sondern vielmehr so, dass jedes der beiden Dörfer einen Mann auf den Kampfplatz schicke. Die beiden hätten miteinander ohne Waffe, nur mit ihren natürlichen Gliedern und körperlichen Fähigkeiten zu ringen, und der zuerst falle, dessen Gemeinde sei die besiegte.
Das wurde abgemacht. Also hielt die Dorfgemeinde Lehbach Umschau nach ihrem stärksten Manne, und natürlich fiel die Wahl auf Karl den Großen.
»Ja, ja,« sagte der, »ich tu's schon. Will schon raufen.« Tat aber weiter nichts desgleichen, als ob die Wahl ihn freue oder aufrege, und ganz gleichmütig trottete er an dem bestimmten Tage auf den Kampfplatz. Siegte Karl, so gab es in der Zwischengemeinde Hüttel wie bisher lebendige Lehbacher und tote Standelegger. Siegte der von Standelegg gesandte Streiter, so sollte Hüttel fürderhin auch bei lebendigem Leibe, mit seinen Kirchgängen, Hochzeiten, Kindstaufen und Geschäften den Standeleggern zu eigen sein. Der Standelegger Kämpfer war ein ganz gefüger, flinker Tischlergeselle, mit dem ein Karl Oberbergbreitebner Fangball spielt. Aber bevor die hellen Haufen der Zuschauer und Zeugen sich noch recht versammelt hatten, lag der Karl schon im Sande, der Tischlergeselle saß festgeklammert auf seiner mächtigen Brust und zündete sich eine Pfeife an.
Der Karl blieb ganz ruhig liegen und horchte gelassen dem Geschrei der Menge, die ihn verlachten und den Gegner bejubelte. Erst als Klein-Christel kam, ward es anders mit ihm. Totenblass im Gesichte, leise flüsternd befahl sie, dass er aufstehe. Also begann er mit Händen und Füßen Anstalten zu treffen, dass er sich erhebe, und schon nach drei Minuten war es so weit, dass die Kleine den Großen vor sich hertreiben konnte gegen das Straßenhäusel. Die lebendigen Hütteler waren für Lehbach verspielt, alle Schmach entlud sich über das arme Straßenhäusel, und es schien kein Mittel mehr zu geben, die Ehre des Großen wieder herzustellen.
Da kam ein schwerer Winter. Der Schnee lag mannshoch in der Gegend und alle Wege waren geschlossen. Seitdem die lustigen Hütteler nicht mehr nach Lehbach kamen, ging es hier recht langweilig zu und man tröstete sich nur mit dem Gedanken, dass sie bei dem großen Schnee auch nicht nach Standelegg gehen könnten; sie waren eingemauert in ihrem Dorfe Hüttel. Es nahten die Faschingstage. Zu dieser Zeit sagte eines Tages Klein-Christel zu ihrem Großen: »Karl, mach' dich auf und geh' hinüber nach Hüttel. Geh' heute hinüber und morgen wieder zurück.«
Karl fragte nicht warum; er verzehrte eine weite Schüssel Heidenbrei, dann ging er nach Hüttel. Der Schnee reichte ihm bis an die Brust, der Karl schob sich langsam voran und hinter ihm her war ein Hohlweg. Am nächsten Tage kam er wieder zurück, und hinter ihm her zog eine lange Reihe faschingslustiger Hütteler, Männlein und Weiblein, die bei dem frischgetretenen Pfad nach Lehbach eilten, um im Wirtshause zu tanzen, zu essen, zu trinken und beim Kaufmann Lebensmittel einzukaufen.
Nun erst merkten die Leute von Lehbach, was Karl der Große als Schneepflug bedeutete, und als solchen mieteten sie ihn von Klein-Christel, so oft im Winter die Pfade verschneit waren zwischen Lehbach und Hüttel. Also gewöhnten die Hütteler sich neuerdings an Lehbach, sie waren wieder »lebendige Lehbacher und tote Standelegger.«
Klein-Christel konnte sich wieder freuen an ihrem Karl; ihr Ansehen und der Wohlstand ihres Hauses wuchs. Sie wäre in der Lage gewesen, eine junge Familie zu ernähren, allein diese war nicht da und kam nicht, und es ist jammerschade, dass weder die kleine, fleißige und kluge Christel, noch der große Karl fortgepflanzt werden. Die Zukunft könnte beide brauchen, und zwar zusammen vermählt; mit Klugheit allein, oder mit Kraft allein lässt sich doch nicht viel machen.
Der Fischer im Olymp.
Dort, wo der Wildgarten des Schlosses an die Landstraße stößt, neben dem Einfahrtstor, steht eine Steingruppe von Ungehörigkeiten aus der griechischen Mythologie. Die größten Auswüchse der Phantasie sind schon wiederholt durch Steinwürfe weggeschlagen worden, allein der Schlossherr steift sich auf das alte Herkommen und lässt die verwundeten Arme, Beine und Nasen allemal wieder herstellen.
Unter dieser alten weltmunteren Sandsteingruppe nun saß ein Bettelmann. Er saß jahrelang dort, immer nur an sonnigen Tagen, er saß auf dem Sockel, er saß sogar manchmal der einen Göttin auf dem Schoß und lehnte sich rückwärts an den schönen Busen, der allerdings nicht ganz so lind war, als der Künstler ihm mit kundigem Meißel den Anschein gegeben. Der Bettelmann trug stets ein weites blaues Beinkleid und einen gelben Pelzmantel, wie man sie bei ungarischen Schafhirten sieht, ferner hatte er ein grellrotes Tuch um das Haupt gewunden, ähnlich wie die Türken ihren Turban tragen; die Füße hielt der Mann in braune Lappen gewickelt und mit grünen Bändern umwunden. Das Gesicht war nicht fahl und nicht mager, war vielmehr rosig und rundlich und hatte zwei ungleiche Augen. Das eine gutmütig ausblickend, das andere verwulstet und mit manchmal zuckenden Wimpern, hinter welchen sich Schelmerei zu verstecken schien. Zur Zeit, als ich den Mann das erste Mal sah, mochte er etwa fünfzig Jahre jung gewesen sein. Ja, es war eine Jugend und Frische in ihm, die Straßenbettler, wenn sie tatsächlich ein wenig davon haben, sonst nicht hervorzukehren, vielmehr zu verstecken pflegen.
Da er hoch auf dem Sockel der Götter saß, so hatte er an einer langen Stange ein Binsenkörblein, das er dem Wanderer entgegenhielt, ähnlich wie der Fischer seinen Angelstab niedersenkt. Gab es nichts, so zog er seine Angel ruhig wieder ein, lehnte sich an die Götter und wartete. Witzige Leute nannten ihn den Fischer im Olymp. Ich, der wöchentlich ein paarmal des Weges zu gehen hatte, warf ihm fast allemal einen Pfennig in das Körbel, nicht etwa, weil dieser Bettelmann so erbarmungswürdig aussah, als vielmehr weil er stets ein so heiteres Gesicht machte. Manchmal aber, wenn das bartlose Rundgesicht gar zu heiter und aufgeweckt dreinsah, dachte ich: Na, schenk' lieber du mir! und ging zugeknöpft vorüber.
Man wunderte sich, dass dem Manne die Polizei gelassen zusah, allein diese hatte diesmal Humor und meinte, fischen sei nicht betteln und es möge sich erst der beschweren, dem der Fluss gehöre. Der sickernde Fluss der Wanderer aber gehört Gott dem Herrn, und der lässt alle Fischer und alle Wilderer gewähren. Auch der Schlossherr fand nichts einzuwenden gegen eine Gestalt, die den Eingang in seinen Park so wunderlich schmückte. Er war ein Freund heiterer Gesichter und sagte, ein so glücklich munteres Antlitz gäbe es in seinem ganzen Schloss nicht. Auch er warf dem Fischer manche kleine Münze in das Binsenkörbchen. Anfangs soll ein hoher Herr mit teilnahmsvoller Gebärde mehrmals einen Taler hineingelegt, damit aber den Bettelmann erzürnt haben. Er lasse sich nichts schenken! sagte der Fischer, zerteilte die große Münze in mehrere kleine und spendete sie den Armen.
Bei schlechtem Wetter war er nicht vorhanden. Die liebe Sonne genoss er mit den Olympischen gemeinsam, in Sturm und Regen ließ er sie allein stehen mit ihren verrenkten nackten Gliedern. Es fragte auch weiter niemand nach ihm, oder vielmehr, ich horchte nicht danach aus. Mir aber — und das ist seltsam genug! Ging ich auch, wenn er oben saß, fast gleichgültig vorüber, wenn er nicht oben saß, war mir geradezu bang um ihn. Dem Wege fehlte der Sonnenschein des Bettlerangesichts. Er wird doch nicht unpass sein? Wo er nur wohnt? Was ihn doch verhindern mag, dass er heute nicht fischt? Was mag der Mann nur eigentlich gewesen sein, ehe er sich in den Olymp versetzte? Man sprach einmal davon, dass er in der Stadt Häuser besäße; das glaubte ich nicht, denn dann hätte er die Taler eingesteckt. — Demnächst war er doch wieder da mit seinem gelben Schafspelz und seinem roten Turban, und kein Engländer kann geduldiger am Bache angeln, als da oben der Bettler auf die kleinen Almosen wartete. Ein paarmal wollte ich ihn ansprechen; in dem Augenblick, als mein Fuß über den Straßengraben stieg, neigte er sich seithin, und sein Gesicht nahm einen unguten Ausdruck an. Da ließ ich ihn einsam sitzen auf seinem Thron und ging den kümmerlichen Geschäften des Tages nach.
Nun war es eines Tages, dass vor mir ein barfüßiger Handwerksbursch die Straße dahinpatschte und unterwegs in der hohlen Hand missmutig die Münzen besah, die er an dem Tage erfochten haben mochte. Eine schien dabei zu sein, die ihm nicht gefiel; war es nun ein schweizerischer Pfennig, der hierzulande ungültig ist, oder war es ein messingener Hosenknopf, der ebenfalls ungültig ist, ich weiß es nicht. Ich sah nur, wie der Handwerksbursch, als er zur Stelle kam, wo an der Steingruppe der Fischer saß, diesem zwar nichts in das Körbel warf, hingegen aber die Münze in die Luft schleuderte, dem Bettler zu. Der wollte die metallene Mücke abfangen, glitschte dabei aus und fiel in den Straßengraben herab.
Ich eilte hinzu, um ihn aufzuheben, er wartete aber nicht auf mich, erhob sich gelassen und murmelte: »Das härteste Bett wäre es nicht« (denn es war weicher Lehm und langes Gras im Graben). »Und so kurz, wie die Bauernbetten ist es auch nicht.« (Denn der Straßengraben war viele Meilen lang.)
»Warum Ihr nur nicht liegen geblieben seid in dem guten Bett!« sagte ich laut, um eine Anrede zu haben, und machte dabei mein Gesicht lachen, dass er sah, es wäre nicht bös gemeint.
»Warum?« fragte er entgegen, »weil es noch zu früh ist zum Schlafengehen. Muss ja erst den Gruß und Kuss aufsuchen, den mir der Herr Vagabund zugeworfen hat.«
Und er begann auf dem Boden umherzulugen, rechts und links und vorn und hinten, und das Geldstück war nirgends. Als er wieder hinan stieg zu den Himmlischen, rief er plötzlich: »Aha, jetzt hebt die auch an!« denn der schweizerische Pfennig lag auf dem Schoß der sitzenden Aphrodite. Dann hub er hell an zu lachen: »Der soll nur liegen bleiben drin, das ist ein Falscher! Oh Schand und Spott!«
Ich wollte den angeknüpften Verkehr nicht sogleich wieder abgebrochen wissen, daher bat ich den Bettelmann, dass er mir den Schweizerischen schenke.
»Wenn du ihn selber herausnehmen willst!« antwortete er mit komischer Miene und drückte fast beide Augen zu. »Ich hab' jetzt nicht Zeit, ich muss lachen. Ich muss lachen über des Vagabunden guten Witz, ha ha ha!«
»Wenn ich auch so herzlich lachen könnt'!« war meine Bemerkung, denn jetzt wollte ich um jeden Preis mit ihm anbinden.
»Kannst nicht?« sagte er, stieg nieder und hub an, mit seinen kurzen Fingern unter meinem Kinn herumzukrabbeln, »da muss man dich halt kitzeln — lach, lach, lach!«
Da lachte ich wirklich, sagte aber: »Lasset das. So ein Lachen tut weh.« Denn ich hatte gerade meinen sauren Tag.
»Du bist gewiss einer von solchen, denen das Flennen lustiger ist, als das Lachen!«
»Wenigstens wäre jenes eher am Platz, als dieses. Wie es zugeht in der Welt!«
»Wie geht es denn zu?« fragte er, dieweilen er sich wieder auf seinen Sitz schwang, die Stange mit dem Binsenkörblein zur Hand nahm und über die Stange hinausblickte.
»Ihr seht es doch!« sprach ich, den falschen Pfennig betupfend, »falsch im kleinen, falsch im großen, alles falsch, alles Betrug.«
»Mich betrügt keiner,« antwortete er, machte die Augen auf und schaute so kühl über mich hinweg, als ob ich Luft wäre.
»Ich wollt Euch um etwas gebeten haben,« so wand ich jetzt ein.
»Gebeten? Du bitten? Du mich?« Sein Gesicht leuchtete auf wie Werg, an das man mit dem Zündflämmchen gefahren.
»Ich wollt Euch gebeten haben um ein Stück Brot.«
Nun schaute er mich forschend an. Mein Stadtherrengewand, das keinen Flicken und keinen Riss hatte, wollte ihm nicht recht stimmen zu dieser Bitte. Dass ich eigentlich nur um ein Stück geistigen Brotes bat, um ein warmes Menschenwort, um einen Funken seines frohen Wesens, er konnte das freilich nicht wissen.
Sein Antlitz war ernst geworden, und völlig gedämpft sagte er: »Wenn du Hunger hast, dann ist's freilich nicht zum Lachen. Auch nicht zum Weinen. Dann ist's zum Essen. Schau! dass du so spät daherkommst! Vor einer Stunde hätte ich noch einen Apfel und eine Traube gehabt. Ich trage mir des Morgens mein Essen allemal im Körbel mit hierher. Jetzt müssen wir was anderes suchen gehen. Aber es ist nicht weit.«
»Wohin denn?«
»Nach Hause.«
Umso besser, dachte ich. Meine Obliegenheit war an diesem Tage vollzogen, ich hatte Zeit, auf Abenteuer auszugehen. Man kennt ja das, mit diesen Professionsbettlern! In Paris war einer, der dreißig Jahre lang mit verkrüppeltem Leib und in armseligen Lumpen an der Pforte von Notre-Dame saß. Abends nach Hause gekommen, zogen ihm täglich livrierte Diener die Saloneleganz an und dann ging's mit lustigen Freunden und Freundinnen zur Tafel, bei der man mit Champagner anfing und aufhörte mit was weiß ich. — Zu Madrid in Spanien soll es sogar eine Aktiengesellschaft auf Bettler geben. Die Krüppel, Kretins und Aussätzigen sind Kapital und Produktion zugleich. Sie werden im Volke zusammengekauft, entsprechend auf günstige Plätze verteilt, der Impresario leitet die Geschäfte, nimmt des Abends die Einnahme in Empfang, und führt sie wohlverbucht in die Hauptkasse ab, während die Bettler in ihren Pensionen standesgemäß verpflegt werden.
Derlei ist mir eingefallen, als ich dem Manne folgte, der, in seinem langen Pelz, über der Achsel die Stange, hastig vor mir hinlief, dem Dorfe zu. Er war viel kleiner, als er auf seinem Stammsitze aussah, seine in Lappen gewickelten Füße huschten lautlos dahin. Den Dorfleuten, die uns, ohne zu grüßen oder gegrüßt zu werden, begegneten, schien er eine gewohnte Erscheinung zu sein, um so verwunderter betrachteten sie mich, der hinter dem gelben Pelz drein lief. Durch einen großen Bauernhof ging der Weg, hinaus in einen Obstgarten, dort zwischen Busch und Baum stand die Klause. Ursprünglich mochte sie als Hüterhaus gedient haben, jetzt war sie die Wohnung meines Götterlieblings. Im Stübchen ein Tisch, ein Stuhl, ein Kasten, ein Ofen, ein schmales kurzes Bett, ein Buch und ein Kerzenleuchter. Durch ein helles Fenster strömte Licht auf diese Herrlichkeiten.
Sogleich öffnete mein Gastherr den Kasten, begann mit weißen Linnen den Tisch zu decken, einen kleinen zierlichen Kübel mit Butter, einen Laib Brot und ein Salzfässchen herzurichten.
Ich fiel ihm in den Arm: »Nein, mein Lieber, so ist es nicht gemeint. Ihr habt, wie ich sehe, hier die Bibel, und da drin steht's, dass der Mensch nicht allein vom Brote lebt, sondern auch vom Worte. Ihr sollet mir zuerst hübsch verzeihen, dass ich falsch, wie die Welt schon einmal ist, mich an Euch gemacht habe und sollet mir dann etwas sagen.«
»Aber essen wirst du doch etwas!« rief er besorgt.
»Ich sehe Euch nämlich schon seit Jahr und Tag an der Straße sitzen und Almosen heischen,« begann ich.
»Da siehst du ganz richtig,« antwortete er.
»Und nun möchte ich gerne wissen — nein, es wird doch nicht gehen. Ihr werdet böse sein, — und Euch beleidigen? Nein.«
»Du mich beleidigen?!« fragte er mit langgezogenem Tone und blickte mich dabei mitleidig, aber sehr überlegen, mit halbem Auge an. »Du armer Narr!«
»Nun gut. Ich möchte nämlich gerne wissen, warum Ihr bettelt.«
»Warum ich —? Ha ha ha? — warum ich bettle?« fuhr er lustig drein. »Sage mir doch, warum du Luft schöpfest! Sage es mir doch!«
»Ihr seid gesund und stark wie einer. Ihr habet da ein gutes Brot, man sieht ihm's an, dass es Euch schmeckt. Aber würde es nicht noch besser schmecken, wenn Ihr es Euch verdient hättet? — Mit Arbeiten —«
Jetzt trat er ein paar Schritte zurück, zog über der Brust seinen Pelz zusammen, legte die Arme darüber, schaute mich mit seinem munteren Gesicht herzlich mitleidig an und sprach: »Jetzt hast es gesagt. Jetzt hast es gesagt, das große Wort. Und wenn die sieben Weltweisen sieben Jahre lang dran studiert hätten — besser hätten sie es auch nicht sagen können. — Arbeiten!«
»Na, ich meine nur ...«
»Arbeiten!« rief er aus, und seine Züge verzogen sich wie im Schmerze. »Aber Freund, arbeiten tut ja weh! Schwitzen! Pfui Teufel! Schau her, das steht auch in diesem Buche: Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dir dein Brot verdienen, weil du gesündigt hast!«
»Nun, da habt Ihr es.«
»Ich habe aber nicht gesündigt!« rief er frisch und munter aus. »Ganz unschuldigerweise bin ich auf die Welt gekommen, hab's nicht betreiben und nicht hindern können. Zuleid' hab' ich auch niemand etwas getan, außer dass ich meiner Kindsfrau in den Finger gebissen haben soll, weil sie mir statt der rechtmäßigen Muttermilch Kuhmilch in den Mund schmuggeln wollte. Denn ich glaube schon mit Zähnen geboren worden zu sein. Und da soll man kein Naturrecht haben aufs Essen? Da soll man sich ein solches Recht erst durch allerlei Anstrengungen erwerben müssen? Tu' mir den Gefallen, Kindskopf, und glaube das nicht.«
»Ihr zieht es also vor, andere für Euch arbeiten zu lassen.«
»Jetzt wirst du bitter, mein Freund,« sagte er gutmütig. »Und das taugt wieder nicht. Ärger ist kein kleineres Unrecht, als Arbeit. Ich will niemand verleiten, und ich habe all meiner Tage keinem Menschen befohlen, für mich zu arbeiten. Siehst du es denn nicht? die ganze Welt ist voller Tiere, alle sind frisch und munter, und kein einziges ist so dumm wie der Mensch, und arbeitet. Arbeiten die Menschen für sie? Lasse diese zweibeinigen Herrschaften nur erst aussterben, dann arbeitet niemand mehr, und die Welt wird doch voll Leben sein.«
Als ich in das Häuschen getreten, hatte ich nicht gedacht, in wenigen Minuten hier vor einem hohen Herrn zu stehen. Nun sah ich's, das war einer. Das war einmal ein anderer, als die gewöhnlichen sind. Um ein Stück Brot war ich gekommen. Er gab ein großes. Ob es auch nahrhaft war, das sollte sich zeigen. Im ersten Augenblick fühlte ich mich schier betäubt. Wie? das Tier arbeitet nicht und lebt doch? Und glücklicher als der Mensch, gerechter, schuldloser?
Es ist naturgemäß, nicht zu arbeiten.
Diesen Gedanken hatte ich noch nie gedacht.
Während ich noch befangen war, begannen sie heranzukommen. Zuerst die krabbelnde Ameise: »Es ist nicht wahr! Wir arbeiten.« — Dann die summende Biene: »Verleumdung! Wir arbeiten!« Dann der Biber, die Spinne, die Vögel, die Schlangen und andere in langen Reihen, und alle riefen pfeifend, piepsend, grölend, knurrend, bellend, krähend: »Wir arbeiten! Wir arbeiten!«
Ich sagte es dem Bettler. Er lächelte freundlich und sprach: »Mein viellieber Gast! das weiß ich ja, dass der Maulwurf wühlt. Aber denke an, zwischen Arbeit und Arbeit ist eine breite Straße. Bin ich ein Müßiggänger? Nein, ich bin ein Bettler. Ich gehe aus, um zu sammeln. Ich strecke meinen Stab aus, um Gaben in Empfang zu nehmen, ich trage sie nach Hause, die Münzen setze ich in Lebensmittel um, die Lebensmittel bereite ich zu, bewahre sie auf, achte, dass sie nicht verderben. Ist das Arbeit? Nein, es ist Tätigkeit. So betätigt sich freilich auch das Tier. — Aber ich mache keine Arbeit, die anderen zugutekommt, solchen, die nicht arbeiten, die faulenzend in Prunk und Hochmut das genießen, was andere erworben. So arbeite ich nicht.«
»Das ist eben eine menschliche Erfindung,« sagte ich.
»Nein, eine teuflische!« rief er. Da war er erregt.
»Tätigkeit und Arbeit, den Unterschied kennt man,« sagte ich. »Pflügen und Säen ist Arbeit, ernten ist nur Tätigkeit. Ihr, lieber Bettelmann, habt Euch für die letztere entschieden.«
»Und das ist das Richtige!« fiel er ein. »Nicht arbeiten, nur sammeln. Die Natur, wenn sie gesund ist, produziert mühelos ihre Früchte aus sich selbst. Arbeit ist Sünde gegen die Natur. Töte mich, wenn's nicht wahr ist.«
»Ich töte Euch nicht,« darauf meine Entgegnung, »denn Ihr müsset mir vorerst noch Antwort geben, Ihr wollet also nicht für andere arbeiten?«
»Nein.«
»Aber andere sollen für Euch arbeiten?«
»Schaf Gottes, wer sagt denn das?« rief er aus. »Ich sammle ja nur Brosamen. Sie geben mir doch nur das in den Korb, was sie zu viel haben, was sie verstreuen wollen. Sie tun's nicht aus Barmherzigkeit, sie tun's, weil ihr Überfluss in ihnen das Bedürfnis gezeitigt hat, Abfälle zu haben, armen Kreaturen manchmal etliche Brocken hinzuwerfen. Sie sollen nur geben. Dankbar müssen sie sein, dass sie geben dürfen.«
»Wie kann man bei so hartem Urteil über die Menschen ein so heiteres Auge haben?« fragte ich ihn.
»Junger Freund,« antwortete er, »das kann man, wenn man fertig ist. — Glaubst du: dass meine Mutter mich als Bettler geboren hat? Meine Wiege war der Reichtum, lieber Mensch! — Das, was ich heute bin, habe ich selbst aus mir gemacht!« Im stolzen Tone des Emporkömmlings waren diese Worte gesprochen. »Aber viel braucht's, bis man es so weit bringt!« fuhr er fort. »Viele Jahre lang, oh meine schönste Lebenszeit, habe ich mich vom Besitz knechten lassen. Man glaubt sein Leben zu schmücken, und man belastet es nur. Die tausenderlei Dinge und Dingeln, die an den Reichen sich kletten, ein abscheulicher Ballast! Man kann nicht weiter, man kann nicht hinan, man ist ein Sklave und trägt die schwere Kette nur deshalb mit Gier, weil sie von Gold ist, und ist ein durch und durch lumpiger Lump. — Du hast gewiss Bekanntschaft mit reichen Leuten. Nun also. Ich war auch so einer. Betrachte ihr dummes Leben, und du hast das meine vor Augen. Aber endlich, als mir übel war aus- und inwendig, gerade schon auf dem Punkt, wo die Besseren sich zu töten pflegen, erwachte in mir der Egoismus. Hol's der Teufel! dachte ich, und schmiss den ganzen Krempel von mir. Es war eine wanstige Ledertasche.« —
Als er nicht weiter sprach, fragte ich: »Was war mit dieser Ledertasche?«
»Ins Wasser hab' ich sie geworfen.«
— Man spricht auch bildlich so, aber bildlich war's nicht gemeint. Eine Stunde unterhalb der großen Stadt, in den Auen. Genau hat er den Platz bezeichnet, wo er seine Papiere, im Werte von mehr als einer Million Gulden, in die Donau geworfen hat.
»Ihr seid nicht klug!«
Er klopfte mir auf die Achsel: »Das muss ich besser wissen.«
»Das mag ja sehr philosophisch sein, aber gut ist es nicht.« Also mein überlegener Einwand. »Ein guter Mensch hätte das Vermögen, anstatt ins Wasser zu werfen, einem Armen geschenkt.«
»Der wäre davon ja reich geworden, du Tropf!« rief der Bettler. »Ich habe mir ohnehin nachher Vorwürfe gemacht. Wie leicht konnte die Ledertasche aufgefangen werden und in Menschenhände kommen. Gift wirft man nicht ins Wasser.«
»Ihr hättet das Vermögen ja an tausend Arme verteilen können.«
»Du hast leicht reden,« entgegnete er darauf. »Du bist sicherlich nicht aufgewachsen unter der Torheit der Million. Wäre ich damals weise gewesen, so hätte mir das Geld nichts angehabt. Ich habe nur gesehen, dass das Geld mein Unglück ist, so habe ich gemeint, es müsste auch das Unglück anderer sein. Und ob's nicht denn doch so ist, sage es, Mensch. Glaubst du nicht auch, dass dir geschenktes Geld zuwider ist? dass es dich verwüstet? dass dich nur der Besitz freut, den du dir selber erworben hast?«
»Und so spricht ein Mann, der an der Straße sitzt und bettelt?«
Er sprach: »Das verstehst du nicht. Die Pfennige, die ich bekomme, sind ehrlich erworben. Halte ich doch die Stange hinaus! Sage ich doch mein Vergeltsgott dafür! Der Taler, wenn er in den Korb fiele, wäre geschenkt. Ich lebe von Pfennigen, begleiche meinen Wohnungszins, nähre mich, kleide mich, bin niemandes Herr, niemandes Knecht, und stärker wie der König.«
»Das wäre!«
»Ja, das ist,« fuhr er lustig fort. »Der König hat ein großes Heer und muss immer noch fürchten, dass ihm der Feind etwas wegnimmt. Mir kann niemand was wegnehmen.«
Ich langte wie raubend nach dem Butterkübel.
»Ha ha ha, sie gehört dem Hausherrn!« lachte er, »sie ist noch nicht bezahlt. Und deswegen, Freund, muss ich wieder ans Tagwerk.« Er langte seinen Korbstab vom Winkel.
Ich hielt ihm die Hand hin: »Hat mich gefreut, endlich einmal die Bekanntschaft eines Glücklichen gemacht zu haben.«
Er wendete sich rasch um, als ob der, zu dem ich sprach, hinter ihm stünde.
»Ein Glücklicher — wo?« fragte er wie verblüfft. »Solltest du mich —? Ja, ja, es geht mir soweit gut, aber glücklich bin ich nicht. Du siehst es ja.« Er deutete auf seine Lagerstätte. »Viel zu kurz. Ich bin fünf Schuh lang, und der Trog vier. Was kannst machen? Bei den Bauern findet man's nicht anders. Man grübelt nicht weiter, klappt sich zusammen und gut ist's.«
Ich sah es wohl ein. Auf sechs Schuh langen Erdenraum hat sogar der Tote Anspruch, und dieser Lebendige besaß ein Drittel weniger. Er hätte vielleicht nur das Fußbrett ausstoßen müssen ....
So nahe ist mancher Mensch seinem vollkommenen Glücke. Aber er stößt das Brett nicht durch. —
Als wir selbander die Straße dahingingen, begegnete uns der Schlossherr, er fuhr vierspännig und grüßte den Bettelmann mit einer Handbewegung. Dieser dankte »von oben herab«. Dann blieb er stehen, schaute ihm nach, schüttelte den Kopf und murmelte: »Armer Bruder! Das Kamel hat vier Beine, und du hast achtzehn. Und kannst nicht gehen. Denn du fahrst ja.«
»Sagt Ihr auch zu dem du?« meine Frage.
»Ha ha ha! das ist der erste gewesen, den ich geduzt. Zu den Eltern hat man damals Sie gesagt. Welche Narrheit. Aber die Geschwister untereinander ... immer du.«
Er war zur Stelle. Ohne weiteres kletterte er mit guter Übung an den steinernen Statuen empor, setzte sich in den Schoß der Aphrodite und streckte den Stab mit dem Binsenkörbchen aus — nach mir.
Ich reichte dem Bruder des Schlossherrn zwei Pfennige und schritt nachdenklich meines Weges.
Der Geistbrenner.
Wer einmal fünfzig Jahre lang Zeuge des Weltlaufes gewesen, bei dem müsste sich, so sollte man meinen, der ganze innere Mensch geändert haben. Alles ist ja so unerhört anders, als man's in der Jugend gesehen, geträumt hat. Die lange Reihe von Hoffnungen, Überraschungen und Enttäuschungen, von Freuden und Qualen, von Entwickelungen und Verwickelungen und Lösungen, bei denen immer wieder alles erwartet wird und immer wieder nichts herauskommt: diese Reihe von großartig aufgedonnerten Nichtigkeiten müsste ein denkendes Wesen doch endlich gleichgültig machen, in den Zustand jenes Träumenden versetzen, der bei keiner Feuersbrunst mehr aufschreit, bei keinem Sturz mehr zusammenzuckt, weil er in seinem Halbschlummer weiß: es ist doch nur ein Traum.
Jawohl, wer fünfzig Jahre lang am sausenden Webstuhl der Zeit steht, der müsste es endlich doch weghaben, wie die Fäden geknüpft, geschlungen und die Knoten wieder gelöst oder zerhauen werden. Er müsste sehen, dass jeder, der da mit hineingewoben wird, eigentlich gleich gut daran ist, ob sein Faden nun geradeaus oder querüber läuft. Ein Kreuz bildet's immer. Der mitverwobene, mit den übrigen Fäden ringende und sich verklemmende, auf andere Fäden sich stützende, in andere Fäden sich bergende und doch für sich ein freier selbstsüchtiger Ichfaden sein wollende Hascher und Haber leidet ganz verzweifelt. Einer, der sich als von außen Sehender fühlt, ändert sich im Lauf seines Lebens. Der Haschende und Habende ändert sich nicht. Der ist lediglich Stoff, der nach gemeinsamen Naturgesetzen steigt und fällt, sich physisch ausdehnt, chemisch verbindet und nicht anders als ein Klumpen Erde mittun muss in dem Kessel, aus dem ewig die Blasen steigen und in dem der Bodensatz in die Tiefe sinkt. Die Haschenden und Habenden, sie sind es, die den Kampf ums Dasein mit demselben trostlosen Stumpfsinn ringen wie der Wurm und die Milbe und die Eintagsfliege. Die Haschenden und Habenden, sie sind für sich nichts; erst wenn sie sich mit Gleichartigem, mit der Stoffmasse verbinden, scheinen sie etwas zu sein, wenigstens so viel, dass sie sich selbst genügen. Sie schauen nicht, sie denken nicht, sie sind bloß, wie ein Schwammtier oder ein Weichtier ist. Diese rein materiellen Menschen sind eigentlich das Unschuldigste, was es geben kann; sie sind ja halb unbewusste Wesen; sie dämmern so hin im Verdauungsschlummer, als ob sie zu viel gefressen hätten, oder sie greifen instinktiv immer und immer mit ihren Fängern aus wie Seetiere, die alles, was sie erhaschen können, einmal an sich ziehen, wenn sie auch, längst übersättigt, alles wieder fallen lassen müssen. Die Hascher und Haber, diese Ärmsten! Und diese Glücklichen! Weil sie ja so kurzsichtig sind und so tief in ihren Tag hineingebettet, dass sie keine Ahnung haben von den ewigen, glühenden, göttlichen Dingen, die den Schauenden nimmer zur Ruhe kommen lassen.
Der reine Stoffmensch ändert sich nicht durch ein Erleben; er ist als Greis innerlich derselbe, der er als Kind gewesen, wenn auch nicht immer ein Habender, wohl aber immer ein Haschender. Er denkt nicht weit genug, um sich zu fragen, wie er die erhaschte Beute nutzen werde; er denkt kaum daran, welchen Wert sie für ihn hat; er lebt in der dämmernden Vorstellung dahin: Das gehört mir! Es ist ein Versunkensein in die Stoffwelt, ein fast friedlicher Schlaf. Aber der Schauende wird anders bis in seinen späteren Tagen. Er mag in der Jugend von den Sinnen zum Stoff hingezogen worden sein; aber als ihm das Auge aufging, trat er ein wenig zurück von dem sausenden Webstuhl, um nicht in das grobe Tuch der Menge mitverwoben zu werden.
Was da aufsteht, das wird von der Menge mit Jubel begrüßt, was hinfällt, mit Schreck und Klage bestattet. Der Schauende jubelt nicht, erschrickt nicht und klagt nicht. Er weiß: diese Schürzungen und Lösungen sind selbstverständliche Vorgänge am Webstuhl. Er sieht den Wandel und Wechsel im kleinen, er empfindet mit, wie die einzelne Kreatur vergehend aufschreit: Ich sterbe, jetzt ist alles aus! Und doch ist nichts aus; alles flutet im gleichen mächtigen Lebensstrom weiter dahin und der Lebensstrom ist und bleibt so urfrisch wie am ersten Schöpfungstage. — Dieses Sehen hat den Schauenden verwandelt. Er war Stoffwesen und ist ein vergeistigter Mensch geworden; er steht gleichsam außerhalb des Schlagbalkens, der die Fäden aneinanderstößt; er schaut vergnüglich dem Weber zu. Aber wenn er ihn fragt: »Meister, wozu das viele Tuch, das du webest und auf die Rolle windest?«, so bekommt er keine Antwort.
Vor etlichen Jahren war ich eines Tages an der Reichsstraße in eine Hütte eingekehrt. Eine armselige Hütte, in deren Mauerspalten Gras keimte. An der schiefwinkligen Tür, deren Fugen mit Moos verstopft waren, klebte ein Blatt Papier, auf dem in ungefüger Handschrift die Worte standen: »Hotel zum Napoleon«. In der Hütte saß ein alter Mann in einem Zwilchkittel, aber barfuß. Er hatte einen schönen weißen Bart, einen Holzblock zwischen den Händen und stampfte im Bottich Vogelbeeren ein. Meine Anfrage, ob ich während des Gewitterregens in seinem Haus Unterstand halten dürfe, wurde damit beantwortet, dass der Alte Körbe und Stiefel von der Wandbank wegräumte, auf dass der Gast sich behaglich niederlassen könne. Sogar einen Lodenmantel rollte er zusammen zu einem Hauptkissen, falls ich mich ein bisschen hinlegen wollte. Ich sei, meinte er, gewiss schon weit gegangen und hingestreckt ruhe sich der Wandersmann am besten aus. Auch in der ewigen Ruhe verlege sich der Mensch aufs Liegen.
»Hab' mir's gleich gedacht, dass das ein vornehmes Hotel ist, das Hotel Napoleon,« sagte ich spaßend.
»Das wohl; nobel sind wir schon!« Der Alte lachte und goss aus einer großen Flasche eine wasserklare Flüssigkeit ins kleine Kelchgläschen, das er vor mich auf die Tischecke stellte.
Auf meine nähere Erkundigung nach der Geschichte dieser Firma antwortete er: »Will der Herr die zwei Dukaten sehen, die der Napoleon meinem Vater hat auszahlen lassen?« Und mit dem dürren Finger durchs Fenster zeigend: »Dort, wo jetzt der Brennofen steht, beim Hollerbuschen, ist die Schmiede gestanden. Von gestern und vorgestern rede ich nit. Ist ja mein Vater noch ein junger Bursch gewest. Hufschmied an der Straßen. Ein gutes Geschäft dazumal. Wenn auch nit gerade jeder fürs Pferdebeschlagen drei Dukaten hat gegeben wie der Franzosenkaiser, als er vorbei ist geritten gen Graz. Später, als es mein Vater erfahren, wer der kleine Reiter ist gewesen, hat er freilich die Dukaten auf den Steinhaufen geschleudert. Und noch später, viel später, wie es geheißen hat, der große Napoleon sei auf eine Insel im Weltmeer verstoßen worden, hat's die Leut' umgewendet und mein Vater hat den Steinhaufen abgetragen. Zwei hat er richtig wiedergefunden von den Goldstücken; und die sind in der Familie verblieben zum ewigen Andenken.«
Es wollte mir nicht übel gefallen, dass dieser Hufschmied, entgegen dem Weltbrauch, den Mächtigen gehasst und den Unglücklichen geehrt hat. Ich nahm einen Schluck von der klaren Flüssigkeit. Das war Feuer, eines Hotels Napoleon würdig. Es regnete stundenlang, der Weg bis zum nächsten Bahnhof war nachher immer noch leicht zu machen und so verlor ich mich mit dem frohen alten Mann in ein anmutiges Gespräch, während er mit dem Kolben im Bottich seine Vogelbeeren stampfte. Dort, wo angeknüpft war, erzählte er weiter. Sein Vater habe neben der Schmiede eine Schänke aufgetan, damit den Fuhrleuten, die etwa in der Reihe auf das Pferdebeschlagen zu warten hatten, die Zeit nicht lang werde. Aus der Schänke sei allmählich ein Wirtshaus geworden und aus diesem ein großer Gasthof, wo alle Fuhrwerke und Herrschaftkutschen Einkehr gehalten. Um diese Zeit sei er, mein jetzt so weißbärtiger Mann, ans Licht gekommen, gehegt und erzogen und »von den Leuten verhunzt wie ein Prinz«. Der einzige Sohn des reichen Napoleonwirts! Denn so hat der Gasthof geheißen und die Deutschen sind lieber beim »Napoleon« eingekehrt als beim »Kaiser Rotbart« auf der nächsten Poststation, weil beim Napoleon eben der Wein besser gewesen. Dann kamen die Eisenbahner ins Land. Da gab es Fuhrwerk über die Maßen und ungeheuer viel Geld. Die Leute hatten nur so gelacht dazu, obwohl ihnen der Strick schon um dem Hals lag. Aber er war noch locker. Der Napoleonwirt selbst hatte Tag für Tag vierundzwanzig schwere Pferde auf der Straße und am Tag der Eisenbahneröffnung saß er an der Ehrentafel fast ganz oben in der Nähe der hohen Herren und einer von ihnen feierte ihn durch einen Trinkspruch als den König der Straße. Das war vielleicht ein unbeabsichtigter Spott; aber ein großer. König der Straße hieß in diesem Fall König ohne Reich, denn wenige Jahre später: und auf der Straße konnten sich Schafe satt weiden. Der alte Napoleonwirt kränkte sich sehr darüber, dass die Eisenbahn, die er so emsig miterbauen half, so treulos war. Kein Mensch, sagte er, sei noch so grob betrogen worden wie er, der Napoleonwirt. Der Eisenbahnzug, der oben am Berghang hin rollte, pfiff auf ihn herab und kein Gesetz kümmerte sich um die Straße. Ohne gewöhnlich andere Gäste zu haben als manchmal einen durstigen Nachbar, wirtschaftete er in seiner Weise noch eine Weile fort; und als er endlich Haus und Hof verkaufte, geschah es gerade so, dass die Gläubiger keinen Schaden hatten. Da meinte der alte Napoleonwirt, für ihn sei es nun die höchste Zeit, zu sterben, denn ein paar Jahr später hätte es nicht einmal mehr für einen Grabstein gereicht. Ein Leben ohne Nachlass und ohne Grabstein hätte er für die überflüssigste Arbeit von der Welt gehalten.
Und der junge Mensch, der Sohn, stand nun allein auf der Straße. Manchmal saß er auf der Bank vor der verfallenden Schmiede und beobachtete die Leute, wie deren doch von Zeit zu Zeit wieder vorüberkamen. Und wenn er sich so ins Schauen verlor, da war ihm anfangs, als vermöge er den Insassen des Viergespannes und den hinkenden Handwerksburschen nicht zu unterscheiden. Es sei denn, dass dieser einen munteren Marsch pfiff und jener ein gelangweiltes Gesicht machte. Und dann wieder zu sich kommend, fragte er: »Was tue ich jetzt? Am vollen Trog habe ich schon gesessen.« Nichts war davon übriggeblieben als der Nachteil, dass ihn nun der leere doppelt verdrießen konnte. Doch er verdross ihn nicht eigentlich. Er war gegen alle weiteren Unfälle gut versichert bei der Assekuranzgesellschaft Habenichts & Co. Der Pfarrer seines Ortes hatte einmal gepredigt, der Christ solle dem Geiste leben. Und weil er das nicht weiter erklärte, so legte der Zuhörer es sich selber zurecht. Es wird auch am besten sein. Das braucht kein großes Betriebskapital. Ich will dem Geist leben. Und gründete eine kleine Branntweinbrennerei. Die Wurzeln, Beeren und Abfälle, aus denen er den Geist zog, hatte er umsonst; er brauchte sie nur zu sammeln, manchmal dafür ein »Vergelt's Gott!« zu sagen und ein »Stamperl Branntwein« zu versprechen. Wenn dann der Nachbar kam, um ihn zu trinken, griff er doch in den Sack; denn man hatte den fröhlichen Burschen nicht ungern und vermutete, dass er auch ein bisschen leben wolle. Er scheint auch in seiner Unterhaltung Geist geschenkt zu haben und nicht etwa Fusel, wie mancher zünftiger Ritter vom Geist zu destillieren pflegt. Da das große Einkehrhaus an der grünen Straße keine rechte Verwendung mehr finden konnte, so wurde es abgetragen und aus seinen Ziegeln am Bahnhof eine Waggonhalle erbaut. Nur die alte kleine Schmiede blieb stehen, um dem einzigen Übriggebliebenen zur Brennerei zu dienen. Das Wohnhaus dazu hatte er sich aus dem Fachgebälk des abgetragenen Gasthofes selbst gezimmert. Und hier lebte der Mann nun gelassen dahin, länger als fünfzig Jahre.
Er war Zeuge, wie sich in dieser Zeit alles mehrmals umstürzte. Die Menschheit machte Purzelbäume. Stand sie auf den Füßen, so behauptete sie, die einzig richtige Grundlage für den Fortschritt sei der Kopf; und stand sie auf dem Kopf, so klagte sie, dass alles in der Welt verkehrt sei. Der Schauende stand abseits und war ein wenig verblüfft. Nicht der Wandel befremdete ihn, sondern die Stetigkeit der Kreatur. Trotz allem unbegreiflichen Wandel blieben die Leute sich gleich. Bauten diese Leute Häuser, so tranken sie Branntwein, um Kraft zu gewinnen. Brannten die Häuser nieder, so tranken sie Branntwein, um sich zu trösten. Die Felder wurden zu Wald: die Leute tranken Branntwein und wanderten aus. In den Wildnissen streiften Jäger und tranken Branntwein. Und der Alte machte seinen Branntwein gerade so, wie man ihn vor so viel hundert Jahren gemacht haben mag. Und auch wo sie es anders machen, ist's im Grunde dasselbe. Alles kreist um den Punkt; und dieser Punkt rührt sich nicht vom Fleck. Zur Zeit der Ritter war es Mode geworden, in Kutschen zu fahren; zur Kutschenzeit ist es Sitte geworden, auf der Eisenbahn zu reisen; in der Eisenbahnzeit wurde es nobel, den Motorwagen zu hetzen; zur Zeit des Motorwagens wird es vornehm sein, im Luftschiff zu fliegen; und zur Zeit des Luftschiffes werden die Herren plötzlich finden, das Vornehmste, das Stolzeste, das Ritterlichste sei das Reiten auf dem Pferd. Dann ist man rund herum. Ein Ringelspiel wie auf Jahrmärkten. An einzelnen Stellen wurde wieder gerodet, wurde wieder gebaut: und immer tranken sie Branntwein und haschten nach Habe, nach grobem Genuss und waren stumpfsinnig für alles andere. So war die Masse immer gewesen und das Erdbeben der jungen Welt hatte wenig geändert. Die Masse ist Rohstoff, an dem die Wetter der Zeiten immerwährend formen und zerstören. So streute die Natur ihren Menschenstaub auch wieder einmal auf die Straße. Eines Tages kam der närrisch gewordene Scherenschleifer und der sausende Teufel. Der erste ein Reiter ohne Ross, der zweite ein Ross ohne Reiter. So der wörtliche Ausdruck des Alten; ich kann mir nur denken, dass damit die Radfahrer und Autofahrer gemeint sein sollten. — Und so, fuhr er fort zu sagen, habe sich seit fünfzig Jahren allerlei hin geändert und zurückgeändert, im Weltkasten sei alles ganz toll durcheinandergerüttelt. Aber die Zwetschken, seien sie braun oder blau, süß oder herb, frisch oder faul: der Kern sei gleichgeblieben. Es sei derselbe harte Kern mit etwas Gift im Innern. Der Mensch turne und bade, »doktere« und schneide an sich grausam herum, sei aber inwendig der Alte geblieben. Vor Zeiten habe eines Tages ein armes Weib verschmachtend an der Straße gelegen und ein vornehmer Vierspänner sei lustig vorübergefahren. Vor einigen Wochen habe da unten bei der Telefonstange Nummer 321 der Blitzschlag einen alten Hausierer betäubt und ein Automobiler sei lustig an ihm vorübergefahren. Einen Menschen aufheben und laben: Das kann man von so einem nicht verlangen. Muss noch froh sein, wenn er selber keinen niederrennt. Ja, der Kern ist hart und ein wenig giftig. Aber abgewöhnen mag man sich's doch nicht, das Zwetschgenessen. Das Auswendige nascht man und auf den Kern lässt man sich nicht ein. Dann bleibt man halt abseitsstehen und schaut zu. Und brennt Geist.
Während solcher Reden hatte der alte Schnapsbrenner mir einen angeschnittenen Laib Weißbrot vorgelegt und mich eingeladen, die Stiefel auszuziehen, damit sich die Füße besser ausrasten könnten. Ja, er stellte sich ausgespreitet hin und wollte sie mir von den Beinen reißen.
Ich lachte und sagte ihm offen, was mich wunderte. Dass er bei seiner Weltverachtung noch so gut sein könne. Ich sei in seinen Augen ja auch nichts anderes als ein Körnchen des Menschenstaubes auf der Straße. Da fuhr er munter in die Höhe: »Ja, glaubt Ihr denn, Ihr bekommt das alles geschenkt? Oh, das Hotel Napoleon ist ein gar teures Hotel!«
»Ich hoffe, dass Ihr Euch die Sachen bezahlen lassen werdet.«
»Bezahlen! Geht mir weg mit dem Wort Bezahlen! Allerlei Geist habe ich Euch vorgesetzt. Guten Geist!« fügte er mit ernsthafter Miene hinzu. »Und seit wann tut man den Geist mit Ziffern und Zahlen ab, seit wann? Ich denk', Ihr werdet Euch selber dalassen müssen. Ich denk' wohl.«
Der Gewitterregen war vorüber, die Straße hatte kalkgraue Tümpel und die Sonne schien wieder drein. Als ich zu Dank und Abschied dem Alten die Hand reichen wollte, nahm er sie nicht an. »Bleiben wir nit beisammen?« sagte er. »Wir bleiben ja beisammen!«
Damals dachte ich, er spreche doch Unsinn, manchmal. Heute denke ich das nicht. Über zwei Jahre sind seitdem dahingegangen, in jene Gegend kam ich nicht mehr, den Alten habe ich nicht mehr gesehen: und doch muss ich oft, sehr oft an ihn denken. Ja, so oft ich selbst mich als Weltbeschauer empfinde, muss ich an jenen Schauenden denken. »Wir bleiben beisammen!« hatte er gesagt. Es dürfte stimmen. Ich war an seiner Weisheit hängen geblieben.
Aber, mein lieber alter Geistbrenner, es wird uns nicht viel helfen. Wenn wir zwei uns auch außerhalb des sausenden Webstuhles stellen, einer links und der andere rechts, und dem Weber mit Fadenknüpfen Handlangerdienste zu leisten vermeinen: wir sind doch mitten im Gewebe; nur sind wir als Fäden vielleicht widerhaariger als andere und bilden hässliche Knoten. Alle miteinander machen wir das liederliche Tuch aus.
Der ordentliche Augustin.
Als der Vater Augustin Kernschimmlers sein vierzigjähriges Geschäftsjubiläum beging, sagte der Festredner unter anderem auch die großartigen Worte: »Unser teurer Jubilar nährte andere und wurde selbst fett, machte andere wohlhabend und wurde reich dabei. Sein Glück gründet auf seinen Tugenden!« Und Sekt darauf. — Denn der Vater Augustin Kernschimmlers war Bäcker und Fleischermeister gewesen — der einzige in dem Städtlein. Als einziger Fleischer hatte er die einzige Bäckerin geheiratet, und Augustin war von diesem einzigen Paar das einzige Kind. Jemand behauptete, der Vater habe das aus Geschäftsrücksichten so eingerichtet, denn er konnte keine Konkurrenten leiden und wollte dem lieben Söhnlein auch die Konkurrenz von Geschwistern ersparen.
Als nun bei dem oben erwähnten Jubiläum das Wochenblatt einen Festartikel über die Doppelfirma brachte und sogar die Bildnisse des verehrten Ehepaares Kernschimmler, da war es plötzlich ausgemacht, dass der kleine Augustin weder Fleischer noch Bäcker werden dürfe, sondern ein Doktor oder Professor, womöglich ein sehr berühmter. Zwar sagte der Vater zu seiner Frau, berühmt werde man ja auch als Fleischer, was eben der große Festartikel und das mit einem Lorbeerkranz umgebene Doppelbild des Jubelpaares im Wochenblatte bezeuge. Sie wusste das freilich besser, sagte es aber nicht, dass ihr die Veranlassung zu diesem illustrierten Festartikel runde hundert Gulden von ihrem Nadelgelde gekostet hatte.
Der Augustin kam in die Stadt, ins Gymnasium, und ward ein sehr ordentlicher Student. Seine Schulbücher hatten nicht ein einziges Eselsohr, doch bei den Examinationen ging es manchmal nicht ab ohne jegliche Erinnerung an das populäre Tier, auch wenn es nicht just Zoologie gab. Die Mutter schickte dem Söhnlein häufig Geräuchertes, Milchbrot, Krapfen und Zwieback, vor allem Powidlkuchen, die er so gerne aß. Einen Teil dieser guten Dinge verzehrte der Junge, der andere verschimmelte ihm im Nachtkästchen, der seine Vorratskammer war. Und als der Rest verschimmelt war, verzehrte er ihn auch, schon aus Ordnungsliebe und weil es ihm leid tat, die mütterlichen Liebesgaben wegzuwerfen. Seine Schulhefte waren stets wie neu und die Schriften und Ziffern wie gestochen, nur recht oft unrichtig. Über Fleiß und Sittlichkeit sangen seine Zeugnisse wahre Lobeshymnen, im Übrigen jedoch gaben sie ihm Anlass zur Unzufriedenheit mit den Professoren. So kam der Tag der Reifeprüfung. Die schwarzen Kleider mit dem Seidenzylinder hatte der junge Kernschimmler sich schon am Vorabend auf das musterhafteste zurechtgerichtet, also auch im Notizbuche die Gegenstände, in denen er bereits geprüft war und noch geprüft werden sollte, mitsamt den erhaltenen und zu erhoffenden Noten sorgfältigst aufgeschrieben. Als er nun auf der Gasse schon nahe dem Schulgebäude dahinging, bemerkte er mit Entsetzen, dass seine Stiefel nicht frisch gewichst waren. Er kehrte in seine Wohnung zurück, fand aber weder die Quartierfrau vor, sie war auf den Markt gegangen, noch den Schlüssel zum Schrank, wo das Stiefelputzzeug aufbewahrt lag. Er musste also zum Krämer und zum Bürstenbinder, um Wichse und Bürsten zu kaufen und dann die Beschuhung selbst in einen des Tages würdigen Zustand zu versetzen. Als er hernach die Stiefel wieder an die Beine zog, riss sich an einem derselben eine Strupfe los. Man sah zwar den Schaden hinter der Hose nicht, aber der junge Mann konnte keine Schlamperei leiden, er ging zu seinem Schuster, der die kleine Angelegenheit auch zur besten Zufriedenheit schlichtete. Als er hernach an den Lehrsaal kam, schritten die Kollegen und Professoren gerade zum Tore heraus, die Abgangsprüfung war vorüber. Augustin hatte nun ein ganzes Jahr Zeit, um vor seiner Prüfung vielleicht auch noch andere Mängel, als die an den Kleidern, zu beseitigen.
Mittlerweile starben rasch hintereinander seine Eltern. Der Schlag würde für den guten Jungen vernichtend gewesen sein, wenn nicht durch denselben in Haus und Geschäft eine Welt von Unordnung aufgetaucht wäre, die in Ordnung gebracht werden musste. Das zerstreute ihn ein wenig. Das Ordnungmachen dauerte aber Jahr und Tag, und mich wundert es nicht, dass darob die Reifeprüfung ganz und gar vergessen worden war.
Augustin Kernschimmler fand sich plötzlich allein auf der Welt, aber als Erbe eines großen Fleischergeschäftes und einer Bäckerei, die sich auch auf Mühle und Kornhandel verzweigte. Die Mühle und die gewerblichen Rechte verkaufte er, ebenso auch die Grundstücke; die beiden alten Häuser aber, das Fleischerhaus des Vaters und das Bäckerhaus der Mutter, behielt er aus Gründen der Pietät, und seine Lebensaufgabe bestand von nun an darin, diese Häuser und ihre Einrichtung in Ordnung zu halten. Jahraus, jahrein beschäftigte er eine Anzahl Dienstboten, um die Möbel abzustauben, die Spinnweben von den Ecken zu fegen, den Schwamm im Fußboden zu vernichten und alles Geschirr und Gezier blank und rein zu erhalten. Er konnte sich nicht entschließen, irgendein Kleidungsstück seiner Eltern wegzugeben, die Dienstboten rangen für und für einen wahren Verzweiflungskampf mit den Motten und anderem Insekt, aber mit Kampfer und anderen Mitteln gelang es immer noch, die Sachen zu erhalten, so dass sie in ihren Schränken und Kästen genauso liegen und hängen konnten, wie sie zu Lebzeiten oder beim Tode seiner Eltern gelegen oder gehangen waren. Die Wohnungen der beiden Häuser waren denn auch stets in dem Zustande, die ehrenwertesten Besuche zu empfangen, die nicht kamen. Auf der Fleischbank konnte zu jeder Stunde geschlachtet, im Ofen jeden Tag gebacken werden, es war alles dazu in bester Bereitschaft. Geschlachtet und gebacken wurde aber nicht. Doch, so fleißig auch gelüftet wurde, es war ein Modergeruch vorhanden, und die Schritte des Wandelnden hallten lauter in den Wänden als anderswo.