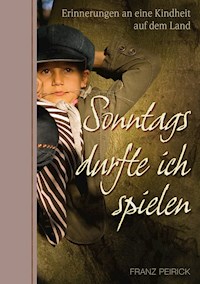
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: LV Buch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein kleines Dorf in Westfalen. Bomben fallen, Moorbrände entziehen der Landbevölkerung die Lebensgrundlage. Franz Peirick, im Kriegsjahr 1940 geboren, wächst auf einem Hof auf, dessen Landwirtschaft von Kargheit und Mangel geprägt ist. Eindrucksvoll beschreibt er in seinen Erinnerungen, wie es seiner Familie trotz aller Widrigkeiten und Strapazen gelingt, mit Willenskraft, harter Arbeit, Bodenständigkeit und Erfindungsgabe die Moorkultivierung voranzutreiben und der verbrannten Erde eine neue landwirtschaftliche Existenz abzuringen. Ein bemerkenswertes Dokument jüngerer Zeitgeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erinnerungen an eine Kindheit auf dem Land
Sonntags durfte ich spielen
Franz Peirick
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Impressum
Vorwort
Meine Eltern haben viele persönliche Erinnerungen aufgeschrieben, sowohl in hochdeutscher als auch in plattdeutscher Sprache, die ich mit großem Interesse gelesen habe. Diese Erinnerungen waren der Anstoß für mich, auch einen Teil meiner persönlichen Erinnerungen zu Papier zu bringen. Sollten meine Kinder diese Aufzeichnungen einmal weiterführen, wären das über hundert dokumentierte Jahre, die für viele unserer Nachkommen und auch Heimatvereine von Interesse sein könnten.
Wenn ich meinen Kindern von meinen Erinnerungen erzählt habe, konnten sie kaum glauben, wie unser Leben noch vor gut 60 Jahren aussah. Die heutige Zeit ist schnelllebig. In den letzten 60 Jahren hat sich so vieles verändert wie vorher in hundertfünfzig oder zweihundert Jahren nicht.
Wer meine Aufzeichnungen liest, sollte allerdings berücksichtigen, dass es sich um meine persönlichen Erinnerungen handelt, die ich in meinem Gedächtnis bewahrt habe.
Diese Erinnerungen geben demzufolge ein subjektives Erleben einer Zeit wieder, die andere Menschen meiner Generation eventuell völlig anders wahrgenommen und erlebt haben.
Franz Peirick
Kriegszeit
Als am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg ausbrach, dachte noch niemand an mich. Am 10. September 1940 bin ich geboren. Als der Krieg dann zu Ende war, war ich gerade mal viereinhalb Jahre alt. Was ich hier niedergeschrieben habe, habe ich selbst erlebt oder erinnere es aus den Erzählungen der Älteren.
Ursprünglicher Siedlungshof im Jahr 1940
Mein Vater wurde 1940 – im Jahr meiner Geburt – als Soldat eingezogen. Die folgenden Kriegsjahre verbrachte ich mit meiner Schwester und meiner Mutter. Oben in unserem Haus in Stevede wohnte außerdem noch eine Frau zusammen mit ihrem kleinen Sohn, deren Mann auch als Soldat im Krieg war.
Meinen Vater sah ich in jener Zeit nur selten. Ich erinnere mich noch gut daran, dass Mutter meinem Vater Briefe schrieb. Meine Schwester Irene, 1939 geboren und ein Jahr älter als ich, und ich bemalten für unseren Vater dann oft Zettel, die wir zu den Briefen meiner Mutter legten.
Einmal malte ich einen Flieger mit Bomben. Wenn Vater Heimaturlaub hatte, hingen in der Küche an der Garderobe der Karabiner, das Seitengewehr (ein Säbel) und der Stahlhelm. Mit dem Seitengewehr spielte ich: Ich lief dann ins Zimmer, hielt den Säbel über den Kopf und rief: „Schait ick die daut.“
So klein ich auch war: Ich hatte schon mitbekommen, dass es im Krieg um Tod und Zerstörung ging.
Mein Vater hatte sechs Brüder, die alle zur Wehrmacht eingezogen worden waren. Drei von ihnen blieben im Krieg: Zwei fielen, und ein Bruder galt als vermisst. Als diese schlechten Nachrichten eintrafen, waren Opa und Oma sehr verbittert. Bald darauf starben sie.
An Opa und Oma väterlicherseits kann ich mich nicht erinnern, wohl aber an meinen Onkel, Mamas jüngsten Bruder. Als er auf einem Kurzbesuch bei uns war, nahm er mich auf den Arm und hob mich hoch in die Luft. Dieser Onkel ist 1944 in der Normandie gefallen. Meine Mutter war sehr traurig, denn sie hing sehr an ihm. Nach der Todesnachricht kam später noch ein Abschiedsbrief, den er geschrieben hatte, bevor er in den Kampf geschickt wurde und damit rechnen musste, nicht zu überleben. Opa las den Brief und sagte: „Der Brief ist mir mehr wert als tausend Mark Geld.“
Opa kam öfter zu Fuß zu uns: mit der Pfeife im Mund, mit Handstock und einem langen Bart, so sehe ich ihn noch heute vor mir. Einmal brachte er mir einen schönen dicken, roten Apfel mit. Den sollte ich aber nicht sofort essen, dann könne ich mich noch länger darauf freuen, meinte er. Ich lief mit dem Apfel herum und sagte immer wieder: „Den verwahr ich mir, bis Papa wiederkommt.“ Lange hielt ich das aber nicht durch: Schon nach kurzer Zeit hatte ich in den Apfel gebissen. Meine Mutter fragte mich: „Wolltest du den Apfel nicht aufbewahren, bis Papa wiederkommt?“ Darauf war meine Antwort: „Aber das dauert doch noch so lange.“
Zu jener Zeit besaßen wir schon zwei Kühe, Alfa und Erna. Die mussten an Wegrändern und in der Wildnis ihr Futter suchen, denn wir besaßen noch keine Weide, nur unkultiviertes Moor. Meine Mutter hatte sehr viel Arbeit damit, aber wir mussten nie hungern. Wir waren so genannte Teilselbstversorger und bekamen zusätzlich Lebensmittelmarken für Mehl, Zucker und Kolonialwaren. Zu den schönen Erinnerungen an diese harten Zeiten gehört die Buttercremetorte, die unsere Mutter für sonntags machte. Dabei gab sie uns die Buttercreme aus dem Spritzbeutel direkt in den Mund. Oder der grüne Waldmeister-Wackelpudding, den es zum Nachtisch gab. Aus dem eigenen Garten hatten wir unser Gemüse, unsere Beeren und unsere Kartoffeln. Ein Schweinchen konnten wir auch noch aus Speiseabfällen und Gemüseresten anfüttern. Unsere Bienen brachten uns den Honig, so dass unsere Ernährung gesichert war.
Anna Peirick
Aber unsere Landwirtschaft hatte ihren Namen noch nicht verdient: Wir mussten mehr hereinstecken, als wir ernten konnten. Wenn der Vater Heimaturlaub hatte, wollte er immer weitere Vennflächen kultivieren. Aber ohne Pferd und Gerät kam nicht viel dabei heraus. Außerdem fehlte die Vorflut für die nötige Entwässerung. Auf dem kleinen Feld ertranken die angepflanzten Kartoffeln, so dass es einfach nichts zu ernten gab. So gab es immer weitere Probleme mit dem Vieh und der Landwirtschaft.
Auch der Keller unseres Hauses stand mehr als einmal einen halben Meter unter Wasser. Die leeren Einmachgläser schwammen dabei im Wasser. Ich kann mich gut daran erinnern, dass der Mutter beim Einsammeln der Gläser das Wasser oben in die Gummistiefel hineinlief.
Besuch im Lazarett
In den fünf Jahren, in denen er Soldat war, lag mein Vater einige Male im Lazarett. Nicht, weil er verwundet worden war. Er war krank. Genaues weiß ich nicht. Ich glaube, manchmal hatte er Bronchitis oder eine psychische Krankheit. Wo es möglich war, besuchte meine Mutter ihn und nahm uns mit.
Vater Bernhard Peirick (oben) im Lazarett
Einmal waren wir in Lüdenscheid und einmal in Dorsten. Mama erzählte uns später, wie wir uns darauf immer freuten. An das Lazarett in Dorsten erinnere ich mich gut. Ab Maria Veen konnten wir mit dem Zug fahren. Bis zum Bahnhof transportierte Mama meine Schwester und mich auf dem Fahrrad: den einen vorn im Körbchen, den anderen hinten auf dem Gepäckträger. Für die Besuche bei unserem Vater hatte meine Mutter uns immer besonders herausgeputzt. Meine Schwester trug ein selbst genähtes Kleidchen und ich eine kurze schwarze Hose. Auf den Außenseiten der kurzen Hosenbeine hatte meine Mutter weiße Perlmuttknöpfchen aufgenäht. Aus demselben Stoff wie die Hose waren auch die Hosenträger. Dazu trug ich ein weißes Hemd und weiße Kniestrümpfe. Ich sah wohl so adrett aus, dass Mama, als sie mit uns an der Hand durch Dorsten ging, von einer Frau angesprochen wurde: „Den Jungen lassen Sie mir bitte.“
In Dorsten wohnte auch unsere Tante Sefa, Mamas einzige Schwester, die auf einen Bauernhof eingeheiratet hatte. Tante Sefa besuchten wir immer gern. In Dorsten gab es eine Elektrische (Straßenbahn), die fuhr auch in Richtung Marl. Auf dieser Strecke stiegen wir bei der Haltestelle „Gärtnerei“ aus und brauchten von dort eine Viertelstunde, um zum Bauernhof von Tante Sefa zu laufen. Zu ihr hatten wir immer guten Kontakt, das blieb auch so, als wir später erwachsen waren. Meine Mutter konnte ihre Schwester meist nur einmal im Jahr besuchen, weil sie wegen der Landwirtschaft nicht abkömmlich war und auch die Fahrtmöglichkeiten sehr schlecht waren.
Franz und Irene: zum Besuch des Vaters adrett herausgeputzt
Im Krieg musste Tante Sefas Familie oft im Luftschutzbunker Zuflucht suchen und übernachten, weil die Bombenangriffe immer häufiger wurden. Als der Krieg endlich zu Ende war, fuhren Mama, meine ältere Schwester und ich einmal mit dem Buna-Auto zu Tante Sefa nach Dorsten. Das Buna-Auto war ein Lastwagen, der im Innenraum Holzbänke hatte und Arbeiter von Hochmoor zu den Chemischen Werken nach Marl-Hüls brachte. Auf dem Rückweg fuhr der Wagen dann aber nur bis Ramsdorf. Über zwei Stunden mussten wir dann noch zu Fuß nach Hause laufen.
Militärische Anlagen im „Weißen Venn“
Das „Weiße Venn“, etwa tausend Hektar groß, liegt in der Region zwischen Coesfeld und Borken, Reken und Gescher. Es war zu jenen Zeiten ein einsames und ödes Gebiet. Ein Umstand, den sich die Militärführung zunutze machen wollte. Sie bestimmte, dass dort die feindlichen Flugzeuge ihre Bombenlast abwerfen sollten, die für das Ruhrgebiet bestimmt war.
Soldaten in Baracken in der Nähe des „Weißen Venns“
Zu diesem Zweck wurden große Hallen errichtet, Attrappen aus leichten Hölzern und dünnen Leisten, die beleuchtet werden konnten und den Bomberpiloten Flugzeughallen vortäuschen sollten. Außerdem mauerte man zweimal fünf Meter große und fünfzig Zentimeter tiefe Kästen. Diese füllte man mit Abfällen aus der chemischen Industrie. Sie sollten bei einem Luftangriff angezündet werden, um durch die starke Rauchentwicklung einen Flughafenbrand vorzutäuschen.
Am Rand des Venns, etwa vierhundert Meter von unserem Haus entfernt, wurden große Scheinwerfer und Flugabwehrgeschütze installiert, um die feindlichen Flugzeuge abzuschießen. Um die Anlage zu bedienen, waren in der Nähe etliche Soldaten in Baracken stationiert. Doch wurden im Moor nur wenige Bomben abgeworfen – das Täuschungsmanöver war offensichtlich misslungen. Eine Bombe aber fiel in unseren Garten und verursachte am Haus erhebliche Zerstörungen. Wir hatten Glück: Obwohl wir nicht wie die Evakuierten in den Keller geflüchtet waren, überlebten wir. Niemand kam zu Schaden.
Die Bombe
Als sich die Bombenangriffe häuften, lebten wir jede Nacht in Angst. Mama lief oft mit uns beiden Kindern unter dem Arm zum Nachbarhof.
Auch der Scheinflughafen im Weißen Venn brachte noch eine besondere Gefahr für unser Haus. Der Keller war zwar durch Eichenpfosten zusätzlich abgestützt, aber bei einem Volltreffer gab es für uns keine Überlebenschance. Gott sei Dank hatten wir Glück, und es blieb relativ ruhig. Mit der Zeit ließ die Angst nach, wir gewöhnten uns an die ständige Bedrohung.
Franz und Irene – eine Kindheit, von Bomben bedroht
Eine Stadt nach der anderen wurde bombardiert. Zum Kriegsende hatten wir noch Evakuierte aus Coesfeld im Haus, da passierte es. Mama erzählte uns hinterher, wie es sich zugetragen hatte. Alle im Haus schliefen, als plötzlich am Himmel ein Flugzeug ein grelles Licht hinterließ. Man sagte: „Der hat einen Christbaum abgesetzt.“ Es muss wohl ein sehr grelles Licht gewesen sein, das die Leute trotz der überall vorgeschriebenen Verdunkelung wahrnahmen. Dann folgte auch schon der mächtige Knall. Das Haus wackelte, und die Fensterscheiben von der Gartenseite waren alle durch den Druck herausgeflogen und zersplittert. Die Dachziegel rappelten vom Dach. Alle waren verschreckt aufgestanden, und als es ruhiger wurde, fragten sie zuerst: „Leben alle noch?“ Sie standen im Dunkeln, bis Mama eine Petroleumlampe anzündete. Die Kinder wurden aus den Betten geholt, alle waren unversehrt.
Die Bombe war etwa fünfzig Meter vom Haus hinter dem Garten im Obsthof eingeschlagen. Der Trichter, den sie hinterließ, diente noch lange Jahre nach dem Krieg als Wasserloch und Viehtränke. Das Wohnhaus war an der Waschküchenseite stark beschädigt worden. Die Fensterscheiben wurden neu eingesetzt, der Dachstuhl wurde notdürftig repariert und die Dachziegel teilweise erneuert. Diese Seite des Hauses wurde nach dem Krieg komplett umgebaut.
Das Haus Peirick vor der Zerstörung
Evakuierte aus Coesfeld
Im Kriegsjahr 1944 war Coesfeld Ziel vieler Bombenangriffe – mit verheerenden Auswirkungen. Wohnhäuser, Kirchen, Fabriken und Geschäfte wurden durch Bomben und Brände zerstört. Auch aus unserer Verwandtschaft waren einige Familien betroffen. Eine Familie wäre fast im eigenen Haus umgekommen. Der Vater wurde verschüttet und schwer verletzt.
Anna und Bernhard Peirick, Pflichtjahrmädchen Inge, Fremdmieter des Hauses, Franz und Irene
Ich erinnere mich, dass eines Tages die Familien plötzlich bei uns vor der Tür standen und eine Unterkunft suchten. Bald hatten wir das Haus voll. Als Kinder empfanden wir das nicht als unangenehm. Aber lange blieben sie nicht, denn das Kriegsende war in greifbare Nähe gerückt. Die Evakuierten blieben nur für einige Wochen. Dann kehrten sie, sobald es möglich war, wieder in ihre notdürftig hergerichteten Häuser zurück. Auch später besuchten uns die Familien, die wir bei uns aufgenommen hatten, noch oft.
Die Räume in unserem Haus, die nicht unbedingt von uns benötigt wurden, waren nach dem Krieg, wegen der Wohnungsnot, noch lange Jahre vermietet. Nacheinander wohnten vier Familien bei uns, die alle nach dieser Zeit bei uns ein eigenes Haus bauten. Die Räume brauchten wir inzwischen auch selbst dringend, denn wir waren mittlerweile sieben Geschwister. Meine ältere Schwester bekam ein eigenes Zimmer. Ich hatte einen ausgebauten Raum über der Waschküche, etwa acht Quadratmeter groß, meine Klausur. Drei meiner Schwestern mussten sich ein Zimmer teilen.
In der Nachkriegszeit waren in der Nachbarschaft auf den Höfen fast überall Evakuierte untergebracht. So haben wir als Kinder Spielkameraden genug gehabt. In Stevede lebten sehr viele Vertriebene aus dem Osten in allen möglichen Räumen, auch in solchen, die eigentlich unbewohnbar waren, in Baracken und Bunkern. Die Frauen arbeiteten teilweise auf den Höfen in der Landwirtschaft mit, um so wenigstens ihre Familien ernähren zu können.
Bei uns in der Nachbarschaft wurde auch ein Luftschutzbunker lange Zeit bewohnt. Außerdem waren in der Nähe noch zwei Baracken aufgebaut und ganz gemütlich als Wohnung eingerichtet worden. So nach und nach zogen viele Familien, je nach ihren Möglichkeiten und Arbeitsplätzen, nach Coesfeld oder in andere Orte.
Meine Mutter und die Landwirtschaft
Meine Mutter war auf einem Siedlungshof aufgewachsen. So wusste sie, welche Arbeit auf einem Hof getan werden musste, um den Lebensunterhalt zu sichern. Mit der Belastung, die in den nächsten fünfzig Jahren auf sie zukam, rechnete sie aber wohl nicht. Als junges Mädchen hatte sie im Elternhaus zwar mitgeholfen, aber die körperlich schweren Arbeiten hatten ihre Brüder erledigt. In späteren Jahren arbeitete sie auf einem größeren Hof bei Coesfeld abwechselnd in der Küche und in der Landwirtschaft und hatte auf diese Weise Erfahrungen mit Tieren und Pflanzen gesammelt.
Anna Peirick mit ihren Kindern Franz und Irene beim Unkrauthacken
Als Vater im Krieg war, war meine Mutter auf sich allein gestellt und für alles zuständig. Zwei Milchkühe mit Jungvieh, einige Schweine und anfangs noch etwa fünfhundert Hühner hatte sie zu versorgen. Nur Mama konnte unsere Kühe melken. Als wir Kinder groß genug waren, brachte sie uns das Melken bei. Als wir dann außer dem großen Garten auch schon etwas Ackerland hatten, wurden zusätzlich Kartoffeln und Rüben angebaut. Alles musste in Handarbeit erledigt werden. Die Pflanzen, Steckrüben oder Runkelrüben, wurden im Garten vorgezogen. Vater war, besonders auch in der Zeit nach dem Krieg, überwiegend mit der Venn-Kultivierung beschäftigt. Als ich in die Mittelklasse der Volksschule ging, musste ich oft in der Landwirtschaft mithelfen. Meine Schwester half im Haushalt, so dass wir Mama etwas entlasten konnten. Wenn sie auf dem Feld arbeitete, ging sie mittags etwa eine halbe Stunde vor uns nach Hause. Wenn wir dort ankamen, war das Mittagessen schon fertig. Wie sie das immer so schnell hinkriegte, weiß ich bis heute nicht.
Anna Peiricks Lieblingskuh Alfa
In dieser Zeit wurden bei den meisten Bauern die Kühe auch mittags gemolken. Das war eine zusätzliche Belastung, die besonders im Sommer auf der Weide sehr viel Mühe bereitete. Damals waren die Leute der Meinung, dass die Kühe dann mehr Milch gäben. Unsere Kühe erbrachten nie hohe Milchleistungen, weil sie nicht genug gutes Futter bekamen. Mama freute sich immer, wenn unsere Kühe auf eine frische Weide kamen, gutes Futter bekamen und sich mit mehr Milch revanchierten. Dann lohnte sich die Melkarbeit auch wieder.
Abends kamen die Kühe auf eine Weide hinter der Scheune, wo für sie nur wenig Futter zu finden war. Diese Weide nannten wir deshalb auch Schmachtweide. Die Kühe sollten von dem Venngras und dem minderwertigen Gras von den Wegrändern Milch geben. Vater hatte Stellmacher gelernt. Deshalb fehlten ihm wohl die Erfahrung im Umgang mit den Tieren und das Gefühl für Tiere und Pflanzen. Er kam oft gar nicht an die Tiere heran. Es fehlte bei uns an gutem Futter für den Viehbestand. Auf den Neukulturen wuchs mit der geringen Düngung nicht viel. Oft konnte auch nicht zur richtigen Zeit gesät werden, wenn das Feld im Frühjahr noch gepflügt werden musste, ohne Drainage war es meistens zu nass. Auch die Stoppelrüben, als Nachfrucht nach dem Roggen, wurden oft zu spät gesät. Die waren dann so mickrig, dass Mama und wir Kinder lange Zeit zupfen mussten, damit unser Vieh genug zu fressen hatte.
Eine alte Baracke, zum Hühnerstall umfunktioniert





























