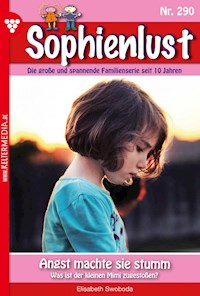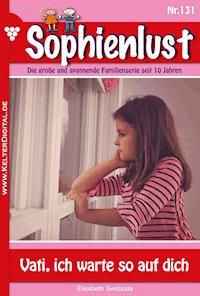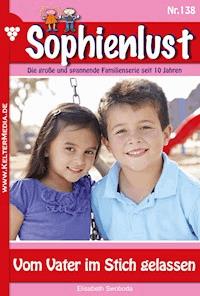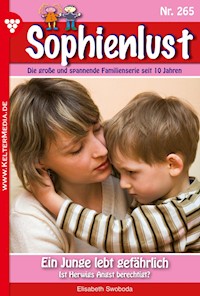Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Die Idee der sympathischen, lebensklugen Denise von Schoenecker sucht ihresgleichen. Sophienlust wurde gegründet, das Kinderheim der glücklichen Waisenkinder. Denise formt mit glücklicher Hand aus Sophienlust einen fast paradiesischen Ort der Idylle, aber immer wieder wird diese Heimat schenkende Einrichtung auf eine Zerreißprobe gestellt. Diese beliebte Romanserie der großartigen Schriftstellerin Patricia Vandenberg überzeugt durch ihr klares Konzept und seine beiden Identifikationsfiguren. Andrea von Lehn fuhr in ihrem Wagen die Landstraße entlang, die von Maibach nach Wildmoos führte. Entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit, möglichst rasant zu fahren, begnügte sie sich diesmal mit einem sehr gemäßigten Tempo. Das hatte zweierlei Gründe. Erstens hatte Andrea das Auto erst am Morgen aus der Reparaturwerkstätte zurückbekommen, wo eine verbeulte Stoßstange und ein eingedrückter Scheinwerfer, typische Folgen eines Auffahrunfalles, repariert worden waren. Trotzdem hatte dieser geringfügige Schaden Hans-Joachim von Lehn, Andreas Ehemann, Grund für einige ätzende Bemerkungen geboten. Er hatte dabei die Fahrweise der Frauen im Allgemeinen, und die von Andrea im Besonderen aufs Korn genommen. Andreas Verteidigung war nur lahm gewesen. Wie hätte sie ahnen sollen, dass die Ampel so plötzlich von Grün auf Gelb wechseln und der Vordermann abrupt anhalten würde? Hans-Joachim hatte die Diskussion mit einem Kopfschütteln und einem Stoßseufzer beendet, und Andrea hatte sich vorgenommen, in Zukunft besser aufzupassen. Das tat sie jetzt, denn sie hatte nicht vor, ihrem Mann einen neuerlichen Anlass zum Schelten zu geben. Im Gegenteil, sie wollte ihm beweisen, dass er ihr bitter unrecht getan hatte, dass ihr Fahrstil in Ordnung war. Der zweite Grund für Andreas langsames Tempo war, dass ihre Gedanken noch bei dem angenehmen Nachmittag weilten, den sie in Maibach verbracht hatte. Es war nett gewesen, einige ihrer alten Schulfreundinnen wiederzusehen und mit ihnen über frühere Zeiten plaudern zu können. Natürlich hatten die jungen Frauen nicht nur über die Schule gesprochen, sondern sich auch neueren Ereignissen zugewandt. Andrea hatte von dem Tierheim erzählt, das sie zusammen mit ihrem Mann, der von Beruf
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sophienlust – 146–
Oliver, das Einzelkind
Warum er von zu Hause auszog ...
Elisabeth Swoboda
Andrea von Lehn fuhr in ihrem Wagen die Landstraße entlang, die von Maibach nach Wildmoos führte. Entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit, möglichst rasant zu fahren, begnügte sie sich diesmal mit einem sehr gemäßigten Tempo. Das hatte zweierlei Gründe.
Erstens hatte Andrea das Auto erst am Morgen aus der Reparaturwerkstätte zurückbekommen, wo eine verbeulte Stoßstange und ein eingedrückter Scheinwerfer, typische Folgen eines Auffahrunfalles, repariert worden waren. Trotzdem hatte dieser geringfügige Schaden Hans-Joachim von Lehn, Andreas Ehemann, Grund für einige ätzende Bemerkungen geboten. Er hatte dabei die Fahrweise der Frauen im Allgemeinen, und die von Andrea im Besonderen aufs Korn genommen.
Andreas Verteidigung war nur lahm gewesen. Wie hätte sie ahnen sollen, dass die Ampel so plötzlich von Grün auf Gelb wechseln und der Vordermann abrupt anhalten würde?
Hans-Joachim hatte die Diskussion mit einem Kopfschütteln und einem Stoßseufzer beendet, und Andrea hatte sich vorgenommen, in Zukunft besser aufzupassen.
Das tat sie jetzt, denn sie hatte nicht vor, ihrem Mann einen neuerlichen Anlass zum Schelten zu geben. Im Gegenteil, sie wollte ihm beweisen, dass er ihr bitter unrecht getan hatte, dass ihr Fahrstil in Ordnung war.
Der zweite Grund für Andreas langsames Tempo war, dass ihre Gedanken noch bei dem angenehmen Nachmittag weilten, den sie in Maibach verbracht hatte. Es war nett gewesen, einige ihrer alten Schulfreundinnen wiederzusehen und mit ihnen über frühere Zeiten plaudern zu können. Natürlich hatten die jungen Frauen nicht nur über die Schule gesprochen, sondern sich auch neueren Ereignissen zugewandt. Andrea hatte von dem Tierheim erzählt, das sie zusammen mit ihrem Mann, der von Beruf Tierarzt war, führte. Sie hatte auch verschiedene Vorkommnisse erwähnt und die Gewohnheiten ihrer vierbeinigen Lieblinge geschildert.
Von den vierbeinigen Lieblingen war dann das Gespräch auf die zweibeinigen, nämlich auf die Kinder, übergegangen. Stolz hatte Andrea einige Fotos von Peterle, ihrem kleinen Sohn, herumgezeigt. Die anderen Damen hatten natürlich nicht nachstehen wollen und ihrerseits Bilder von ihren Kindern hervorgezogen, um sie herumzureichen.
Der Nachmittag war wie im Fluge vergangen. Viel zu rasch war die Zeit zum Aufbrechen gekommen.
»Als Nächste bin ich an der Reihe. Ihr müsst mich bald besuchen«, hatte Andrea die Freundinnen eingeladen und auch sofort einen Termin vereinbart.
Daran dachte Andrea, als sie jetzt nach Hause fuhr. Sie begann schon zu überlegen, wie sie die Jause gestalten sollte. Da gewahrte sie eine kleine Gestalt, die vorschriftswidrig am rechten Fahrbahnrand entlangtrottete. Ein Glück, dass ich so langsam fahre, schoss es ihr durch den Sinn. Hans-Joachim hat doch recht. Man kann nicht vorsichtig genug sein.
Andrea überholte den einsamen Wanderer und stellte dabei fest, dass es sich um einen etwa neun- bis zehnjährigen Jungen handelte. Sie hielt an, kurbelte das rechte Seitenfenster herunter und rief dem Kind zu: »Wo willst du denn hin?«
Da der Junge verdrossen schwieg, fuhr Andrea fort: »Es dämmert bereits. Es dauert nicht mehr lange, dann ist es stockdunkel. Weißt du nicht, dass es gefährlich ist, hier auf der Straße zu Fuß zu gehen? Ein Auto könnte dich erfassen und überfahren.«
Der Junge zuckte mit den Schultern, schwieg aber. Andrea ließ nicht locker. »Möchtest du ein Stück mitfahren?«, fragte sie. »Komm, steig ein!«
Der Junge gehorchte. Er setzte sich neben Andrea auf den Beifahrersitz und nahm das unförmige Bündel, das er auf der Schulter getragen hatte, auf den Schoß. Bisher hatte er noch kein Wort geäußert, aber als Andrea ihm ihren Namen nannte und nach dem seinen fragte, erwiderte er höflich: »Ich heiße Oliver Drexler.« Danach verstummte er wieder.
Andrea fuhr weiter, wobei sie von Zeit zu Zeit ihrem stummen Gefährten einen nachdenklichen Seitenblick zuwarf. Oliver war ein hübscher Junge mit sonnengebräuntem Gesicht, dunkelblondem Haar und großen braunen Augen mit langen gebogenen Wimpern. Beinahe wirkte er wie ein Mädchen. Allerdings war sein Gesichtsausdruck nicht sehr freundlich, sondern eher verschlossen.
Andrea ließ sich davon nicht abschrecken. »Ich bin gleich zu Hause«, erklärte sie dem Jungen. »Ich wohne an der Grenze zwischen Wildmoos und Bachenau. Wo kann ich dich absetzen?«
»Ach, irgendwo«, entgegnete Oliver vage.
Diese gleichgültige Antwort verwunderte Andrea. »Musst du noch weit gehen?«, erkundigte sie sich. »Sag mir, wo du zu Hause bist. Ich bringe dich gern hin. Es macht mir nichts aus, noch ein Stück zu fahren«, erbot sie sich.
Es folgte eine längere Pause. Endlich bequemte sich Oliver zu einer Auskunft. »Ich wohne in Maibach.«
»Oh!« Andrea trat auf die Bremse. »Da habe ich dich in die falsche Richtung gefahren. Das tut mir leid. Hast du denn nicht gewusst, dass du dich von Maibach entfernst? Ich habe dich ungefähr drei Kilometer von der Stadt entfernt aufgelesen. Kennst du dich hier in der Gegend nicht aus? Bist du vielleicht erst vor Kurzem hierhergezogen?«
»O nein, ich wohne schon immer in Maibach«, erwiderte der Junge gelassen.
Andrea konnte nur staunen. »Aber warum bist du denn in mein Auto eingestiegen?«, rief sie. »Du musst doch gemerkt haben, dass die Richtung nicht stimmt!«
Oliver nickte, und Andrea war nahe daran, die Geduld zu verlieren. »Nun sag mir, um Himmels willen, wohin du eigentlich willst!«
»Das weiß ich nicht.«
Die Trostlosigkeit, die in seiner Stimme lag, veranlasste Andrea, ihn und sein Bündel schärfer ins Auge zu fassen. »Du bist doch nicht etwa von zu Hause fortgelaufen?«, fragte sie argwöhnisch.
Oliver senkte verlegen den Kopf. Er kam Andrea wie eine Schnecke vor, die sich in ihr Haus zurückzog. Sie wusste nicht recht, wie sie den Jungen aus seiner Reserve herauslocken sollte. Eines war jedoch für sie sicher: Sie hatte mit ihrem Verdacht, dass er von zu Hause fortgelaufen sei, den Nagel auf den Kopf getroffen.
Andrea schickte sich an, ihren Wagen zu wenden und nach Maibach zurückzufahren.
»Was tun Sie denn?«, fragte Oliver erschrocken.
»Ich bringe dich zurück nach Maibach«, erwiderte sie.
»Nein, das dürfen Sie nicht!« Vor Aufregung klang die Stimme des Jungen schrill und hoch.
»Soll ich dich vielleicht hier aussteigen lassen und deinem Schicksal überlassen?«, fragte Andrea.
Ein trotziges »Ja« war die Antwort.
»Nun sei doch vernünftig«, versuchte Andrea ihn zu beruhigen. »Deine Eltern machen sich gewiss schon Sorgen um dich. Wahrscheinlich suchen sie dich bereits überall.«
»Nein, das tun die bestimmt nicht«, erwiderte Oliver voll Bitterkeit.
Andrea ging darauf nicht ein, sondern fragte: »In welcher Straße wohnst du? Ich muss deine genaue Adresse wissen, damit ich dich sicher heimbringen kann.«
»Ich will aber nicht heim.«
»Nun benimm dich nicht wie ein dummer Junge«, sagte Andrea und bemühte sich, möglichst streng zu wirken. »Ich muss dich zu deinen Eltern bringen. Was sollte ich denn sonst mit dir anfangen?«
»Ich könnte mir andere Eltern suchen«, meinte er.
»Das ist Unsinn. Das sollte ein so großer Junge wie du doch wissen.«
»Aber sie mögen mich nicht!«
Andrea konnte unschwer erraten, dass mit »sie« Olivers Eltern gemeint waren. »Das bildest du dir bestimmt nur ein«, sagte sie beschwichtigend. »Wahrscheinlich hast du zu Hause Streit gehabt, aber deswegen muss man nicht gleich davonlaufen. Hast du Angst vor einer Strafe?«, fügte sie hinzu, als Oliver beharrlich schwieg. »Ich glaube, deine Mutter ist vor Sorge um dich schon so außer sich, dass sie froh ist, wenn sie dich wiedersieht, und auf jede Strafe verzichtet.«
»Nein, Mama ist nicht froh, wenn sie mich wiedersieht«, stellte Oliver betrübt fest. »Sie mag mich nicht.«
»Das glaube ich einfach nicht«, erwiderte Andrea.
»Es ist aber so. Ich sage die Wahrheit.«
Mit Schrecken bemerkte Andrea, dass jetzt Tränen in Olivers Augen standen. Durch den Umgang mit ihrem kleinen Bruder Henrik gewitzigt, wusste sie, dass es Jungen nicht liebten, beim Weinen ertappt zu werden.
»Deine Mutter mag dich also nicht«, stellte sie daher ruhig fest. »Wieso nicht? Ich meine, wie bist du zu dieser Auffassung gekommen?«
»Mama war es doch, die mich weggeschickt hat.«
»Sie hat dich weggeschickt?«
»Ja, sie hat meine Sachen in ein Leintuch gewickelt und gesagt, ich soll gehen und mir andere Eltern suchen.« Oliver deutete auf das Bündel, das auf seinen Knien lag und jeden Augenblick auseinanderzufallen drohte.
Sie waren nun beinahe wieder in Maibach angelangt. Andrea hielt an, um den Sachverhalt, der ihr absurd vorkam, zu klären.
»Was du mir da erzählt hast, ist einfach lächerlich und …«
»Es ist wahr«, unterbrach Oliver sie. »Bitte, glauben Sie mir, meine Mama wird sich überhaupt nicht freuen, wenn Sie mich zurückbringen. Wahrscheinlich macht sie gar nicht die Tür auf, wenn sie merkt, dass ich es bin.«
»Das kann ich mir nicht vorstellen.«
»Es ist aber so. Bitte, bringen Sie mich nicht zu meiner Mutter zurück«, flehte der Junge mit weit aufgerissenen Augen. »Sie …, sie hasst mich«, flüsterte er.
Andrea wurde unsicher. »Eine Mutter hasst doch ihre Kinder nicht«, meinte sie.
Oliver widersprach ihr: »Mama liebt nur meine Schwestern. Daphne und Sophie – die beiden hat sie gern. Aber was mit mir passiert, ist ihr egal.«
Andrea überlegte. Alles, was der Junge ihr erzählt hatte, kam ihr unglaublich vor. Andererseits schien er völlig aufrichtig zu sein und wirklich Angst vor seiner Mutter zu haben. »Wenn ich nur wüsste, was ich tun soll. Ich muss mich mit Mutti beraten«, sagte sie mehr zu sich selbst.
»Was haben Sie jetzt vor? Was werden Sie mit mir machen?«, fragte Oliver ängstlich.
»Ich fahre mit dir nach Sophienlust und liefere dich dort ab«, entgegnete Andrea fröhlich. »Damit bist du fürs Erste versorgt.«
»Sophienlust?«
»Das ist ein Kinderheim«, erläuterte Andrea. »Es gehört meinem Stiefbruder Dominik. Seine Mutter, Frau von Schoenecker, verwaltet es für ihn.«
»Ach!« Mehr sagte Oliver nicht, aber er schien von der Idee, in ein Kinderheim gebracht zu werden, nicht besonders begeistert zu sein.
»Keine Sorge, es wird dir in Sophienlust gut gefallen. Bisher waren alle Kinder, die dort waren, glücklich und zufrieden«, ermunterte Andrea den Jungen. Wenn alles stimmte, was er ihr berichtet hatte – und die Habseligkeiten, die in seinem Leinentuch eingewickelt waren, bestätigten seine Geschichte –, so musste es sich bei Frau Drexler um eine Rabenmutter handeln. Das eigene Kind auf die Straße zu schicken, damit es sich andere Eltern suchen sollte! Andrea konnte über eine derartige Handlungsweise nur empört sein.
Andrea von Lehn brachte Oliver Drexler also nach Sophienlust und beschrieb ihrer Stiefmutter Denise von Schoenecker, die zum Glück trotz der vorgeschrittenen Stunde noch anwesend war, wo und wie sie den Jungen aufgelesen hatte.
»Ich bin über das Verhalten von Olivers Mutter richtig entsetzt«, schloss Andrea ihre Ausführungen. »Das muss eine schreckliche Frau sein. Findest du das nicht auch, Mutti?«
Denise war mit ihrem Urteil etwas vorsichtiger. »Ich möchte Frau Drexler erst kennenlernen, bevor ich mich festlege«, meinte sie. »Auf alle Fälle müssen wir sie davon unterrichten, dass Oliver sich hier bei uns befindet.«
Das sah Andrea ein. Schließlich durfte man nicht einmal eine Rabenmutter über das Schicksal ihres Kindes im Ungewissen lassen.
»Ich werde nachsehen, ob ich die Adresse von Olivers Eltern im Telefonbuch finde«, sagte Denise.
Andrea und Denise hatten sich in das Biedermeierzimmer zurückgezogen, nachdem sie Oliver mit den anderen Kindern sowie Schwester Regine und der Heimleiterin, Frau Rennert, bekannt gemacht hatten.
Schwester Regine hatte es übernommen, sich um Oliver zu kümmern und ihm alle Einrichtungen des Hauses zu zeigen. Der Junge hatte sich willig ihrer Führung anvertraut und zugelassen, dass sie sein Bündel ausgepackt hatte. Im Übrigen hatte er ziemlich müde gewirkt.
»Kein Wunder, wenn man bedenkt, was der arme Kerl durchgemacht hat«, fand Andrea, als Schwester Regine eintrat und berichtete, dass mit Oliver heute nichts anderes mehr anzufangen sei, als ihn zu Bett zu bringen.
»Seine Adresse muss er uns noch mitteilen, bevor er einschläft«, sagte Denise, während sie stirnrunzelnd im Telefonbuch blätterte. »Ich sehe gerade, dass es in Maibach sechs verschiedene Familien gibt, die Drexler heißen und einen Telefonanschluss besitzen. Weißt du eigentlich, ob in Olivers Zunamen ein ›x‹ oder ein ›ch‹ vorkommt?«, wandte sie sich an Andrea.
»Nein, ich habe keine Ahnung.«
»Nun, es würde mir auch wenig nützen. Zwei der Drexlers schreiben sich mit einem X, vier mit ch.«
Schwester Regine begab sich also noch einmal in Olivers Zimmer, um ihn nach seiner Adresse zu fragen. Schlaftrunken teilte er ihr diese und auch die Telefonnummer seiner Eltern mit. Da er sich jetzt sicher und gut aufgehoben fühlte, schien er nichts mehr dagegen zu haben, dass seine Mutter seinen Aufenthaltsort erfuhr.
*
Maria Drexler fuhr erschrocken hoch. Auf einem Küchensessel sitzend war sie kurz eingenickt, aber das Geschrei ihrer jüngeren Tochter hatte sie eben geweckt. So unglaublich es klang – Maria hatte keine Schwierigkeiten, die Stimmen der beiden Säuglinge auseinanderzuhalten, obwohl die beiden erst vor zwei Tagen drei Monate alt geworden waren.
Nun fiel Sophie in das Gebrüll ihrer Schwester ein. Maria blickte auf die Küchenuhr und seufzte. Kein Zweifel, die Zwillinge waren hungrig. Dabei sollten sie erst in einer Stunde die nächste Mahlzeit erhalten.
Maria beschloss, die Erziehung zur Pünktlichkeit noch eine Weile aufzuschieben. Sie holte Milch aus dem Kühlschrank und griff nach einem Löffel und einem Päckchen Babynahrung, um die Kindermahlzeit herzustellen.
Mit den fertigen Fläschchen betrat Maria das Schlafzimmer, wo die Babys in einem geräumigen Gitterbett lagen, das zusammen mit einer neu angeschafften Wickelkommode den letzten freien Platz des ohnehin nicht großen Raumes beanspruchte.
Maria nahm erst Daphne hoch und setzte sich mit ihr auf ihr eigenes Bett, um sie zu füttern. Daphne begann sofort gierig zu saugen, während Sophie unentwegt weiterschrie.
»Sei doch still, mein Püppchen, gleich bist du an der Reihe«, murmelte Maria. Doch das nützte wenig. Wenn Gerold nur endlich heimkommen und mir helfen würde, dachte Maria. Schließlich sind es auch seine Kinder. Aber seit die Mädchen auf der Welt sind, lässt er sich daheim kaum mehr blicken, und wenn er endlich spät abends kommt, fällt er ins Bett und schläft. Dann bin ich diejenige, die in der Nacht aufstehen und die Babys beruhigen muss.
Maria legte Daphne, die nun befriedigt vor sich hin gluckste, ins Bettchen zurück, und nahm Sophie heraus. Als Sophie ihr Fläschchen sah, verstummte augenblicklich ihr Gebrüll. Sie riss ihr Mündchen weit auf, um nach dem Schnuller zu schnappen.
»Na, na, sei nicht so gefräßig«, sagte Maria lachend. »Du tust ja so, als ob du halb verhungert wärst.«
Eigentlich könnte mir Oliver zumindest beim Füttern zur Hand gehen, fuhr es Maria durch den Sinn. Würde er jetzt Sophie das Fläschchen geben, könnte ich Daphne schon wickeln.
Maria rief nach ihrem Sohn. »Oliver, komm herüber ins Schlafzimmer!«
Stille. Nichts rührte sich. Dieser Lümmel!, dachte Maria. Wahrscheinlich spielt er mit seiner Autobahn und will mich nicht hören.
Nachdem sie ihre Töchter gesättigt und gewickelt hatte, ging sie wieder in die Küche. Daphne und Sophie schlummerten im Schlafzimmer satt und zufrieden, und auch Maria fielen beinahe die Augen zu. Doch ein Blick auf die Uhr belehrte sie, dass es Zeit war, für Oliver das Abendessen zu richten. Sie selbst verspürte keinen Hunger. Dazu war sie viel zu müde, und was Gerold betraf …
Auch über die Veränderung, die nach der Geburt der Zwillinge mit ihrem Mann vorgegangen war, wollte Maria sich jetzt nicht den Kopf zerbrechen. Mechanisch schnitt sie von dem Brotlaib zwei Scheiben herunter und bestrich sie mit Butter. Dann zögerte sie. Würde Oliver die Brote lieber mit Mettwurst oder mit Salami belegt haben? Der Junge war in letzter Zeit so schwierig, dass sie ihm einfach nichts recht machen konnte. Am besten war es wohl, ihn zu fragen, welche Wurst er bevorzuge.
Maria öffnete die Tür des Wohnzimmers. Draußen dämmerte es bereits, und das Wohnzimmer lag im Halbdunkel.
»Oliver! Warum drehst du das Licht nicht auf? Oliver! Schläfst du?«
Maria knipste das Licht an und sah sich in dem Raum um. Von ihrem Sohn war keine Spur zu entdecken.
»Oliver! Wo bist du? Versteckst du dich? Mach keine dummen Witze. Dafür habe ich im Moment gar nichts übrig!«, rief Maria ärgerlich aus. Doch sie erhielt keine Antwort.
»Na gut, dann gehst du eben hungrig …« Das Wort blieb Maria in der Kehle stecken. Sie wankte und griff sich an die Stirn. »Bin ich denn ganz verrückt geworden?«, murmelte sie tonlos. Soeben war ihr nämlich die unliebsame Szene, die sich am frühen Nachmittag in der Wohnung abgespielt hatte, eingefallen.
Oliver war vergnügt pfeifend aus der Schule gekommen. Aber das Mittagessen hatte seine gute Laune mit einem Schlag zunichte gemacht. »Muss es denn ausgerechnet Spinat geben«, hatte er gemault. »Du weißt doch, dass ich Spinat nicht ausstehen kann.«
Maria hatte sich bemüht, ihre aufkeimende Gereiztheit zu unterdrücken, und freundlich geantwortet: »Du kannst Verschiedenes nicht ausstehen. Das ist mir durchaus bewusst. Übrigens bin auch ich nicht gerade wild auf Spinat …«
»Warum kochst du ihn dann?«, hatte Oliver seine Mutter unterbrochen.
»Weil mein Wirtschaftsgeld leider nicht ausreicht, um jeden Tag Schnitzel oder Braten auf den Tisch zu stellen.«
»Daran sind nur die Babys schuld. Dauernd kaufst du Milch und Windeln und Salben und Puder – lauter unnützes Zeug. Früher ist es uns viel besser gegangen. Wir hatten genug Platz, und Papi ist jeden Tag zeitig heimgekommen.«
Damit hatte Oliver einen wunden Punkt berührt. Maria hatte keine Lust gehabt, dieses Thema mit ihrem Sohn durchzudiskutieren. Sie hatte nur kurz gesagt: »Schluss jetzt! Iss den Spinat, er wird dir schon schmecken. Daphne und Sophie waren ganz zufrieden damit.«
Das hätte sie jedoch lieber nicht sagen sollen. Oliver hatte angewidert seinen Teller weggeschoben und geschimpft: »Was, ich soll das gleiche Zeug wie die Babys essen?«