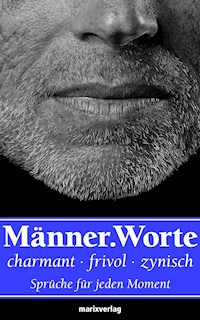14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Irrlicht
- Sprache: Deutsch
Der Liebesroman mit Gänsehauteffekt begeistert alle, die ein Herz für Spannung, Spuk und Liebe haben. Mystik der Extraklasse – das ist das Markenzeichen der beliebten Romanreihe Irrlicht: Werwölfe, Geisterladies, Spukschlösser, Hexen und andere unfassbare Gestalten und Erscheinungen erzeugen wohlige Schaudergefühle. Keine Leseprobe vorhanden. E-Book 1: Wenn Geister Rache üben… E-Book 2: Wenn Flitterwochen tödlich enden E-Book 3: Tränen der Angst E-Book 4: Tod in Blackhole Forest E-Book 5: Teufelskult auf Manderley E-Book 6: Wenn das Glück dem Tod begegnet…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 873
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Wenn Geister Rache üben…
Wenn Flitterwochen tödlich enden
Tränen der Angst
Tod in Blackhole Forest
Teufelskult auf Manderley
Wenn das Glück dem Tod begegnet…
Irrlicht – Jubiläumsbox 4 –E-Book 17-22
Diverse Autoren
Wenn Geister Rache üben…
… gibt es für den Frevler kein Erbarmen!
Roman von Celine Noiret
Silvia Pattern, vierundzwanzig Jahre jung, lebenslustig und normalerweise voller Schwung und Tatendrang, unterdrückte bereits etliche Male ein herzhaftes Gähnen. Sie beschloß, den Sender in ihrem Autoradio zu wechseln; bisher hatte sie mit halbem Ohr der ziemlich drögen Stimme eines so genannten »Experten für Liebes- und Ehefragen« zugehört.
Der Mann tat so, als wüßte er tatsächlich für alle Probleme eine Lösung – etwas, das ihm Silvia nicht so ohne weiteres abnahm. »Vermutlich ist er selbst schon dreimal geschieden«, brummte sie unwillig, ehe sie dem »Lebensberater« mitten im Wort den Saft abdrehte und einen Sender suchte, der Rock und Popmusik brachte, während sie gleichzeitig aus dem Augenwinkel heraus den zwar wunderschönen, aber gleichzeitig geheimnisvoll, ja sogar ein wenig unheimlich anmutenden Wald links und rechts beobachtete.
Sie konnte diesmal dem Gähnreflex nicht widerstehen, da sie vergangene Nacht sehr schlecht geschlafen hatte. Das war immer so, wenn sie am nächsten Tag »auf Tour« war. Obwohl sie ihren Job bereits seit zwei Jahren zur großen Zufriedenheit ihrer beiden Chefs in Düsseldorf erledigte und ihr die Arbeit Spaß machte, war sie in der Nacht davor jedes Mal schrecklich aufgeregt. Die Nervosität legte sich im Normalfall, sobald sie angelangt war und sich konkret auf die Suche begeben konnte.
Aber noch war es nicht so weit.
Das schlanke Mädchen mit den schulterlangen aschblonden Haaren, war, aus Aachen kommend, mit ihrem kleinen roten Peugeot auf die belgische Route Nationale gelangt und näherte sich einer Kreuzung.
»Aha, da ist es ja«, murmelte sie zufrieden, als sie das Schild »St. Pierre sur Roc, 10 Kilometer« las.
Sie bog nach rechts ab und drehte das Radio um eine Idee leiser. Es war kurz nach vier Uhr nachmittags an einem prächtigen, milden Herbsttag, Mitte September. Es war einer jener traumhaft schönen Tage, voll Erinnerung an den vergangenen heißen Sommer, aber ohne dessen verzehrende Glut, dafür mit der Verheißung von Reife und Fülle, mit einem Himmel wie lichtblaue Seide, ohne ein Wölkchen und ohne den geringsten Windhauch, jedoch mit dem betäubenden Geruch nach Erde, Wald und Gras.
›Wenn ich Glück habe, dauert das wunderschöne Wetter noch etliche Tage lang an; und es müßte schon mit dem Teufel zugehen, wenn ich nicht fündig würde‹, ging es Silvia Pattern, deren korrekte Berufsbezeichnung »Adventure Scout« lautete (was bei weitem nicht so
holprig klang wie das deutsche »Abenteuerpfadfinderin«), durch den Kopf, als sie in das schmale Sträßchen eingebogen war.
Als der Weg plötzlich ziemlich steil anstieg, schaltete sie nochmals einen Gang herunter. Das hatte den Vorteil, daß das Getriebe geschont wurde und daß sie sich bei dem geringen Tempo in aller Ruhe die Gegend anschauen konnte.
Links und rechts der kurvenreichen Fahrstraße erhob sich eine kleine Böschung mit reichem Wildblumenbewuchs zwischen den Schlehdornbüschen und Heckenrosen, während sich dahinter der Hochwald ausbreitete.
Es schien ein gesunder Mischwald zu sein aus verschiedenen Nadelbäumen, abwechselnd mit Birken, Eichen, Buchen und Ebereschen, deren Beeren in einem strahlenden Rotorange durch das noch grüne Laub schimmerten.
»Schätze, daß dies der besagte Gemeindewald von ›St. Pierre sur Roc‹ ist«. Die hübsche junge Fahrerin war jetzt hellwach und schon mächtig gespannt auf dieses ganz versteckt liegende belgische Städtchen ›St. Peter auf dem Felsen«.
Die smarte Düsseldorferin arbeitete für die Agentur »Managing and Training Agency«, kurz MATA genannt, und als »Adventure Scout« oblag es ihr, geeignetes Gelände zu finden, um es Führungskräften aus Wirtschaft, Politik und Industrie, welche Erholung und Entspannung gepaart mit Abenteuer suchten, zu ermöglichen, ein sogenanntes »Überlebenstraining« in freier Natur zu praktizieren.
Es kam durchaus nicht jeder Wald dafür in Frage – nein, die Anforderungen an einen solchen Fleck Natur waren sogar ziemlich hoch. MATA konnte es sich nicht leisten, frustrierte Kunden zu haben, die halb verhungert und verdurstet regelrecht »aus der Wildnis« flohen und sie womöglich anzeigten und Schadenersatz verlangten.
Die Herren mit der wohlgefüllten Brieftasche wollten zwar das Gefühl haben, »Abenteurer« zu sein – in jedem von denen steckte ein kleiner Junge, der Robinson Crusoe spielen wollte, aber irgendwo waren auch Grenzen. Der Wald, in dem sie sich etwa eineinhalb Wochen lang aufhalten und selbständig ernähren sollten, mußte tatsächlich die Möglichkeiten bieten, sich eine Unterkunft aus primitiven Mitteln zu bauen, sowie auf relativ einfache Weise an Nahrung zu gelangen.
Vielen Gemeindevorstehern und Stadtvätern hatte Silvia zu deren bitterer Enttäuschung schon Absagen erteilen müssen. Der übliche Stangenwald aus schnell wachsenden Fichten, wie er in Deutschland leider noch üblich war – ohne Unterholz und bar aller Sträucher –, war schlichtweg zu kümmerlich.
Keine Nüsse, keine Bucheckern, keine Beeren, keine Pilze; kein noch so kleines Bächlein oder winzige Quelle mäanderte durch moosigen Grund und fiel somit als Frischwasserreservoir flach. Und was die Möglichkeit anbetraf, etwa ein Eichhörnchen oder ein Kaninchen mittels einer selbst gebastelten Schlinge, beziehungsweise mit einer Steinschleuder zu erlegen – ebenfalls Fehlanzeige.
»Wir kommen leider nicht ins Geschäft«, hatte Silvia den Herren gesagt, welche gemeint hatten, durch diese interessanten »Überlebenscamps« als Ferienorte auch für andere Erholungssuchende bekannt zu werden. Aber so lief es nun mal nicht.
Jedoch dieses Städtchen in den Ardennen auf einer etwa sechshundert Meter hohen Hochfläche in wahrhaft traumhafter Landschaft gelegen – das Wenige, was die junge Frau bisher gesehen hatte, erschien ihr sehr viel versprechend – könnte dieses Mal ein Volltreffer zu sein.
›Mal sehen, wie der Bürgermeister sich dazu stellt‹, überlegte sie. Aber meistens waren diese Herren nicht das Problem…
»Liebe Güte, hören denn die Kurven überhaupt nicht mehr auf?«
Silvia hatte ihren Wagen immer mehr verlangsamt; sie fuhr zudem äußerst rechts und hoffte, daß ihr kein anderes Fahrzeug auf der schmalen Straße entgegenkam. Sie sehnte jetzt das Ende der Fahrt herbei.
Plötzlich erkannte sie rechts vorne in beunruhigend großer Nähe eine seltsame Bewegung im Wald. Es schien beinahe so, als brauste auf einmal ein Sturmwind durch die Baumwipfel, so daß die Äste einer Anzahl alter Baumriesen heftig ins Schwanken gerieten.
Gerade als Silvia erneut vom Gas ging, legte sich der annähernd orkanartige Sturm, alle Bäume beruhigten sich wieder – bis auf einen, eine dicke Tanne nämlich, die mit einem geradezu ohrenbetäubendem Getöse quer über die Straße krachte und einer Bahnschranke gleich den Weg versperrte.
Silvias Notbremsung erfolgte automatisch; sie kam etwa einen halben Meter vor dem Baumstamm zum Stehen. daß sie laut geschrieen hatte, kam ihr überhaupt nicht zu Bewußtsein, aber daß sie nun zitterte wie Espenlaub, blieb ihr natürlich nicht verborgen.
»Oh, mein Gott«, flüsterte sie, »wenn dieses Monstrum von Baum mein Auto erwischt hätte, wäre es jetzt platt wie eine Flunder – und ich auch.«
Sie schaltete den Motor aus und stieg nach einer Weile, als sie sich wieder ein wenig beruhigt hatte, aus ihrem Auto aus, um sich das unerwartete Hindernis genauer zu betrachten.
Etwa einen halben Meter über dem gewaltigen Wurzelstock war die Tanne einfach abgebrochen, wobei Silvia die Bruchstelle äußerst merkwürdig vorkam: keineswegs so zersplittert, wie es oft bei einem schweren Sturm und morschen Bäumen vorkam, sondern ziemlich glatt und vor allem: der Baumstamm war innen kerngesund!
›Es bestand überhaupt kein Grund dafür, daß die Tanne umgefallen ist‹, dachte Silvia Pattern verblüfft. ›Wenn wir jetzt schon so weit sind mit den Umweltschäden, daß vollkommen intakte Bäume, ohne Fäulnisschäden oder Wurm- und Käferfraß, einfach mir nix, dir nix umkippen, dann gute Nacht!‹
Auch die Nadeln der Tanne zeigten frisches Grün, die Äste und Zweige erschienen voller Saft und Silvia konnte nur den Kopf schütteln – und sich dazu gratulieren, daß sie nicht ein klein wenig schneller gefahren war…
Aber nun hatte sie ein weiteres Problem: sie konnte das Hindernis seitlich nicht umfahren. Sie mußte versuchen, auf der schmalen Straße zu wenden und dann zurückfahren zur Kreuzung und von da aus einen anderen Zugang zum Ort finden.
›Viele Wege führen nach Rom, sagt man; da werden wenigstens zwei auch nach St. Pierre sur Roc führen.‹
Nachdem sie ihren kleinen Peugeot nach einem halben Dutzend Wendemanövern in die richtige Fahrtrichtung platziert hatte, fuhr die junge Frau retour zur Kreuzung, an der sie vor einiger Zeit schon einmal abgebogen war, fädelte sich erneut in die Route Nationale ein, in der Hoffnung, eine weitere Abzweigung in das Städtchen zu finden.
Als erstes würde sie dann den Vorfall mit der umgestürzten Tanne auf der Polizeistation melden.
*
Monsieur André Lacourbe, das fünfundfünfzigjährige Stadtoberhaupt von St. Pierre sur Roc tobte in seinem Amtszimmer in der »Mairie«, dem Bürgermeisteramt der Stadt, herum.
Gerade hatte er von der Abholzfirma »Adolphe Mahonney« eine Absage bekommen und seine Sekretärin, Mademoiselle Ginette Balanche, mit ihren neununddreißig Jahren ein »spätes« Mädchen und angeblich hinter ihrem verwitweten Chef her, guckte ihn an wie ein verschrecktes Huhn.
Das tat sie immer, wenn André Lacourbe sich lautstark aufregte und dann meistens seinen Unmut an ihr ausließ.
»Was denken sich diese Brüder eigentlich?« brüllte der Bürgermeister, nachdem er den Hörer seines Amtstelefons aufgeknallt hatte. Er war so rot im Gesicht wie ein gekochter Hummer und Ginette befürchtete schon, es könnte ihn der Schlag treffen.
»Was haben die Mahonney-Leute denn gesagt, Monsieur?« erkundigte sie sich schüchtern.
»Gesagt, gesagt! Dieser Ignorant von einem Juniorchef hat mir mitgeteilt, daß sie in der nächsten Zeit die geplante Fällaktion im Gemeindewald nicht durchführen könnten, weil sie erst ihre anderen, bereits zugesagten Aufträge abarbeiten müßten! Das hat der arrogante Schnösel mir eiskalt ins Gesicht gesagt!«
»Ach so.« Ginette atmete auf. »Nun, das hört sich doch ganz vernünftig an, Monsieur. Sie müssen eben die Arbeiten der Reihe nach durchführen, so wie sie sie angenommen haben. Außerdem: soo furchtbar eilig ist es uns doch nicht, oder?«
Lacourbes Zorn wandte sich jetzt umgehend gegen seine unscheinbare Untergebene.
»Sie sind doch …«
Gerade konnte sich der Gemeindevorsteher noch bremsen, ehe er etwas gesagt hätte, was ihm sogar die gutmütige Ginette Balanche übel genommen hätte. Die alte Jungfer verteidigte ihren Chef zwar eisern gegen alle Kritiker in der Stadt, aber beleidigen ließ sie sich von ihm auf keinen Fall – trotz ihrer unbestreitbaren Sympathien für den immer noch attraktiven Witwer.
»Mademoiselle Ginette, Sie sind einfach zu gut für diese schlechte Welt! Ihnen fehlt das Gespür für alles Hinterhältige im Leben. Meine Nase hingegen« – und er tippte dabei an sein ziemlich mächtiges Riechorgan – »schnuppert Verrat schon aus meilenweiter Entfernung, während Ihr entzückendes Näschen nichts davon wahrnimmt – selbst wenn der Misthaufen meterhoch direkt vor dem Rathaus liegen sollte.«
»Ich verstehe Sie nicht, Monsieur!«
Hilflos zuckte Ginette die Schultern, aber das »Näschen« für ihre etwas zu lang und spitz geratene Nase hatte sie jedenfalls umgehend versöhnt.
»Schauen Sie, Mademoiselle Ginette, das liegt doch auf der Hand. Diese Abholzfirma steckt mit unseren Feinden im Stadtrat unter einer Decke! Ich glaube diesen Kerlen kein Wort, von wegen ›anderen Aufträgen, die angeblich Vorrang haben‹. Welchen Großauftrag sollten die denn schon haben, frage ich Sie? Vielleicht in Südamerika am Amazonas oder im Kongo? In Belgien jedenfalls nicht! Und wenn sie zu wenige Leute haben, sollen sie gefälligst Holzfäller einstellen, ehe sie versuchen, mich für dumm zu verkaufen.«
»Aber, wieso? Was hätte ›Alphonse Mahonney« davon, wenn er uns absichtlich hängen läßt?« Die Sekretärin blieb hartnäckig und blickte ihren Chef verständnislos an.
Monsieur André warf die Arme zum Himmel, zuckte mit den Achseln und meinte:
»Vielleicht hat man sie geschmiert – was weiß denn ich? Sie wissen, meine Liebe, daß mir und meinen Freunden im Stadtrat viel daran liegt, möglichst zügig mit der Fällaktion zu beginnen, um die geplanten Bauarbeiten an den neuen Projekten schnell zu verwirklichen. Je länger nun gezögert wird, umso mehr Zeit bleibt unseren Gegnern, weitere Verbündete zu finden und vor allem die Schwankenden auf ihre Seite zu ziehen.«
»Aber, Monsieur, der Stadtrat hat doch neulich mehrheitlich entschieden…«
»Ja, ja, ja! Das weiß ich, Teuerste (der Bürgermeister war darauf bedacht, ihr zu schmeicheln – was täte er denn ohne sie?), aber so lange noch kein Axthieb erfolgt ist, kann diese äußerst wacklige Mehrheit immer noch kippen und dann wäre Essig mit unseren schönen Plänen. Kein Flughafen, kein Erlebniscenter, kein Hotel!«
»Oh, Monsieur le Maire, das müssen Sie natürlich unbedingt verhindern!« Aufgeregt flatterte Mademoiselle Ginette, eine kleine hagere Person, um den ziemlich beleibten Bürgermeister herum. »Das wäre ja eine Katastrophe!«
Wie viele andere Befürworter des ehrgeizigen Bauprojektes wollte sie ihr sauer Erspartes in die Errichtung des Flugplatzes und des Vergnügungsparks investieren und hoffte dabei auf beste Rendite.
»Deswegen müssen diese Holzköpfe endlich spuren und unverzüglich anfangen, den Gemeindewald abzuholzen, damit Tatsachen geschaffen sind, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Sonst funken uns die so genannten ›Naturschützer« noch gewaltig dazwischen, wenn die erst einmal gemerkt haben, wie groß die Fläche überhaupt sein wird, die wir für den Fortschritt zu opfern bereit sind«, meinte er hochtrabend. »Verstehen Sie jetzt meine Ungeduld, Teuerste?«
»Oh, ja, Monsieur!«
Ginette war eben erst klar geworden, daß der gewiefte Bürgermeister vor der Abstimmung im Stadtrat offensichtlich nicht mit der ganzen Wahrheit herausgerückt war. Recht hatte er!
»Sie müssen diese Firma unbedingt irgendwie dazu zwingen, so bald wie möglich anzufangen. Vielleicht würde eine höhere Summe sie geneigter stimmen…«
»Pah! Von wegen! Ich werde den Brüdern mit einer Klage wegen Schadensersatz drohen und zwar in dreistelliger Millionenhöhe und …«
Mehr konnte die treue Seele Ginette leider nicht verstehen, denn das Telefon auf ihrem Schreibtisch hatte geklingelt und sie stöckelte eilig aus dem pompösen Eckzimmer ihres Chefs in ihr vergleichsweise bescheidenes Reich, um den Anruf entgegen zu nehmen.
›Hoffentlich keine neue Hiobsbotschaft‹, dachte Ginette noch. Falls es sich die Behörden in Brüssel noch einmal überlegen sollten und die zugesagten erheblichen Zuschüsse für den Flughafen streichen würden – immerhin zig Millionen Euro – wäre das vermutlich der Anfang vom Ende aller hochfliegenden Pläne der »Fortschrittlichen« in St. Pierre.
Das vollkommen unbedeutende Städtchen würde weiter vor sich hindämmern und irgendeine andere Gemeinde, in der es nicht so viele »naturfreundlich« Gesinnte gab, würde mit Kußhand den Reibach machen.
*
Silvia Pattern gelangte auf einem Umweg von zirka fünfzehn Kilometern in den gesuchten Ort und landete direkt auf dem Marktplatz in der Mitte von St. Pierre sur Roc.
Sie stieg aus, streckte sich erst einmal und schaute sich dann interessiert um. Ihre Müdigkeit war seit dem Zwischenfall mit dem Baum wie weggeblasen. Sie hatte genau vor dem Hotel »Le Cerf Bleu« – dem »Blauen Hirschen« also – geparkt.
»Nicht schlecht«, murmelte das junge Mädchen vor sich hin, »unsere gestreßten Manager werden es begrüßen, nach eineinhalb Wochen ›Leben in Gottes freier Natur‹ die Gemütlichkeit eines belgischen Kleinstädtchens mit Flair zu genießen.«
Doch, ja, dieser Ort schien Silvia durchaus geeignet für die Ansprüche ihrer verwöhnten Klientel.
Einige Momente lang dachte sie unvermittelt an Stefan Dormagen, ihren langjährigen Beinaheverlobten, von dem sie sich vor einiger Zeit – in aller Freundschaft – getrennt hatte.
Es war eine »Sandkastenliebe« gewesen, welche die beiden verbunden hatte und irgendwann war »die Luft raus« und die Liebe verflogen; aber geblieben waren eine tiefe Freundschaft, sowie eine echte Kameradschaft. Silvia wußte, daß sie sich auf Stefan, einen fünfundzwanzigjährigen Pharmaziestudenten, stets würde verlassen können.
›Stefan würde es hier auch gefallen‹, dachte sie, als sie den Mittelpunkt dieses niedlichen Fachwerkstädtchens betrachtete. Alles, was ein Gemeinwesen benötigte, war um einen alten, blumengeschmückten Marktbrunnen aufgereiht: das Rathaus (als »Mairie« gekennzeichnet), eine barocke Stadtpfarrkirche, die Polizeistation, der Gemeindesaal, ein kleines Kaufhaus, sowie Metzger- und Bäckerladen plus kleinem Café, dazu ein »Magasin d’ Alimentation«, also ein Lebensmittelladen.
Silvia entdeckte zu ihrem Entzücken neben dem »Blauen Hirschen«, in welchem sie beabsichtigte ein Zimmer zu nehmen, einen Bücherladen, der auch Zeitschriften und Ansichtskarten verkaufte, sowie ein winziges Antiquitätengeschäft.
›Dem werde ich einen ganz besonders intensiven Besuch abstatten, sobald es meine Zeit erlaubt‹, nahm die junge Frau sich vor. Sie liebte es geradezu, zwischen alten Bildern, Lampen, Schmuck und Möbeln herumzustöbern.
Auf diese Weise hatte sie schon das eine oder andere Juwel für ihre schnuckelige Jungesellinnenwohnung erstanden, um die sie von ihren Freundinnen glühend beneidet wurde. Sie selbst hätte es allerdings vorgezogen, wenn ihr Auszug aus Stefan Dormagens geräumiger und urgemütlicher Altbauwohnung nicht nötig gewesen wäre. Aber gleichzeitig wußte sie, daß dieser harte Schnitt das Richtige gewesen war…
Sie riß sich beinahe gewaltsam los von dem attraktiven Anblick, den der Ortskern dieses Städtchens bot. Als erstes lenkte sie ihren Schritt zur Gendarmerie, wo sie den Vorfall mit dem umgestürzten Baum zu Protokoll gab. Der Dienst habende Beamte – ein Schild auf seinem Schreibtisch wies ihn als Jean-Pierre Lacourbe, Leiter der Dienststelle, aus – nahm sich mit Eifer dieses Falles an.
Der junge Mann – Silvia schätzte ihn um die dreißig – schien allerdings mehr an ihr, als an der Beinahekatastrophe interessiert zu sein. Als sie jedoch ihre Beobachtungen genau schilderte und davon sprach, daß es ihrer Ansicht nach keinen vernünftigen Grund für einen Sturz der Tanne gegeben hatte, wurde er stutzig.
»Ich werde dieser Sache sofort persönlich nachgehen«, versprach er, »sowie die Feuerwehr alarmieren, daß sie das Hindernis von der Straße räumt, ehe noch jemand dagegen knallt.«
Dann dankte er ihr geradezu überschwenglich, ehe er die Frage riskierte, ob sie längere Zeit in der Stadt zu verbringen gedachte. Es war nicht zu übersehen, daß er sich das erhoffte. Aber ehe er sie einladen konnte, machte Silvia ihm klar, daß sie zum Arbeiten hierher gekommen war und nicht zum Urlaubmachen.
Im gleichen Atemzug fragte sie ihn, ob er wüßte, wann der Bürgermeister von St. Pierre sur Roc zu sprechen wäre. Dies entlockte dem jungen Mann ein strahlendes Lächeln.
»Oh! Mademoiselle möchte zu meinem Vater? Welch’ ein Zufall! Heute sitzt er zwar nicht mehr in seinen Amtsräumen, aber morgen früh ab neun Uhr wird er für Sie da sein, Mademoiselle Pattern.«
Silvia, die genau gemerkt hatte, daß ihr Gegenüber vor Neugierde beinahe platzte, dachte nicht im Traum daran, ihm den Gefallen zu tun und ihr Anliegen vor ihm auszubreiten. Sie fand, es wäre besser, zu gehen, um nicht noch Öl aufs Feuer zu gießen. Für ihren Geschmack hatte der oberste Ordnungshüter von St. Pierre nämlich ein wenig zu schnell Feuer gefangen…
*
Der Besitzer des »Cerf Bleu« bemühte sich höchstpersönlich um den neu angekommenen, weiblichen Gast. Monsieur Gaston Rienne, der einundfünfzig Jahre alte Hotelier, war sehr angetan von der aparten Deutschen.
Als sie auf Befragen erwiderte, vorerst würde sie nur drei Tage bleiben wollen, schien er ein wenig enttäuscht zu sein: so charmante Gäste wünschte er sich eigentlich das ganze Jahr über.
»Es ist jetzt sehr ruhig bei uns«, meinte er bedauernd, »wenn der Sommer vorüber ist, ist gewöhnlich bis Weihnachten so ziemlich Schluß mit Übernachtungsgästen.«
»Das könnte sich möglicherweise demnächst ändern, Monsieur Rienne«, kündigte Silvia ein wenig voreilig an und erregte damit sofort die größte Aufmerksamkeit des smarten Geschäftsmannes.
Kurz informierte ihn die hübsche Deutsche über ihr Vorhaben und der Hotelier schien entzückt.
»Ach? Sie wollen uns wirklich deutsche Herren nach St. Pierre sur Roc bringen, welche das primitive Leben in unseren Wäldern ausprobieren und sich anschließend von den Segnungen der Zivilisation wieder verwöhnen lassen wollen? Eine geradezu grandiose Idee, Mademoiselle Pattern! Sie hätten für Ihr Vorhaben gar keinen besser geeigneten Ort als den unseren finden können.«
»Beinahe hätte ich ihn überhaupt nicht gefunden, Monsieur«, lächelte Silvia und erzählte dem Gastwirt, welcher eigenhändig ihr Gepäck in den ersten Stock hievte, von ihrem erschreckenden Erlebnis mit der unvermittelt umstürzenden Tanne, die jetzt quer über der Straße lag und die Zufahrt zum Ort blockierte.
»Mon Dieu! Eine Katastrophe!« rief der lebhafte Monsieur Rienne aus, welcher Silvia sehr stark an Hercule Poirot, den cleveren Detektiv aus Agatha Christies Kriminalromanen, erinnerte.
»Ich werde sofort die Gendarmerie verständigen, sowie unsere Jungs von der Feuerwehr, damit sie das Hindernis beseitigen«, kündigte er an, nachdem er das Zimmer für die attraktive Demoiselle aus dem Nachbarland aufgesperrt hatte.
»Schon erledigt, Monsieur. Ich war bereits bei der Polizei«, beruhigte ihn Silvia, als Herr Rienne ihren Koffer abstellte. Offenbar imponierte dem Mann die Umsicht seines weiblichen Gastes. Er lächelte breit.
»Voila! Hier ist Ihr Zimmer mit Bad und Balkon. Der Blick geht auf den Marktplatz hinaus. Da sieht man mehr und kann das Leben und Treiben besser beobachten, vor allem am Samstag, wenn Markttag ist und alle Bauern aus der Umgebung zu uns kommen und ihre Agrarprodukte anpreisen. Oder hätten Sie es lieber ganz ruhig und ein Zimmer nach hinten hinaus? Unser Innenhof ist ebenfalls sehr hübsch mit lauschigen Lauben und vielen Pflanztrögen…«
»Oh, nein, Monsieur Rienne! Ich mag das lebhafte Markttreiben. Dieses Zimmer ist geradezu perfekt für meinen Geschmack«, rief Silvia, welche nach einem raschen Blick ins moderne Duschbad zurück zur Balkontür geeilt war, diese aufriß und hinaustrat, um den Stadtmittelpunkt von erhöhter Warte aus in Augenschein zu nehmen.
»Ab sieben Uhr können Sie unten im Hotelspeisesaal zu Abend essen, Mademoiselle. Unsere Küche ist weithin berühmt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und viel Erfolg bei Ihrer Suche nach einem geeigneten Waldstück für Ihre Robinsone aus Deutschland.«
»Merci beaucoup, Monsieur«, bedankte sich Silvia, die vom Balkon wieder ins Zimmer getreten war und machte sich an ihrem Gepäck zu schaffen. Sie haßte es nämlich, »aus dem Koffer zu leben«. Sobald sie ein Hotelzimmer bezogen hatte, räumte sie als erstes ihre Sachen in die Schränke und Schubladen ein.
Kurz vor dem Verlassen ihres Hotelzimmers mit der Nummer sieben, drehte der Hotelier sich noch einmal um:
»Daß ohne den geringsten Windstoß ein solcher Baumriese einfach umkippt, ist schon sehr schwer zu begreifen.«
Monsieur Gaston Rienne schüttelte ratlos den Kopf und zuckte die breiten Schultern. Dann meinte er: »Ich bin gespannt, was unser Feuerwehrkommandant dazu sagen wird. Unseren Bürgermeister aber wird’s auf jeden Fall freuen, wenn ihm die Bäume den Gefallen tun und von selbst umfallen.«
Silvia horchte auf, aber der Gastwirt des »Blauen Hirschen«, dem zu dämmern schien, daß er bereits zu viel gesagt haben könnte, kniff jetzt die Lippen zusammen, murmelte »à bientôt (auf bald), Mademoiselle«, und verschwand auf einmal ganz eilig.
Monsieur Rienne schalt sich im Geiste einen Idioten. Am liebsten hätte er sich auf die Zunge gebissen. Welcher Teufel hatte ihn nur geritten, daß er jetzt davon anfing? Er konnte nur hoffen, daß die Deutsche nicht so gut französisch verstand, sonst würde sie gewiß so bald wie möglich das Weite suchen.
*
›Nanu?‹ fragte sich Silvia einigermaßen verblüfft. Was konnte der Hotelier nur damit gemeint haben? Wieso sollte der Bürgermeister sich freuen, wenn die Bäume umknickten? Sie sprach zwar recht gut französisch – glaubte sie jedenfalls bisher – aber jetzt zweifelte sie doch daran, denn dieser Satz ergab für sie gar keinen Sinn. Der Maire einer – wenn auch noch so kleinen Gemeinde – mußte seine fünf Sinne beisammen haben und konnte kein Spinner sein, der sich an Katastrophen delektierte. Na, in Kürze würde sie den Herrn ja selbst kennenlernen...
Routiniert räumte sie ihre Kleidung in den geräumigen Schrank ein. Ein kurzer Blick auf ihre Armbanduhr – ein Geschenk von Stefan zu ihrem letzten Geburtstag im Sommer – sagte ihr, daß es erst kurz nach fünf Uhr nachmittags war, also waren es noch zwei ganze Stunden bis zum Abendessen.
Sie würde in die Stadt gehen und sie genauer erkunden. Sicher fand sie in einem Geschäft einen Ortsplan, der ihr vor allem die Wälder und die verschiedenen Wege darin aufzeigte.
*
Der zweistündige Spaziergang hatte das junge Mädchen sehr hungrig gemacht; außer einem reichlichen Frühstück daheim und einer Banane zu Mittag hatte sie heute noch nichts zu sich genommen; infolgedessen freute sie sich auf das Abendessen. Da sie keineswegs unter Gewichtsproblemen zu leiden hatte, würde sie tüchtig zugreifen.
Der Speisesaal im Erdgeschoß des »Cerf Bleu« ging auf den Stadtplatz hinaus; er war reichlich mit Grünpflanzen und blühenden Blumen in Kübeln ausgestattet und erschien jetzt, im dämmerigen Schein gedämpften Lampenlichtes und zahlreicher Kerzen auf den mit weißem Damast gedeckten Tischen sehr heimelig und romantisch.
Unwillkürlich schweiften Silvias Gedanken zu Stefan, aber geschwind schob sie diese beiseite; dafür tauchte vor ihrem geistigen Auge jetzt das gut aussehende Gesicht des Polizeikommissars auf. Sie hatte seine kecken, dunklen Augen, die sie so bewundernd angestarrt hatten, keineswegs vergessen…
Aber auch diesen Gedanken ließ sie sofort in der Versenkung verschwinden. Dieser Jean-Pierre Lacourbe schien ein rechter Windhund zu sein. Wahrscheinlich war er hinter jedem Weiberrock her und sie wäre gut beraten, ihn gar nicht mehr zu beachten…
Ein freundlicher älterer Kellner komplimentierte Silvia an einen Ecktisch am Fenster, von wo aus sie sowohl auf die abendliche Stadt, wie auf den Speisesaal einen ausgezeichneten Blick hatte. Zum Glück war der Gastraum keineswegs so menschenleer, wie Silvia befürchtet hatte.
Nichts empfand die junge Frau so trostlos wie gähnend leere Speisesäle. Aber der »Blaue Hirsch« schien sich auch bei der einheimischen Bevölkerung großer Beliebtheit zu erfreuen. Ein gutes Zeichen für seine Qualität fand Silvia – und sie hatte diesbezüglich reichlich Erfahrung.
Monsieur Gaston Rienne hatte sich am Abend einen schwarzen Smoking angezogen, ähnelte mehr denn je Hercule Poirot und ging von Tisch zu Tisch, um »die honneurs zu machen«. Mit jedem einzelnen Gast wechselte er ein paar liebenswürdige Floskeln. Das Publikum, meist ältere Paare, waren gut angezogen und Silvia war dankbar dafür, daß sie die Eingebung gehabt hatte, sich ebenfalls für diesen Abend ein wenig »aufzubrezeln«.
Nicht zu sehr natürlich, aber genügend, um nicht unangenehm aufzufallen. Dies war entschieden kein Haus, wo man sich in Jeans und Sweatshirt an der Abendtafel niederließ. Ebenfalls ein Pluspunkt für ihr Vorhaben, wie sie fand:
Oftmals war es so, daß die Ehefrauen oder Freundinnen der Herren, welche zehn Tage »in der Wildnis« verbrachten, ihre Männer in angenehmer und »zivilisierter« Umgebung erwarteten, um mit ihren Liebsten anschließend noch ein paar Tage in einem gewissen Luxus zu verbringen.
Sie spitzte die Ohren, als sie am Nebentisch einen Gast – offenbar einen Bürger St. Pierres – ziemlich laut sagen hörte:
»Gabrielle, bitte glaube mir, ich höre in meinem Garten wirklich diese Stimmen, welche nur von den Bäumen kommen können. Sie jammern regelrecht: ›Gnade für uns! Gnade für uns!‹ Ich bilde mir das doch nicht ein!«
Die junge Deutsche hätte sich um ein Haar an ihrem französischen Rotwein verschluckt. Eigentlich sah der distinguierte, ältere Herr, der in Begleitung einer mit Schmuck behängten, nicht mehr ganz jungen Dame erschienen war, doch ganz normal aus…
Monsieur Rienne, der sich ihr gerade zugewandt hatte, um zu fragen, ob alles zu ihrer Zufriedenheit wäre, hatte bemerkt, daß sie die Worte des Gastes vom Nebentisch verstanden hatte; er rollte heimlich mit den Augen und lächelte dabei entschuldigend.
Silvia vermutete, daß er sich am liebsten an die Stirn getippt hätte… Sie vergaß den kleinen Vorfall umgehend, lobte die Küche des Hotels und widmete sich weiter ihrem Abendessen, einem ausgezeichneten »Coq au vin«; als Dessert würde sie sich eine geradezu göttliche Crème brûlée leisten.
Die überzähligen Kalorien könnte sie am nächsten Tag mit Leichtigkeit durch ihren Marsch durch die umliegenden Wälder wieder loswerden.
Ehe sie ziemlich früh zu Bett ging, telefonierte sie noch rasch mit einem ihrer beiden Chefs, um ihm Mitteilung zu machen, daß sie mit beinahe hundertprozentiger Sicherheit ein geeignetes Terrain gefunden hätte, um streßgeplagte Manager für viel Geld der Illusion auszusetzen, für etwa zehn Tage wie weiland Robinson Crusoe mutterseelenallein und ohne irgendwelche technische Erfindungen – wozu beispielsweise auch Streichhölzer zählten – für ihr Überleben selbständig sorgen zu können.
»Ich habe mich während eines Spaziergangs durch den Ort mit verschiedenen Leuten unterhalten und was ich über die Möglichkeiten, in den hiesigen Wäldern für ein paar Tage leben zu können, erfahren habe, klingt geradezu sensationell, Herr Steigleder«, meldete sie ihrem Juniorchef.
Steigleder senior hatte vor zehn Jahren bereits die Idee zu solchen Überlebenscamps gehabt und inzwischen war dies der Renner geworden.
Silvia hatte beinahe ein schlechtes Gewissen, weil sie so schamlos übertrieb. In Wirklichkeit hatte sie – von einem vagen, ersten Eindruck einmal abgesehen – überhaupt keine Gewißheit, ob dieses St. Pierre sur Roc in Frage käme.
»Vergessen Sie ja nicht, zum Bürgermeister dieses Kaffs zu gehen und Bescheid zu geben, daß Sie in den nächsten beiden Tagen die Gegend unsicher machen wollen. Es ist zu Ihrem eigenen Schutz! Falls Sie im Wald verunglücken sollten, wüßte sonst kein Mensch, wo er nach Ihnen suchen sollte und außerdem erfahren Sie auf diese Weise, wo eventuell gejagt wird.«
Das sagte er jedes Mal und Silvia unterdrückte ein Gähnen. Als ob sie das nicht selber wüßte!
»Klar, Chef«, beruhigte sie den Junior, »das mache ich doch immer.«
Florian Steigleder brummte etwa, was wohl ein Lob für ihre Findigkeit und Umsicht sein sollte und wünschte ihr noch einen schönen Abend.
Silvia Pattern legte auf, um noch einmal auf den Balkon zu gehen. Die Bewohner von St. Pierre – diesem »Kaff«, wie ihr Chef es genannt hatte – schienen tatsächlich mit den Hühnern schlafen zu gehen. Kurz nach neun Uhr abends war der Marktplatz bereits wie leergefegt.
Da der Abend lau war, ließ sie die Balkontür offen. Bald darauf war die junge Frau eingeschlafen.
*
Im Wald auf dem Pic Noir, der höchsten Erhebung der Gegend um St. Pierre sur Roc, herrschte in dieser lauen, sternklaren Nacht gewaltiger Aufruhr. Falls sich allerdings Menschen dort aufgehalten hätten, hätten sie davon gar nichts wahrgenommen.
Unhörbar für menschliche Ohren planten die Waldbewohner den Aufstand. Die Geister – welche in jedem Baum lebten – hatten von dem perfiden Vorhaben erfahren, ihre Heimstatt – und damit sie selbst – für immer zu vernichten!
Eine Gruppe von Stadträten war nämlich vor einiger Zeit im Wald aufgetaucht und hatte laut darüber debattiert, was alles der Kettensäge zum Opfer fallen müßte. Bald war klar, daß der gesamte Stadtwald abgeholzt werden würde.
Eine hundertjährige Tanne war der Wortführer und alle übrigen Geister der einzelnen Bäume gaben ihren Kommentar dazu ab. Die Tanne sagte gerade:
»Hoffentlich hat sich das freiwillige Opfer unserer heldenmütigen Schwester unten vor der Stadt gelohnt. Völlig selbstlos hat sie ihr Leben hingegeben und sich quer über die Zufahrtstraße gelegt.«
»Ich befürchte, daß die Menschen in ihrer kleingeistigen Beschränktheit gar nicht begreifen, was unsere Schwester damit ausdrücken wollte«, widersprach eine Buche und schüttelte aufgeregt ihre Äste.
»Das denke ich auch«, meldete sich eine Esche zu Wort, »sie werden glauben, der Baum wäre alt und morsch gewesen und hätte daher seinen Halt verloren.«
»Ach, was«, lachte eine dicke Eiche bitter auf, »so dämlich sind die Zweibeiner nun gerade nicht! Sie werden doch sehen, daß das Holz der Tanne kerngesund war. Aber ob sie den richtigen Schluß aus dieser Tatsache ziehen, das wage ich allerdings auch zu bezweifeln.«
»Sicherlich wollte dieser weibliche Mensch, der mit einem lauten und stinkenden Auto ankam, die Stadt und seine Bewohner bei ihrer mörderischen Aktion auch noch unterstützen«, mutmaßte die Esche und fuhr dann fort:
»Eigentlich schade, daß unsere Schwester nicht auf das Auto…«
Aber da fuhr die Hundertjährige barsch dazwischen:
»Sprich es nicht aus, Schwester! Das wäre zu schlimm und wir wären dann um kein Blatt und um keine Nadel besser als die unvernünftigen Zweibeiner. Eigentlich sind die Menschen ja nicht wirklich böse, sie besitzen nur zu wenig Verstand und sehen bloß ihren materiellen Vorteil.«
»Das glaube ich auch«, versuchte eine kleine Fichte die aufgebrachten Gemüter ein wenig zu besänftigen, »man müßte einen Weg finden, um den Leuten klar zu machen, wie sehr sie sich selbst schaden, wenn sie uns, die Wälder, zerstören und alles zubetonieren, nur weil sie sich ein gutes Geschäft davon versprechen.«
»Diese Meinung teile ich auch«, riß die uralte Tanne, welche alle übrigen Bäume überragte, die Gesprächsleitung wieder an sich. »Wir werden uns etwas einfallen lassen müssen, um die Menschen aufzurütteln in ihrem kurzsichtigen Denken. Vielleicht gelingt es uns noch in letzter Sekunde, die Zahl der Gegner dieses Flughafenprojektes zu vergrößern, so daß der Bürgermeister eine neue Abstimmung machen lassen muß und die Naturfreunde sich dieses Mal durchsetzen.
Leicht wird es allerdings nicht werden«, sprach der Geist der greisen Tanne weiter, »denn die Pläne für unseren Tod sind schon sehr weit gediehen und ich warne euch alle vor allzu großem Optimismus. Wenn wir uns sehr anstrengen und jeder, der in diesem Wald lebt – ich meine damit auch die Tiere – sein Bestes gibt, dann stehen unsere Aussichten halbe-halbe, daß wir ungeschoren davonkommen, meine Schwestern und Brüder.«
»Ja«, meinte ein Ahorn, der sich bis jetzt in der Diskussion zurückgehalten hatte, »wir werden alle sehr angestrengt nachdenken müssen, wie wir den Widerstand gestalten wollen. Ich bin optimistischer als du, Schwester, und glaube, daß unsere Chancen viel besser stehen.«
»Ja, ja!« jubelte eine noch junge Blutbuche, »wir werden es schaffen! Ich bin noch so jung, weshalb sollte mich die Axt des Holzfällers treffen?«
»Eher die Kettensäge«, brummte der Geist einer schon recht betagten Fichte, die bereits ihre sämtlichen Zweige traurig hängen ließ.
»Keine Unkenrufe«, gebot die weise Tanne streng. »Schlechte Gedanken beeinflussen unsere Ideen und wir brauchen gute Einfälle, wenn wir etwas erreichen wollen, Freunde.«
Die Tiere des Waldes aber hatten aufmerksam der Debatte der Bäume gelauscht und alle wurden dadurch aus ihrer Lethargie gerissen, welche sich bereits ihrer Herzen und Gehirne bemächtigt hatte.
Viele von ihnen hatten schon mit ihrem Leben abgeschlossen gehabt. Wohin sollten sie sich wenden, wenn die große Abholzaktion zu Ende und die Lebensgrundlage jedes Einzelnen mutwillig zerstört waren?
Nicht nur Rehe und Hirsche, Hasen und Füchse oder Wildschweine wären dann dem Tod geweiht, auch für die Kleinen, wie Käfer, Würmer, Ameisen und Schmetterlinge, bedeutete dies das Ende…
*
Als Silvia am nächsten Morgen erwachte, fühlte sie sich voller Tatendrang. Die junge Frau sang sogar unter der Dusche – etwas, was sie seit der Trennung von Stefan nicht mehr getan hatte. Als sie sich gründlich einseifte, fiel ihr auf einmal ihr merkwürdiger Traum von vergangener Nacht ein. Sie hatte ganz deutlich Stimmen gehört, welche um Hilfe und Mitleid gebeten hatten: »Helft uns!« »Laßt nicht zu, daß sie uns umbringen!« »Habt Erbarmen mit uns!«
›Vermutlich ist mir im Schlaf der Gedanke an den älteren Gast von gestern abend durch den Sinn gegeistert‹, dachte sie und schmunzelte. Der Herr hatte doch davon gesprochen, daß er Bäume gehört hätte, die um Hilfe gerufen hätten, oder so ähnlich. Hm. Eigenartig war das Ganze aber schon.
›Irgendeine vernünftige Erklärung gibt es für alles‹, dachte die junge Frau und zwängte sich rasch in ihre neuen, engen Jeans, wählte eine roséfarbene Bluse und ein farblich passendes Sweatshirt dazu und schlüpfte zum Schluß in flotte, bequeme Laufschuhe. Geeignetes Schuhwerk war in ihrem Job das A und O.
Als sie nach dem Frühstück das Hotel verlassen wollte, hielt Monsieur Gaston Rienne, sie auf.
»Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, Mademoiselle, und viel Erfolg bei Ihrer Suche. Hoffentlich gestaltet sich der Tag angenehmer als die vergangene Nacht, nicht wahr?«
Auf Silvias fragenden Blick hin trat er näher und senkte vertraulich seine Stimme: »Haben Sie letzte Nacht nicht die Totenvögel schreien gehört, Mademoiselle Pattern?«
»Welche ›Totenvögel‹, Monsieur?« fragte diese verdutzt und leicht beunruhigt. Unwillkürlich war sie zusammengeschaudert, als hätte ein eiskalter Windhauch sie gestreift. Unbemerkt von beiden war auch der Ober von gestern abend herangetreten und flüsterte jetzt beinahe:
»Ich hab’ die Schleiereulen, Uhus und Käuze auch gehört, Chef. Die ganze Nacht hindurch haben diese Biester schaurig geheult und gekrächzt und mich
nicht schlafen lassen. Es müssen Hunderte gewesen sein.«
»So ging es mir ebenfalls«, beschwerte sich Monsieur Rienne, »kein Auge habe ich zugetan, so unheimlich war das.«
»Oh, das tut mir aber leid, Messieurs.« Silvia hatte irgendwie das unbestimmte Gefühl, sich dafür entschuldigen zu müssen, daß sie ihrerseits hervorragend geruht hatte, aber lügen wollte sie keinesfalls. »Ich habe nichts dergleichen gehört; im Gegenteil, ich habe selten so tief und fest geschlafen. Ich hatte bloß einen seltsamen Traum.«
»Das spricht zum einen für Ihre Jugend und zum anderen für unsere guten und bequemen Betten, Mademoiselle«, lächelte der Hotelier, der heute dunkle Ringe unter seinen braunen Augen hatte. »Das beruhigt mich sehr. Es wäre doch zu peinlich, wenn unsere geschätzten Gäste wegen ein paar Nachtvögeln ihre verdiente Nachtruhe einbüßten.«
Allmählich war Silvia ein klein wenig beunruhigt. Der Kellner sprach von »Hunderten« und sein Chef versuchte jetzt wieder abzuwiegeln, in dem er von »ein paar« redete. Sie war nicht gerade scharf darauf, ihre Kunden in einen Ort zu lotsen, wo es anscheinend üblich war, daß Uhus und Käuze die Leute am Schlafen hinderten.
Und wie war das mit den seltsamen Stimmen gewesen, die sie gehört hatte und was genau hatten sie gesagt? Aber das hatte sie ja bloß geträumt. Außerdem wollte sie jetzt keine große Debatte beginnen, sondern schleunigst gegenüber zum Rathaus und ihr Vorhaben beim Bürgermeister ankündigen.
»Ich schlafe meistens wie ein Stein, Monsieur Rienne«, erklärte sie dem Hotelbesitzer abschließend und machte sich auf den Weg quer über den Stadtmarkt, am Brunnen mit seiner steinernen Figur des heiligen Petrus vorbei, wobei sie dessen überdimensional großen Schlüssel dank seiner Vergoldung in der morgendlichen Herbstsonne glänzen sah. Als Silvia ihre Blicke wieder auf das Kopfsteinpflaster richtete, war ihr geradeso, als wäre eben ein Frosch zwischen zwei Marktständen hindurch gekrochen…Sie zwinkerte heftig und als sie die Augen wieder auf die bestimmte Stelle richtete, war nichts mehr zu sehen.
*
Silvias Vorhaben, den Bürgermeister von St. Pierre sur Roc sprechen zu wollen, ließ sich schwieriger an als gedacht. Das lag weder an ihr, noch an Monsieur le Maire selbst, dafür umso mehr an dessen Sekretärin, Mademoiselle Ginette Balouche, welche offenbar glaubte, sich als waschechter Vorzimmerdrachen aufspielen zu müssen.
»Ha, ma Chère, was glauben Sie denn?« versuchte sie der überraschten Deutschen zu verdeutlichen, »ohne Termin können Sie Monsieur auf keinen Fall behelligen. Solche Überfälle gibt es in einem Gemeinwesen dieser Größenordnung nicht! Da könnte ja jeder kommen und Monsieur Lacourbe mir nichts, dir nichts bei seiner höchst verantwortungsvollen Tätigkeit stören und …«
Silvia kannte solche Alpträume von Vorzimmerdamen zur Genüge und ein Blick auf Ginette hatte ihr genügt, um zu wissen, woher der Wind wehte. ›Alte Jungfer, die ihren Chef vergöttert und ihm vor allem junge, hübsche Frauen vom Leib zu halten versucht. Auf gar keinen Fall lasse ich mich von dieser mageren Schreckschraube abwimmeln.‹
»Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, Madame«, lächelte Silvia zuckersüß ihr Gegenüber an, ohne auf deren Worte auch nur mit einer einzigen Silbe einzugehen. »Um erst lang Termine ausmachen zu können, fehlt mir leider die Zeit; morgen fahre ich bereits wieder nach Deutschland zurück (was glatt gelogen war, aber die rechte Hand des Bürgermeisters beruhigen sollte).
Ich möchte Ihrem Chef nur kurz Bescheid geben, daß ich vorhabe, mich in den Wäldern um St. Pierre sur Roc herumzutreiben, um einen geeigneten Platz für ein Camp zu finden; dann bin ich auch schon wieder weg; das dauert keine drei Minuten, Madame.
Wie ich Sie einschätze, Madame, sind Sie gewiß so geschickt, mich auch kurzfristig bei Monsieur le Maire anzumelden und mich mit ihm ein paar Worte wechseln zu lassen – trotz seiner Arbeitsüberlastung.«
Ginette hatte vor allem »Wälder« und »Camp« verstanden und dachte infolgedessen, daß dieses freche, junge Ding von »Alphonse Mahonney«, jenem Unternehmen geschickt worden war, das die Abholzung des Stadtwalds vornehmen sollte; und jetzt sollte die da einen guten Platz für das Camp der Holzfäller finden.
»Oh, Mademoiselle, wie war doch gleich wieder Ihr Name? Der Chef wird entzückt sein, daß »Adolphe Mahonney« es doch so rasch ermöglichen konnte, bei uns zu beginnen. Es liegt Monsieur Maire eine Menge daran, daß die Arbeiten zügig in Angriff genommen und ausgeführt werden«, fügte sie beinahe geschwätzig hinzu. »Ich werde Sie umgehend anmelden, Mademoiselle! Un moment, s’il vous plait!«
Und mit kleinen, eiligen Trippelschritten entfernte sich die graue Maus Ginette in Richtung gepolsterter Doppeltür ins »Allerheiligste«, sprich ins Büro des Bürgermeisters, um ihm die Freudenbotschaft zu verkünden.
›Nanu?‹
Silvia Pattern war vollkommen überrascht von dieser Wendung. Wer um alles in der Welt war »Adolphe Mahonney«? Aber allmählich gewöhnte sie sich daran, daß die Bewohner von St. Pierre sur Roc etwas »eigenartig« zu sein schienen. Hauptsache, sie gelangte ohne Probleme durch diese Tür und konnte endlich ernsthaft mit ihrer Arbeit beginnen.
»Monsieur le Maire läßt bitten«, flötete Mademoiselle Balouche kurz darauf und hielt Silvia die schwere Tür auf. Als seine Sekretärin keine Anstalten machte, den Raum wieder zu verlassen, knurrte ihr Chef nur einmal kurz:
»Fermez la porte!« (»Tür zu«!) und die graue Eminenz schloß selbige geräuschlos – von außen. André Lacourbe rieb sich erfreut nach der Begrüßung die Hände.
»Schön, daß es so bald losgeht mit dem Baumfällen«, meinte er zufrieden. Und um für alle Zeiten zu demonstrieren, daß er doch am längeren Hebel saß, fügte er noch einiges hinzu, was Silvia erneut zu denken gab.
Daß der ein wenig behäbige, aber dennoch durchaus gut aussehende Herr im dunkelgrauen Anzug mit dem schwarzen Oberlippenbart »einen Sprung in der Schüssel hatte«, schloß sie eigentlich aus. Es mußte sich folglich um einen Irrtum handeln, dem der Vater des »Obergendarmen« und (wie sie vermutete!) »Dorfcasanovas« Jean-Pierre Lacourbe, unterlag.
»Monsieur le Maire«, begann sie daher behutsam, »ich fürchte, Sie verwechseln mich. Ich bin keineswegs von einer Firma, die Bäume fällt, geschickt worden. Im Gegenteil! Mein Unternehmen sucht geeignete Wälder, in denen unsere Kunden ihrem Hobby frönen können, für etliche Tage auf sich allein gestellt, ein so genanntes ›Überlebenstraining‹ zu absolvieren.«
???
Dem Bürgermeister blieb der Mund offenstehen.
»Aber, meine Sekretärin…«, begann er hilflos, jedoch Silvia ließ ihn nicht weiter sprechen.
»Die Dame muß etwas gründlich mißverstanden haben.«
»Das scheint mir allerdings auch so zu sein! Die gute alte Ginette versteht in letzter Zeit so manches vollkommen falsch«, murmelte er dann, wobei sich Erbitterung und Resignation die Waage hielten.
Monsieur Lacourbe senior widmete sich jetzt wieder ausschließlich der charmanten jungen Dame, welche der Zufall so unverhofft in sein Amtszimmer geschickt
hatte.
»Das klingt ja recht spannend, was Sie mir da erzählen, Mademoiselle«, meinte er dann, »und diese Herren bezahlen in der Tat dafür, daß sie zehn Tage lang in der Wildnis herumirren müssen, sich ihren Schlafplatz unter Gebüsch oder auf Bäumen selbst machen dürfen und sich obendrein von Wurzeln und Beeren ernähren, die sie möglicherweise finden?«
»Genauso ist es, Monsieur! Es kann alles Eßbare verwendet werden – auch Schlangen, Würmer und Raupen – wenn es einer hinunterbringt, aber im Allgemeinen leben die Herren von Pilzen, Beeren und Bucheckern, manchmal von Fröschen und kleinen Krebsen oder Fischen, die sie möglicherweise mit einer selbst gebastelten Angel fangen.«
»Na, ich wünsche jedenfalls guten Appetit«, schüttelte sich das Stadtoberhaupt von St. Pierre und grinste.
Hin und wieder ist einer so geschickt und macht sich eine Steinschleuder, mit der er ein Eichhörnchen oder auch mal eine Taube schießt – aber das ist eher die Ausnahme.
Die meisten dieser verwöhnten Manager sind schon froh, wenn sie abends in eine gut mit Blättern und Moos ausgepolsterte Höhle kriechen können, um dort zu schlafen, ohne zu frieren.
Ganz wichtig sind jedoch saubere Quellen in einem tauglichen Waldgebiet. Wir wollen schließlich nicht, daß unsere Klientel sich die Ruhr holt für die etlichen tausend Euro, die sie auf den Tisch blättern muß für den »Kick«, wie einst Robinson Crusoe leben zu dürfen.
Meine Chefs würden es also gar nicht gerne hören, wenn ich ihnen sagen müßte, daß Sie dabei sind, dieses Naturparadies vor Ihrer Haustür zerstören zu lassen«, startete Silvia Pattern einen Versuchsballon.
Aber ehe Monsieur André Lacourbe darauf eingehen konnte, öffnete sich schwungvoll die Tür zur Amtsstube des Bürgermeisters und herein spazierte der schneidige, junge Mann, den Silvia bereits gestern am Nachmittag als dessen Sohn Jean-Pierre kennengelernt hatte, der die Polizeistation der Stadt leitete.
Der Vater glaubte, ihn der jungen Dame umständlich vorstellen zu müssen und an der »diskret« vom Alten eingeschobenen Bemerkung über den ledigen Status seines einunddreißigjährigen Sprößlings, erkannte Silvia unschwer den Wunsch seines Erzeugers nach einer geeigneten Schwiegertochter, sowie nach diversen Enkelkindern.
Sie hatte beinahe Mitleid mit dem Sohn; ihre eigene Mutter konnte es sich ebenfalls nicht verkneifen, Silvia seit ihrer endgültigen Trennung von Stefan, jedem als noch »zu Habende« zu offerieren – eine Unart, welche die Tochter beinahe in den Wahnsinn trieb.
Jean-Pierre schien allerdings eher zur dickfelligeren Sorte Mensch zu gehören: er registrierte den zarten Hinweis des Vaters zur »Verpflichtung eines jeden anständigen Bürgers«, eine Familie zu gründen, überhaupt nicht. Zumindest reagierte er darauf nicht sauer. Vermutlich hatte er auf die Worte seines Alten Herrn gar nicht geachtet, denn er zeigte sich erneut glattweg hypnotisiert von der kessen Blondine, die da ganz lässig in Jeans und Sweatshirt bei seinem Vater im Büro saß.
›Wie mag sie es bloß geschafft haben, sich an Ginette vorbeizuschmuggeln?‹ dachte er und war von ihrer Raffinesse fast noch mehr beeindruckt als von ihrem tollen Aussehen. Ihre großen blaugrauen Augen mit den langen, geschwungenen dunkelbraunen Wimpern und der lachlustige Mund mit den vollen roten Lippen hatten es ihm bereits gestern angetan. Wer, um alles in der Welt, war sie bloß?
Als seine Neugier diesbezüglich befriedigt war – endlich wußte er, wozu sie in das eher langweilige Städtchen St. Pierre sur Roc gekommen war – hatte er natürlich noch tausend Fragen an die bezaubernde, junge Deutsche mit der aschblonden Pferdeschwanzfrisur und der hinreißenden Figur.
Und was tat ein junger Mann, der interessiert war an einer jungen Frau? Er lud sie natürlich postwendend für abends zum Essen ein – holte sich jedoch prompt einen Korb. Soo schnell ließ sich Silvia nicht mit fremden Männern ein – aber um den Faden nicht ganz abreißen zu lassen (schließlich fand sie ihn auch recht attraktiv!), ließ sie die Möglichkeit durchblicken, daß der junge Mann – vielleicht – Chancen hätte, sie am übernächsten Abend in ein Restaurant seiner Wahl zu entführen.
Jean-Pierre war zwar ein stadtbekannter Draufgänger, jedoch kein Dummkopf und hatte infolgedessen sofort bemerkt, daß die schöne Blonde aus dem Nachbarland keine »Eroberung im Sturm« anstrebte, sondern eher das gute altmodische »Den-Hof-Machen«. Bitte sehr!
Die jungen Leute hatten sich dann jedenfalls so schnell für den übernächsten Tag verabredet, daß der Bürgermeister bloß noch staunen konnte. Mon Dieu! Wenn er da an seine eigene Jugend dachte! Wochenlang hatte er seinerzeit um Jean-Pierres Mutter herumschwänzeln müssen, ehe er es wagen durfte, sie zu einem Spaziergang am Sonntagnachmittag – unter den Augen sämtlicher Bewohner von St. Pierre – rund um den Marktplatz eben dieser Stadt einzuladen…
Heutzutage ging eben alles viel schneller. André Lacourbe seufzte unwillkürlich. Auch, daß man alt wurde, geschah viel zu schnell. Er fühlte sich mit seinen fünfundfünfzig Jahren noch keineswegs alt, und wenn er das junge Ding betrachtete, das sein einziger Sohn vor seinen Augen anschmachtete, kriegte er beinahe Lust, sich selbst noch einmal auf die Pirsch nach einer passenden Bürgermeisterin zu begeben.
Eines aber wußte er ganz genau: Mademoiselle Ginette Balouche würde sie mit Sicherheit nicht heißen…
»Viel Erfolg«, wünschte er Silvia, »und verlaufen Sie sich nicht in unserem Wald.«
»Sie sollten auf keinen Fall alleine gehen, Mademoiselle«, äußerte sich sein Sohn, der Commissaire, besorgt, »und nicht, weil es etwa nicht geheuer wäre! Wir haben weder gefährliche Raubtiere bei uns, noch ist mir etwas von flüchtigen Verbrechern bekannt. Die letzten Banditen hat mein Vorgänger noch dingfest gemacht und ins Gefängnis schaffen lassen; aber ein Unfall kann sich schnell ereignen – etwa ein Beinbruch – und dann würde es unter Umständen lange dauern, bis wir Sie fänden.
Leider habe ich selbst keine Zeit, Sie zu begleiten – was ich sehr, sehr gerne täte – und Gendarmen, die abkömmlich wären, haben wir auch nicht. Aber unser Gemeindediener, Marcel Binz, der wäre der Richtige. Was meinst du, Vater?« wandte er sich an den Bürgermeister.
»Du sagst es, Jean-Pierre. Marcel ist der ideale Mann dazu! Er kennt den Wald wie seine Hosentasche und falls etwas passieren sollte, kann er über Handy genau die Position im Gelände angeben, um die Helfer schnellstens an den Unfallort zu dirigieren.«
Der Bürgermeister klingelte nach Mademoiselle Ginette Balouche – die sich bereits gelb und grün geärgert hatte, daß diese fremde Weibsperson so lange bei ihrem Chef im Zimmer blieb – und erteilte ihr den Auftrag, das Faktotum Marcel so schnell wie möglich in die Mairie zu rufen, weil dort Arbeit auf ihn warte.
»Höchst angenehme Arbeit, Mademoiselle Ginette«, grinste Lacourbe junior, »ich würde ja gerne selbst Mademoiselle Silvia Pattern in den Wald begleiten, aber leider ruft mein Dienst in der Gendarmerie.«
Sowohl die junge Frau, wie der Bürgermeister lachte und seiner Sekretärin blieben die Worte im Halse stecken. Was gab es denn da zu kichern?
»Jawohl, Ginette, betonen Sie das, bitte, ausdrücklich, dann beeilt sich der gute Marcel besonders!« rief ihr Chef und Ginette machte, daß sie in ihrem Büro verschwand.
Silvia bedankte sich für die Fürsorglichkeit, obwohl sie eigentlich über ihren »Bodyguard« nicht so sehr begeistert war.
Aber die Vernunft sagte ihr, daß sie froh darüber sein sollte.
Jean-Pierre zwinkerte ihr zum Abschied ein klein wenig zu vertraulich zu – fand sie jedenfalls – und fast bereute die junge Frau schon, seine Einladung angenommen zu haben. Er schien doch ein rechter Filou zu sein und allzu offensichtlich von sich selbst eingenommen. Schürzenjäger waren eigentlich nicht so sehr ihr Fall... Aber sie würde alles an sich herankommen lassen.
Als sie das Vorzimmer durchquerte, um zum Ausgang der Amtsräume zu gelangen, teilte ihr Ginette noch mit ziemlich ungnädiger Miene mit, daß Marcel, der Gemeindediener, in etwa einer Viertelstunde unten am Eingang des Rathauses auf sie warten würde.
»Sie werden ihn sofort erkennen, Mademoiselle; er sieht nämlich aus wie ein Bär«, fügte die Vorzimmerdame noch hinzu.
›Na, wunderbar, dann paßt er doch genau in den Wald‹, dachte Silvia, welche noch schnell in den Lebensmittelladen laufen wollte, um sich Proviant mitzunehmen. Sie rechnete damit, frühestens am späten Nachmittag wieder in der Stadt zu sein.
Weil alle wichtigen Geschäfte um den Marktplatz nahe beieinander lagen, gelangte die junge Frau im Nu zu Madame Yvette Fraizys »Magasin d’Alimentation«.
Kurz davor glaubte sie ihren Augen nicht zu trauen: zwei Kröten hüpften gemächlich über den Gehweg, ehe sie um die Hausecke verschwanden. Kröten mitten in der Stadt? Sicher hatte sie sich getäuscht…
Als Silvia die Ladentür öffnete, war sie erstaunt über die Menschenmenge, welche sich in dem relativ kleinen Raum geradezu drängte. Was war denn hier los?
Sofort fiel ihr auf, daß die Leute alle sehr aufgeregt waren. Als erstes bemerkte sie den Hotelgast vom vorigen Abend, welcher sich beim Essen so aufgeregt hatte, weil er angeblich »Stimmen« gehört hatte, die um Hilfe riefen.
Offenbar war er nicht der einzige – eine ganze Reihe von Männlein wie Weiblein behauptete ebenfalls, »mit eigenen Ohren« gehört zu haben, wie irgendjemand um Gnade gebettelt hätte.
»Mir war auch so«, platzte – eigentlich ohne es zu wollen – Silvia heraus, »aber ich nahm an, ich hätte es bloß geträumt.« Die Aufmerksamkeit Madame Fraizys und ihrer sämtlichen Kunden war ihr nun sicher.
»Die deutsche Mademoiselle ist Gast im ›Cerf Bleu‹.«
»Ja, ich weiß, sie ist gestern angekommen«, hörte Silvia hinter ihrem Rücken flüstern.
›Typisch Kleinstadt‹, dachte sie. ›Bei uns daheim ist es um kein Jota anders. Fremde fallen einfach auf wie bunte Hunde; alles wird von den Einheimischen registriert. Wer denkt, er könnte sich unbeobachtet an einem fremden Ort bewegen, der ist auf dem Holzweg.‹
Alle im Laden starrten sie neugierig an, einschließlich der Inhaberin dieses belgischen »Tante-Emma-Ladens« und Silvia dachte, jetzt wäre die beste Gelegenheit, auch mit den Menschen dieser Stadt ins Gespräch zu kommen. Das hatte sich noch stets als positiv erwiesen; so manches Mal hatte sie dabei Dinge erfahren, die sie für ihren Job gut gebrauchen konnte.
Um im Gespräch zu bleiben und um gleichzeitig zu zeigen, daß sie sich für die Vorkommnisse in der Stadt interessierte, erzählte sie den gespannt Lauschenden, daß ein ohne ersichtliche Ursache umstürzender Baum gestern nachmittag beinahe ihr Auto getroffen hätte.
Daraufhin entspann sich erneut eine lebhafte Diskussion.
»Ich glaube, daß die Bäume im Wald dahinter stecken; sie wollen sich nicht einfach so ausrotten lassen – daher auch das fürchterliche Geschrei der Käuze und Uhus mitten in der Nacht!« behauptete Madame Fraizy und etwa die Hälfte der Anwesenden stimmte ihr zu, während sich die andere Hälfte darüber amüsierte.
»Aber, Madame Yvette, ich bitte Sie! Das kann doch nicht Ihr Ernst sein! Bäume sind Pflanzen ohne Verstand und ohne Gefühle und haben keine Möglichkeit, sich zu äußern. Wie sollen sie sich dann an uns Menschen wenden und um Hilfe bitten?« rief ein Mann mittleren Alters mit Brille und eine jüngere Frau pflichtete ihm umgehend bei.
»Jetzt, Madame Fraizy, geht aber die Phantasie gehörig mit Ihnen durch! Glauben Sie wirklich, daß die Bäume im Gemeindewald wissen, was ihnen bevorsteht und daß sie deshalb alle Uhus und Käuze angestiftet haben, die ganze Nacht lang durchzuheulen?«
»Makabere Vorstellung«, meldete sich ein junger Bursche vorwitzig zu Wort. »Aber schlecht wäre es nicht! Diese Vögel würden doch ihre Brutplätze verlieren, wenn aus unserem Gemeindewald ein Flughafen und ein Hotel werden sollten. An deren Stelle würde ich auch versuchen, mich zu wehren.«
»So ein ausgemachter Quatsch!«
Eine bieder aussehende Hausfrau sagte es und wandte sich gleich darauf an Silvia:
»Sie müssen ja den Eindruck haben, in einem Tollhaus gelandet zu sein. Was sagen Sie denn dazu, Mademoiselle?«
Silvia war schockiert; schon wieder war von der Zerstörung dieses herrlichen Fleckchens Erde die Rede und das ging ihr gewaltig gegen den Strich. Am besten fuhr sie gleich wieder nach Hause, berichtete ihren Chefs von der bevorstehenden Abholzung und machte sich erneut auf die Suche nach einem geeigneten Gelände für ihre Kunden.
»Ich wußte ja nichts vom Vorhaben der Stadt, ihren wunderbaren Wald der Vernichtung preiszugeben; ich kann bloß sagen, daß mich der Vorfall mit der umgestürzten Tanne sehr nachdenklich gestimmt hat. Der Stamm war nämlich kerngesund und es bestand überhaupt kein natürlicher Anlaß dafür, daß der Baum umgefallen ist.
Ja, als ich die Tanne da so quer über der Fahrbahn liegen sah, hatte ich beinahe den Eindruck, als wollte sie gegen irgendetwas demonstrieren. Ich habe diesen Gedanken aber sofort als blanken Unsinn abgetan.«
Erst einmal trat Stille ein im Laden.
»Na, das fehlte ja noch, daß jetzt auch noch das Grünzeug anfängt, zu protestieren und zu demonstrieren! Als nächstes plädieren dann vielleicht die Selleriestängel für Schonzeit und die Krautköpfe verlangen womöglich das Wahlrecht!« machte sich endlich ein Spaßvogel bemerkbar und erntete damit großes Gelächter.
Kaum hatte sich dieses gelegt, ging die lebhafte Debatte weiter. Ein alter Herr – wie Silvia später erfuhr, war es der neunundsiebzig Jahre alte, ehemalige Direktor und Lehrer des Gymnasiums, Monsieur Guy Monnet – setzte sich vehement für den Stopp des Projektes ein.
Nach seiner Meinung hätten nur einige wenige einen Profit davon; alle anderen dagegen nicht. Im Gegenteil, für manche würden der neue Hotelkomplex und der moderne Freizeitpark á la Disneyworld sogar finanzielle Einbußen bedeuten – vom Lärm des Flughafenbetriebs, sowie der Verschandelung der Landschaft ganz zu schweigen.
»Aber wir können uns doch nicht gegen die moderne Zeit auflehnen«, wagte es Madame Fraizy, dem alten Herrn zu widersprechen. »Ob wir wollen oder nicht, wir müssen uns anpassen – sonst machen andere das Geschäft.«
»Das mag ja sein, aber alle reden sie vom Klimawandel und davon, daß wir die Natur dringend vor radikalen Eingriffen schützen müssen. Und dann geht unser Bürgermeister her und überredet mehr als die Hälfte aller Stadtverordneten zu solch einer Barbarei!«
Richtig in Fahrt hatte der alte Herr sich geredet und der junge Bursche von vorhin pflichtete ihm umgehend bei:
»Man muß sich das mal vorstellen: statt Bäumen und moosigem Waldboden haben wir dann eine Abfertigungshalle aus Glas und Stahlbeton und zubetonierte Start- und Landepisten.
Und wo man vorher den Kuckuck rufen gehört hat, nervt einen dann das Gekreisch aus der Achterbahn und das Gedudel der Karussells im Freizeitpark!«
Silvia fiel auf, daß in diesem Fall die jungen und die älteren Leute sich in ihrer Ablehnung einig waren, während die sogenannten »gestandenen« Bürger in mittlerem Alter von etwa fünfunddreißig bis fünfzig Jahren eher Parteigänger der Abholzaktion zu sein schienen.
»Jeder schreit: »Rettet den brasilianischen Regenwald!« Aber vor der eigenen Haustür macht man den gleichen Fehler, indem man Natur, die sich über Jahrhunderte entwickelt hat, einfach innerhalb weniger Tage vernichtet – wobei keiner auch nur einen einzigen Gedanken an die betroffene Tierwelt verschwendet.«
Wer das mit großem Bedauern festgestellt hatte, war ein junger Mann von siebenundzwanzig Jahren, Robert Maurois, ein Student der Germanistik und französischen Geschichte an der Universität in Brüssel, der sich in den Semesterferien sein Studiengeld als Briefträger in seiner Heimatstadt St. Pierre sur Roc verdiente. Außerhalb der Ferien arbeitete er für gewöhnlich nur einen Tag in der Woche, den er sich von Vorlesungen freigehalten hatte.
Das sollte Silvia aber erst ein wenig später erfahren.
»Ah, Robert! Hoffentlich bringen Sie mir nicht wieder nur Rechnungen«, lächelte die behäbige Geschäftsfrau und nahm die umfangreiche Post entgegen, die der junge Mann ihr überreichte.
»Keine Angst, Madame Yvette, alles, was auch nur im Entferntesten nach Rechnung, Steuern oder sonstigem lästigem Behördenkram ausgesehen hat, habe ich unterwegs weggeworfen«, gab der schlanke, aber muskulöse und auch sonst recht ansehnliche Aushilfspostbote schlagfertig zur Antwort. »Ich stelle ab heute nur noch Gewinnmitteilungen und Liebesbriefe zu.«
Silvia entging nicht, daß es diesem hübschen schwarzhaarigen Robert auf einfache Art und Weise gelungen war, die gereizte Stimmung im Laden zu entspannen. Der Verkauf ging ungestört weiter und binnen kurzer Zeit hatte auch die blonde Deutsche eine große Tüte mit vier dick belegten Baguettebrötchen – zwei mit Schinken, zwei mit Käse – zwei Äpfeln, zwei Bananen, einer Tüte mit Erdnüssen und zwei mittelgroßen Tafeln Schokolade auf dem Arm.
Madame Yvette schrieb alles fein säuberlich auf einem Block untereinander und rechnete dann den Betrag aus, denn ihre Registrierkasse war kaputt – und dies schon seit langem. Aber da sie noch zu jener Generation gehörte, die das Kopfrechnen gut beherrschte und nicht für die kleinste Addition gleich einen Taschenrechner benötigte, ging es ziemlich flott vonstatten.
»Haben Sie sich für eine längere Expedition ausgestattet, Mademoiselle?« hörte Silvia den Briefträger sagen und sie blickte hoch. Robert Maurois stand neben ihr und schaute grinsend auf sie hernieder.
Silvia wurde es abwechselnd heiß und kalt.
»Wie? Was haben Sie gesagt, Monsieur?« stotterte sie nach einer Weile dümmlich.
Wenn früher jemand von Liebe auf den ersten Blick gefaselt hatte, hatte sie immer bloß überheblich die Achseln gezuckt und den Betreffenden als Narren bezeichnet – seit diesem Augenblick in dem kleinen Krämerladen allerdings wußte sie, daß es sie wirklich gab, diese mächtige Gefühlsaufwallung aus heiterem Himmel, rational nicht erklärbar, aber nichtsdestotrotz eine unleugbare Tatsache, die alles auf den Kopf stellte.
›Hätte ich mich doch bloß mit diesem Prachtstück von Mann für den Abend verabredet‹, fuhr es ihr bedauernd durch den Sinn; sie überlegte fieberhaft, wie sie den Sohn des Bürgermeisters – diesen Möchtegern-Kleinstadtcasanova – loswerden könnte.
Aber dieser um einen Kopf größere, unverschämt gut aussehende Bursche in seiner Postuniform machte natürlich keine Anstalten, sie zu irgendetwas einzuladen…
»Nein, nein, ich muß beruflich in den Wald gehen und da nehme ich mir ein wenig Proviant mit«, begann sie atemlos, aber der junge Mann unterbrach sie sofort.
»Ach, ja? Beruflich? Sie wollen wohl Pilze sammeln und anschließend auf dem Markt verkaufen? Oder sind Sie womöglich Holzfällerin? Ich habe mir sagen lassen, emanzipierte junge Damen machen heutzutage alles«, sagte er und verdrehte dabei die Augen. Silvia und etliche Kunden im Laden mußten lachen, weil es gar so drollig geklungen hatte.
»Nein, nein! Weder, noch! Ich suche geeignetes Gelände für Kunden, die, ganz auf sich allein gestellt, in freier Natur zehn Tage fern der Zivilisation, überleben wollen.«
»Bravo! Schlafen auf weichem Moos und unterm schützenden Blätterdach und leben von Regenwürmern und Ameiseneiern. Warum nicht, wer’s mag! Ich hab’ schon gehört von solchen ›Survivalcamps‹ und finde die Idee gar nicht mal so schlecht. Da wird mancher merken, wie verweichlicht und lebensuntüchtig er in Wahrheit ist und wie abhängig von der Technik und der so genannten ›Zivilisation‹. Und Sie suchen also die passende Gegend dafür aus? Viel Erfolg, Mademoiselle!«
Madame Yvette Fraizy räusperte sich diskret, um Silvias Aufmerksamkeit zu erregen. Es waren schließlich noch andere Kunden im Laden…
Sie bezahlte und wollte das »Magasin d’ Alimentation« verlassen, als der Briefträger, der eben eine Flasche Milch an der Ladentheke geleert hatte (»mein zweites Frühstück«, wie er sagte), sie erneut ansprach.
»Sie werden aber doch nicht allein im finsteren Tann herumstolpern wollen? Man weiß ja nie, nicht wahr? Da war doch mal so eine Geschichte, welche mir meine deutsche Großmutter erzählt hat, als ich klein war. Sie handelte von einem gewissen Rotkäppchen und einem bösen Wolf und…«
»Kann mir nicht passieren«, behauptete Silvia und ging durch die Ladentür, die Robert ihr höflich aufhielt.
»Nee? Etwa, weil Sie nicht Rotkäppchen, sondern in Wirklichkeit Schneewittchen sind und die Sieben Zwerge bereits auf Sie warten?« Der Student in der Briefträgeruniform grinste sie frech an.
Das erheiterte die junge Frau sehr und sie beschloß, ihn aufzuklären, obwohl es ihn doch eigentlich überhaupt nichts anging. Oder?
»Monsieur Lacourbe stellt mir den Gemeindediener Marcel Binz zur Verfügung. Er soll mich durch die Gegend führen und dementsprechend beraten.«
»Der gute Marcel? So. so. Ja, das ist genau der Richtige für so etwas«, gab Robert, wenn auch sichtlich widerstrebend, zu. »Also, viel Spaß und viel Glück bei der Suche, Mademoiselle.«
Ehe es sich Silvia versah, hatte der junge Mann sich auf sein Fahrrad mit den beiden großen, schwarzen Ledertaschen geschwungen und war weitergefahren in Richtung Hotel »Cerf Bleu«, um dort seine Post zu verteilen.
Zuletzt hatte er ihr noch freundlich zugewinkt und wie im Traum stolzierte Silvia mit ihrer Tüte zurück zum Rathaus – es waren nur ein paar Schritte – wo bereits ein etwa vierzigjähriger, vierschrötiger Mann wartete, auf den Ginettes Beschreibung »Bär« nur allzu genau paßte.