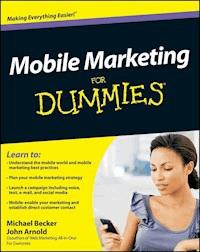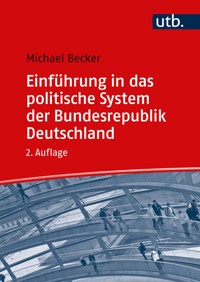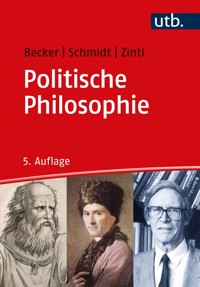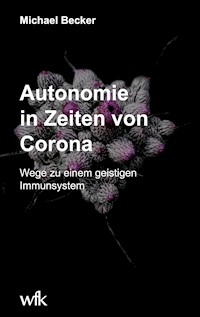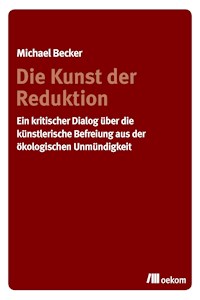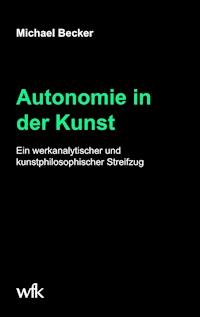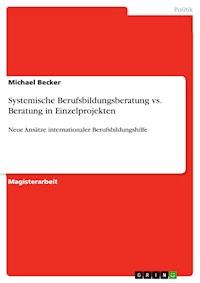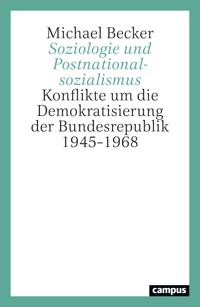
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch analysiert das Verhältnis der westdeutschen Soziologie zum Nationalsozialismus zwischen 1945 und 1968 und widerlegt die verbreitete Annahme, dass der Nationalsozialismus aus der Soziologie verdrängt wurde. Vielmehr kann die bundesrepublikanische Soziologie als postnationalsozialistische Disziplin verstanden werden: Sie war in ihrer institutionellen Entwicklung, ihren Konfliktlinien und ihren Themenstellungen maßgeblich durch die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus sowie dessen Folgen und Wirkungen in der Gegenwart geprägt. In den Augen ihrer wichtigsten Nachkriegsvertreter war die Soziologie ein intellektuelles Unternehmen zur Demokratisierung der Bundesrepublik. Die Untersuchung verknüpft soziologische und gesellschaftsgeschichtliche Perspektiven und verdeutlicht, wie die Soziologie zur politischen Kultur der Bundesrepublik beigetragen hat. Somit liefert sie auch einen Beitrag zum gesellschaftlichen Umgang mit dem Nationalsozialismus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 686
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Becker
Soziologie und Postnationalsozialismus
Konflikte um die Demokratisierung der Bundesrepublik 1945–1968
Campus VerlagFrankfurt/New York
Über das Buch
Das Buch analysiert das Verhältnis der westdeutschen Soziologie zum Nationalsozialismus zwischen 1945 und 1968 und widerlegt die verbreitete Annahme, dass der Nationalsozialismus aus der Soziologie verdrängt wurde. Vielmehr kann die bundesrepublikanische Soziologie als postnationalsozialistische Disziplin verstanden werden: Sie war in ihrer institutionellen Entwicklung, ihren Konfliktlinien und ihren Themenstellungen maßgeblich durch die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus sowie dessen Folgen und Wirkungen in der Gegenwart geprägt. In den Augen ihrer wichtigsten Nachkriegsvertreter war die Soziologie ein intellektuelles Unternehmen zur Demokratisierung der Bundesrepublik. Die Untersuchung verknüpft soziologische und gesellschaftsgeschichtliche Perspektiven und verdeutlicht, wie die Soziologie zur politischen Kultur der Bundesrepublik beigetragen hat. Somit liefert sie auch einen Beitrag zum gesellschaftlichen Umgang mit dem Nationalsozialismus.
Vita
Michael Becker, Dr. phil., ist Diplom-Soziologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sozialforschung, Frankfurt am Main.
Übersicht
Cover
Titel
Über das Buch
Vita
Inhalt
Impressum
Inhalt
I.
Einleitung
I.1
Stand der Forschung
I.1.1
Die Soziologie in der Weimarer Republik
I.1.2
Die Soziologie im Nationalsozialismus
I.1.2.1
Die Deutsche Gesellschaft für Soziologie
I.1.2.2
Emigration und Vertreibung
I.1.2.3
Die Wissenschaftsgestalt der Soziologie
I.1.3
Das deutschsprachige Exil
I.1.4
Die westdeutsche Soziologie und der Nationalsozialismus
I.2
Theoretische Gesichtspunkte zur Analyse des soziologischen Feldes
I.2.1
Disziplinäre Identität und der prekäre Status der Soziologiegeschichte
I.2.2
Soziologiegeschichte und Gesellschaftsanalyse
I.2.3
Soziologie und Nationalsozialismus: Perspektiven einer soziologiegeschichtlichen Gesellschaftsanalyse
I.3
Materialien der Untersuchung
II.
1945–1958: Konflikte um den Nationalsozialismus in der Formierung des soziologischen Feldes
II.1
Die Neugründung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie
II.1.1
Die Soziologie im Reeducation-Konzept
II.1.2
NS-Belastung als Konfliktgegenstand
II.1.3
Restauration der Weimarer Verhältnisse
II.1.4
Die ersten beiden Soziologentage nach dem Zweiten Weltkrieg
II.2
Besuche in Deutschland. Soziologische Beobachtungen in der Nachkriegsgesellschaft
II.3
Die Etablierung der Soziologie als Disziplin: Zwischen Kooperation und »Bürgerkrieg«
II.3.1
Die akademische Etablierung der Disziplin und die Fraktionierung des soziologischen Feldes
II.3.2
Der Konflikt um das UNESCO-Institut
II.3.3
Der Konflikt um die internationale Repräsentation der DGS
II.3.4
Vorstandswechsel in der DGS 1955
II.4
Soziologie und politische Publizistik. Drei Debatten über postnationalsozialistische Wissenschaft und Gesellschaft
II.4.1
Kritik der geisteswissenschaftlichen Tradition und der wissenschaftlichen Mitverantwortung für den Nationalsozialismus
II.4.2
Die Diskussion über politischen Defaitismus
II.4.3
Die Restaurationsdebatte
II.5
Nationalsozialismus und Demokratie im Spiegel der empirischen Sozialforschung
II.5.1
»Das Gesellschaftsbild des Arbeiters«
II.5.2
»Wandlungen der deutschen Familie in der Gegenwart«
II.5.3
Das »Gruppenexperiment« des Instituts für Sozialforschung
II.5.4
Die »Heimkehrerstudien« des Instituts für Sozialforschung
II.5.5
Jugend zwischen Nationalsozialismus und Demokratie
II.5.6
Gab es eine »Ausblendung« des Nationalsozialismus aus der empirischen Forschung?
II.6
Fazit: Die Bedeutung des Nationalsozialismus für die Neukonstituierung des soziologischen Feldes von 1945 bis 1958
III.
1958–1968: Die Entstehung konkurrierender Soziologiekonzeptionen in der Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte
III.1
Die Eskalation des »Bürgerkriegs« und der Zerfall der »Triade«
III.1.1
Der IIS-Kongress 1958
III.1.2
Gehlens gescheiterte Berufung nach Heidelberg
III.1.3
Das fünfzigjährige DGS-Jubiläum 1959
III.1.4
Zwischenfazit
III.1.5
Klärungsversuche: Das Niederwald-Gespräch, die Tübinger Arbeitstagung und der Ursprung des Positivismusstreits
III.1.6
Die Fälle Pfeffer und Mühlmann und das Ende der »Triade«
III.1.7
Der 15. Deutsche Soziologentag 1964 und der Werturteilsstreit
III.1.8
Der 16. Deutsche Soziologentag 1968: Schlusspunkt einer Epoche
III.1.9
Fazit
III.2
Ortsbestimmungen: Fünf Entwürfe zum Zusammenhang von Nationalsozialismus, Demokratie und Soziologie
III.2.1
Helmut Schelsky (Hamburg)
III.2.2
René König (Köln)
III.2.3
Theodor W. Adorno (Frankfurt)
III.2.4
Helmuth Plessner (Göttingen)
III.2.5
Ralf Dahrendorf (Hamburg/Tübingen)
III.2.6
Fazit
III.3
Am Vorabend von 1968 – Die Soziologie und die NS-Debatte der Neuen Linken
III.3.1
Vier Ebenen der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus
III.3.2
Die »antisemitische Welle« als Ausgangspunkt der NS-Debatte
III.3.3
Die Diskussion über den Antisemitismus
III.3.4
Die faschismustheoretische Diskussion
III.3.5
Die NPD-Debatte
III.3.5.1
Erwin K. Scheuch und Hans Dieter Klingemann: Theorie des Rechtsradikalismus in westlichen Industriegesellschaften (1967)
III.3.5.2
Reinhard Kühnl, Rainer Rilling, Christine Sager: Die NPD. Struktur, Ideologie und Funktion einer neofaschistischen Partei (1969)
III.3.5.3
Lutz Niethammer: Angepaßter Faschismus. Politische Praxis der NPD (1969)
III.3.5.4
Zum Vergleich der drei Ansätze
III.3.6
Fazit
III.4
Fazit: Konflikthafte Ausdifferenzierung – Soziologie und Nationalsozialismus von 1958 bis 1968
IV.
Epilog, oder: Woher stammt die Verdrängungsthese?
V.
Schluss: Plädoyer für eine soziologische Analyse postnationalsozialistischer Verhältnisse
Verwendete Archive
Literatur
Dank
I.Einleitung
Das Verhältnis von Soziologie und Nationalsozialismus ist in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach kontrovers diskutiert worden. Dabei hat sich die These durchgesetzt, dass die Soziologie den Nationalsozialismus weitgehend verdrängt hat. Die vorliegende Studie will zeigen, dass diese These revidiert werden muss.
Die Untersuchung ist selbst von der Verdrängungsthese ausgegangen. An ihrem Beginn stand das Interesse, die Gründe dieser Verdrängung zu finden und die Prozesse zu rekonstruieren, in denen sie sich vollzogen hat. Im Verlauf der Forschung hat sich aber herausgestellt, dass diese These auf einem historischen Bild von der Soziologie beruht, das wesentliche Aspekte außer Acht lässt. Dieses Bild ist das einer professionellen Fachwissenschaft, die sich im Verlauf der Nachkriegsjahrzehnte ausdifferenziert und an den Universitäten institutionalisiert hat. Dabei hat sie, so die Annahme, durch ihren starken Gegenwartsbezug den Nationalsozialismus aus der Gesellschaftsanalyse ausgeklammert.
Ändert man den Blick auf die Soziologie, so erscheint auch das Verhältnis zum Nationalsozialismus in einem anderen Licht. Untersucht man die Soziologie als ein zivilgesellschaftliches Feld, in dem Auseinandersetzungen über die Durchsetzung legitimer Gesellschaftsbilder stattfinden, dann wird sichtbar, dass der Nationalsozialismus dabei in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten ein wesentlicher Bezugspunkt gewesen ist. An die Stelle der Verdrängungsthese tritt dann die folgende Erkenntnis:
In der Zeit von 1945 bis 1968 war der Nationalsozialismus ein zentraler Gegenstand der Auseinandersetzung im soziologischen Feld und ein maßgeblicher Bezugspunkt bei der Herausbildung konkurrierender Soziologiekonzeptionen. Die konfliktäre Bezugnahme auf den Nationalsozialismus war ein wesentliches Movens der Feldentwicklung. Erst in den 1970er Jahren, mit dem Übergang in eine neue Phase der Disziplin, verlor der Nationalsozialismus an Bedeutung für die Entwicklung des Feldes.
Mit dieser Erkenntnis wird noch einmal neues Licht auf eine oft diskutierte Frage geworfen. Die Studie stellt eine kritische Intervention in den fachgeschichtlichen Diskurs dar, in dem die Verdrängungsthese weithin geteilt wird – ein Prozess, an dem ich selbst beteiligt gewesen bin. Dagegen soll im Folgenden gezeigt werden, dass nicht der Nationalsozialismus in der bundesrepublikanischen Nachkriegssoziologie verdrängt wurde; vielmehr wird heute eine Phase historisch marginalisiert, in der die Soziologie ein Feld gesellschaftspolitischer Praxis war, in dem kontinuierliche Auseinandersetzungen um den Nationalsozialismus stattgefunden haben.
Bei genauem Hinsehen ist die Vorstellung einer Verdrängung des Nationalsozialismus aus der Soziologie erstaunlich: Denn die Soziologie der Nachkriegsjahrzehnte wird gemeinhin als Demokratisierungswissenschaft verstanden. Ihr wird eine Schlüsselrolle für die Herausbildung einer demokratischen Gesellschaft zugesprochen. Doch die politische Kultur der Bundesrepublik bildete sich in beständigen Konflikten um den Nationalsozialismus heraus (vgl. Herz/Schwab-Trapp 1997a).
Die Bundesrepublik ist eine postnationalsozialistische Gesellschaft. Dabei bezieht sich dieser Begriff nicht auf einen eingrenzbaren Zeitabschnitt, sondern auf »das Weiterwirken des Nationalsozialismus« in der Gegenwart (Messerschmidt 2009: 144). Dieses Weiterwirken, so möchte ich hinzufügen, wird vor allem in der andauernden Generierung und Strukturierung gesellschaftlicher Konflikte sichtbar, die sich auf die Gegenwart beziehen, konkreter: Auf die Demokratisierung von Staat und Gesellschaft der Bundesrepublik. Der Nationalsozialismus war und ist in der bundesrepublikanischen Gesellschaft stets ein prägender Faktor der Gegenwart. Die deutsche Gesellschaft war und ist beständig mit ihrer Genese aus dem Nationalsozialismus konfrontiert. Damit sind Konflikte um antagonistische Geschichtsbilder und konkurrierende Demokratiekonzeptionen verbunden. Postnationalsozialismus ist also nicht als »Epochenbegriff« zu verstehen, sondern als eine »Analysekategorie« (ebd.).
Mein Ansatz ist, die Entwicklung des soziologischen Feldes in diesen Konflikten zu verorten. Ich schlage also vor, die westdeutsche Soziologie als postnationalsozialistische Soziologie zu untersuchen. Dabei zeigt sich, dass sie selbst ein Feld gesellschaftlicher Konflikte war und zugleich von solchen Konflikten in ihrer Entwicklung geprägt wurde; sie war ein immanenter Bestandteil der Herausbildung der politischen Kultur der Bundesrepublik. Stimmen diese Annahmen, dann schließt sich daran die Vermutung an, dass die in dieser Gesellschaft entwickelten Konzeptionen von Soziologie selbst von diesen postnationalsozialistischen Verhältnissen geprägt sein müssen. Das soll im Folgenden geprüft werden.
In Kapitel I.1 lege ich den Forschungsstand zum Verhältnis von Soziologie und Nationalsozialismus dar. Dabei gehe ich zunächst auf die Soziologie in der Weimarer Republik, die Entwicklung der Disziplin im Nationalsozialismus und das deutschsprachige Exil ein. Diese Abschnitte können zugleich als Vorgeschichte meiner Untersuchung gelesen werden. Der Forschungsstand zur bundesrepublikanischen Soziologie zeigt, dass sich in den letzten Jahrzehnten ein umfangreicher Diskurs um das Thema entwickelt hat. Die von mir vorgeschlagene Untersuchungsperspektive aber erweist sich als Desiderat dieser Forschungen.
In Kapitel I.2 entwickle ich meine theoretische Perspektive im Anschluss an Alex Demirović und Pierre Bourdieu. Ich verstehe die Soziologie als immanenten Bestandteil ihres Gegenstands; sie hat, so die praxistheoretische Annahme, einen konstitutiven Effekt für die Entwicklung der Gesellschaft. Soziologie- und Gesellschaftsgeschichte sind demzufolge eng miteinander vermittelt. Im Feld der Soziologie finden Konflikte um die Legitimität und Geltung von Aussagen über die Gesellschaft statt. In diesem Sinne ist die Studie auch ein Beitrag zur Untersuchung des gesellschaftlichen Umgangs mit dem Nationalsozialismus.
Anschließend gebe ich in Kapitel I.3 einen Überblick über das verwendete Material.
Teil II ist der Zeit vom Kriegsende bis ins letzte Drittel der 1950er Jahre gewidmet – wobei die hier gewählte Phaseneinteilung sich naturgemäß nicht in Gänze mit der Chronologie der historischen Ereignisse deckt. Ich frage zunächst nach der Bedeutung der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus für die Neukonstituierung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (Kapitel II.1). Im Nachkriegsjahrzehnt waren zahlreiche amerikanische SozialwissenschaftlerInnen in militärischer und ziviler Funktion in Deutschland und wirkten bei der Neuformierung des soziologischen Feldes mit. Ihren Beobachtungen über die postnationalsozialistische Gesellschaft und deren Aussichten auf Demokratisierung widme ich das anschließende Kapitel (Kapitel II.2). Sodann nehme ich die Etablierung der Soziologie als akademische Disziplin in den Blick und frage, welche Bedeutung die Konflikte um den Nationalsozialismus für diesen Prozess hatten (Kapitel II.3). Zahlreiche SoziologInnen nahmen am publizistischen Diskurs des Nachkriegsjahrzehnts teil. Einerseits trugen sie damit zur »Versozialwissenschaftlichung« (Schäfer 2015: 5) der gesellschaftlichen Selbstverständigung bei, andererseits entwickelten sie in diesen Foren ihre gesellschaftspolitischen Positionen. Dabei spielten Debatten über den Umgang mit dem Nationalsozialismus und die Herausbildung der bundesrepublikanischen Demokratie eine zentrale Rolle, wie ich an drei Beispielen zeige: Den Debatten über die Mitverantwortung der Wissenschaft für den Nationalsozialismus, über politischen Defaitismus und über die politische und gesellschaftliche Restauration (Kapitel II.4). Abschließend nehme ich mit der empirischen Sozialforschung des Nachkriegsjahrzehnts jenen Aspekt in den Blick, der gemeinhin als das Herzstück der Soziologie in dieser Phase angesehen wird. Entgegen der Vorstellung einer Ausblendung des Nationalsozialismus aus der Forschung zeige ich an drei klassischen Studien (»Das Gesellschaftsbild des Arbeiters«; »Wandlungen der deutschen Familie in der Gegenwart«; »Gruppenexperiment«), zwei unveröffentlichten Untersuchungen (den sogenannten »Heimkehrerstudien« des Instituts für Sozialforschung) sowie einer zentralen Debatte (über die Nachkriegsjugend), dass Bezugnahmen auf den Nationalsozialismus prägend für die empirische Forschung waren und zu wissenschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen führten (Kapitel II.5).
Teil III ist der Entwicklung des soziologischen Feldes zwischen 1958 und 1968 gewidmet. Dieses Jahrzehnt gilt als neue Phase im gesellschaftlichen Umgang mit der NS-Vergangenheit, die zunehmend Gegenstand öffentlicher Konflikte wurde. Die Soziologie war, so mein übergreifendes Argument, ein integraler Bestandteil dieser Entwicklung. Feldintern ergibt sich diese Periodisierung, wie ausführlich zu zeigen sein wird, durch die zu diesem Zeitpunkt eintretende Veränderung NS-bezogener Konflikte, die auch in der Genese des soziologischen Feldes eine neue Phase einläuteten.
Ich verfolge zunächst die Entwicklung dieser Konflikte, die sich in dieser Phase zuspitzten und zunehmend öffentlich ausgetragen wurden. Auseinandersetzungen um die nationalsozialistische Vergangenheit waren zugleich solche um die gegenwärtige Hegemonie im Feld und prägten ein Jahrzehnt lang dessen institutionelle Entwicklung. Sie fanden Ausdruck in einer Reihe wichtiger institutionell-politischer Ereignisse im Feld bis zum Soziologentag 1968 und verdichteten sich in den zentralen wissenschaftstheoretischen Debatten um Positivismus und Wertfreiheit. Währenddessen wurde insbesondere von jüngeren Akteuren das Projekt einer fachlichen Professionalisierung der Soziologie formuliert. Damit wurde das vorherrschende Paradigma einer politisch-intellektuell engagierten Wissenschaft, das mit den NS-bezogenen Konflikten verbunden war, zunehmend in Frage gestellt (Kapitel III.1). Am Ende der 1950er Jahre war die Soziologie eine etablierte Disziplin und befand sich in einem Prozess der zunehmenden Ausdifferenzierung. In den folgenden Jahren lösten sich die prägenden Koalitions- und Konfliktkonstellationen des ersten Nachkriegsjahrzehnts nach und nach auf. Die Dynamik dieser Entwicklungen führte dazu, dass die zentralen Akteure ihre Konzeptionen von Soziologie ausformulierten. Diese Konzeptionen waren auf das Engste vermittelt mit ihren Geschichtsdeutungen, Demokratievorstellungen und gesellschaftstheoretischen Grundannahmen. So entstanden zwischen dem Ende der 1950er und der Mitte der 1960er Jahre eine Reihe von konkurrierenden »Ortsbestimmungen« der bundesrepublikanischen Soziologie und ihrer Funktion in der postnationalsozialistischen Gesellschaft. Diese repräsentierten zugleich unterschiedliche gesellschaftliche Standpunkte zum Verhältnis zwischen Demokratie und Nationalsozialismus (Kapitel III.2). Ab dem Ende der 1950er Jahre formierte sich eine Koalition gesellschaftskritischer Akteure, die den öffentlichen Umgang mit der NS-Vergangenheit skandalisierte und sich für eine Aufarbeitung des Nationalsozialismus sowie seiner Kontinuitäten und Wirkungen in der Gegenwart einsetzte. Die Soziologie war ein zentrales Praxisfeld dieser Koalition und der daraus entstehenden Protestbewegung. Ich rekonstruiere zunächst die unterschiedlichen Ebenen der Auseinandersetzung dieser Bewegung mit dem Nationalsozialismus im soziologischen Feld. Anschließend gehe ich drei thematischen Diskursen nach, die daraus hervorgegangen sind: Den Debatten über Antisemitismus, über Faschismustheorien sowie über Rechtsextremismus (Kapitel III.3).
Die Untersuchung in den Teilen II und III zeigt, dass der Nationalsozialismus ein zentraler Bezugspunkt in der Entwicklung des soziologischen Feldes von 1945 bis 1968 war. Das soziologische Feld war Austragungsort politisch-intellektueller Konflikte um die postnationalsozialistische Demokratisierung der Bundesrepublik. Mit dem Soziologentag 1968 kam die geschilderte Entwicklung im soziologischen Feld zum Ende, die Tagung bedeutete einen Wendepunkt für die Disziplin – und markiert als solcher auch den chronologischen Endpunkt der vorliegenden Untersuchung. In der Folge setzte sich ein verändertes Verständnis von Soziologie als fachlich-professioneller Einzelwissenschaft durch. Wie aber entstand, so ist vor diesem Hintergrund zu fragen, die Vorstellung von der Verdrängung des Nationalsozialismus aus der Soziologie? Dem gehe ich in einem Epilog nach (Kapitel IV).
I.1Stand der Forschung
Das Verhältnis von Soziologie und Nationalsozialismus in Deutschland ist analytisch auf zwei Ebenen untersucht worden. Die erste Ebene ist die der Fach- bzw. Disziplingeschichte. Die zweite Ebene ist die Frage nach dem Nationalsozialismus als Forschungsgegenstand der Soziologie. Dabei sind diese Ebenen eng miteinander verwoben; so wird etwa bei der Diskussion um das vermeintliche Ausbleiben soziologischer NS-Forschung immer wieder auf in der Fachgeschichte liegende Gründe verwiesen (vgl. z. B. Christ 2011), während für die Analyse der Fachgeschichte umgekehrt ein soziologisches Verständnis des Nationalsozialismus als zentral erachtet wird (vgl. z. B. Klingemann 2009).
Neben dieser Trennung zweier Untersuchungsebenen orientiert sich die Forschung zudem an periodischen Abgrenzungen, die sich im Kern aus den historischen Zäsuren ergeben, die auch für die Gestalt und Entwicklung der Soziologie von unmittelbarer Bedeutung waren. So sind die Entwicklung der Soziologie in der Weimarer Republik, im Nationalsozialismus und in der frühen Bundesrepublik getrennt voneinander untersucht worden, wenngleich die Übergänge, Kontinuitäten und Brüche natürlich häufig mit in den Blick genommen worden sind – zumeist als Vor- bzw. Nachgeschichte der je untersuchten Epoche. Zudem ist das deutschsprachige Exil zu nennen, das zumeist als eigenständige Formation innerhalb der Geschichte der Soziologie verstanden wird.1
Die Frage nach dem Verhältnis der Soziologie zum Nationalsozialismus hat innerhalb der Disziplin stets polarisiert, die disziplingeschichtliche Forschung wurde von Beginn an von scharf, bisweilen sogar persönlich geführten Debatten begleitet. Dies gilt bis in die Gegenwart, wie sich an der bislang letzten großen Diskussion ablesen lässt, die 2011 durch einen Beitrag von Michaela Christ ausgelöst wurde (vgl. Christ 2011; Christ/Suderland 2014a).2 Die Gegenstände des Streits haben sich dabei allerdings verändert, wie ich im Folgenden zeigen werde. In diesen Hinsichten unterscheiden sich die fachinternen Diskussionen nicht von Debatten über den Nationalsozialismus in anderen gesellschaftlichen Feldern.
Die große Aufmerksamkeit, die diese Kontroversen jeweils kurzzeitig erregt haben, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich stets nur eine sehr kleine Minderheit der professionellen SoziologInnen3 für das Thema interessiert und dessen Erforschung gewidmet hat (vgl. Borggräfe/Schnitzler 2014: 447 f.).
Die folgende Skizze des Forschungsstands hat drei Ziele: Einerseits dient sie, in den Abschnitten über die Weimarer Republik, den Nationalsozialismus und das Exil, zugleich als Vorgeschichte meiner Untersuchung. Andererseits hebe ich vor allem solche Aspekte hervor, die ich im Verlauf der Arbeit noch einmal aufgreife. Abschließend identifiziere ich das aus meiner Sicht maßgebliche Desiderat einer Untersuchung der westdeutschen bzw. bundesrepublikanischen Soziologie in ihrem Verhältnis zum Nationalsozialismus.
I.1.1Die Soziologie in der Weimarer Republik4
Die Soziologie wurde von den liberalen Eliten der Weimarer Republik als Verbündete im Kampf um die Demokratie angesehen und als solche in ihrer Institutionalisierung gefördert. Von ihr wurden mehr und schlüssigere Antworten auf die drängenden Zeitfragen erwartet als vom konservativen geisteswissenschaftlichen Establishment (vgl. Käsler 1984: 262 f.). Wenngleich die fachliche Konsolidierung in der Weimarer Republik prekär blieb, Lehrstühle für Soziologie fast ausschließlich in Kombination mit anderen Fächern bestanden (vgl. Berking 1983: 40) und die GründerInnen der Disziplin – darunter Max Weber, Ferdinand Tönnies und Georg Simmel – akademisch andere Disziplinen wie die Nationalökonomie oder die Philosophie vertraten (vgl. ebd.: 39), so erlebte die Soziologie in der kurzen Zeit der Weimarer Republik doch einen beachtlichen Aufschwung. Die Zahl der Ordinarien stieg von drei im Jahr 1919 auf 17 im Jahr 1932/33, dazu kamen 25 außerplanmäßige oder Honorarprofessoren sowie PrivatdozentInnen (vgl. Käsler 1984: 256). Es entstanden sozialwissenschaftliche Institute (etwa in Köln, Berlin und Frankfurt), zahlreiche Zeitschriften und – als Ausweis disziplinärer Emanzipation – das von Alfred Vierkandt herausgegebene Handwörterbuch der Soziologie (vgl. Berking 1983: 40 f.), so dass die Soziologie 1933 »in ihrem institutionellen Konsolidierungsprozeß weit fortgeschritten« war (Stölting 1986: 343).
Den Erwartungen von liberaler Seite konnte die Soziologie dennoch nicht gerecht werden. Denn die SoziologInnen waren von Beginn an »nicht nur in die organisatorische Struktur der Universität, sondern zugleich in die normative Struktur des akademischen Milieus eingebunden« (Berking 1983: 39), sie waren Teil jener bildungsbürgerlichen Schicht, die Fritz K. Ringer als die »deutschen Mandarine« bezeichnet hat.5 Diese Verortung präformierte auch ihre Wahrnehmungen der gesellschaftlichen Veränderungen der Zwischenkriegszeit. Sie erfuhren »den gesellschaftsstrukturellen und soziokulturellen Wandel vor allem als Auflösungsprozeß« (ebd.: 50) von Kultur, Geist und Gemeinschaft in einer zweckrationalen Massengesellschaft, der zugleich ihr »geistesaristokratisch[es]« (ebd.: 52) Selbstverständnis in Frage zu stellen drohte. Damit gewann die Vorstellung von der ›Volksgemeinschaft‹ für die deutsche Intelligenz eine große Anziehungskraft. Die Hoffnung auf eine neue Einheit der in Klassen gespaltenen Gesellschaft wurde vor diesem Hintergrund auch von vielen SoziologInnen geteilt (vgl. Käsler 1984: 479 ff.; Papcke 1986: 185). Die soziologischen Theorien dieser Epoche müssen in diesem Kontext verstanden werden. »Wie in der Thematik der Gemeinschaft, erscheint auch in der von ›Masse‹ und ›Führer‹ die soziologische Theorie eingebunden in einen gesellschaftlichen Diskurs«, so Stölting (1986: 362). Auch wenn sich unter den SoziologInnen noch verhältnismäßig viele »Vernunftrepublikaner« (Käsler 1984: 225) befanden, schätzt Käsler, dass zwei Drittel der Weimarer SoziologInnen die Republik nicht als ihre politische Heimat ansahen (vgl. ebd.: 504). Der allgemeine Patriotismus, die Idee einer Einheit der Nation in äußerer Größe, der Gedanke einer Gemeinschaft über und jenseits der Klassengesellschaft und der Parteiendemokratie, all das führte dazu, dass die Universitäten und auch ihre SoziologInnen dem Nationalsozialismus nichts entgegenzusetzen hatten und viele ihn sogar begrüßten (vgl. ebd.: 502 ff.). Mit der neuidealistischen antikapitalistischen Sehnsucht der konservativen Kulturkritik war zudem ein endemischer Antisemitismus verbunden, der eine »Gestalt des Juden« imaginierte, »in dem alle Züge, die an der gegenwärtigen Gesellschaft hassenswert schienen, amalgamiert wurden« (Stölting 1986: 77).
Demgegenüber setzten sich nur wenige SoziologInnen ernsthaft analytisch und deutend mit dem Nationalsozialismus auseinander (vgl. Stölting 2014: 35). Diese waren zumeist – wenngleich nicht ausschließlich – entweder Außenseiter des Fachs oder jüngere WissenschaftlerInnen, die (noch) nicht in akademischen Positionen waren (vgl. Papcke 1986: 203). Auch unter ihnen finden sich Sympathisanten des Faschismus bzw. des Nationalsozialismus, etwa Johann Plenge, Robert Michels und Hans Freyer (vgl. Stölting 2014: 49, 58, 64). Überwiegend aber waren sie politisch aktive GegnerInnen des Nationalsozialismus. So war die sozialdemokratische Debatte über den Nationalsozialismus der einzige kontinuierliche Diskussionszusammenhang, an dem auch SozialwissenschaftlerInnen teilhatten (vgl. Käsler/Steiner 1992: 117). Dagegen wurden auf keinem der vier Soziologentage zwischen 1922 und 1933 der Nationalsozialismus oder der Faschismus thematisiert, auf den fünf Tagungen des Vereins für Socialpolitik und den neun Generalversammlungen der Vereinigung der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Hochschullehrer bot sich das gleiche Bild. In der Lehre sah es ähnlich aus, nur fünf sozialwissenschaftliche Veranstaltungen fanden in dieser Zeit explizit zum Thema Faschismus statt. Und auch in den einschlägigen Zeitschriften lassen sich kaum Beiträge zum Thema finden (vgl. Papcke 1986: 198 ff.).
Erhard Stölting hat als die maßgeblichen Themen bzw. analytischen Perspektiven dieser soziologischen Untersuchungen aus der Zeit der späten Weimarer Republik die sozialstrukturelle Basis der NS-Bewegung, die Deutung des Nationalsozialismus als Faschismus, um das Begriffspaar von Masse und Führer gebildete Massentheorien sowie Propagandatheorien herausgearbeitet (vgl. Stölting 2014).
Einige der wichtigsten soziologischen Studien mit Bezug auf den Nationalsozialismus konnten aufgrund der politischen Entwicklungen nicht mehr erscheinen, so etwa Hans Speiers »Die Angestellten vor dem Nationalsozialismus« (Speier 1977), Rudolf Heberles »Landbevölkerung und Nationalsozialismus« (Heberle 1963) oder Erich Fromms »Arbeiter und Angestellte am Vorabend des Dritten Reiches« (Fromm 1983).
Wenngleich Stölting vielen dieser Analysen eine große Hellsichtigkeit und eine überdauernde Gültigkeit zuspricht, so konstatiert er dennoch »eine spezifische zeittypische Blindheit für das, was sich anbahnte« (Stölting 2014: 44), insbesondere, aber nicht nur mit Blick auf den Antisemitismus (vgl. ebd.: 44) – »offenbar war das, was kommen sollte, kaum vorstellbar« (ebd.: 35).
Der Bestand einer kritischen soziologischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus aus der Weimarer Republik, auf den etwa bundesrepublikanische SoziologInnen hätten zurückgreifen können, ist mithin eher gering.
I.1.2Die Soziologie im Nationalsozialismus6
Die Soziologie im Nationalsozialismus kann zugleich als eines der am besten erforschten und am heftigsten umstrittenen Kapitel in der Geschichte der deutschsprachigen Soziologie gelten. Ihre breit angelegte, empirische Erforschung hat, mit wenigen Vorläufern, erst in den 1980er Jahren begonnen (vgl. Schauer 2018: 120). Sie war mit der jahrzehntelang dominanten – und bis heute vereinzelt vertretenen (vgl. z. B. Gerhardt 2006: 32; 2009a: 179 ff.) – Behauptung konfrontiert, Soziologie habe es im Nationalsozialismus nicht gegeben. Bestritten wurde dabei allerdings nicht die Existenz, sondern vielmehr der Wissenschaftscharakter der unter dem Namen Soziologie betriebenen Forschung (vgl. Rehberg 1992: 30 f.). Demgegenüber hat die soziologiegeschichtliche Forschung überzeugend nachgewiesen, dass die nationalsozialistische Machtübernahme zwar tiefgreifende Konsequenzen für die Soziologie hatte, von ihrem Ende aber mitnichten die Rede sein kann. Vielmehr kam es zu weitreichenden Veränderungen auf personeller und institutioneller Ebene sowie in Bezug auf die Wissenschaftsgestalt der Soziologie.
I.1.2.1Die Deutsche Gesellschaft für Soziologie
Das lässt sich zunächst an den Ereignissen innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Soziologie ablesen, die Henning Borggräfe und Sonja Schnitzler (vgl. Borggräfe/Schnitzler 2014), aufbauend auf Untersuchungen von Carsten Klingemann (vgl. Klingemann 1996: 11 ff.), im Detail rekonstruiert haben. Sie stellen fest, »dass es in der Entwicklung der DGS, anders als in anderen Gesellschaftsbereichen, aber auch in anderen Wissenschaftsorganisationen, nach der Machtübernahme tatsächlich schnell zu einem tiefgreifenden Einschnitt kam« (ebd.: 450). Zunächst versuchte eine Gruppe pronationalsozialistischer SoziologInnen um den in Jena lehrenden Franz Wilhelm Jerusalem und seinen Assistenten Reinhard Höhn die neuen Machtverhältnisse zu nutzen, um innerhalb der DGS organisatorischen und inhaltlichen Einfluss zu gewinnen (vgl. Borggräfe/Schnitzler 2014: 451 f.). Diesem Versuch begegnete der damalige Erste Schriftführer der Gesellschaft Leopold von Wiese (vgl. ebd.: 455 f.) mit einer Strategie der »Selbstgleichschaltung« (Klingemann 1996: 11; vgl. Borggräfe/Schnitzler 2014: 452), die nicht nur die Absetzung von Ferdinand Tönnies als Präsident beinhaltete, sondern auch den Ausschluss aller »Wissenschaftler, die aus politischen und rassischen Gründen ihre berufliche Stellung verloren hatten und/oder emigriert waren« (Borggräfe/Schnitzler 2014: 452), aus dem Rat der DGS. Der vehemente Protest des antinationalsozialistischen Tönnies führte zwar zur Rücknahme des den Rat betreffenden Beschlusses (vgl. ebd.: 453), konnte aber die entstandene Konfliktkonstellation nicht entschärfen. Borggräfe und Schnitzler zufolge konkurrierten drei verschiedene Lager um die Macht in der DGS: Zunächst Leopold von Wiese, dessen Anpassungsbereitschaft durch die missglückte »Selbstgleichschaltung« dokumentiert ist; sodann eine Gruppe völkisch orientierter DisziplinvertreterInnen, die »die DGS als Wissenschaftsorganisation zwar bewahren wollten, aber die alte Führung nicht mehr akzeptierten« (ebd.: 455); schließlich eine kleine Fraktion pronationalsozialistischer SoziologInnen – insbesondere die schon erwähnten Jerusalem und Höhn, bisherige Außenseiter des Fachs, die die Soziologie noch deutlich stärker politisch ausrichten und dafür die DGS unter ihre Kontrolle bringen wollten (vgl. ebd.: 455). Dabei unterschieden sich die beiden letztgenannten Fraktionen nicht in ihrer Haltung zum Nationalsozialismus, sondern in ihren Vorstellungen über die Rolle der Soziologie im NS-Staat (vgl. ebd.: 458). Im Ergebnis dieses Machtkampfs wurde Hans Freyer zum »Führer« der DGS gewählt; er rief auch zur Teilnahme an dem von der Fraktion um Jerusalem und Höhn organisierten SoziologInnentreffen auf, das im Januar 1934 in Jena stattfand (vgl. ebd.: 456; vgl. van Dyk/Schauer 2008). Anschließend kam es zwischen Freyer und Höhn zu einer »Pattsituation« (Borggräfe/Schnitzler 2014: 457), in deren Folge die DGS alle Aktivitäten einstellte, allerdings nicht aufhörte zu existieren (vgl. ebd.: 456 ff.). Borggräfe und Schnitzler heben hervor, dass zwar dieses Resultat ungewöhnlich war, keineswegs aber die vorhergehenden Auseinandersetzungen, die sich in vielen Organisationen in ähnlicher Weise abspielten (vgl. ebd.: 455, 458).
I.1.2.2Emigration und Vertreibung
Noch bevor der Machtkampf zwischen den pronationalsozialistischen und den anpassungsbereiten DisziplinvertreterInnen innerhalb der DGS seine Dynamik voll entfaltete, wurden bereits zahlreiche SoziologInnen Opfer des am 7. April 1933 erlassenen »Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums« (vgl. Schauer 2018: 123). Ein großer Teil der in Deutschland als SoziologInnen forschenden und lehrenden WissenschaftlerInnen musste nach 1933 erzwungenermaßen ins Exil gehen, weil sie entweder als Juden und Jüdinnen verfolgt wurden oder in politischer Opposition zum Nationalsozialismus standen.7 Die bekanntesten Namen darunter sind häufig genannt worden: Theodor W. Adorno, Norbert Elias, Theodor Geiger, Hans Heinrich Gerth, Max Horkheimer, René König, Emil Lederer, Karl Mannheim, Helmuth Plessner und Hans Speier. Damit verschwanden die Kultur- und Wissenssoziologie ebenso wie die marxistische Gesellschaftstheorie, die die Zentren der Weimarer Soziologie als maßgebliche Perspektiven geprägt hatten, aus den deutschen Universitäten.
I.1.2.3Die Wissenschaftsgestalt der Soziologie
Der Versuch der dem Nationalsozialismus positiv gegenüberstehenden SoziologInnen, »eine auf Volk, Gemeinschaft, Führerschaft und Staat orientierte Soziologie dem Nationalsozialismus als ideologische Hilfswissenschaft anzudienen« (Schauer 2018: 132), wie er auf dem Jenaer Soziologentreffen im Januar 1934 angestrebt wurde (vgl. Borggräfe/Schnitzler 2014: 451 ff.; Schauer 2018: 132 ff.; van Dyk/Schauer 2015: 62 ff.), scheiterte aber sehr bald. Alexandra Schauer erklärt diese Tatsache mit der polykratischen Herrschaftsstruktur des Nationalsozialismus. Diese führte zu einer »andauernde[n] Unsicherheit darüber […], welche Theorie die ›wahrhaft nationalsozialistische Wissenschaft‹ repräsentierte«. Diese Frage konnte zugleich nicht öffentlich diskutiert werden, »ohne den monolithischen Charakter der nationalsozialistischen Ideologie und ihren absoluten Wahrheitsanspruch in Frage zu stellen« (Schauer 2018: 135). Ideologische Führungsansprüche wurden so nicht nur von den maßgeblichen nationalsozialistischen Staats- und Parteiorganen zurückgewiesen (vgl. ebd.: 136), sie scheiterten zugleich an den »disparate[n] Theorien und Gesellschaftsvorstellungen« der SoziologInnen selbst (ebd.: 135 f.).
In der Folge war es dann die Generation der SchülerInnen der gescheiterten GemeinschaftssoziologInnen, die eine »außeruniversitäre Professionalisierung soziologischen Expert/innenwissens in diversen Politikfeldern des ›Dritten Reichs‹« (Klingemann 2014: 480; vgl. Schauer 2018: 137 ff.) vorantrieb. Institutionellen Ausdruck fand dies in der Gründung zahlreicher Forschungsinstitute.8 Damit ging ein Wandel soziologischer Wissenskultur einerseits, des Sozialcharakters der SoziologInnen andererseits einher: spezialisierte, sozialtechnologisch versierte ExpertInnen, die anwendbares, herrschaftsrelevantes Wissen bereitstellen konnten, lösten die traditionellen, bildungsbürgerlichen Gelehrten ab (vgl. Schauer 2018: 141). Jörg Gutberger formuliert vor dem Hintergrund seiner umfangreichen Untersuchungen zur Sozialstruktur- und Sozialraumforschung im Nationalsozialismus:
»Sozialwissenschaftliche Forschung unter dem Nationalsozialismus verschrieb sich darum weniger der Legitimation ideologischer Lehrsätze, als vielmehr der Transformation der nationalsozialistischen Gesellschaftsutopie- und Zukunftsvorstellungen in eine bürokratisch-handhabbare Herrschaftsstrategie.« (Gutberger 1996: 268)
Alexandra Schauer hat dies als »innersoziologische[…] Modernisierung« (Schauer 2018: 121) bezeichnet. Sichtbar wird, dass die Soziologie in ihrer Entwicklung im Nationalsozialismus keine Ausnahme im Feld der Wissenschaften darstellte, denn, so Mitchell G. Ash, in vielen Disziplinen und Forschungsfeldern kam es im Zuge von deren »Neuverflechtung« (Ash 1995: 904) in die neuen politischen Verhältnisse zu „,Selbstmobilisierungen‹« (Mehrtens, zit. nach ebd.: 903), wobei Ash Politik und Wissenschaft als je füreinander einsetzbare Ressourcen begreift (vgl. ebd.: 904 f.) und argumentiert, dass politische Systemwechsel zur »Umgestaltung von Ressourcenkonstellationen« (ebd.: 904) führen (vgl. auch Weisbrod 2002: 18 f., 30 f.).
I.1.3Das deutschsprachige Exil
Die sozialwissenschaftliche Emigration, die der Nationalsozialismus ausgelöst hat, hat die intellektuellen Felder in den Herkunfts- ebenso wie in den Aufnahmeländern auf Jahrzehnte geprägt. M. Rainer Lepsius hat darauf hingewiesen, dass es sich bei der Emigration um einen Prozess handelte, der das gesamte deutschsprachige Mitteleuropa erfasste und über einen Zeitraum von ca. acht Jahren immer neue Länder betraf, die unter die Herrschaft des Nationalsozialismus gerieten. Die Emigration begann bereits 1932, hatte einen ersten Höhepunkt im Zuge des Erlasses des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, und setzte sich dann in Österreich und weiteren Teilen Mitteleuropas fort. Schließlich erreichte diese Entwicklung als »sekundäre Emigration« jene Länder, in denen viele EmigrantInnen zunächst Zuflucht gefunden hatten, etwa Frankreich und die Niederlande (vgl. Lepsius 1981b: 461; vgl. auch Fleck 1998: 893 ff.). So sammelten sich die meisten EmigrantInnen ab Ende der 1930er Jahre in den USA, wo sich in New York vier institutionelle Zentren herausbildeten: Das Institute for Social Research (Institut für Sozialforschung), die University in Exile/Graduate Faculty der New School for Social Research, das Bureau of Applied Social Research und das Institute for World Affairs (vgl. Papcke 2018: 151). Bei der Diskussion der Leistungen und des Einflusses der deutschsprachigen Emigration werden zumeist die Sozialwissenschaften insgesamt in den Blick genommen; starre Disziplingrenzen werden weder den Feldentwicklungen noch den theoretischen Ansätzen der EmigrantInnen gerecht.9 Nicht eindeutig zu bestimmen ist das Ende des Exils, denn es stellt sich die Frage, bis wann die Arbeiten der EmigrantInnen »als Exilsoziologie zu gelten haben« und ab wann sie »dem Normaloutput der Aufnahmeländer zuzurechnen sind« (ebd.: 150). Eine klare Abgrenzung ist, auch aufgrund einer oft erst späten Remigration, nicht möglich.
Im Zentrum der Arbeiten der deutschsprachigen ExilantInnen stand die Auseinandersetzung mit der deutsch-europäischen Entwicklung. »Die ältere Emigrantengeneration«, so Lepsius, »verbindet ein Thema, der Versuch, die Voraussetzungen, Funktionsbedingungen und Folgen des Nationalsozialismus zu erklären. Die bedeutendste wissenschaftliche Leistung der Emigranten als Gruppe ist die dadurch eingeleitete ›Totalitarismusforschung‹ im weitesten Sinne.« (Lepsius 1981b: 472; vgl. auch Cobet 1988: 12 f.)
M. Rainer Lepsius und Ilja Srubar haben jeweils Überblicke über diese Forschungen vorgelegt und deren zentrale Themen herausgearbeitet, die sich nicht immer scharf abgrenzen lassen bzw. zum Teil im Werk hier genannter AutorInnen gemeinsam bearbeitet wurden:10 Das erste Thema ist der »Zusammenhang von Wirtschaftsordnung und totalitärem System« (Lepsius 1981b: 474). Dabei stehen sich marxistische und liberale Analysen gegenüber,11 wobei die Vertreter liberaler Wirtschaftstheorien (von Hayek, Mises, Röpke, Rüstow) großen Einfluss auf die Entwicklung des Konzepts der ›sozialen Marktwirtschaft‹ hatten und so zu den wenigen ExilvertreterInnen gehören, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit eine Rezeption erfuhren (vgl. Lepsius 1981b; Srubar 1988: 284 ff.). Das zweite Thema ist der Zusammenhang von »Persönlichkeit, Sozialstruktur und politischer Ordnung« in den Forschungen zur »autoritären Persönlichkeit« (Fromm, Horney, die AutorInnengruppe der Authoritarian Personality) (Lepsius 1981b: 474). Das dritte Thema ist die Theorie über die Herausbildung der »Massengesellschaft«, die insbesondere mit den Namen Emil Lederer und Hannah Arendt verbunden ist (vgl. ebd.; Srubar 1988: 284 ff.). Als viertes und fünftes Thema lassen sich die Funktionsanalysen der Demokratie einerseits, des Nationalsozialismus andererseits (als Totalitarismusforschung im engeren Sinne) nennen, die von den gleichen AutorInnen geleistet wurden (Arendt, Fraenkel, Kirchheimer, Franz Neumann, Sigmund Neumann) (vgl. Lepsius 1981b: 475). Das sechste Thema ist die deutsche Sozial-, Kultur- und Geistesgeschichte, aus deren Untersuchung insbesondere die Topoi des deutschen Sonderwegs und der verspäteten Nation hervorgegangen sind (u. a. Plessner, Heimann, Geiger). »Dabei vollzog sich eine Neubewertung der deutschen Geschichte, die als Grundlage einer beginnenden ›Vergangenheitsbewältigung‹ betrachtet werden kann.« (vgl. Srubar 1988: 289 ff., hier: 289) Als siebtes Thema können, mit dem vorherigen sich teilweise überschneidend, die von Lepsius genannten »geistesgeschichtliche[n] und universalhistorische[n] Reflexionen der bürgerlichen Epoche« zählen, worunter er so unterschiedliche Autoren wie Horkheimer und Adorno, Rüstow und Voegelin zusammenfasst (Lepsius 1981b: 475).12
Noch 1981 stellte Lepsius fest, dass diese Arbeiten in Deutschland nicht systematisch analysiert worden seien. In den USA hatten einige der von den EmigrantInnen vorgelegten Analysen eine langandauernde Diskussion nach sich gezogen oder eigene Forschungsfelder begründet, etwa zum autoritären Charakter in der Sozialpsychologie oder zur Demokratieanalyse in der historischen bzw. politischen Soziologie (ebd.: 474 f.). Die Demokratieanalyse fand auch in Deutschland eine Rezeption, allerdings nicht in der Soziologie, sondern in der Politikwissenschaft, für die insbesondere Franz Neumann und Ernst Fraenkel bedeutsam wurden (vgl. Bleek 2001: 275 f., 281). Darüber hinaus sind die meisten Arbeiten kaum zur Kenntnis genommen worden, viele wurden spät oder gar nicht übersetzt (vgl. Lepsius 1981b: 473) und erst im Zuge der Studierendenbewegung rund um 1968 (neu) rezipiert.13 So hat die Hochschätzung der EmigrantInnen eine Kehrseite, die zwar nicht für Lepsius, aber wohl für viele andere gilt:
»Rückblickend könnte es so anmuten, als hätte man jene, die am meisten unter dem Nationalsozialismus gelitten hatten, zu authentischen Stimmen erhoben, um sich – wenigstens halbbewusst – durch eine Art Exterritorialisierung der Beschäftigung mit diesem Thema der eigenen wissenschaftlichen Auseinandersetzung guten Gewissens entziehen zu können.« (Rehberg 2014: 529 f.)
I.1.4Die westdeutsche Soziologie und der Nationalsozialismus
Die Forschung über das Verhältnis der westdeutschen Soziologie zum Nationalsozialismus hat zwei Ausgangspunkte. Erstens ist seit den 1980er Jahren der Umgang der Disziplin mit ihrer Vergangenheit im Nationalsozialismus kritisiert worden. In der Auseinandersetzung mit der Behauptung, es habe keine Soziologie im Nationalsozialismus gegeben, sind nicht nur die oben zusammengefassten Studien entstanden, die detailliert das Gegenteil aufzeigen; in der Folge richtete sich der Blick auch auf personell-institutionelle Kontinuitäten und NS-bezogene Kontroversen in der westdeutschen Nachkriegssoziologie. Zweitens ist in Folge der jüngsten Debatte über das Thema die Marginalität der soziologischen NS-Forschung ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt, die, so Christ, zuvor nicht als Defizit wahrgenommen wurde: »Fast bemerkenswerter noch als die fehlenden Forschungen zum Nationalsozialismus ist die mangelnde Problematisierung dieser Lücke.« (Christ 2011: 411) Allerdings hat es immer wieder Stimmen gegeben, die das Fehlen solcher Forschungen beklagt haben (vgl. Dahrendorf 1965a; Herz 1987; Cobet 1988; Rehberg 1992; Bodemann 1997; Stapelfeldt 2005). Bei der Suche nach den Ursachen ist wiederum auf die Fachgeschichte verwiesen worden, daneben ist aber auch die Frage aufgeworfen worden, ob die theoretischen Paradigmen der Soziologie zur Ausblendung des Nationalsozialismus geführt haben (vgl. Christ 2011: 412; Christ/Suderland 2014b: 20 f.).
Bevor ich mich den einschlägigen Forschungsarbeiten zuwende, sei an dieser Stelle auf einen Aspekt der Fachgeschichtsschreibung verwiesen, der im Folgenden eine wichtige Rolle spielt. Er betrifft die Unterscheidung zwischen der soziologischen »Gründergeneration« der überwiegend zwischen 1900 und 1910 Geborenen (etwa Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, René König, Helmuth Plessner, Helmut Schelsky und Otto Stammer) und der »Nachkriegsgeneration« der überwiegend zwischen 1925 und 1930 Geborenen (etwa Ralf Dahrendorf, Dietrich Goldschmidt, M. Rainer Lepsius, Renate Mayntz, Heinrich Popitz und Erwin K. Scheuch) (vgl. Bude 2002: 408). Während erstere bereits in der Weimarer Republik, sodann im nationalsozialistischen Deutschland bzw. im Exil Soziologie betrieb, begann zweitere ihre Ausbildung nach Kriegsende und rückte Ende der 1950er bzw. Anfang der 1960er Jahre in die Lehrstühle ein (vgl. ebd.: 408). Diese Unterscheidung ist in der soziologiegeschichtlichen Literatur gängig (vgl. Bude 1992; 2002; Bude/Neidhardt 1998). Sie ist aber in zweifacher Hinsicht problematisch: Einerseits, weil sie mit dem Begriff der »Gründergeneration« das Problem der Kontinuität zwischen der Soziologie im Nationalsozialismus und in Westdeutschland in den Hintergrund rückt. Andererseits, und damit zusammenhängend, weil sie die zwischen den genannten Generationen liegenden Jahrgänge, und damit vor allem solche SoziologInnen, die während des Nationalsozialismus mit ihrer soziologischen Arbeit begannen, außer Acht lässt. Dennoch behalte ich diese Unterscheidung bei, wenn es um generationelle Unterschiede oder Gemeinsamkeiten dieser beiden Gruppen geht. Auf biografische Darstellungen verzichte ich im Folgenden aus Platzgründen, soweit diese in der Literatur leicht aufzufinden sind (als Überblick für die Gründergeneration vgl. etwa Weyer (1984: 404 ff.) und Boll (2004: 136 ff.); für die Nachkriegsgeneration vgl. etwa Fleck (1996) sowie Bolte und Neidhardt (1998)); bei anderen Akteuren gebe ich jeweils einen kurzen Überblick.
Henning Borggräfe und Sonja Schnitzler haben, aufbauend auf früheren Studien und anhand eigener Forschungen im Archiv der DGS, die Auseinandersetzungen mit und um den Nationalsozialismus innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in vier Phasen eingeteilt.
Die erste Phase begann Borggräfe und Schnitzler zufolge mit der Neugründung der DGS und reichte bis zur Mitte der 1950er Jahre und damit bis zum Ende der DGS-Präsidentschaft Leopold von Wieses, an dessen Stelle 1955 Helmuth Plessner rückte (vgl. Borggräfe/Schnitzler 2014: 459, 463). Als maßgebliche Entwicklung dieser Phase nennen sie die DGS-internen Auseinandersetzungen um die Belastungskriterien, an die die Mitgliedschaft in der Fachvereinigung geknüpft sein sollte (vgl. ebd.: 460 ff.). Dabei stellt die Soziologie auch hier keine Ausnahme im Feld der Wissenschaften dar. Generell war nicht die Haltung zum Nationalsozialismus entscheidend, vielmehr ging es um die Wiederherstellung von Professionsregeln. »Säuberungen« und Ausschlüsse trafen mithin diejenigen, die gegen diese Regeln verstoßen hatten oder deren Karrieren maßgeblich auf politischen, nicht auf fachlichen Gründen beruhten; im Falle der DGS waren also die Ereignisse vor der »Stilllegung« entscheidend (vgl. ebd.: 460; Klingemann 2008: 3344). Die interne Kritik am vorherrschenden Umgang mit dem Nationalsozialismus, die insbesondere mit dem Namen Heinz Maus verbunden ist, war dagegen marginal; dies ist mehrfach beschrieben worden (vgl. Borggräfe/Schnitzler 2014: 461; Becker 2014: 257 ff.; Christ 2011: 412 f.; Römer et al. 2012). Auf diese Aspekte komme ich in Kapitel II.1. zurück.
Den Beginn der zweiten Phase datieren Borggräfe und Schnitzler auf das Jahr 1955 und die Übernahme der DGS-Präsidentschaft durch den Remigranten Helmuth Plessner. Bis 1967, dem Ende der zweiten Phase, gehörten dem Vorstand der DGS durchgängig sowohl bereits im nationalsozialistischen Deutschland tätige SoziologInnen als auch EmigrantInnen an (vgl. Borggräfe/Schnitzler 2014: 463). In diese Phase fielen drei maßgebliche disziplininterne Auseinandersetzungen: Erstens der von Johannes Weyer rekonstruierte »Bürgerkrieg« in der Soziologie, eine Auseinandersetzung um die internationale Repräsentation der DGS, die zugleich ein Streit um die wissenschaftliche Ausrichtung der Disziplin war und bei der sich RemigrantInnen und während des Nationalsozialismus in Deutschland tätige SoziologInnen gegenüberstanden (vgl. ebd.: 464 ff.; Weyer 1986). Zweitens der »Fall Pfeffer«, der Konflikt um die von Helmut Schelsky durchgesetzte Berufung des ehemaligen Nationalsozialisten Karl-Heinz Pfeffer an die Universität Münster (vgl. Borggräfe/Schnitzler 2014: 466). Und schließlich drittens der »Fall Mühlmann«, der Skandal um den designierten DGS-Vorsitzenden Wilhelm Emil Mühlmann, dessen Wahl aufgrund seiner antisemitischen Positionen letztlich verunmöglicht wurde (vgl. ebd.: 467). Auf diese Aspekte komme ich in Kapitel III.1 zurück.
Mit der Wahl eines neuen DGS-Vorstands 1967, der ausnahmslos aus VertreterInnen der Nachkriegsgeneration bestand, begann Borggräfe und Schnitzler zufolge die dritte Phase, die bis 1979 andauerte (vgl. ebd.: 468 ff.) und insbesondere durch »die heftige Konfrontation mit der Studentenbewegung« (ebd.: 469) sowie die aufkommende Faschismusdiskussion geprägt war (vgl. ebd.). Darauf komme ich in Kapitel III.3 zurück. Zudem geben Borggräfe und Schnitzler den wichtigen Hinweis, dass »der Mythos von der Nichtexistenz der Soziologie im ›Dritten Reich‹« (ebd.: 470) erst in dieser Phase durch die Nachkriegsgeneration festgeschrieben wurde. Dies greife ich in Kapitel IV auf.
In der vierten Phase ab 1979 wurde dieser Mythos im Zuge der neu auflebenden Fachgeschichtsschreibung dekonstruiert (vgl. ebd.: 471 ff.).
Von zentraler Bedeutung an Borggräfes und Schnitzlers Ansatz ist, dass sie ihre Ergebnisse in den Kontext historiografischer Forschungen zur Geschichte und Nachgeschichte des Nationalsozialismus stellen und so die fachgeschichtliche Verengung, die der Diskussion bis heute häufig innewohnt, durchbrechen (vgl. ebd.: 447, 449). An diesen Ansatz schließe ich im Folgenden an.14
Mit Beginn der von Borggräfe und Schnitzler genannten vierten Phase sind, insbesondere von Carsten Klingemann, aber auch in zahlreichen weiteren Arbeiten, die personellen und institutionellen Kontinuitäten der Nachkriegszeit detailliert aufgearbeitet und in ihrer Bedeutung für die Disziplinentwicklung diskutiert worden, wobei die Forschung nicht allein auf die DGS fokussiert war. Im Mittelpunkt standen vor allem die Entwicklung und Praxis der empirischen Sozialforschung und die Frage, ob diese als NS-Kontinuität oder US-amerikanischer15 Kulturtransfer zu deuten sei.
Die erste Position ist allen voran von Carsten Klingemann vertreten worden, der in seinen Forschungen auf »etwa 120 Soziologen der Nachkriegszeit« gestoßen ist, »die bereits vor 1945 fachwissenschaftlich tätig waren oder ihre Ausbildung erhalten haben« (Klingemann 2009: 197). Klingemann bezeichnet diese Gruppe als »ehemalige ›Reichssoziologen‹« (ebd.: passim).16 Diese FachvertreterInnen sind aus seiner Sicht die maßgeblichen Akteure der akademischen und außerakademischen Institutionalisierung der Soziologie in den drei Westzonen und der frühen Bundesrepublik und verantwortlich für die großen Forschungsprojekte dieser Zeit (vgl. ebd.: 276 ff., 284). Zudem betont Klingemann ihre Rolle als LehrerInnen der Nachkriegsgeneration (vgl. ebd.: 17 ff.). Bezüglich dieser Kontinuitäten sind zentrale Akteure wie Helmut Schelsky – zu dem mittlerweile ein eigener Spezialdiskurs geführt wird (vgl. Schäfer 2014; sowie als Überblick Gallus 2013; Wöhrle 2015) – oder Elisabeth Pfeil (vgl. Schnitzler 2012) ebenso untersucht worden wie heute kaum noch bekannte Fachvertreter, beispielsweise Ludwig Neundörfer (vgl. Klingemann 2009: 306-310). Die »ReichssoziologInnen« waren oftmals zugleich die leitenden Personen in wichtigen Institutionen der Sozialforschung. Besondere Aufmerksamkeit hat – aufgrund ihrer zentralen Stellung im soziologischen Feld und ihrer Funktion als »Waschanlage« für ehemalige NationalsozialistInnen (Rehberg 1998: 273; vgl. auch Ahlheim 2001) – die Sozialforschungsstelle Dortmund erhalten (vgl. Adamski 2009). Auf die Forschungsfelder, in denen ehemalige »ReichssoziologInnen« tätig wurden, komme ich in Kapitel II.5 genauer zurück. Klingemanns Einschätzung, dass es sich hier um die zentrale Akteursgruppe der Nachkriegssoziologie handelt, teile ich aber nicht.
Die zweite Position hat maßgeblich Uta Gerhardt vertreten, die insbesondere die Surveyforschung als amerikanischen Import ansieht, der gegenüber der empirischen Forschung im Nationalsozialismus einen neuen Ansatz mit sich gebracht habe (vgl. Gerhardt 2009b: 182 f.). Darüber hinaus betont sie die Rolle aus den USA zurückgekehrter EmigrantInnen und die Prägung der empirischen Soziologie durch amerikanische Schriften (vgl. ebd.: 183). Daran angelehnt spricht auch Alexia Arnold am Beispiel der »Darmstadt-Studie«, dem großen Community Survey der Nachkriegszeit, von einem »Beispiel gelungenen Kulturtransfers« (Arnold 2010b: 43) und einem »Neuanfang durch Sozialforschung« (ebd.: 44).
Diese soziologiegeschichtlichen Arbeiten gehen zurück auf frühere Kontroversen über die Frage von Kontinuität und Neuanfang in der Nachkriegssoziologie zwischen René König, Helmut Schelsky und M. Rainer Lepsius (vgl. Römer 2020: 232 ff.).
Die Diskussion um die »Empirisierung« der Soziologie wäre eine eigenständige Betrachtung wert. Sie weist in ihrer Zuspitzung im Kontext der Debatte über die Soziologie im Nationalsozialismus und deren Kontinuitäten in der Bundesrepublik zwei Eigentümlichkeiten auf: Erstens wird in der Entgegensetzung von »amerikanischem« Import und »deutscher« Kontinuität – Carsten Klingemann spricht sogar von »germanisierten amerikanischen Methoden« (Klingemann 2014: 492) – die eigentlich intendierte Rückbindung an einen historisch-gesellschaftlichen Entstehungskontext durch eine fast schon ethnisierende Zuschreibung ersetzt. Zweitens, und damit zusammenhängend, schleicht sich in die Verengung der Kontinuitätsdiskussion auf die Frage nach dem Stellenwert der Empirie ein positivistisches Missverständnis ein, das Sozialforschung auf die Entwicklung, sodann die Verfeinerung empirischer Methoden verkürzt, diese Entwicklung wiederum mit dem ahistorisch verwendeten Attribut der »Modernisierung« versieht und nolens volens auch Kontinuitäten zwischen NS-Staat und Bundesrepublik auf ein inhaltsleeres Kriterium der »Modernität« der (wissenschaftlichen) Mittel reduziert.
Dagegen sind Differenzierungen auf zwei Ebenen vorzunehmen: Zum einen muss historisch differenziert werden, welche Akteure in welchen Forschungskontexten an der Entwicklung empirischer Sozialforschung beteiligt waren. Christian Fleck hat gezeigt, dass die empirische Sozialforschung als dominante methodologische Orientierung der Sozialwissenschaften in einem transatlantischen Kontext und unter Mitwirkung zahlreicher staatlicher und nicht-staatlicher Institutionen entstanden ist (Fleck 2007). In der Bundesrepublik wiederum trafen (zahlreiche) bereits im Nationalsozialismus tätige SoziologInnen und (wenige, aber im soziologischen Feld durchaus einflussreiche) RemigrantInnen in einem veränderten Wissenschaftskontext aufeinander. Zum anderen liegen den verschiedenen, im Feld der Nachkriegssoziologie vertretenen Ansätzen der empirischen Sozialforschung unterschiedliche oder sogar antagonistische wissenschafts- und gesellschaftstheoretische Annahmen zugrunde. Diese Aspekte werden im Folgenden eine Rolle spielen.
In diesem Sinne abwägend hat auch Karl-Siegbert Rehberg die Entwicklung der westdeutschen Soziologie beurteilt. Insbesondere hat er auf die Gleichzeitigkeit personeller Kontinuitäten und der Rückkehr von EmigrantInnen sowie institutioneller Kontinuitäten und (amerikanisch geförderter) Neugründungen hingewiesen. Dabei hat er auch die Frage nach den Kräfteverhältnissen im soziologischen Feld und der Diskursmacht der Akteure aufgeworfen (vgl. Rehberg 1992: 35 ff.). Bedeutsam sind also vor allem, so kann man im Anschluss an Rehberg festhalten, die feldimmanenten und institutionalisierten Widersprüche und Spannungen, die auch die Auseinandersetzungen mit und um den Nationalsozialismus geprägt haben.
Ich argumentiere, dass das in den hier vorgestellten Arbeiten diskutierte Kontinuitätsproblem sich mithilfe des Feld-Begriffs präziser bewerten lässt. Nach dem Ende des Nationalsozialismus kam es zu einer Neukonstituierung des soziologischen Feldes. Innerhalb dieses Feldes gab es erhebliche institutionelle und personelle Kontinuitäten zum Nationalsozialismus. Diese Feststellung allein genügt aber nicht, um die Entwicklung der Soziologie zu verstehen. Entscheidend sind vielmehr die Konstellationen, in die diese Institutionen und Personen nunmehr zu denen traten, die für die Möglichkeiten des Bruchs und der Erneuerung (oder auch des Rückbezugs auf die vornationalsozialistische Zeit) standen. Ebenso wichtig sind die sich neu konstituierenden Beziehungen zu anderen gesellschaftlichen Feldern. Erst in der Untersuchung dieser Konstellationen und der daraus entstehenden Konflikte lässt sich die Bedeutung der NS-Kontinuitäten für die Feldentwicklung einschätzen.
Die bei Rehberg angedeuteten Spannungen fanden Ausdruck in »Kämpfen um Definitions- und Repräsentationsmacht« (Moebius 2015: 18) in Bezug auf die Frage, wer »das Definitionsmonopol auf den Problembestand der deutschen Soziologie und ihre Methoden« wahrnimmt (Demirović 1999: 311). Im Kern standen sich dabei drei Parteien gegenüber, die sich um Helmut Schelsky, René König sowie das Institut für Sozialforschung (IfS), also Theodor W. Adorno und Max Horkheimer bildeten. Während Oliver König auf die Dynamik einer »rotierenden Triade« (König 2000a: 589; vgl. auch Moebius 2015: 11) hinweist, in der jeweils zwei Parteien eine Koalition gegen die dritte eingingen, weist Demirović darauf hin, dass die drei Parteien jeweils unter anderen wichtigen Akteuren im Feld um weitere Verbündete warben (vgl. Demirović 1999: 325). Zu nennen sind hier insbesondere Helmuth Plessner, Otto Stammer und Ralf Dahrendorf, deren jeweilige Rollen ich im Verlauf meiner Argumentation genauer untersuchen werde. Und während Moebius zunächst noch einen Konsens in der Neukonstituierung der Disziplin sieht und eine Zuspitzung der Konflikte besonders ab Mitte der 1950er Jahre konstatiert (vgl. Moebius 2015: 11 ff.), geht Demirović von Konkurrenzen und Auseinandersetzungen schon seit Ende der 1940er Jahre, etwa im Kontext der Frage nach der Trägerschaft für das zu gründende UNESCO-Institut für Sozialwissenschaften, aus (vgl. Demirović 1999: 310 ff.). Wichtig für das vorliegende Thema ist dabei, dass diese Konkurrenz stets auch als Auseinandersetzung von Akteuren mit antagonistischen politischen Optionen und damit zusammenhängenden wissenschaftlichen Entwürfen zu verstehen ist. Dieser Aspekt wird durchgängiges Thema der Studie sein.
Thomas Herz hat mit Blick auf die (von ihm ähnlich wie hier geschilderte) Situation der Nachkriegssoziologie die These aufgestellt, dass »die Ausblendung des Nationalsozialismus aus der Forschung […] vermutlich der Preis […] für die Etablierung des Faches an den Universitäten« gewesen sei (Herz 1987: 566). Ähnlich geht Karl-Siegbert Rehberg davon aus, dass die Konventionen »der bildungsbürgerlich geprägten Universität« »die Ausblendung bestimmter Wahrheiten institutionell gestützt« und so eine »kollegial abgesicherte Vergangenheitsverdrängung« befördert hätten (Rehberg 1992: 41; vgl. auch Christ/Suderland 2014b: 17 f.). Ich will im Folgenden zeigen, dass diese Thesen revidiert werden müssen.
Kontroverse Deutungen liegen auch zur Rolle der Hochschul- und Wissenschaftspolitik der Besatzungsmächte, insbesondere der USA, vor. Uta Gerhardt hat – vor dem Hintergrund ihrer widerlegten These, dass eine wissenschaftliche Soziologie im Nationalsozialismus nicht existiert habe – die Aktivitäten der westlichen Besatzungsmächte bei der Wiedergründung der DGS und der Förderung der, vermeintlich einen Neuanfang darstellenden, inner- und außeruniversitären Etablierung der Soziologie untersucht. Sie stellt diese Politik in den Rahmen der von ihr, vor allem in der amerikanischen Besatzungszone, als weitgehend erfolgreich angesehenen Entnazifizierung und Reeducation und betont die positive Rolle, die der Soziologie für den Prozess der Demokratisierung zugesprochen wurde (vgl. Gerhardt 2006). Aus konservativer Sicht hat Bernhard Plé die These vertreten, dass die amerikanische Besatzungsmacht ihre Ordnungs- und Demokratievorstellungen im Rahmen einer »säkularen Mission« mittels der von ihnen geförderten Sozialwissenschaften durchgesetzt hätte (vgl. Plé 1990). Demgegenüber interpretiert Johannes Weyer die amerikanische Besatzungspolitik als Abfolge einer »Phase der Duldung der Restauration« (1945-1947), einer »Phase der gezielten Instrumentalisierung der Soziologie für die US-Globalstrategie« des Antikommunismus (1947-1953) und schließlich einer Phase des »Rückzug[s] der Militärregierung aus der Wissenschaftsförderung« zugunsten privater Stiftungen (Weyer 1984: 388). Auch Carsten Klingemann betont, dass »die von den Besatzungsmächten angestrebte ›Förderung von Demokratie und Wissenschaft‹ durch zum Teil politisch schwer belastete Soziologen erfolgte«, weil diese »wegen ihrer fachwissenschaftlichen Aktivitäten im Dritten Reich als Wissenschaftler geeignet erschienen« (Klingemann 2009: 284). Der Antikommunismus dieser FachvertreterInnen habe als gleichbedeutend mit einer demokratischen Haltung gegolten (vgl. ebd.: 284). Damit ist der Kalte Krieg als zentraler Faktor der Soziologieentwicklung angesprochen. Die seit ca. 2000 stark anwachsende Literatur der Cold War Studies stellt die Nachkriegsentwicklungen in den Kontext des raschen Aufstiegs der Sozialwissenschaften im Rahmen der Blockkonfrontation, in der sie Expertise für politische und militärische Entscheidungen liefern sollte (vgl. Link 2018).17 Diesen Aspekt hat Fabian Link als Ausgangspunkt und Prämisse für seine jüngst erschienene, umfangreiche Untersuchung zur Geschichte der Soziologie in der Nachkriegszeit (bis zum Positivismusstreit 1961) gewählt. Link konzentriert sich dabei auf die von ihm als Denkkollektive konzipierten Kreise um Horkheimer und Schelsky (vgl. Link 2022: 67) und argumentiert, dass diese, auf der Grundlage eines »antitotalitäre[n] Antikommunismus« (ebd.: 59) im Sinne der Demokratisierung der westdeutschen Gesellschaft kooperiert hätten. Ihm zufolge lässt sich eine umfassende »epistemische Westernisierung des deutschen Wissenschafts- und Intellektuellenfelds im frühen Kalten Krieg« (ebd.: 564) konstatieren.
Auf die amerikanische Rolle bei der Neugründung der DGS komme ich in Kapitel II.1 zurück, die Bezugnahmen maßgeblicher Fachvertreter auf westliche Wissenschaftstraditionen greife ich in Kapitel III.2 auf. Darüber hinaus schildere ich in Kapitel II.2 die Beobachtungen, die amerikanische SoziologInnen in der Nachkriegszeit in Deutschland machten.
Der Aspekt der Demokratisierung ist für die vorliegende Fragestellung von zentraler Bedeutung. Dass die westdeutsche Soziologie der Nachkriegszeit als Demokratisierungswissenschaft zu beschreiben ist, hat sich zum zentralen Narrativ der Fachgeschichtsschreibung entwickelt (vgl. Neun 2018: 505; Weischer 2004: 211; Link 2022). Gesellschaftliche Demokratisierung wird in der Forschungs- ebenso wie in der Erinnerungsliteratur zeitgenössischer FachvertreterInnen einerseits als normativ handlungsleitendes Motiv der Akteure verstanden, andererseits als maßgebliche Funktion sozialwissenschaftlichen Wissens. Das gilt sowohl für die Gründergeneration als auch für die Nachkriegsgeneration, die dieses Narrativ wesentlich geprägt hat. In autobiografischen Rückblicken von VertreterInnen der Nachkriegsgeneration werden der Zweite Weltkrieg, der Zusammenbruch des Nationalsozialismus und der politische Systemwechsel zur Demokratie als zentrale Erfahrungsmomente genannt (vgl. die Beiträge in Fleck 1996; Bolte/Neidhardt 1998). Die Soziologie galt als das geeignete Instrument, diese Erfahrungen analytisch zu durchdringen (vgl. Bude/Neidhardt 1998: 407; Weischer 2004: 121 f.). Oevermann spricht von der »›Nie wieder‹-Generation«, die Soziologie »als eine Dauerreflexion dieses Zivilisationsbruches« betrieben habe (Oevermann 2014).
Die Motivation, zur erfolgreichen Etablierung der Demokratie beizutragen, verband demzufolge beide Generationen, und die soziologiegeschichtliche Forschung korrespondiert mit dieser Selbsteinschätzung. So ist die Aufgabe der Soziologie als »flexible Systemstabilisierung einer hochbelasteten Civil Society« (Fischer 2015: 75) charakterisiert, und ihre Bedeutung für die Herausbildung demokratischer Milieus betont worden (Becker 2017; 2018).
Dieses Verständnis von Soziologie als Demokratisierungswissenschaft gilt zudem als verbindendes Element unterschiedlicher ›Schulen‹ innerhalb der Disziplin (vgl. Link 2022). Auf der theoretisch-begrifflichen Ebene, so argumentieren Nolte und Fischer, vollzog sich diese Entwicklung als Abkehr von den Begriffen Volk, Nation und Gemeinschaft zugunsten der Selbstbeschreibung der sozialen Formation als Gesellschaft (vgl. Nolte 2000; Fischer 2015: 76 f.) sowie der Betonung des Individuums im Sinne eines »Ich-starken Zivilbürgers« (Link 2022: 561). Link zufolge stellte die Soziologie gesellschaftliches Orientierungswissen bereit und wirkte in erziehungspolitischer Absicht (vgl. ebd.: 376–469).
Auf der epistemischen und methodologischen Ebene gilt die Hinwendung zur empirischen Sozialforschung, die von den beteiligten Akteuren im Rückblick als Instrument einer ideologiefreien Gesellschaftsanalyse bezeichnet wurde, als die entscheidende Entwicklung der Nachkriegssoziologie (vgl. Weischer 2004; Bude/Neidhardt 1998: 408; Link 2022: 298 ff.) – was die oben benannten Kontroversen ausgelöst hat.
Es besteht allerdings eine inhärente Spannung zwischen diesem Narrativ und der Behauptung, dass die Nachkriegsgeneration den Nationalsozialismus aus der Forschung ausgeklammert habe. Letztere hat insbesondere M. Rainer Lepsius mehrfach vorgetragen (vgl. Lepsius 1969: 198; 2000: 17). Lepsius sah in solch einer Ausblendung bereits früh »eine Strategie der Immunisierung der soziologischen Ansätze« (Lepsius 1969: 198), womit er insbesondere auf die Modernisierungstheorie zielte.18 Diese Kritik formulierte in ähnlicher Weise auch Michaela Christ mit Blick auf eine von ihr konstatierte Dominanz der Modernisierungstheorie in den 1950er, 1960er und 1970er Jahren (vgl. Christ 2011: 421).19 Auf die Frage der empirischen Sozialforschung gehe ich insbesondere in Kapitel II.5 ein, Lepsius’ Position unterziehe ich im Epilog einer genaueren Betrachtung, die Frage nach der Soziologie als Demokratisierungswissenschaft wird dagegen ein leitendes Motiv der gesamten Studie sein.
Entgegen Michaela Christs eingangs zitierter pessimistischer Einschätzung wird in der Zusammenschau deutlich, dass zahlreiche Aspekte der Disziplingeschichte aufgearbeitet worden sind und von einem bloßen Schweigen der westdeutschen Soziologie zum Nationalsozialismus keine Rede sein kann (vgl. Borggräfe/Schnitzler 2014: 448). Allerdings fehlt bislang nicht nur eine integrierte Darstellung dieser Forschungsergebnisse, es fallen bei genauem Hinsehen auch zwei Defizite ins Auge, die meines Erachtens ein soziologiegeschichtliches Desiderat zur Folge haben.
Erstens wohnt den Thematisierungen des Verhältnisses von Soziologie und Nationalsozialismus durchgängig ein expliziter oder impliziter Vergangenheitsbezug inne. Auf der Ebene der Fachgeschichte werden die Konflikte und Kontroversen stets als solche um die »Aufarbeitung« (Schauer 2018: 120) der Disziplin im Nationalsozialismus gedeutet. Das lässt sich beispielhaft an Stephan Moebius’ Diskussion des »Bürgerkriegs in der Soziologie« zeigen; obwohl Moebius die Zielsetzung einer der Konfliktparteien als »konservative Wende der DGS« benennt und damit den Gegenwartsbezug herausstellt, verortet er den »Bürgerkrieg« schließlich doch in »den Aufarbeitungsdebatten der bundesrepublikanischen Soziologie über die Rolle der Soziologie im Nationalsozialismus« (Moebius 2018: 292). Zudem wird der Nationalsozialismus fast ausnahmslos als historischer Forschungsgegenstand konzeptualisiert, bemängelt wird dann das Fehlen einer Historischen Soziologie, die Beiträge zu einer Analyse der Vorgeschichte und Geschichte des Nationalsozialismus liefern könne (vgl. etwa Cobet 1988: 11).
Zweitens verweist dieses Defizit auf eine Selbstreferenzialität der soziologiegeschichtlichen Forschung, die sich mit Bezug auf Stephan Moebius’ Methodologie der Soziologiegeschichte als ein Mangel an »real- und sozialhistorische[r] Kontextualisierung« (Moebius 2017: 28) beschreiben lässt. Borggräfe und Schnitzler formulieren das Problem wie folgt:
»Bis heute wird die Diskussion über die Soziologiegeschichte fast ausschließlich fachintern geführt und ist von der historiografischen Beschäftigung mit der Geschichte und Nachgeschichte des ›Dritten Reichs‹ weitgehend abgekoppelt.« (Borggräfe/Schnitzler 2014: 447)20
Dabei ist für das vorliegende Thema vor allem die Frage der Nachgeschichte von zentraler Bedeutung. Die historiografische Forschung hat erstens gezeigt, dass zu keiner Zeit von einem bloßen Verschweigen und Verdrängen des Nationalsozialismus gesprochen werden kann (vgl. König 2003: 26). Zweitens macht die Forschung deutlich, dass die Bezugnahmen auf den Nationalsozialismus stets im Kontext »gegenwärtige[r] Konfliktlagen« standen (Stölting 2014: 35) und in die Auseinandersetzungen immer auch ein in gesellschaftskritischer Absicht formulierter Gegenwartsbezug eingebracht wurde (vgl. Siebeck 2017: 27).21
Nur selten in der Debatte um Soziologie und Nationalsozialismus aber wird das Verständnis des Historischen dahingehend ausgeweitet, auch die Gesellschaft der Bundesrepublik selbst als durch den Nationalsozialismus geprägt zu begreifen, mithin die Soziologie als eine Disziplin zu analysieren, die sich in der postnationalsozialistischen westdeutschen Gesellschaft entwickelt hat.22 Dies ist meines Erachtens das maßgebliche soziologiegeschichtliche Desiderat der bisherigen Forschung und Debatte.
I.2Theoretische Gesichtspunkte zur Analyse des soziologischen Feldes
I.2.1Disziplinäre Identität und der prekäre Status der Soziologiegeschichte
Über den prekären Zustand der Soziologiegeschichte herrscht unter den FachhistorikerInnen weitgehend Einigkeit. Andrew Abbott etwa ist zwar der Auffassung, dass die Soziologie sich im Gegensatz zu anderen Sozialwissenschaften »durch ihr starkes Interesse an der eigenen Geschichte« auszeichne (Abbott 2015: 284). Allerdings sei die Geschichtsschreibung nur zu einem geringen Teil von (Fach-)HistorikerInnen geleistet worden, sondern zumeist als Teil soziologischer Forschungen und somit auch fachlicher Diskussionen und Polemiken (vgl. ebd.: 284; vgl. zu dieser Perspektive auch Dayé/Moebius 2015: 9). Christian Fleck weist ganz ähnlich darauf hin, dass die Geschichte der Soziologie im Vergleich mit der vor allem auf die Naturwissenschaften gerichteten Wissenschaftsgeschichte sowie der Geschichte von Ökonomie, Psychologie und Humanwissenschaften »eine weit geringere Institutionalisierung gefunden« hat (Fleck 2015b: 41). Karl-Siegbert Rehberg wählt mit der Untersuchung soziologischer Studienordnungen einen anderen Blickwinkel und stellt für die Vermittlung soziologischen Wissens fest, dass »die historische Einbindung zunehmend aus dem Blick gerät« (Rehberg 2015: 433). Noch in den 1970er Jahren sei dies sowohl in den USA als auch in Deutschland anders gewesen, mittlerweile hätten aber Theorienvergleiche gegenüber fachhistorischen Einführungen stark an Bedeutung gewonnen (vgl. ebd.: 432 f.). Rehberg kontrastiert diesen Befund mit der Praxis der Philosophie und »deren zugleich systematische[r] und denkgeschichtliche[r] Aneignung« ihrer Geschichte (ebd.: 433). Einigende Forschungsprogramme zur eigenen Disziplingeschichte sind in der Soziologie gegenwärtig kaum sichtbar. Selbst unter Interessierten, so Christian Fleck, seien die Gemeinsamkeiten gering. Es fehle an einer »kritischen Masse« gemeinsam Forschender, die Beiträge seien zu wenig aufeinander bezogen und die AutorInnen könnten nicht systematisch voneinander lernen (Fleck 2015b: 87 f.). Es gebe daher auch kein homogenes Feld der Soziologiegeschichte (vgl. ebd.: 87). Gerade die großen Werke der Soziologiegeschichte stünden als »Unikate« (ebd.) für sich und fungierten nicht als Ausgangspunkt für weitergehende Forschungsprogramme. Fleck macht dafür den Zustand des Fachs verantwortlich:
»Die Fragmentierung der Soziologie selbst, die als Multiparadigma-Welt schöngeredet wird, unterbindet systematisch das Relevantwerden historischer Studien, da deren mögliche Adressaten sich dann nicht angesprochen fühlen, wenn sie den Beitrag als zur Traditionslinie eines konkurrierenden Ansatzes gehörig betrachten können.« (Fleck 2015b: 88)
Dieser Diagnose einer gewissen Richtungslosigkeit entspricht auch Lothar Peters Kritik am Mangel systematischer soziologiehistorischer Forschung. »Man betreibt sie zwar, aber man weiß nicht, warum«, so seine ernüchternde Feststellung (Peter 2015: 117). Damit korrespondiert schließlich der Befund eines »mangelhafte[n] Bewusstsein[s] für die Bedeutung des Historischen für die Gegenwart der Disziplin […] nicht nur auf der Ebene der Theorie, sondern auch auf der der Selbstorganisation der Soziologie« durch Christian Dayé und Stephan Moebius (Dayé/Moebius 2015: 10). Das Historische, so machen diese kurzen Bemerkungen deutlich, ist kognitiv, sozial und institutionell am Rande der Disziplin verortet.
Was aber wäre von einer stärkeren Hinwendung zur eigenen Disziplingeschichte zu erwarten? Welche Funktionen kann und soll Soziologiegeschichte haben? Dayé und Moebius haben die soziologiehistorische Literatur auf die Auffassungen dazu befragt (vgl. ebd.: 7 ff.). Soziologiegeschichte kann demnach zunächst als »Selbstzweck« (ebd.: 8) verstanden werden. Daneben kann sie als »›Arbeitsgedächtnis‹« (ebd.: 9) konzeptualisiert werden bzw. als Instanz zur Historisierung häufig genutzter Begriffe und Konzepte, deren Ursprung durch diesen Gebrauch aus dem Blick geraten ist. Sie kann neue Forschungen anregen, den Ursprung von Kontroversen aufdecken, sie »hilft Doppelarbeit zu vermeiden und nicht auf Modetrends hereinzufallen« (Lepenies 1981: XXVII; vgl. auch Dayé/Moebius 2015: 12 f.); ältere Theorien können im Lichte neuerer überprüft werden und umgekehrt (so Lothar Peter, vgl. Dayé/Moebius 2015: 13). Zu manchen dieser vorgeschlagenen Funktionen mag die folgende Untersuchung einen Beitrag leisten. Für ihre Konzeptionalisierung aber sind diese Motive nicht zentral.
Ein bestimmendes und für diese Studie in mehrfacher Hinsicht bedeutsames Moment der Soziologiegeschichte dagegen ist der häufige Fokus auf Identitätsbildung (vgl. Dayé/Moebius 2015: 8). Dieser Fokus war etwa für Wolf Lepenies bei der Auswahl der Texte für seine wegweisende Anthologie zur Geschichte des Fachs maßgeblich leitend. Lepenies fragt anhand klassischer Texte nach der kognitiven, sozialen und historischen Identität der Soziologie (vgl. auch Lepenies 1981: VIII). Dabei nimmt er eine Doppelperspektive ein, die die Bemühungen um Identitätsbildung sowohl in den versammelten Texten aufspüren als auch durch die Sammlung selbst stärken will (vgl. ebd.: I). Auch Dirk Kaesler, Herausgeber der »Klassiker der Soziologie«, des wohl populärsten deutschsprachigen Werks zur Soziologiegeschichte, lässt sich von der Identitätsproblematik leiten. Seiner Diagnose zufolge ermangelt der Soziologie »die Verbindlichkeit eines Kanons« (Kaesler 2003: 12; Hervorh. i. O.). Im »Haus der Soziologie« (ebd.: 12) gebe es keine Instanz, die die Aufgabe der Kanonisierung übernehmen könne (vgl. ebd.: 13). Klassiker könnten, so Kaesler, als Orientierungspunkte der gegenwärtigen und zukünftigen Forschungsarbeit dienen und dafür eine geteilte Diskussionsgrundlage bereitstellen. Im Gegensatz zu Flecks Kritik an der »Fragmentierung« des Fachs begrüßt Kaesler aber »die Vielgestaltigkeit der Soziologie ohne Einschränkungen als positiv«, wenngleich er ebenfalls die Gefahr der »Beliebigkeit« konstatiert (ebd.: 14). Gegen diese Gefahr könne Kanonisierung immunisieren. Soziologiegeschichte kann demzufolge selbst ein Versuch sein, in der »Multiparadigma-Welt« eine geteilte Identität zu stiften; sie kann auch (und zugleich zu diesem Zweck) in historischer Sicht danach fragen, wie die Soziologie zu früheren Zeitpunkten ihre Identität zu gestalten und festzuhalten versucht hat. Dagegen formulieren Dayé und Moebius die Sorge, dass ein funktionaler, auf die Identität gerichteter Blick auf die Geschichte allzu schnell teleologisch wird und historische Kontingenzen übersieht (vgl. Dayé/Moebius 2015: 8). Somit unterfüttere die Kanonisierung einen »die herrschenden Positionen potenziell festschreibende[n] Diskurs« (ebd.: 12) bzw. führe zu »Diskursverknappungen und -ausgrenzungen« (ebd.). Aus diesem Blickwinkel, so lässt sich schlussfolgern, soll die Soziologiegeschichte also vielmehr die Vorstellung historischer Identität einerseits, die Bestrebungen gegenwärtiger Identitätsstiftung andererseits kritisch hinterfragen und selbst wieder auf ihre Funktionen hin überprüfen. Sie kann, in den Worten von Dayé und Moebius, zeigen, dass
»in der Geschichte der Disziplin auch politische, religiöse und wirtschaftliche Einflussnahmen, Brüche, Diskontinuitäten, Verwerfungen, Selektionen, Vergessens- und Verdrängungsprozesse sowie zahlreiche Kontroversen existieren, die sich wiederum bis in die spätere Geschichtsschreibung der Fachgeschichte fortsetzen« (ebd.).
Die Bemühungen um Identität zeitigen also bisweilen selbst einen gegenteiligen Effekt, indem sie Widerspruch herausfordern und Kontroversen über die Grundlagen und Bestandteile eben jener Identitätsbildung in Gang setzen. Kaeslers Ausführungen tragen solchen Befürchtungen in ihrer Selbstreflexivität dann auch durchaus Rechnung. Er geht von der prinzipiellen Unabschließbarkeit der Kanonisierung aus, der Notwendigkeit, diese immer wieder zu revidieren und zu erweitern und sieht gerade darin die Möglichkeit, einen offenen Diskurs herzustellen (vgl. Kaesler 2003: 13). Denn die Soziologie entwickle sich gerade nicht »kumulativ«, sondern sitze »auf einem zeitgebundenen, ideologischen und metaphorischen Rahmenwerk« auf: »Daraus ergibt sich eine prinzipielle, nicht aufzuhebende Spannung zwischen den vielfältigen ›Theorien‹ der Soziologie und der sogenannten ›Praxis‹ ihrer Umgebung.« (ebd.: 15) Damit ist das Verhältnis von Soziologie und Gesellschaft als maßgebliches Movens der Disziplinentwicklung und als potenzieller Erkenntnisgegenstand der Soziologiegeschichte benannt. Der Charakter dieser »Spannung« und ihre Folgen für die Konzeptualisierung der Soziologiegeschichte bleiben dabei freilich offen.