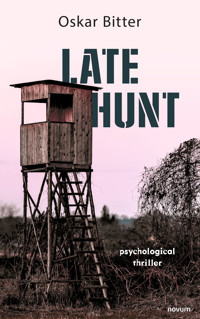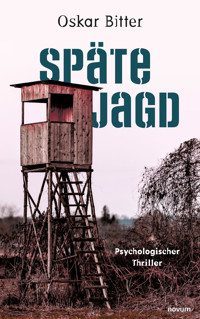
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum pro Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Etwas stimmt nicht in der zünftigen Welt der Pfadfinder. Wölfling Georg Molenbrick verunsichert das Verhalten einiger Älterer. Als Zwölfjähriger entkommt er um Haaresbreite einem Missbrauch. Der Bund der "Fahrenden Schar" gerät in Verruf. Aber die Täter bleiben in Amt und Würden. Sie schikanieren Georg bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Er sinnt auf Rache und überschreitet dabei Grenzen. Kriminalkommissar Mirko Jägers wird auf ihn aufmerksam. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Die späte Jagd beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2024 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99146-477-8
ISBN e-book: 978-3-99146-478-5
Lektorat: Tobias Keil
Umschlagfoto: Przemyslaw Iciak | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Zitat
Verrätereien begeht man öfter aus Schwäche
als in der ausgesprochenen Absicht, zu verraten.
François VI. Duc de La Rochefoucauld (1613‒1680)
Vorwort
Im stolzen Alter von fünfundachtzig Jahren bezieht der alleinstehende Faustus Molenbrick ein Zimmer in der Seniorenresidenz seines Heimatortes. Er ist froh darüber, dass er endlich einen Platz in Neu-Moritzhain gefunden hat.
Drei Wochen nach dem Einzug – am Gründonnerstag – bereitet die Nichte von Herrn Molenbrick zusammen mit ihrer Tochter die Räumung des verlassenen Eigenheims vor. Während der Besichtigung des Objektes stoßen sie im Obergeschoss in der Besenkammer zufällig auf eine Zugstange für die Dachbodenklappe. Ohne langes Überlegen ziehen sie die steile Ausziehleiter herunter und steigen hinauf. Sie gelangen auf einen kahlen, unbenutzt wirkenden Trockenboden. An manchen Stellen ist der Mörtel von den Dachziegeln abgebröckelt und liegt auf dem staubigen Boden herum. An dem einen Ende stehen sie vor einer gemauerten Wand, hinter der sich ein weiterer Raum befinden muss. Damit haben sie nicht gerechnet. Nach einigen Versuchen finden sie endlich den richtigen Schlüssel, der in das Vorhängeschloss der verriegelten Tür passt. Gespannt betreten sie die Mansarde.
Die Glasscheibe des runden Fensters an der Stirnseite des Dachbodens ist völlig verschmutzt. Es dringt so gut wie kein Licht hindurch. Sie tasten vergeblich nach einem Lichtschalter neben dem Türrahmen. Die Tochter zieht ihre Taschenlampe aus der Jackentasche und leuchtet in dem Raum herum. Hier wurden die Dachschrägen verkleidet. Die Wände sind mit fleckigen Raufaserbahnen tapeziert. An manchen Stellen haben sie sich vom Untergrund gelöst. Es riecht muffig und leicht verräuchert. Als Erstes entdecken sie Karl-May-Romane, mehrere Naturführer und ein uraltes Lexikon in dem Wandregal links neben der Tür. Auf der anderen Seite steht eine schmale Kommode. Jemand hat dort einen zusammengerollten schwarzen Ledergürtel mit metallener Schnalle sowie einen olivgrünen Brotbeutel abgelegt. Letzterer wird von Wanderern und Pfadfindern gern neben dem Rucksack als Umhängetasche getragen. Das haben die beiden auf ihren Ausflügen schon öfters gesehen. In den Schubfächern sind Wolldecken und Bettlaken verstaut. Übermütig lässt sich die Großnichte von Faustus Molenbrick vor dem leeren Schreibtisch unter dem Giebelfenster auf einen bequemen Lehnstuhl fallen. In dem wackelnden Lichtkegel ihrer Taschenlampe wirbelt jede Menge Staub auf. Die Mutter stolpert über das Kabel einer Stehlampe und reißt es aus der Steckdose heraus. Daraufhin leuchtet die Tochter die Wand ab, findet den Anschluss, drückt den Stecker wieder hinein und knipst den Schalter an. Sofort leuchtet es durch den leicht zerschlissenen, lindgrünen Stoffschirm hell auf. Gemeinsam mustern sie den gusseisernen Kaminofen, in dem reichlich weißgraue Asche zurückgeblieben ist. Daneben steht ein brüchiger Weidenkorb. Ein paar Holzscheite und eine Schachtel Streichhölzer liegen darin. Unter dem Bett ziehen sie einen Nachttopf hervor. Er ist leer. Kein Zweifel: Das ist keine Abstellkammer. Diesen Raum hat sich jemand eingerichtet. Allerdings muss das schon ziemlich lange zurückliegen.
Dort, wo sich das kleine Oberlicht befindet, ist der untere Teil der Dachschräge durch eine meterhohe Holzverkleidung abgetrennt. Zwei verzogene Klapptüren, die sie nur mit allergrößter Mühe quietschend und knarrend öffnen können, ermöglichen den beiden Spürnasen Einblick in den dahinterliegenden Stauraum. Anscheinend ist er nie benutzt worden. Doch dann strahlt die Taschenlampe zwei mit einer rostbraunen Masse beschmierte Gegenstände an: ein Fahrtenmesser und ein aufgeklapptes Taschenmesser. Vor Aufregung übersehen sie beinahe den zerknitterten Zettel. Die Botschaft, die er enthält, klingt gestelzt und bedrohlich zugleich:
„Du elender Frevler! Deine Schandtat schreit nach sofortiger Vergeltung. Die Klinge ist gewetzt. Die Hatz beginnt. Der Todesengel schwebt über Dir. Der unerbittliche Rächer macht sich auf den Weg.“
Die Buchstaben sind aus einer Zeitung ausgeschnitten und auf das Blatt geklebt worden. Befindet sich auf den Messern getrocknetes Blut? Der Drohbrief legt das nahe. Sie lassen alles an Ort und Stelle liegen. Gefolgt von ihrer Mutter klettert die Tochter die Leiter wieder herunter. Da oben wollen sie keine Sekunde länger bleiben.
„Diese Kammer wurde vor uns geheim gehalten. Aber warum? Was ist dort geschehen?“, fragt die schockierte Tochter. Die Mutter zuckt mit den Schultern und antwortet verunsichert: „Mit so etwas habe ich nicht gerechnet. Das passt doch überhaupt nicht zu Onkel Faustus. Was er wohl dazu sagen wird?“
Erstmal brechen sie alle weiteren Vorbereitungen zur Entrümpelung des Hauses ab und überlegen, wie sie in dieser Angelegenheit am besten weiter vorgehen. Der Onkel ist geistig noch ziemlich rege und macht insgesamt einen ausgeglichenen Eindruck. Selbst auf die Gefahr hin, dass ihm ihre Entdeckung unangenehm sein sollte, halten sie ihn diesbezüglich für belastbar. Auch wenn sich in der Dachkammer jemand Drittes mit seinem Einverständnis aufgehalten hat, muss Faustus Molenbrick noch lange nichts von den offenbar mit Bedacht in der Dachschräge versteckten Gegenständen gewusst haben.
Deshalb rufen sie ihn in der Seniorenresidenz an. Auf dem Apparat in seinem Zimmer. Weil niemand abnimmt, wählen sie die Nummer der Rezeption.
Dort erfahren sie, dass ihr Verwandter heute schwer gestürzt und dabei heftig mit dem Kopf auf einer Steinplatte aufgeschlagen ist: während seines gewohnten täglichen Rundgangs durch die Grünanlage des Wohnheims. Den habe er bei gutem Wetter immer gleich nach dem Frühstück unternommen. Vor drei Stunden sei er von einem Rettungswagen abgeholt und ins Eibenstädter Klinikum eingeliefert worden.
Sofort rufen sie dort an und werden zur Intensivstation weitergeleitet. Zu spät! Ihr Verwandter sei vor wenigen Minuten an den Folgen der schweren Verletzungen gestorben. Das Seniorenheim werde jetzt benachrichtigt. Der Stationsarzt schildert ihnen knapp die Umstände:
„Das ist alles so plötzlich geschehen, dass der alte Mann kaum gelitten hat. Hier ist er nicht mehr zu Bewusstsein gekommen. Und dann hat sein Herz aufgehört zu schlagen.“
Sie sind erschüttert und brauchen einige Zeit, um diese Nachricht einigermaßen zu verdauen. Die trostlose Atmosphäre in dem verlassenen Haus ist kaum auszuhalten. Um sich abzulenken, überlegen Mutter und Tochter, was für Konsequenzen sich aus der neuen Situation für sie ergeben:
„Wir könnten die belastenden Gegenstände ein für alle Mal entsorgen. Noch weiß niemand etwas davon. Aber was ist, wenn hier noch mehr solcher Überraschungen auf uns lauern?“, gibt die Großnichte zu bedenken. „Dann ist das jetzt nur die Spitze des Eisbergs.“
„Mal bitte nicht den Teufel an die Wand! Sollte Onkel Faustus wirklich etwas damit zu tun haben, kann er deswegen sowieso nicht mehr belangt werden. Aber wenn sich jemand hinter seinem Rücken schuldig gemacht hat, will ich das schon wissen!“, antwortet die Mutter. „Wenn jemand seine Gutmütigkeit schamlos ausgenutzt hat.“
Dem hat die Tochter nichts entgegenzusetzen. Eine Weile drucksen sie noch vor sich hin. Schließlich geben sie sich einen Ruck und benachrichtigen die Polizei. Obwohl sie gegenüber dem Onkel ein schlechtes Gewissen haben. Trotzdem!
„Man kann ja nie wissen …“, sagt die Mutter. „Für alle Fälle. Nicht dass man uns später vorwirft, etwas verheimlicht zu haben“, bekräftigt die Tochter. „Dafür halte ich meinen Kopf nicht hin.“
Kurze Zeit später steht ein Polizeiwagen vor dem Haus. Und in Eibenstädt macht sich ein gut vernetzter, sensationsgieriger Reporter vom „Hochwald-Kurier“ auf den Weg nach Neu-Moritzhain.
Der Tod von Faustus Molenbrick hat die beiden Frauen schwer getroffen. Am späten Abend können sie endlich in aller Stille um ihn trauern.
Elvira, die Nichte.
Ihre Tochter Okka, die Großnichte.
Jede für sich.
Jede allein bei sich zu Hause.
I
1966
Er ist noch nie so lange ohne sie unterwegs gewesen. Ohne seine Eltern: Papa Julius und Mama Christa. Ohne seine Geschwister: die zwei Jahre älteren Zwillinge Maria und Bernd. Alle beneiden ihn, weil er mit den Pfadfindern auf „Große Fahrt“ geht. Klar, die Neugier hat ihn mächtig gepackt. Aufregung und Vorfreude steigern sich von Tag zu Tag. Seine Gruppe ist in Ordnung. Den Führer, Wolfgang Pahlmann, will er sich auf Distanz halten. Irgendetwas an seiner Art stört ihn: Manchmal ist er zu streng, manchmal ist er zu nett.
Jeder verstaut in seinem Tornister, was er in den zwei Wochen unbedingt braucht: Wechselwäsche, Kulturbeutel, Taschenmesser oder Fahrtendolch, Kochgeschirr mit Becher und Essbesteck. Die übrige Ausstattung besteht aus Hordentopf, Proviant, Erste-Hilfe-Set, Streichhölzern, Kerzen, Stablampe, Karten und Kompass. Hinzu kommt das kleine Fahrtenbeil. Damit fällen sie junge Buchen oder Birken für die Zeltstangen. Oder sie hauen dicke Äste für Heringe zurecht und spitzen sie zu. Oder sie machen Kleinholz. Der zusammenklappbare Mini-Spaten gehört auch noch dazu. Damit sie bei starkem Regen Abflussrinnen um das Zelt herum graben können. Sie sind wirklich für alle Fälle gerüstet. Was sie über den persönlichen Bedarf hinaus mitnehmen, teilen sie immer gerecht untereinander auf. Zum Schluss werden die Schlafsäcke in Zeltbahnen oder Regenponchos so fest wie möglich eingerollt, um sie dann an den Tornistern mit Lederriemen festzuschnallen.
„Sieht aus wie ein U, das auf dem Kopf steht“, sagt Georg zu Papa Julius, der ihm beim Zusammenrollen geholfen hat.
Die Tornister sind nicht leicht, lassen sich aber gut tragen. Obwohl sie auf den Rücken der Jungen für Außenstehende vielleicht etwas monströs wirken. Nur Wolfgangs ist für die anderen zu schwer, weil er den Hordentopf übernimmt, in dem sie noch einen Teil der Lebensmittel verstauen. Der Gruppenführer schnallt das große Blechgefäß an den dafür vorgesehenen Laschen auf dem Deckel seines „Affen“ fest. So heißen diese mit braunem Rinderfell bezogenen Tornister tatsächlich: Die Tierhaare weisen Nässe durch Regen oder Schnee ab. In dem Topf kochen sie auf einer mit Steinen abgesicherten Feuerstelle Tütensuppen, Kartoffeln, Nudeln, Grießbrei, Wasser für Tee oder was auch immer. Die Klampfe von Wolfgang tragen sie abwechselnd. Ohne dieses Utensil geht gar nichts. Und: Ohne ausgiebige Pausen würden sie ihre jeweilige Etappe nicht schaffen.
Ihr Zelt ist eine sogenannte Kothe, ein den Behausungen der Samen in Lappland verwandtes Modell. Die Unterseiten der vier zusammengeknüpften Zeltbahnen werden mit Heringen im Boden verankert. Die schmaleren, oberen Enden müssen sie an einem Kreuz aus Ästen befestigen. Dann binden sie zwei dünne Baumstämme an der Spitze so zusammen, dass eine Gabel entsteht, und stellen sie quer über dem Zelt auf. Während jeweils zwei von ihnen die Stämme festhalten, wirft Wolfgang ein Seil über die Gabel und bindet das eine Ende in der Mitte des Kreuzes fest. Dann kriecht er unter die Zeltbahnen und zieht die Kothe so weit hoch, dass die Spannung dem Ganzen einen stabilen Halt gibt. Jetzt wird das freie Seilende am Kreuz fest verknotet und die Kothe steht wie eine Eins. Georg wundert sich jedes Mal aufs Neue, wie genial dieses System funktioniert. Aber nur, wenn die Heringe auch wirklich fest in der Erde verankert sind. Neben allem anderen hängt der erfolgreiche Aufbau der Kothe auch von dem Auffinden einer dafür geeigneten Stelle ab.
Die durch das Kreuz verursachte Öffnung wird zum Schutz gegen Regen mit einer Plane abgedeckt. Ansonsten bildet sie den Rauchabzug, wenn sie in der Mitte des Zeltes ein Feuer brennen lassen. In kalten Nächten wechseln sie sich für die Nachtwache ab, die immer eine volle Stunde dauert. Georg findet es toll, zwischen drei und vier Uhr nachts für Holznachschub zu sorgen und in die Flammen zu starren. Er ist noch nie auf diesem Posten eingeschlafen. Wolfgang weiß das zu schätzen: Georg lässt sich freiwillig für diese kritische Zeitspanne einteilen und man kann sich immer auf ihn verlassen. Die anderen halten in dieser Phase meistens nicht durch und nicken schon nach ein paar Minuten wieder ein. Wenn dann jemand später zufällig aufwacht, ist das Feuer ausgegangen und muss mit der restlichen Glut neu entfacht werden.
Es ist Freitag, als sie endlich auf Fahrt gehen, zwei Tage nach dem Beginn der Sommerferien. Ihre Pfadfindergruppe durchstreift ein einsames Mittelgebirge. Wasser für die Feldflaschen bekommen sie auf den weit verstreuten Bauernhöfen und in den kleinen Dörfern. Die Leute sind hilfsbereit. Manchmal stoßen sie auch auf eine Quelle im Wald. Mit ihrer Ausrüstung können sie sich perfekt im Gelände bewegen. Egal, wie das Wetter ist.
Heute wandern sie durch ein enges Tal. An einer Stelle staut sich der Bach zu einem kleinen See. Das Wasser ist glasklar. Sie wollen sich abkühlen. Georg schlüpft als Erster in die Badehose. Er ist eine Wasserratte. Auf einmal schaut ihn Wolfgang verärgert an.
„In unserem Jungenbund gehen wir nicht mit Klamotten ins Wasser. Entweder wir baden nackt oder wir lassen es bleiben.“
Dann zieht sich der Gruppenführer aus und steht breitbeinig in seiner voll entwickelten Männlichkeit vor ihnen. Georg ist verunsichert und schaut an ihm vorbei. Er fixiert eine Baumwurzel am Ufer. Papa Julius hat sich noch nie so aufdringlich vor ihm entblößt.
„Wollt ihr etwa nachher die nassen Badehosen mit euch herumschleppen?“
Die anderen Jungs grinsen und schon springen sie splitternackt ins frische Nass. Nur Georg nicht. Er geht wie gewohnt ins Wasser und schwimmt am längsten. Danach wringt er seine Badehose aus und wickelte sie in ein Handtuch. Heute Abend bekommt er nichts zu essen. Normalerweise ist das die Strafe für Vergehen wie Rülpsen oder Furzen beim gemeinsamen Einnehmen der Mahlzeiten, wenn sie sich im Kreis gegenübersitzen. Dann darf man zwar in dieser Runde noch zu Ende essen, muss aber beim nächsten Mal aussetzen. Wolfgangs Maxime:
„Ohne Disziplin sind wir ein maroder Haufen! Unser Verhalten soll vorbildlich sein – nicht abschreckend. Wir wollen uns nicht wie Rowdys aufführen. “
Bisher sah Georg das genauso. Aber was ist daran rowdyhaft, wenn er mit seiner Badehose ins Wasser geht? Das ist vollkommen daneben. Manchmal kann ihr Gruppenführer echt unangenehm werden. Trotzdem macht der angebliche Rowdy gute Miene zum bösen Spiel. Mit dieser lächerlichen Maßnahme lässt er sich nicht von dem abbringen, was er für richtig hält. Das Verhalten seines Gruppenführers findet er ausgesprochen unsportlich. Auch von seinen Kameraden ist er enttäuscht:
„Hätte nie gedacht, dass die bei so einer Gemeinheit alle mit Wolfgang an einem Strang ziehen.“
Gerade belegen sie ihre Brotscheiben mit Frühstücksfleisch aus Dosen und teilen die von einem Baum am Feldweg geplünderten Kirschen untereinander auf. Währenddessen machen sie allerhand Witzchen über ihren verklemmten Mitstreiter, allen voran Wolfgang. Niemand ahnt, dass Georg in seiner Geheimtasche im Tornister „für alle Fälle“ eine Vollmilch-Nuss-Schokolade aufbewahrt: zur Sicherheit zusätzlich mit Zeitungspapier umwickelt und in einem dicken Wollstrumpf verstaut. Nachdem er den anderen eine Weile beim Essen zugesehen hat, steht er auf und sagt zur Erklärung:
„Muss mal austreten.“
Er kriecht kurz in die Kothe und holt sich heimlich die Notration. Als er wieder herauskommt, hält er demonstrativ eine halb verbrauchte Rolle Klopapier in der Hand. Wolfgang nickt ihm gnädig zu.
„Vergiss die Schippe nicht!“
Damit meint der Gruppenführer, dass er seine Hinterlassenschaft gut einbuddeln soll. Das ist bei den Pfadfindern so üblich. Georg greift zu dem kleinen Spaten, der neben dem Zelt im Boden steckt, und macht sich auf den Weg. Hinter einem riesigen Buchenstamm setzt er sich ins Laub und lässt es sich schmecken. Ein bisschen zusammengeschmolzen ist die Tafel schon, aber das macht ihm nichts aus:
„Die Form ist mir ganz egal. Wichtig ist der Inhalt. Hm, ist das lecker! Wenn das die anderen wüssten …“
Wie gut, dass ihre Fahrt schon am nächsten Tag zu Ende geht. Als sie spätabends am Bahnhof ankommen, stellen sie sich zum Abschluss in der Eingangshalle im Kreis auf und singen ein Lied, das sie unterwegs eingeübt haben: „Wenn die bunten Fahnen wehen.“1Zum Abschied ist das so Sitte und gehört zu den ungeschriebenen Gesetzen ihres Bundes. Georg findet es zünftig, nach einer Fahrt so auseinanderzugehen. Die Eltern lauschen dem volltönenden Gesang ihrer Söhne mit voller Begeisterung. Sie können es kaum erwarten, ihre Schützlinge in Empfang zu nehmen.
Papa Julius ist nicht mitgekommen, sondern besucht mit Maria und Bernd das Open-Air-Kino im Eibenstädter Stadtpark. Wolfgang begrüßt Mama Christa und streicht Georg zum Abschied etwas ruppig übers Haar. Georg will sein Geschenk für die Mutter auspacken: den mit großer Mühe aus einer ziemlich harten Wurzel geschnitzten Wicht. Wolfgang hilft ihm, den Tornister abzunehmen. Er trägt ihn sogar bis zum Wagen seiner Mutter und legt ihn in den Kofferraum. Warum behandelt ihn Wolfgang wie ein Kleinkind? Dann wird er Mama Christa den Wicht eben später geben. Für seine Schwester hat er eine Katze geschnitzt, auch aus einer Wurzel. Bernd bekommt einen besonders schönen Rosenquarzstein aus einem der vielen Bachläufe, die sie überqueren mussten. Papa Julius geht erstmal leer aus. Er muss sich noch gedulden, bis er eine der wirklich gelungenen Aufnahmen von unterwegs vergrößert hat. Vielleicht nimmt er die von der Krausen Glucke. So ein riesiges Exemplar dieses Pilzes hat er vorher noch nie gesehen. Das wird seinen Vater bestimmt genauso beeindrucken wie ihn selbst. Aber dafür muss Georg erstmal den Film zu Hause in der kleinen Dunkelkammer im Keller entwickeln. Wolfgang sieht seine Eltern vor dem Bahnhofsgebäude stehen. Sie winken ihnen zu, machen aber keine Anstalten, näher zu kommen. Georg findet, dass sie ganz schön alt aussehen.
„Wusste gar nicht, dass die mich abholen wollten. Umso besser. Wie ich meine Eltern kenne, haben sie es bestimmt supereilig. Georg, dann bis zum nächsten Mal. Ach so, am Samstag in drei Wochen ist Bundestreffen im Landheim. Vergiss nicht, die Fotos mitzubringen. Tschüss, Frau Molenbrick.“
Georg ist elf. Wolfgang hat ein paar Wochen vor ihrer Fahrt den sechzehnten Geburtstag gefeiert und die „Fledermäuse“ in eine Eisdiele eingeladen. Ihre Gruppe hat sich für diesen Namen entschieden. Fledermäuse haben einen fantastischen Orientierungssinn. Mit diesen Lebewesen kennen sie sich bestens aus. Wenn sie auf Fahrt sind, lassen sie keine Gelegenheit aus, die Großen Abendsegler in der Dämmerung zu beobachten. Bis die Dunkelheit sie endgültig verschluckt. Irgendwo sind fast immer welche unterwegs.
Auf der Jagd nach Insekten.
*
Die enge, holprige Hochwälder Landstraße führt von Eibenstädt zur Distrikthauptstadt Clausburg. Seit dem Bau der neuen Schnellstraße wird sie hauptsächlich von den Anwohnern der Ortschaften und Gehöfte genutzt, die direkt an dieser Strecke liegen. An einer einsamen Stelle zweigt ein üppig bewachsener Feldweg mit tief gefurchten Spurrillen von der Fahrbahn ab. Bis nach Ober-Waldheim, der nächsten Ortschaft, sind es von hier noch gut sieben Kilometer. Direkt an der Abzweigung stehen zwei Holzpfähle, an die eine dunkelgrüne, dreizeilig beschriftete Tafel geschraubt ist. Eingerahmt von zwei stilisierten Lilien2sehen Vorbeikommende darauf den Hinweis „LANDHEIM“. Darunter steht „Pfadfinderbund“ und darunter wiederum „Fahrende Schar“. Die gelbe Schrift hebt sich deutlich vom Untergrund ab.
Das abgelegene Anwesen ist von der Landstraße aus nicht einsehbar. Es reiht sich unauffällig in die von kleinen Baumgruppen, Viehweiden und bestelltem Ackerland geprägte Hügellandschaft ein. Die nächsten Anrainer leben in dem Aussiedlerhof neben der bewaldeten Anhöhe am östlichen Horizont. Wer unter der Woche und außerhalb der Schulferien bis hierher vordringt, begegnet keiner Menschenseele.
Keiner?
Der Schein trügt!
Das Landheim steht am Rande einer ausgedehnten Wiese, die eine dichte Sträucherhecke mit einer Höhe von fast drei Metern säumt. An einem wunderschönen Frühsommertag ist der benachbarte Bauer dort mit seinem Traktor zugange. Das Gras ist schon hochgeschossen und muss gemäht werden. Heute ist Mittwoch. Auf den ersten Blick wirkt das Haus verlassen. Als der Landmann wieder einmal beim Abfahren seiner Runden die Blickrichtung ändert, sieht er etwas weiß hinter dem Gebüsch direkt neben dem Gebäude durch die Zweige schimmern. Aber er kann nicht erkennen, was es ist. Nachdem er alles abgemäht und zum Trocknen in langen Reihen aufgehäufelt hat, steuert er auf den gut befestigten Feldweg hinter dem Landheim zu. Der führt auch nach Ober-Waldheim und ist wesentlich kürzer als die Hochwälder Landstraße. Wer sich in der Gegend auskennt, würde von Eibenstädt kommend als Anlieger diese Verbindung bevorzugen. Auch mit dem PKW. Gerade als er auf die fein geschotterte Spur einbiegen will, sieht er einen weißen VW 1500 Variant Kombi aus dem Gebüsch rollen. Er wartet und lässt den Wagen vorfahren. Am Lenkrad sitzt ein Mann, den er auf Anfang dreißig schätzt. Auf dem Sitz daneben hockt ein blondgelockter Junge, der wie versteinert zum Traktor herüber starrt und nicht auf sein Winken reagiert. Der Landwirt ist überrascht:
„Der kleine Kerl sieht aus, als ob ihm gerade etwas Furchtbares passiert ist. Als hätte er einen Schock bekommen. Die Pfadfinder, die mir hier sonst hin und wieder mal begegnen, wirken dagegen immer reichlich ausgelassen und fröhlich.“
Der Trecker tuckert ruhig dahin, während dem Fahrer der Blick des Jungen nicht aus dem Kopf geht.
„Vielleicht hat ihm sein Begleiter die Gruselgeschichten über das verfallene Kloster an dem versumpften Weiher erzählt. Über die enthauptete Äbtissin, die dort herumspuken soll.“
Die fast völlig zugewachsene Ruine liegt ein paar hundert Meter abseits vom Landheim. Man muss den Weg gut kennen. Das ist ein unheimlicher Ort, an den sich nur selten jemand verirrt.
„Aber deswegen sah der Junge nicht so verstört aus. Jetzt mal ernsthaft: Was haben die beiden hier überhaupt zu suchen? Mitten in der Woche. Ohne all die anderen, die sonst immer mit dabei sind?“
Hinter dem nächsten Hügel biegt der Bauer in die Einfahrt zum Hof ab. Seine Frau und die beiden Töchter erwarten ihn zum Abendessen. Das bringt ihn auf andere Gedanken.
„Endlich Feierabend!“
*
Wegen der überdachten Veranda, die sich über die gesamte Vorderfront erstreckt, und der vier Fenstertüren, durch die man auf sie gelangt, wirkt das Landheim majestätisch und rustikal zugleich. Die weinroten Dachziegel und die grob verputzten, weiß angestrichenen Wände betonen diesen fast mediterran anmutenden Baustil. Abgesehen von dem ansehnlichen Vorbau ist es ein schlichtes, einstöckiges Gebäude mit ausgebautem Dachgeschoss.
In die Kellerräume fällt tagsüber durch Fensterschächte ausreichend Licht, um sich in der Küche und dem gegenüberliegenden Waschraum zurechtzufinden. Zusätzlich wird die große, weiß gekachelte Küche durch eine flimmernde Röhre an der Decke hell erleuchtet. Im Kellergang und im Waschraum hängt jeweils eine vergitterte Glühbirne an der Wand. Damit können die beiden Räume nur spärlich beleuchtet werden. Nach Sonnenuntergang ist das kein Ort für Angsthasen. Die fünf Duschen, die sich im Waschraum befinden, haben keine Kabinen oder Vorhänge. Toiletten gibt es draußen auf dem Hof in einem Anbau.
Im Erdgeschoss befinden sich ein gemütliches Kaminzimmer für Gruppenabende und ein geräumiger Essenssaal, der auch für die regelmäßig stattfindenden Zusammenkünfte der Mitglieder genutzt wird. Manchmal sitzt hier eine große Anzahl Pfadfinder aus verschiedenen Ortschaften des Landstrichs Hochwald dicht gedrängt beim Singen und Erzählen zusammen. Im hinteren Teil des Erdgeschosses ist ein Raum mit zehn einfachen Feldbetten als Schlafstätte eingerichtet.
Die Gruppen haben meistens fünf bis acht Mitglieder, oft mit einer leichten Fluktuation von Aussteigern und Neuzugängen. Der Führer trägt das wappenförmige Bundesabzeichen über der rechten Brusttasche seines Uniformhemdes. Es zeigt eine Wildente im Flug, mit gelbem Garn auf hellblauen Stoff gestickt. Danach kommen in der Hierarchie des Pfadfinderbundes die Träger des schwarzen Halstuchs mit gelbem Randstreifen: die Wölflinge. Das Schlusslicht bilden meistens ein oder zwei Neue.3Letztere haben sich noch keiner Prüfung unterzogen und warten auf die sogenannte Wölflingstaufe, die nach strengen Regeln erfolgt: im Winter barfuß durch den Schnee laufen – im Sommer mit verbundenen Augen ein Maisfeld durchqueren. Wobei das noch die harmloseren Varianten sind. Erst danach wird das Halstuch verliehen.
Im ausgebauten Dachgeschoss ist ein großer Schlafsaal eingerichtet. In diesem Raum stehen zwölf zweistöckige Betten. In zwei Reihen zu jeweils sechs Betten mit einem Mittelgang dazwischen. Auf den quietschenden Ungeheuern aus Stahl und Draht liegen reichlich versiffte Rosshaarmatratzen sowie ordentlich zusammengelegte graue Jugendherbergsdecken. Voll belegt – was selten vorkommt – ist es hier wie im Taubenschlag. Nachts muss dann immer besonders gut gelüftet werden. Die Tür zum linken Giebelzimmer, das den Gruppenführern vorbehalten bleibt, wird dann meist einen Spalt geöffnet: Damit es nicht drunter und drüber geht. In der rechten Stirnseite befindet sich – abgetrennt von dem kleinen Flur oberhalb der Treppe – ein separater Raum. Hier quartiert sich der Bundesführer ein. Er schläft auf einer Matratze, die durch eine von der Decke herunterhängende Stoffplane – ähnlich wie bei einem Paravent – vom sonstigen Raum abgetrennt wird. Wer genauer in diesen abgetrennten Bereich hineinsieht, erkennt dort zwei Matratzen hintereinander auf dem Boden liegen.
Hans Lichtenstein, der wackere Bundesführer aus dem Eibenstädter Nachbarort Lurchheim, hat immer einen Auserwählten, der sich die Schlafstätte für kürzere oder längere Zeit mit ihm teilt. Mit Gerfried, dem schlaksigen, sommersprossigen Träumer und Chef der Gruppe „Hirschkäfer“, geht es dieses Jahr schon eine ganze Weile so. Gerfried ist auf demselben Gymnasium wie Georg. Ein bisschen neidisch sagt Wolfgang einmal zu seinen Jungs von den „Fledermäusen“:
„Gerfried ist ganz der musische Typ. Darauf steht unser Hansi nun mal. Da kommt unsereiner nicht gegen an.“
Aber was die Älteren hinter dem Rücken von Hans und Gerfried so tuscheln, das versteht Georg nicht richtig. Bei dem Gedanken, neben der Plane mit diesem erwachsenen Mann Kopf an Fuß zu schlafen, wird ihm jedes Mal mulmig. Er ist ständig darum bemüht, Hans nicht auf sich aufmerksam zu machen. Der schielt oft genug in seine Richtung, wenn sie im Kaminraum am offenen Feuer sitzen und ihre Fahrtenlieder singen. Zu oft.
Morgens weht ein frischer Wind aus Nordost. Heute, am Samstag, ist das Bundestreffen voll im Gange. Mittags tritt das Leitungsgremium zum „Thing“ zusammen, wie sie ihr Treffen in Anlehnung an uralte germanische Bräuche nennen. Sie wollen die übliche Tagesordnung abarbeiten:
TOP 1: Reflexion der Gruppenaktivitäten.
TOP 2: Planung der nächsten Zusammenkünfte.
TOP 3: Großes Geländespiel im kommenden Frühjahr.
TOP 4: Treffen mit anderen Jungenbünden.
TOP 5: Finanzen.
TOP 6: Instandhaltung des Landheims.
TOP 7: Broschüre „Der flatternde Wimpel“, Ausgabe 2/66.
Die anderen haben während des Plenums „Freie Zeit“. Normalerweise stehen im Spätsommer die Zelte aller Gruppen auf der großen Wiese im Kreis. Die Wetterprognosen für die nächsten Tage sind sehr durchwachsen. Haben sich die Führer deshalb dafür entschieden, mit ihren Gruppen im Haus zu übernachten? Normalerweise ist man nicht so zimperlich. Jedenfalls ernten sie einen heftigen, aber vergeblichen Proteststurm der allzeit abenteuerlustigen Jungen:
„Auf Fahrt zelten wir auch bei jedem Wetter.“ – „Sollen wir hier verweichlichen?“ – „Im Haus ist es nur doof.“
Philipp Marong, Georgs bester Freund, ist in den Sommerferien nicht mit dabei gewesen, als sie durch das Mittelgebirge gestreift sind. Stattdessen musste er seine Eltern nach Italien begleiten, an die Adria. Wolfgang nimmt ihm das immer noch übel.
Gestern beim Abendessen war das nicht zu überhören. Zuerst ließ er sich von Philipp das Brot reichen und bedankte sich überschwänglich dafür. Was vollkommen übertrieben klang. Dann schnitt er ganz gemächlich eine Scheibe ab und sagte dabei beiläufig:
„Na, an den überlaufenen Stränden in Rimini kann man sich wohl nicht so in die Fluten stürzen, wie uns der liebe Gott erschaffen hat. Wir sind in dem einsamen Tal splitterfasernackt ins kühle Nass eines aufgestauten Bachlaufs gestürzt! Hm, ach so, natürlich bis auf unseren prüden Georg.“
Das ist einer von Wolfgangs berühmten Doppelschlägen gewesen. Im Austeilen gilt er als unschlagbar. Trotzdem ist Philipp ganz begeistert von dem tollen Urlaub am Mittelmeer. Immer wieder muss er davon erzählen. Stolz präsentiert er seinen Kameraden die schönste Muschel, die er am Strand gefunden hat, und lässt sie schnell wieder in der Tasche seiner ledernen Kniebundhose verschwinden, um sie vor Wolfgang zu verstecken. Manchmal taucht der nämlich wie aus dem Nichts auf. Er beherrscht die Kunst des Anschleichens in höchster Vollendung.
Jetzt schichten Georg und Philipp in der Mitte der Wiese Holzscheite für das Lagerfeuer auf, das heute Abend entfacht werden soll. Vorher haben sie zusammen mit ein paar Jungen aus anderen Gruppen fachmännisch einen Kreis aus Feldsteinen um die Feuerstelle gelegt. Wolfgang steht ganz in ihrer Nähe und unterhält sich mit einem anderen Gruppenführer namens Egbert darüber, dass sich einige Mütter vor dem Treffen beschwert haben:
„Im Zelt würde es in den kalten Nächten und bei Regen zu ungemütlich werden. Sie befürchten, dass sich ihre vielgeliebten Sohnemänner erkälten können, bevor die Schule wieder losgeht. Ihre Klagen haben Hans zum Einlenken gebracht. Anweisung vom Bundesführer: Wir dürfen diesmal unsere Kothen nicht aufbauen. Egbert, jetzt mal ehrlich, ist das nicht vollkommen daneben?“
„Total lächerlich! Dann bestimmen also die Mütter, wo es langgeht. Wolfgang, die haben doch überhaupt keine Ahnung. Haben die überhaupt schon mal im Freien übernachtet? So wie wir? Wohl kaum.“
Egbert scheint angestrengt nachzudenken.
„Hm, also …“
Plötzlich hellt sich seine Miene auf.
„Na ja, die sind eben wie Mädchen. Mütter sind wie Mädchen, da kann man nichts machen.“
Wolfgang versteht die Welt nicht mehr:
„Egbert, ich kapier das einfach nicht! Wieso knickt unser Bundesführer vor denen so ein. Wir brauchen keinen, der unsere Jungs derart verhätschelt. Die halten mehr aus, als ihre Mamas glauben. Was ist denn mit den Vätern los? Warum stärken die ihrem Nachwuchs nicht den Rücken? Haben die auch nur die geringste Vorstellung davon, was ihre Frauen unserer bündischen Schar mit diesem Quatsch antun?“
Auf dem Weg zum „Thing“ gehen die beiden an den derart übertrieben bemutterten Wölflingen vorbei, ohne sie auch nur eines einzigen Blickes zu würdigen. Georg fällt plötzlich ein, dass ihm seine Schwester Maria ein Bild in der Tageszeitung gezeigt hat, auf dem Pfadfinderinnen beim Zelten zu sehen sind. Und zwar in diesem kühlen und teilweise regnerischen Sommer! Vielleicht stimmt das gar nicht, was Hans herumerzählt und was die Gruppenführer bereitwillig nachplappern. An diesem Punkt ist Georg absolut empfindlich. Auf seine Mutter lässt er nichts kommen. Auf Maria auch nicht. Trotzdem will er sich jetzt nicht die gute Laune verderben lassen. Nachdem sie genug Holz aufgeschichtet haben, treffen sie sich mit Klaus, einem Jungen aus der Gruppe „Hornissen“. Der Forscherdrang hat sie zusammengebracht. Sie wollen mit dem „Bestimmungsbuch für Wirbellose“, einer Lupe und einem leeren Obstglas mit durchlöchertem Deckel nach Käfern, Spinnen und Würmern suchen. Georg hat alle Utensilien in seinem olivgrünen Brotbeutel verstaut und sich den Riemen um die Schulter gehängt.
Abends wird es ziemlich mild. Die „Große Runde“ kann also ohne Bedenken im Freien stattfinden. Sie sitzen alle weit ab vom Landheim auf der Wiese in einem Kreis um das hell auflodernde Lagerfeuer. Aber die meisten haben vorsichtshalber ihre Jujas4mit rausgenommen und sich im Schneidersitz auf Regenponchos niedergelassen. Die Gruppen berichten nacheinander von ihren diesjährigen Erlebnissen auf „Großer Fahrt“. Ein spontan bestimmter Sprecher pro Gruppe setzt sich dafür neben den Bundesführer. Zwischendurch wird das eine oder andere Lied gesungen. Gerfried und zwei Rover4, die gerade von einer abenteuerlichen Wanderung in den schottischen Highlands zurückgekehrt sind, begleiten sie mit ihren Gitarren, während Hans den Takt auf einer Trommel angibt. Becher mit einer heißen Mischung aus schwarzem Tee und Orangensaft machen die Runde. Nach und nach wird dem Gebräu eine ordentliche Dosis Rotwein untergemischt. Die Stimmung ist ausgelassen, die Flammen beleuchten begeisterte, glühende Gesichter.
Georg hat sich zu Freunden von den „Hirschkäfern“ gesetzt, mit denen er gerade darüber tuschelt, wie nervig das manchmal ist, wenn die Gruppenführer auf Fahrt zwei Kameraden ausgucken, um ihnen irgendwelche unbeliebten Aufgaben aufzubrummen: Wasser holen, im nächsten Dorf einkaufen, einen geeigneten Zeltplatz auskundschaften. Das sind Dinge, die auf dem Weg von allen gemeinsam erledigt werden können, da muss niemand extra vom Rastplatz losgeschickt werden, während die anderen ihre Pause genießen und faul herumgammeln. Deshalb achten sie immer vorausschauend darauf, dass ihre Route möglichst praktisch verläuft. So macht es etwa Sinn, erst einen Ort für Einkäufe anzusteuern und dann am Waldrand weiterzuwandern. Auch wenn das ein kleiner Umweg ist. Dafür haben sie sich unterwegs schon mit Proviant versorgt und die Sachen untereinander zum Tragen aufgeteilt. Wenn sie dann noch auf einen tollen Lagerplatz stoßen, sind alle zufrieden. Als die Jungen sich vielsagend angrinsen, ruft Wolfgang zu ihnen hinüber:
„Jetzt bist du dran, Georg. Komm und setz dich zu uns.“
Der jeweilige Erzähler muss nämlich zwischen seinem Gruppenführer und Hans sitzen. Georg ist das irgendwie peinlich, er hat überhaupt keine Lust dazu. Aber er gibt sich einen Ruck, lässt sich auf dem ihm zugewiesenen Platz nieder und berichtet von ihrer abenteuerlichen Wanderung. Es fängt an, ihm richtig Spaß zu machen. Er behält den roten Faden und fügt Detail für Detail zusammen. An der Stelle, wo sie sich heillos verlaufen und den Zeltplatz auf dem Gelände der Jugendherberge erst in stockfinsterer Nacht erreichen, wird es ringsum mucksmäuschenstill. Alle kleben an seinen Lippen. Das spornt ihn mächtig an. Gleichzeitig merkt er, wie Hans ihm die Hand auf seine Schulter legt – und nicht mehr wegnimmt. Das fühlt sich unangenehm an. Was will dieser Mensch von ihm? Seine gute Laune bekommt einen gewaltigen Dämpfer. Verunsichert schaut er für eine Sekunde seinen Gruppenführer an, der ihm aufmunternd zunickt. Trotz der unangenehmen Berührung denkt Georg erfreut:
„Wolfgang ist ja richtig stolz auf mich.“
Nachdem er zum Ende gekommen ist und alle seine spannende Geschichte ausdauernd beklatscht haben, befreit er sich mit einem Ruck von der unverändert auf seiner Schulter klebenden Hand des Bundesführers. Dann eilt er zu seinen Freunden zurück. Weitere Fahrtenberichte folgen. Wie immer bei solchen Anlässen stellen sie sich zum Schluss im Kreis auf und singen „Ade nun zur guten Nacht“. Als sich die Runde gerade auflösen will, kommt Hans auf ihn zu und hält ihm einen mit Rotwein gefüllten Becher hin:
„Das war ja eine tolle Story, die du uns gerade erzählt hast. Keine Sekunde langweilig! Davon können sich die anderen eine Scheibe abschneiden. Georg, du gehörst jetzt zu den Aufsteigern bei uns. Die müssen natürlich auch lernen, von einem kräftigen Schluck nicht gleich umzukippen. Nur zu …“
Gesagt, getan.
Georg weiß nicht, warum er diesen Unsinn ohne zu zögern mitmacht. Er hat an dem Wein eher genippt als zügig davon getrunken. In dem Tee ist ja auch schon etwas von dem Zeug drin gewesen. Obwohl ihm Lichtenstein nicht ganz geheuer ist, fühlt er sich durch dessen Worte geschmeichelt. Ihm wird auf einmal ganz leicht zumute. Er könnte alle umarmen. Mit großen Augen starrt er Hans an, der den Becher wieder an sich nimmt. Seine Zurückhaltung gegenüber diesem Mann droht dahinzuschmelzen wie ein Schneemann bei Tauwetter in der strahlenden Mittagssonne.
„Georg, du hast ja einen guten Zug am Leib. Alle Achtung! Aber jetzt mal was anderes: Habt ihr denn unterwegs auf Fahrt kein ein einziges Mal gebadet? Normalerweise sind doch alle ganz verrückt danach. Oder sind die Fledermäuse etwa wasserscheu geworden?“
Es wirkt irgendwie streng, wie er ihn jetzt ansieht. Georg bekommt einen knallroten Kopf. Genau an dem Punkt hat er sich eben bei seiner spannenden Berichterstattung bewusst vorbeigemogelt. Dieser blöde Hans behandelt ihn plötzlich wie einen Verräter. Während er verlegen grinst und dann zu Boden starrt, kommt der Bundesführer einen Schritt näher und macht Anstalten, den Arm um ihn zu legen. In diesem Augenblick taucht Wolfgang aus der Dunkelheit auf, geht im allerletzten Moment zwischen die beiden und zerrt Georg hinter sich her:
„Die anderen sind schon beim Zähneputzen. Jetzt beeil dich mal ein bisschen, gleich ist Nachtruhe.“
Im Gehen dreht er sich nochmal kurz um und ruft:
„Bis dann Hans, wir sehen uns ja nachher noch.“
Hans sagt nichts. Im Schlepptau seines Gruppenführers wendet ihm Georg den Rücken zu und trabt in Richtung Landheim. Wolfgang hat ihm voll aus der Patsche geholfen.
„Das vergesse ich ihm nie!“
Nachts wälzt er sich in seinem Etagenbett hin und her. Philipp schläft über ihm fest wie ein Murmeltier. Georg muss ständig daran denken, dass Hans gesehen haben kann, wie er kaum etwas von dem Wein getrunken, sondern nur ein paar winzige Schlucke zu sich genommen hat.
„Von wegen‚ganz schöner Zug‘! Weswegen will der mich mit solchen Schmeicheleien um den Finger wickeln?“
Eine ganz leichte Wirkung von dem Alkohol spürt er immer noch – trotz der geringen Dosis. Endlich schläft er ein und hat einen schrecklichen Traum: Hans steht vor seinem Bett und beugt sich zu ihm hinunter. Mit einer beschwörenden Stimme flüstert er ihm ins Ohr:
„Komm doch mit zu mir. Wir machen es uns noch ein bisschen gemütlich. Gerfried ist heute nicht da. Ich hab dir noch einen winzigen Schluck Wein eingegossen. Komm schon – oder hast du etwa Angst vor mir?“
Bevor er vor Schreck aufwacht, glaubt er noch die ekelhafte Alkoholfahne von Hans gerochen zu haben. Bis zum Morgengrauen dämmert er missmutig vor sich hin. An Schlaf ist nicht mehr zu denken.
1967
Beim diesjährigen Bundestreffen im Landheim begegnet er Hans zum ersten Mal seit dem letzten Sommer. Er verhält sich ihm gegenüber freundlich, bleibt aber ungewohnt zurückhaltend. Georg ist davon angenehm überrascht und lässt sich am Ende der Freizeit von Hans dazu einladen, zusammen mit ihm im Herbst auf Jagd zu gehen. Für Georg, den ultimativen Naturfreund, ist das eine riesige Sensation. Solch eine Gelegenheit hat sich ihm bisher nie geboten. Sein Großonkel ist zwar in der Forstverwaltung beschäftigt, aber der zeigt ihm lieber die Pflanzenwelt der heimischen Wälder. Natürlich kennt er sich auch mit allen Tieren, ihrer Lebensweise und Funktion für die Umwelt aus. Sein Wissen gibt er gern an Georg weiter. Aber jetzt geht es um etwas völlig anderes: Wild vom Hochstand aus zu beobachten und – wenn nötig – zu erlegen. Abenteuer pur. Die Ansitzjagd. Wer von seinen Freunden wird da nicht neidisch zu ihm aufblicken, wenn er ihnen davon erzählt, wie er hautnah dabei gewesen ist?
Der Bundesführer holt ihn tatsächlich an einem Sonntag im goldenen Oktober in aller Herrgottsfrühe mit dem uralten, schon stark verbeulten Jeep von zu Hause ab. Vorher wechselt er mit Papa Julius noch ein paar Worte. Hans erzählt unter anderem, dass er erst vor Kurzem von einem Pächter die Erlaubnis bekommen habe, in dessen Revier zu jagen. Dass sein Vater extra so lange aufgeblieben ist, wunderte Georg nicht.
„Bestimmt will er sich davon überzeugen, dass ich bei Hans in guten Händen bin. Kann ja nichts schaden. Sicher ist sicher. Hans hat sich bei Papa total eingeschleimt. Hat er das nötig? Verdammt abartig, dieses leutselige Gehabe. Wo es doch nur um einen harmlosen Jagdausflug geht.“
Endlich sind Hans und Georg wie geplant um halb drei Uhr unterwegs zum Lurchheimer Forst. An der Stelle im Wald, von der aus sie starten wollen, wartet schon jemand auf sie, der sich lässig mit dem Rücken an die Fahrertür eines nagelneuen weißen VW Variant Kombi lehnt. Davon hat ihm Hans aber nichts gesagt. Ob Papa das weiß? Ein gewisser Peter Zarßcke will sie bei ihrer Unternehmung begleiten. Georg kommt der Mann irgendwie bekannt vor. Er ist einige Jahre älter als Hans und scheint ein enger Freund zu sein. Zur Begrüßung umarmen sich die beiden jedenfalls auffallend heftig. Georg findet das irgendwie übertrieben, fast schon peinlich. Dann tauschen sie von Jägerlatein gespickte, für Außenstehende völlig unverständliche Sätze aus. Sie wirken auf ihn wie alte Kumpel, die schon so manches zusammen erlebt haben und seit Urzeiten gemeinsam auf die Jagd gehen. Georg fühlt sich plötzlich wie das fünfte Rad am Wagen. So hat er sich den Jagdausflug in seiner großen Vorfreude ganz bestimmt nicht ausgemalt. Nach einer Weile wendet sich der Mann ihm zu und stellt sich genauer vor:
„Also, mein Junge, ich bin Lehrer auf dem Christian-Heinrich-Rinck-Gymnasium. Deutsch, Latein und Geschichte. Die AG für Spanisch als dritte Fremdsprache biete ich auch noch an. Ach so, ähm, das hätte ich beinahe vergessen: Das Revier, in dem wir heute unterwegs sind, gehört mir. Das habe ich vor gar nicht so langer Zeit von der Waldheimer Jagdgenossenschaft gepachtet. Ein echter Glückstreffer war das! Das Revier heißt tatsächlich ‚Sonntagsjägers Grund’5. Aber keine Angst, Hans und ich sind richtige Jäger, hahaha! Auch wenn heute Sonntag ist, hahaha.“
Er sieht Georg belustigt von oben bis unten an. Auf einmal runzelt er die Stirn und scheint angestrengt über irgendetwas nachzudenken. Dann hellt sich seine Miene auf:
„Jetzt hab ich’s! Du gehst doch auch auf unsere Schule, nicht wahr? Mensch, na klar, ich habe dich schon öfter auf dem Schulhof gesehen. Wie du mit den anderen herumgetobt hast. Immer an vorderster Front, was? Vielleicht bekomme ich deine Klasse in der Oberstufe in Latein. Ihr seid doch eine ganz tolle Truppe – habt das Glück, noch keine Mädchen aus dem Landkreis aufnehmen zu müssen. Die ersten gemischten Klassen sind gerade in unser Knabengymnasium eingezogen. Dagegen sind wir machtlos. Na ja, ihr seid nochmal davongekommen. Oder hast du etwa schon eine Freundin?“
„Nein, also … Natürlich nicht. Wieso denn auch? Ich bin lieber mit meinen Freunden zusammen: mit den ‚Fledermäusen‘. So heißt meine Pfadfindergruppe.“
Georg ist dieser Typ nicht ganz geheuer. Er hat Zarßcke schon öfter von Weitem gesehen: Wenn er die Pausenaufsicht auf dem Schulhof übernimmt, albert er fast immer mit einer Gruppe von Jungen aus der Oberstufe herum und führt sich auf, als sei er einer von ihnen. In der Unterstufe hat Zarßcke zum Glück andere Klassen. Georgs Lateinlehrerin heißt Frau Riemenschneider und er kommt prima mit ihr zurecht. Aber jetzt nervt ihn der völlig unerwartet hinzugekommene Pauker mit seinem kumpelhaften Gequatsche. Das hat hier überhaupt nichts zu suchen! Ihm ist diese leutselige Aufdringlichkeit äußerst unangenehm. Er fühlt sich durch den blöden Kerl höllisch verunsichert. Als müsse er sich vor ihm rechtfertigen. Aber wofür?
„Ich weiß, ich weiß. Georg, ich war doch früher – also direkt nach dem Krieg – auch bei den Pfadfindern. Mit zwölf Jahren war ich schon am Wiederaufbau der ‚Fahrenden Schar‘ beteiligt! Meine Gruppe hat sich ‚Siebenschläfer‘ genannt: im Winter faul, im Sommer hyperaktiv. Hahaha! Ich hatte den Spitznamen ‚Splitti‘. Weil ich bei jeder Gelegenheit als Erster splitternackt ins Wasser gesprungen bin. Hahaha! Eine super Gruppe war das! Ein Paradies für echte Jungen.“
Georg bekommt schon wieder einen knallroten Kopf. Er fühlt sich gerade wie ein kleines Kind, das nicht weiß, wie ihm geschieht. Und nicht wie ein zwölfjähriger Gymnasiast und Wölfling auf der Ansitzjagd. Wie sehr hat er sich über die Einladung des Bundesführers gefreut! Er will ganz nah an die Tiere im Wald herankommen. Morgens um vier Uhr, wenn der Mond noch nicht untergegangen ist. Lange bevor der Morgendunst langsam von der aufgehenden Sonne verdrängt wird. Egal ob Bock oder Ricke: Insgeheim hofft er auf ein krankes Reh, das erlegt werden muss, um die anderen Tiere zu schützen.
Inzwischen sitzen sie vor einer Lichtung auf dem Hochstand. Aber dieser großtuerische Zarßcke vermasselt ihm die ganze Tour. Der Mann wird ihm von Minute zu Minute unsympathischer. Am schlimmsten findet Georg, wie er ständig „mein liebes Hänschen“ sagt. Ekliger geht es nicht. Warum lässt sich Hans das gefallen?
Das Infrarot-Fernglas wird von Hand zu Hand gereicht. Hans sitzt in der Mitte, sodass Georg genügend Abstand zu Zarßcke hat. Hoffentlich bleibt das auch so. Die Männer halten ihre Jagdgewehre in Bereitschaft. Umsonst, kein Tier nähert sich der Lichtung. Noch nicht mal ein Wildkaninchen. Anfangs ist Georg hellwach vor Aufregung gewesen. Aber jetzt kämpft er gegen die Müdigkeit an. Um Viertel nach fünf Uhr wird Zarßcke unruhig. Er muss gleich zurück zum Parkplatz, wegen irgendeines familiären Termins.
„Leider, aber meine Mutter und ihre Schwester bestehen darauf. Ich soll sie zu einem Ehemaligentreffen ihrer Konfirmationsgruppe nach Bad Laubenroth fahren. Natürlich erwarten sie von mir, dass ich sie auch wieder zurückbringe. Anscheinend ist denen Eibenstädt nicht mehr gut genug – muss immer was Besonderes sein. Wenn ich mich jetzt nicht davonmache, wird es knapp. Dass ich den ganzen Tag im Kurpark rumhänge und Däumchen drehe, ist denen schnurzpiepegal. Für uns Männer haben die alten Damen selbstverständlich null Verständnis. Die kennen keine Gnade. Der Kirchenklub geht ihnen über alles. Jetzt müsst ihr leider ohne mich weitermachen. Wirklich zu schade. Wäre gerne bei euch geblieben.“
Er grinst sie verschwörerisch an und gibt Hans einen schmatzenden Kuss mitten auf den Mund, bevor er die Leiter hinunterklettert. Georg ist entsetzt. Gott sei Dank reicht ihm Zarßcke nur die Hand. Es fühlt sich an wie ein Griff in feuchte Watte. Endlich ist der Lehrer im Dunkeln verschwunden. Zurück bleibt die lausige Kälte, die alles durchdringt. Hans holt etwas aus seinem großen Rucksack.
„Georg, lass uns zusammen unter der Decke warten. So können wir uns gegenseitig wärmen. Ich bin sicher, dass wir noch was vor die Flinte bekommen. Vorgestern habe ich hier jede Menge Spuren von Wildschweinen gesehen. Und Losung von Füchsen.“
Georg findet das naheliegend. Wenn man vor Kälte zittert, kann man nicht gut durch das Infrarot-Fernglas sehen. Eng an eng sitzen sie eine Weile da. Es wird wärmer. Hans atmet auf einmal so komisch. Heftig, fast stöhnend. Er reibt seine Hand auf Georgs Schenkel. Dann zieht er Georgs Linke ganz sanft zu sich und legt sie in seinen Schoss. Der Hosenstall ist weit geöffnet. Georg schreit auf:
„Lass mich los, du Dreckschwein!“
Mit der rechten Hand zieht er wie besessen sein Fahrtenmesser, einen Finnendolch, aus der Scheide am Gürtel und sticht Hans in den Oberschenkel. Nicht tief, nur ein wenig. Es reicht, dass Hans aufjault. Georg nimmt seinen Brotbeutel, wirft hektisch das Messer hinein und klettert zügig – aber konzentriert – die Leiter hinunter. Immer nach oben schauend, um die Reaktionen des Bundesführers im Blick zu haben. Aber der scheint auf dem Hochstand festzukleben. Nur sein Gewimmer ist zu hören, durchsetzt von gelegentlichem Fluchen:
„Du abscheulicher kleiner Mistkerl, das wirst du mir büßen!“
Georg verschwindet in dem Dickicht am Rande der Lichtung. Ein kurzer Blick auf die Klinge des Finnendolchs erschreckt ihn zutiefst.
„Ist das Blut? So viel? Von dem kleinen Pikser! Das kann doch nicht wahr sein!“
Egal. Nicht mehr zu ändern. Das Messer steckt er wieder in die Scheide. Er springt über Geäst sowie halb verfaulte Baumstümpfe und kämpft sich durch fast undurchdringliches Gebüsch. Angst sitzt ihm im Nacken. Als er sich außer Reichweite glaubt, wird er ruhiger. Diesen ungeheuerlichen Vorfall will er sofort Papa Julius und Mama Christa erzählen.
„Was werden sie dazu sagen? Und erst die Zwillinge?“
Damit hat Georg nicht gerechnet. Obwohl – ganz unerwartet kommt das abartige Begrapschen nicht. Vor dem Treffen mit Hans hat er sich noch zur Vorsicht ermahnt:
„Es wird so viel geredet. Man kann nie wissen …“
Und sich schnell wieder beruhigt:
„Es geht schließlich nur um die Jagd. Wir sitzen auf dem Hochstand. Was soll da schon passieren? Ich übernachte ja nicht in seinem Zimmer im Landheim.“
Dann stolpert er und fällt der Länge nach hin. Er ist auf eine Falle gestoßen. Ein Wildschwein steckt mit dem linken Vorderlauf in einem Eisenbügel, umgeben von einer rostbraunen Masse: Blut. Reichlich Blut.
„Da war ein Wilderer am Werk. Oder ein Tierquäler.“
So etwas kommt immer wieder vor. Davon hat er schon gehört. Das junge Tier – wahrscheinlich ein knapp zweijähriger Überläufer auf der Suche nach seiner Rotte – ist ganz schwach und gibt kaum wahrnehmbare Geräusche von sich. Wie lange liegt es wohl schon hier? Georg hat den Eindruck, dass ihn die Augen des Tieres um Gnade anflehen. Wie unter Hypnose holt er sein Taschenmesser aus dem Brotbeutel. Es ist schärfer als der Finnendolch. Er weiß genau, was er tun muss. Mit einem Schnitt durch die Kehle beendet er die Qual. Dann stürzt er durch den Wald in Richtung Stadtrand. Er kennt sich in diesem Abschnitt gut aus. Wie oft ist er hier mit dem Patenonkel über Stock und Stein gegangen, um Pilze zu sammeln oder Pflanzen zu bestimmen. Dank seiner Orientierung landet er am Vorstadtbahnhof von Eibenstädt. Was für ein Glück, dass er die Monatskarte immer bei sich hat. Aber er fährt nicht nach Hause. Er steigt in den ersten Bus nach Neu-Moritzhain. Seine Eltern erwarten ihn spätestens nach ihrem Besuch des Gottesdienstes. Die Kirchenuhr schlägt achtmal.
*
Faustus Molenbrick ist der Onkel von Papa Julius und der Patenonkel von Georg. Er arbeitet als Angestellter in der Forstverwaltung von Neu-Moritzhain. Seine Frau, Tante Mildred, litt an einer schlimmen Krankheit. Zum Schluss lag sie im Krankenhaus und wurde durch eine Beatmungsmaske mit Sauerstoff versorgt. Georg besuchte sie zusammen mit Mama Christa und Gerhard, dem Sohn von Faustus und Mildred. Gerhard ist Georgs Cousin zweiten Grades. Tante Mildred hing an dem Gerät wie an einem Blasebalg. Das sah furchtbar aus. Kurz nach dem Besuch wurde sie auf grausame Weise erlöst: Sie starb allein bei laufenden Maschinen. Die wurden erst ein paar Minuten danach abgestellt.
Faustus Molenbrick wohnt jetzt allein.
Großneffe – und gleichermaßen Patensohn – Georg hetzt den Schotterweg zum Haus seines Onkels hinauf. Die letzten Meter rennt er im Spurt. Als sei der Leibhaftige hinter ihm her. Er klingelt wie besessen an der Eingangstür, aber Faustus lässt sich Zeit, er räumt gerade das Frühstücksgeschirr vom Tisch. Dann öffnet er Georg endlich die Haustür.
„Junge, warum klingelst du heute Sturm? Das ist doch sonst nicht deine Art. Wirst du etwa vom Satan gehetzt? Was ist denn passiert?“
Bevor Georg etwas sagen kann, muss er erstmal verschnaufen. Dann stößt er kurzatmig hervor:
„Ach, nur so. Dachte, du krokelst mal wieder im Keller herum. Hätte ja sein können.“
„Aber nicht am Sonntagmorgen, Georg. Wusste gar nicht, dass du mich heute besuchen kommst.“
„Ach, Onkel Faustus, ich war heute in aller Herrgottsfrühe auf Ansitzjagd. Mit unserem Bundesführer von den Pfadfindern. Sind leider leer ausgegangen. Na ja, und als wir danach in der Nähe von deinem Haus vorbeigekommen sind, wollte ich einen Abstecher zu dir unternehmen.“
„Soso, auf Ansitzjagd. Alle Achtung! Und jetzt bist du bei mir. Na gut. Soll mir recht sein. Wenn deine Eltern damit einverstanden sind.“
„Ich ruf sie nachher an, jetzt sind sie noch in der Kirche.“
„Na, dann immer hereinspaziert.“
Damit ist die Sache geritzt.
*
Das vom Ort weit abgeschieden gelegene Einfamilienhaus mit dem großen Wiesengrundstück steht direkt am Waldrand. Georg kommt oft hierher. Manchmal mit seinen Eltern und Geschwistern, viel öfter aber allein. Das ergibt sich immer wie von selbst, fast automatisch. Onkel Faustus und ihn verbindet eine echte Seelenverwandtschaft. Wenigstens hat das Papa Julius einmal gesagt. In Wahrheit teilen sich die beiden ein großes Geheimnis. Weil Faustus Molenbrick befürchtet, dass Georg von seinen Eltern gegenüber den Zwillingen hin und wieder vernachlässigt wird, verwöhnt er ihn ein wenig.
Als das Eigenheim vor vielen Jahren gebaut wurde, hat er im hinteren, zum Wald ausgerichteten Giebel auf dem Dachboden einen Raum abtrennen lassen. Einfach so, für alle Fälle. Nach langjährigem Leerstand ist das heute Georgs Reich. In irgendeinem Roman hatte Faustus mal etwas über ein geheimes Gemach gelesen, in das sich ein in die Jahre gekommener Schlossdiener zurückzog, um ungestört seine Memoiren zu schreiben. Er nannte den Raum „Oase“. Nun heißt die Dachkammer so. „Oase“ hört sich geheimnisvoll an. Noch wichtiger ist, dass kein Außenstehender versteht, was damit gemeint ist. Auf jeden Fall klingt es nicht nach „Dachkammer“. Der Junge darf sich – wann immer er will – dahin zurückziehen.
Der Onkel hat das Zimmer nach und nach mit allem ausgestattet, was der heimliche Bewohner braucht. Im Regal stehen einige Bücher, die aus seiner eigenen Jugendzeit stammen. Georg hat ein paar Nachschlagwerke über heimische Pflanzen und Tiere von zuhause mitgebracht. Dort wird das niemand merken. Und wenn schon. Dann hat er sie halt gerade an jemanden aus seiner Klasse oder von den Pfadfindern ausgeliehen. Faustus Molenbrick hat in einer Truhe im Keller noch ein paar alte Klamotten von seinem Sohn gefunden. Seine Frau muss sie beim Auszug aus ihrer alten Wohnung mitgenommen haben, obwohl Gerhard nicht mehr hier eingezogen ist. Für alle Fälle hat er sie dem Patensohn zum Wechseln vorsorglich in den Schrank gepackt. Auf der bezogenen Matratze des Bettes liegt ein Schlafsack ausgerollt. Auch für ein Kissen am Kopfende und eine Wolldecke am Fußende hat der Gastgeber gesorgt. Georg liest, bastelt auf dem uralten, hier oben wieder zusammengebauten Schreibtisch an irgendetwas herum oder schaut aus dem runden Fenster hinaus und lässt seinen Gedanken freien Lauf. Beim letzten Besuch hat er es geschafft, das Buddelschiff endlich aufzurichten – nach einigen dramatischen Fehlversuchen. Jetzt steht es ohne Ziehfäden stolz auf seinem Sockel. Wie hineingezaubert. Irgendwann will er es Philipp mal zeigen. Natürlich nicht hier, sondern zu Hause bei seinen Eltern.
Manchmal wundert sich Faustus Molenbrick darüber, aber wenn er ihn besucht, scheint sein Neffe gerne für sich zu sein. Stundenlang verbringt er die Zeit allein im Dachgeschoss, ohne über Langeweile zu klagen. Trotzdem unternehmen sie auch immer wieder etwas zusammen: machen ausgedehnte Ausflüge in die nähere Umgebung, führen längere Schwätzchen beim Essen in der Küche, gehen in den Ort, um Einkäufe zu tätigen oder um jemand zu besuchen. Wenn der Junge über Nacht bleibt, schläft er ausschließlich in der „Oase“. Niemand ahnt etwas davon.
Ist Georg mit seinen Eltern und den Zwillingen zu Besuch, bleibt der Dachboden tabu. Auch wenn seine Cousine Elvira mal vorbeikommt: Das ist die Tochter von Papas Schwester Berit. Dann spielen sie zusammen im Wohnzimmer oder draußen im Garten. Manchmal streifen sie auch – in Sichtweite zum Haus – am Waldrand herum. Tante Berit ist überängstlich, darauf müssen sie Rücksicht nehmen. Als Pfadfinder und erprobter Waldläufer kann sich Georg darüber krumm und schief lachen. Maria und Bernd spielen überhaupt nicht mehr. Sie machen betont auf erwachsen, sitzen steif auf dem Sofa und schauen sich den ganzen Nachmittag im Fernsehen Sendungen an: „Gut gefragt ist halb gewonnen“, „Bonanza“ oder den „Beat-Club“. Dabei trinken sie Unmengen Orangenlimonade. Wenn sie nichts Interessantes im Programm finden, lesen sie Comics oder die „Bravo“. Dabei hören sie die neuesten Hits im Radio. Manchmal zappeln sie dann zum Takt der Musik herum, als hätten sie Schüttelfrost. Georg ist jedes Mal tief beeindruckt, wenn er sie dabei überrascht.
„Echt lässig, wie die sich geben.“
Die Erwachsenen verbringen die meiste Zeit im Wintergarten oder auf der Veranda und überlassen die Kinder sich selbst. Zu wichtig ist ihnen das, was sie jedes Mal zu besprechen haben. Zumindest der Lautstärke nach zu urteilen, in der sie ununterbrochen durcheinanderreden und sich pausenlos den Zigarettenqualm ins Gesicht pusten.
Als Faustus Molenbrick mit seiner Frau in dieses Haus gezogen ist, hat ihr Sohn Gerhard gerade seine Druckerlehre in einer weit entfernten Großstadt im Norden des Landes angefangen. Er wohnt dort bei einer entfernten Verwandten und fährt selten nach Neu-Moritzhain. Von der Kammer weiß er nichts. Wenn überhaupt, kommt er nur auf einen Sprung vorbei. Außer Georg und seinem Onkel klettert niemand vom ersten Stock zum Trockenboden hinauf. Die Zugstange für die Klappe mit der Ausziehleiter verstecken sie in der Besenkammer. Damit niemand in Versuchung kommt. Im Keller steht neben der Waschmaschine ein Wäschetrockner. Dieses Luxusgerät ist der ganze Stolz des Onkels. Wenn mal jemand fragt, was sich unter dem Dach befindet, sagt Faustus Molenbrick:
„Nichts. Die Wäsche wird im Keller getrocknet. Das übernimmt das Gerät von Miele. Ist schon klasse, was die Technik heute so alles ermöglicht. Hat aber auch eine hübsche Stange Geld gekostet.“
Manchmal muss er dann den Trockner vorführen.
Es gibt aber auch resistentere Nachfragen. In solchen Fällen fügt er noch hinzu:
„Der Boden wird ganz einfach nicht genutzt. Da geht niemand hoch. Höchstens, wenn das Dach vielleicht mal repariert werden muss. Aber so weit ist es ja noch lange nicht.“
Heute ist Georg irgendwie anders als sonst: unruhig, nervös. Plötzlich starrt er wie abwesend aus dem Fenster. Dann fängt er wieder an, auf seinem Stuhl herum zu zappeln. Wenn der Junge nach dem Jagdausflug etwas braucht, dann wohl als Erstes eine kleine Stärkung. Also stellt Faustus Molenbrick einen Becher mit heißem Kakao und einen Teller mit Honigbroten auf den Tisch und sagt:
„Greif zu! Das kann schon mal passieren, dass man die ganze Nacht umsonst auf dem Hochstand sitzt. Das Wild geht seine eigenen Wege.“
Aber Georg ist jetzt mit seinen Gedanken an einem ganz anderen Punkt und hat absolut keine Lust, über sein „Jagdabenteuer“ zu reden.
„Onkel Faustus, eine echte Oase muss wie ein Zufluchtsort absolut sicher sein. Sonst hat man keine Ruhe. Wenn da jeder reinkommen kann, macht das Ganze überhaupt keinen Sinn. Dann haben die Häscher ja Zugriff auf mich. Das dürfen wir nicht zulassen!“
„Welche Häscher, Georg?“
„Nur mal angenommen, nachts schleicht sich ein Werwolf durch eine offene Luke oder durch einen Spalt zwischen den Dachziegeln auf den Trockenboden. Dann reißt er die Tür zur Kammer auf und springt mit einem Satz in mein Bett, mitten auf mich drauf.“
„Na, du hast ja eine blühende Fantasie. Was für einen Schund liest du denn gerade? Eins von meinen Büchern ist es bestimmt nicht. Ich glaub’ es einfach nicht. Du willst mich wohl nach Strich und Faden veralbern?“
„Um Gottes willen, Onkel Faustus. Ich fühle mich eben sicherer, wenn man die Kammertür von innen verriegeln kann. Das ist doch ganz normal, oder?“
„Aha, daher weht der Wind.“
Bisher lässt sich die Tür nur von außen verschließen. Das geht natürlich nicht, wenn Georg sich dort aufhält. Der Onkel vermutet, dass sich Georg vor dem großen, düsteren Trockenboden ängstigt. Vielleicht ist ihm manchmal etwas mulmig zumute, besonders wenn Faustus Molenbrick tagsüber mal aus dem Haus geht oder nachts kein Geräusch aus dem Erdgeschoss nach oben dringt.
„Georg, wie wäre es, wenn wir von innen einen Riegel anbringen? Damit du die Tür selbst verschließen kannst. Dann hast du deine Ruhe. Und du kommst ja jederzeit wieder heraus.“
„Das ist klasse, Onkel Faustus. Wenn du klopfst, mache ich dir natürlich auf. Dreimal kurz, zweimal lang. So machen wir das.“
„Also gut, dann gehen wir jetzt runter in den Keller. Mal sehen, ob ich im Werkraum noch einen geeigneten Bolzenriegel finde. Wenn wir fündig werden, bringen wir den gleich an.“
Als Georg seine Eltern anruft, sind sie gerade nach Hause gekommen. Sie wundern sich, dass er bei Onkel Faustus ist, sind aber damit einverstanden. Sie wollen ihn vor dem Abendessen mit dem Auto dort abholen. Wie es auf der Pirsch gewesen sei, fragt ihn Papa Julius neugierig.
„Das war prima. Papa, wir sind aber nicht auf der Pirsch gewesen. Wir haben die ganze Zeit auf dem Hochstand gesessen. Das nennt man ‚Ansitzjagd‘. War ziemlich kalt da draußen, aber ich hatte ja den gefütterten Parka an. Der ist spitze! Schade, ich habe nur ein einziges Wildschwein gesehen, einen Überläufer. Es war wie verhext. Hans hat mich in der Nähe von Onkel Faustus rausgelassen. Den Rest bin ich zu Fuß gegangen. Ist ja nicht weit gewesen. Ach übrigens, Papa, kennst du einen Peter Zarßcke? Der soll bei mir auf der Schule Latein unterrichten.“
„Von dem haben wir noch nie was gehört. Jetzt ist ja Frau Riemenschneider für euch zuständig. Andere Lateinlehrer sind mir bisher nicht über den Weg gelaufen. Und deiner Mutter auch nicht, sonst wüsste ich davon. Warum ist das denn so wichtig für dich, Georg?“
„Nein, ist es überhaupt nicht. Hätte ja sein können, dass dir der Name was sagt. Papa, du kennst doch jeden. Der Mann unterrichtet den Sohn von Mirandas Nachbarn in der Oberstufe oder so. Die haben den mal erwähnt. Dass der komisch sein soll. Ich weiß aber nicht mehr, weshalb. Fiel mir nur gerade so ein. Ist ja auch egal.“
„Wer ist denn Miranda?“
„Mensch Papa, du bist echt vergesslich geworden! Miranda und ich sind in der Grundschule in derselben Klasse gewesen, obwohl sie fast ein dreiviertel Jahr jünger ist als ich. Die habe ich sogar ein paar Mal zu meinem Geburtstag eingeladen.“
„Ach ja, daran kann ich mich noch erinnern. War das nicht deine erste Angebetete? Dein erster großer Schwarm?“
„Hä? Papa, träum weiter. Ich leg jetzt auf. Onkel Faustus braucht mich im Garten. Dann bis nachher.“
Also hat Hans seinem Vater kein Sterbenswörtchen davon gesagt, dass Zarßcke mit auf den Jagdausflug kommt. Verdammt hinterhältig, wie diese Typen vorgehen. Sie machen genau das Gegenteil von dem, was sie anderen predigen. Von wegen „großes Pfadfinderehrenwort“! Denen wird er nichts mehr glauben.
*
Nach dem Mittagessen klettert Georg die Leiter hoch, schließt seine Kammer auf und schiebt den neuen Riegel von innen vor. Jetzt ist er in Sicherheit. Er öffnet den Brotbeutel und zieht die beiden Messer hervor. Angewidert versteckt er sie in dem Stauraum unter den Ziegeln am Ende der Dachschräge. Die beiden Klappen schließen gut, sie springen nicht wieder von alleine auf.
Der Onkel geht selten in das Zimmer. Diese Nische hat er anscheinend noch nie benutzt. Es ist ihm bestimmt zu unbequem, sich auf den Boden zu knien, um dort etwas zu verstauen. Manchmal fragt er nach dreckigen Anziehsachen für die Waschmaschine. Ansonsten lässt er den Jungen in der Oase schalten und walten, wie er will.
„Als Kind hätte Onkel Faustus selbst gerne solch eine Zuflucht gehabt, statt sich einen engen Raum mit zwei älteren Brüdern teilen zu müssen“, denkt Georg. „Die haben sich oft um jeden Zentimeter Platz gestritten.“
Das hat ihm der Onkel schon öfters erzählt.
In aller Abgeschiedenheit beschließt Georg, sich von seinem gesparten Geld ein neues Taschenmesser zu kaufen, das genauso aussieht wie das alte, das er hier oben versteckt hat. Ein paar Exemplare von diesem Modell hält das Geschäft noch vorrätig, das an einer Ecke ganz in der Nähe von ihrem Wohnhaus in Eibenstädt gelegen ist. Er geht oft dorthin. Manchmal ohne konkreten Anlass. Nur um in den Regalen herumzustöbern. Hier bekommt man alles: von A der Angelschnur bis Z der Zerstäuberflasche. Aber die jetzt von ihm begehrten Objekte liegen unter der Glasscheibe des Verkaufstisches. Er muss sich nur eins davon holen. Wenn jemand fragen sollte, hat er das alte Taschenmesser im Stadtwald beim Pilzesammeln verloren.
Onkel Faustus steht auf der Leiter und ruft in den Trockenboden hinein:
„Georg, du musst jetzt runterkommen! Beeil dich mal ein bisschen, deine Eltern sind gleich hier!“
*
Am nächsten Wochenende darf Georg schon wieder bei Onkel Faustus schlafen. Papa Julius bringt ihn am Freitagabend nach Neu-Moritzhain.
„Und du kommst ohne uns klar?“