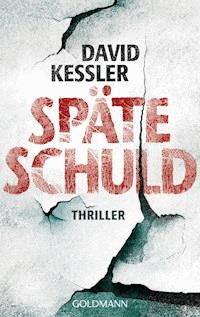
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Du kannst davonlaufen, dich verstecken, ein neues Leben beginnen – doch deiner Schuld entkommst du nie.
Der Moderator Elias Claymore ist ein aufgehender Stern am amerikanischen Talkshow-Himmel. Doch als er angeklagt wird, ein neunzehnjähriges Mädchen vergewaltigt zu haben, wird ihm sein Ruhm zum Verhängnis: Die Presse stürzt sich begierig auf den Fall, und es mangelt den Medien auch nicht an Material, denn Claymore ist alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Mit den Indizien und seiner eigenen düsteren Vergangenheit gegen sich hat Claymore nur eine einzige Chance: seinen alten Freund, den Anwalt Alex Sedaka …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Der Moderator Elias Claymore ist ein aufgehender Stern am amerikanischen Talkshow-Himmel, doch dann ist seine Karriere schlagartig zu Ende, als er angeklagt wird, ein neunzehnjähriges Mädchen vergewaltigt zu haben. Die Medien stürzen sich begierig auf den Fall und walzen jedes Detail genüsslich aus – und es mangelt ihnen auch nicht an Material, denn Claymore ist alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Claymores düstere Vergangenheit wird ans Licht gezerrt, und auch die Indizien sprechen gegen ihn. Doch Elias Claymore weiß, dass im Falle einer Verurteilung für ihn weit mehr als nur seine Freiheit auf dem Spiel steht, und so wendet er sich an seinen alten Freund, den Anwalt Alex Sedaka. Aber auch Sedaka muss bald erkennen, dass in diesem Fall das Ringen um Gerechtigkeit schnell zu einem Kampf um Leben und Tod werden kann …
Autor
Mit fünfzehn Jahren brach David Kessler die Schule ab und schrieb ein Drehbuch für einen Fernsehfilm, der zwar nie produziert wurde, Kessler aber die Augen dafür öffnete, dass seine Berufung im Schreiben liegt. Im Laufe seiner schriftstellerischen Karriere hat er in England und Amerika bereits mehrere Thriller veröffentlicht und in einem Buch sogar den Täter in einem tatsächlichen Mordfall benannt, bevor dieser neun Jahre später aufgrund eines DNA-Tests der Tat überführt werden konnte.
Mit seiner Thrillerserie um den in San Francisco lebenden Anwalt Alex Sedaka erscheint David Kessler erstmals auf Deutsch.
Von David Kessler außerdem im Goldmann Verlag erschienen:
15 Stunden. Thriller (auch als E-Book erhältlich)
David Kessler
Späte Schuld
Thriller
Aus dem Englischen
von Verena Kilchling
Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel »No Way Out« bei Avon,
a division of HarperCollinsPublishers.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung Mai 2013
Copyright © der Originalausgabe 2010 by David Kessler Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2013
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Copyright © FinePic®, München
Redaktion: Alexander Groß
An · Herstellung: Str.
Satz: IBV Satz- u. Datentechnik GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-641-09945-9
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Eran, meinen Bruder im Geiste
»Wer mit Ungeheuern kämpft,
mag zusehn, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird.
Und wenn du lange in einen Abgrund blickst,
blickt der Abgrund auch in dich hinein.«
Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und BöseAphorismus 146
Samstag, 4. Juli 2004 – 23.40 Uhr
Es waren nur zehn Finger, die über die Tastatur flogen, und doch konnten sie so viel Böses bewirken.
Voller Ehrfurcht sah sie zu, wie die Worte vor ihren Augen Gestalt annahmen, wie die Buchstaben auf dem Bildschirm mit ihren Fingern Schritt hielten. Am erstaunlichsten aber war, wie viel Schaden sich mit einer einzigen winzigen Veränderung anrichten ließ. Um das Verhalten eines ganzen Computerprogramms zu ändern, musste sie lediglich zwei Zeilen des Programms geringfügig modifizieren. Hacker und »Mitternachts-Programmierer« hätten sich über die absurde Einfachheit ihrer Manipulationen kaputtgelacht, und vielleicht hätten sich einige sogar über die schiere Dreistigkeit ihrer Unternehmung amüsiert. Aber nur wenige hätten ihre Ziele gutgeheißen.
Na und?
Sie wollte damit nicht reich oder berühmt werden. Sie wollte Gerechtigkeit – simple, altmodische Gerechtigkeit.
Während sie weiterarbeitete, hob sie den Kopf und blickte aus dem Fenster. In der Ferne sah sie die Lichter der nächtlichen Stadt glitzern, die sie daran erinnerten, dass es dort draußen, jenseits ihrer privaten Welt der Rache, noch eine andere Welt gab. Aber sie zwang sich, die Ablenkung zu ignorieren. Im kleinen Lichtkegel der Schreibtischlampe tanzten ihre Finger weiter über die Tastatur. Der Rest des Zimmers lag im Dunkeln.
Kurz darauf hielt sie inne und betrachtete zufrieden ihr Werk, das mit ein paar Klicks der linken Maustaste vollendet war. Sie hatte eine völlig neue Version des Programms erschaffen.
Und was für eine neue Version!
Fast wehmütig dachte sie an die einzelnen Arbeitsschritte zurück. Es war ziemlich kompliziert gewesen, an den Quellcode zu kommen, aber mithilfe von ein paar alten Kontakten war es ihr gelungen, die bürokratischen Hürden zu überwinden. Zum Glück besaßen viele Bundesstaaten inzwischen öffentlich zugängliche Archive oder hatten Informationsfreiheitsgesetze verabschiedet. Sie hätte sich gewünscht, das modifizierte Programm überall einschleusen zu können. Das wäre ein ziemlicher Coup gewesen. Aber sie musste realistisch bleiben.
Anfangs hatte sie gar nicht gewusst, ob sich ihr Vorhaben überhaupt in die Tat umsetzen ließ. Sie hatte keinen festen Plan verfolgt, sondern war aus purer Neugier auf die Idee gekommen, die Software zu modifizieren. Aber nachdem sie dann das Handbuch des Programms gelesen und einem Programmierer ein paar Fragen gestellt hatte, um zu verstehen, wie die Software funktionierte, war ihr aufgegangen, wie einfach das alles war.
Das Programm unentdeckt einzuschleusen war natürlich ein ganz anderes Problem. Es gab diesbezüglich mehrere Möglichkeiten. Eine bestand darin, sich in die verschiedenen Server zu hacken und das neue Programm hochzuladen. Aber das war riskant.
Es gab allerdings noch eine zweite Möglichkeit, die neue Version der Software einzuschleusen, eine, bei der sie vollkommen ohne Hacking auskam. Sie konnte die Systemadministratoren dazu bewegen, die Software selbst zu installieren. Dafür musste es so aussehen, als wäre die Software die neue Version eines Programms, das ohnehin bereits benutzt wurde. Indem sie das Programm zusammen mit einem gefälschten Briefkopf per Kurier verschickte, konnte sie die Netzbetreiber täuschen und sie dazu bringen, die neue Version in der irrigen Annahme zu installieren, es handele sich um ein Upgrade der Softwarefirma. Softwaremanipulation gepaart mit psychologischer Kriegsführung.
Jetzt würde sie es den Niggern heimzahlen.
Freitag, 5. Juni 2009 – 07.30 Uhr
Bethel war neunzehn – zu jung, um die Sechziger selbst erlebt zu haben, und zu desinteressiert, um sich die Erinnerungen ihrer Großeltern anzuhören, zum Beispiel wie ihre Mutter auf dem Woodstock-Festival gezeugt worden war.
Aber jetzt schallte Buffalo Springfields »For What It’s Worth« aus den Kopfhörern ihres iPods, während sie am Straßenrand stand und auf Hilfe wartete. Sie wusste wenig über die politischen Hintergründe dieses Songs und nichts über die Schließung des Nachtclubs Pandora‘s Box oder die Hippie-Unruhen vom Sunset Strip. Aber die Stimme von Stephen Stills war einfach unwiderstehlich. Es war keine große Kunst, den Gemeinschaftskundeunterricht an der Highschool komplett zu verschlafen – sogar die Hausaufgaben und Prüfungen ließen sich schlafwandlerisch absolvieren. Sie wusste ein bisschen was über den Vietnamkrieg und die Bürgerrechtsbewegung der sechziger Jahre, aber das war oberflächliches Schulwissen, das man nebenher aufschnappte, während man vom Quarterback der Footballmannschaft träumte.
Dieses Wissen blieb nicht als einheitliches Bild, sondern als Sammlung von Slogans in ihrem Gedächtnis haften: »We shall overcome«, »I have a dream«, »Power to the people«, »Burn, baby, burn!«. Der Ruf des Zorns hallte nach wie vor durch die Jahrzehnte, wenn auch nur noch schwach. Ein zeitlicher Abgrund trennte Bethel von der aufgewühlten Atmosphäre, die ihr Land damals beinahe auseinandergerissen hätte. Und dieser Abgrund wurde immer breiter, so dass vom durchdringenden Timbre der historischen Stimmen schließlich nur noch der verebbende Nachhall von Helden übrig blieb, an die sich kaum noch jemand erinnerte: Rosa Parks, Martin Luther King, Malcolm X, die Chicago Seven. Für Bethel nichts als Namen und Slogans, ohne Substanz.
Aber sie mochte den Song. Er war so angenehm eingängig. Bei der eindringlichen Liedzeile am Ende des Refrains, die die jungen Zuhörer dazu aufforderte, innezuhalten und sich umzusehen, bekam sie jedes Mal eine Gänsehaut. Sie hatte nur eine dunkle Ahnung davon, was sie bedeutete. Was auch immer es war, es hatte vor langer Zeit stattgefunden. Ist ja auch egal, dachte sie. Das war die Generation ihrer Großeltern gewesen. Sie selbst gehörte einer anderen Generation an, einer Generation, die mehr damit beschäftigt war, Arbeit zu finden, als damit, die Welt zu verändern.
Ihr voller Name lautete Bethel Georgia Newton. Was das Aussehen anging, war sie ganz das klassische Cheerleadergirl mit blondierten Haaren, sorgsam kultiviertem Teint und einem Lächeln wie aus der Zahnpastawerbung. Weder zu schlank noch zu drall, sondern ein perfektes »Zwischending« für ihre Größe von knapp eins siebzig; sportlich, aber auf eine weibliche, nicht übertriebene Art, mit durchtrainierten, aber nicht übermäßig muskulösen Beinen. Sie war in einem bürgerlichen Milieu aufgewachsen, weit weg von jeder Straßenkultur, aber was Lebenserfahrung anging, war sie kein unbeschriebenes Blatt mehr. Man konnte sie vielleicht nicht unbedingt als abgeklärt bezeichnen, aber sie hatte bereits einen Blick auf die bittere Seite des Lebens geworfen.
In ihrem engen weißen T-Shirt und Jeansshorts, die ihre durchtrainierten Kurven nur unzulänglich verbargen, stand sie am Straßenrand und hielt bei jedem vorbeifahrenden Auto den Daumen hoch. So wie ihr T-Shirt sich über ihren vollen Brüsten spannte und die perfekte, satte Bräune ihrer Oberschenkel seidig im kalifornischen Sonnenlicht schimmerte, konnte es doch nicht allzu schwer sein, jemanden zu finden, der sie ein Stück mitnahm. Aber sie musste feststellen, dass die Leute anscheinend panische Angst davor hatten, einer fremden Person am Straßenrand zu helfen.
Ein paar Meter entfernt stand ihr liegen gebliebenes Auto, und sie konnte nicht mal telefonisch Hilfe anfordern, weil der Akku ihres Handys leer war. Zunächst hatte sie einen halbherzigen Versuch unternommen, das Auto selbst zu reparieren, aber sie verstand nicht wirklich etwas von Motoren. Also blieb ihr nichts anderes übrig, als einen guten Samariter an den Straßenrand zu winken und ihn zu bitten, sie zu einer Werkstatt mitzunehmen.
Insgeheim hoffte sie auf einen gutaussehenden Mann mit technischem Geschick und ansehnlichem Vermögen, der sie nicht nur aus ihrer Notlage am Straßenrand rettete, sondern auch aus der Ziellosigkeit und Langeweile, die ihr Leben in letzter Zeit zu bestimmen schienen. Aber sie hätte sich auch mit einem älteren Pärchen zufriedengegeben, das sie bis zur nächsten Telefonzelle mitnahm. Nun, nicht einmal das war ihr vergönnt. Das Leben war unfair.
Aber dann schien sie doch noch Glück zu haben.
Ein aquamarinfarbener Mercedes steuerte auf sie zu und bremste, ein neueres Modell aus der exklusiven Sparte der europäischen Automobilindustrie. Der Besitzer war eindeutig wohlhabend und wahrscheinlich jüngeren Alters. Als der Mercedes am Straßenrand zum Stehen kam, sah sie, dass der Fahrer ein Schwarzer war, den sie auf Ende zwanzig schätzte.
Was meine Eltern jetzt wohl denken würden?, fragte sie sich amüsiert und malte sich aus, wie sie mit dem jungen Mann im Schlepptau bei ihren liberalen Eltern auftauchte.
Aussprechen würden sie ihre Gedanken natürlich nicht. Sie würden ihn herzlich und gastfreundlich behandeln, aber Bethel fragte sich, ob sie wirklich in der Lage waren zu praktizieren, was sie predigten. Ihr ging auf, dass sie ihre Eltern eigentlich gar nicht richtig kannte. Und nun stand sie hier, weit weg von zu Hause, auf der Suche nach sich selbst.
Der junge Mann beugte sich lächelnd aus dem Autofenster und fragte, ob sie Hilfe brauchte. An seinem selbstbewussten Tonfall erkannte sie, dass er es im Leben zu etwas gebracht hatte. Sie fühlte sich sofort angezogen von seinem jugendlich-guten Aussehen und seiner ruhigen, coolen Selbstsicherheit, auch wenn sein Vokabular noch Spuren einer Herkunft aufwies, die er vermutlich verheimlichen wollte – oder vielleicht nur vergessen.
Er warf einen Blick unter die Motorhaube, schüttelte nach ungefähr einer Minute den Kopf und sagte: »Mit Motoren stehe ich auf Kriegsfuß. Mit Menschen komme ich irgendwie besser klar.« Mit diesem offenherzigen Eingeständnis und seinem entwaffnenden Lächeln gewann er sie endgültig für sich. Zwei Minuten später saß sie in seinem Wagen, und sie glitten die Straße entlang und lernten sich besser kennen. Bis ihr irgendwann auffiel, dass er von der Hauptstraße abgebogen war.
Sie wollte fragen, wo sie hinfuhren, aber dann erhaschte sie einen flüchtigen Blick auf sein Profil und sah, wie sich seine Lippen zu einem Lächeln verzogen. Sie konnte nicht erkennen, ob es ein freundliches Lächeln war. Während sich die ersten Anzeichen einer dunklen Vorahnung in ihrer Magengrube zu einem Knoten ballten, ging ihr auf, dass sie viel zu große Angst hatte, um ihre Frage zu stellen.
Freitag, 5. Juni 2009 – 08.50 Uhr
»Ich habe Schmetterlinge im Bauch, Gene«, gestand Andi, während sie sich durch die Straßen von Los Angeles schlängelten.
»Zum Umkehren ist es zu spät.«
Sie lachten beide. Allmählich entwickelte sich dieser Satz zum Insiderwitz. Es hatte sie beide nervös gemacht, den Big Apple zu verlassen und ein neues Leben an der Westküste zu beginnen, auf der anderen Seite des Kontinents. Aber für Andis Karriere war der Umzug unumgänglich gewesen.
Andi Phoenix saß schweigend im Auto und brütete nervös vor sich hin. Sie war Ende dreißig und hatte sich ihr gutes Aussehen durch gesunde Ernährung, regelmäßiges Workout und ein wenig plastische Chirurgie bewahrt. Ihre Brüste waren mithilfe von Silikonimplantaten von 70B auf 75D angewachsen, und sie hatte sich bereits einmal Botox spritzen lassen, um die ersten Altersfältchen zu bekämpfen. Aber alles andere war allein ihrer Disziplin und einer gesunden Lebensweise zu verdanken. Das Blond ihrer Haare kam aus der Flasche, denn ihre Originalhaarfarbe war ein unscheinbares Braun. Die neue Haarfarbe war so etwas wie eine Therapie gewesen nach ihrer schwierigen Jugend. Leider brachten all diese Verschönerungen als großen Nachteil die Aufmerksamkeit der Männer mit sich, auf die sie gut hätte verzichten können. Sie war ein paar Zentimeter kleiner als die schwarze Frau auf dem Fahrersitz. Auch sonst hatte sie manchmal das Gefühl, im Schatten ihrer Freundin zu stehen.
Gene berührte sanft Andis Unterarm. »Denk dran, Süße: Die kennen dich auch noch nicht. Aber sie waren bereit, das Risiko einzugehen und dich herzuholen.«
Am Steuer saß – auch im übertragenen Sinne – Eugenia Vance, die eins achtzig groß und muskulös war und sie an diesem Morgen spielerisch im Bett niedergerungen hatte, wie üblich.
Sie hatten sich vor über zwanzig Jahren kennengelernt, als Andi noch ein Teenager gewesen war. Seit Gene Andi durch ihre Krisenjahre geholfen hatte, waren sie unzertrennlich. In all den Jahren, die sie sich kannten, hatten sie nie das Wort »lesbisch« verwendet, um ihre Beziehung zu definieren. Es ging nicht darum, irgendetwas zu leugnen, aber alle ihre Instinkte sträubten sich gegen diese Kategorisierung. Weder Gene noch Andi liebten »Frauen«, sie liebten sich.
»Trotzdem frage ich mich, ob das Ganze nicht ein großer Fehler war.«
Schnaubend brachte Gene zum Ausdruck, was sie von Andis Selbstmitleid hielt. »Da hast du dir ja den idealen Zeitpunkt für deine Zweifel ausgesucht, Mädchen!«
In Kalifornien war Andis Spezialgebiet sehr gefragt. Sie hatte Psychologie im Hauptfach studiert und anschließend ihren Juraabschluss an der juristischen Fakultät der Northeastern University gemacht, in deren progressiver, soziales Engagement unterstützenden Atmosphäre sie regelrecht aufgeblüht war. Nach dem Examen hatte sie jedoch feststellen müssen, dass die Justiz ein nervtötendes Geschäft sein konnte. Ihre Arbeit als Strafverfolgerin bestand weniger aus Prozessarbeit als darin, Absprachen mit den Richtern auszuhandeln, was normalerweise bedeutete, dass sich der jeweilige Kriminelle in weniger schweren Anklagepunkten schuldig bekannte, um mit einer milderen Strafe davonzukommen – wohl kaum der Dienst an der Gerechtigkeit, den sie sich vorgestellt hatte, und weit entfernt von den Idealen, die sie ursprünglich dazu bewogen hatten, Juristin zu werden.
Zugespitzt hatte sich die Lage, nachdem sie sich eine Lungenentzündung eingefangen hatte und gezwungen gewesen war, sich in der Kanzlei, in der sie nach dem Studium eine Stelle gefunden hatte, längere Zeit krankschreiben zu lassen. Als sie an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt war, hatte man sie alles andere als mit offenen Armen empfangen. Das Arbeitsrecht schützte sie zwar vor Kündigung, aber sie wurde immer unverhohlener ausgebootet. Schließlich hatte sie die Kanzlei gewechselt und die darauffolgenden acht Monate damit verbracht, sich in die neuen Fälle einzuarbeiten.
In dieser Zeit hatte sich ihr Interesse an der Materie geändert. Es gab zwar auch Unschuldige, die Rechtsbeistand brauchten, aber im Wesentlichen bedeutete strafrechtliche Arbeit, dass man den Schuldigen half, und das machte ihr ganz und gar keinen Spaß. Also zog sie die »Wilderer-wird-Wildhüter«-Nummer ab und bewarb sich bei der Staatsanwaltschaft, in der Abteilung für häusliche Gewalt, wo sie sich eine Zeitlang sehr wohlfühlte. Da sie sich wieder ganz von unten hocharbeiten musste, war sie nicht besonders oft im Gerichtssaal. Ihre Aufgabe bestand hauptsächlich im direkten Kontakt mit den Gewaltopfern, im Lesen von Polizeiberichten und im Zusammentragen von Beweisen. Das machte ihr nichts aus. Die Arbeit gab ihr das Gefühl, endlich nützlich zu sein.
Paradoxerweise setzte ihre zweite Phase der Desillusionierung erst ein, nachdem sie befördert worden war und mehr Zeit im Gerichtssaal verbrachte. Sie tat wieder genau das Gleiche wie vorher, nur dass sie jetzt auf der anderen Seite des Tisches saß und die Verbrecher Absprachen mit ihr aushandelten. Deren Anwälte empfand sie größtenteils als widerliche Typen, und ihr ging auf, wie verachtenswert sie selbst früher den Staatsanwälten als Strafverteidigerin vorgekommen sein musste.
Zur selben Zeit entwickelte sie ein neues Steckenpferd: die Vertretung von Gewaltopfern vor Gericht. Die zivilrechtliche Vertretung von Gewaltopfern war eine wachsende Branche, und sie wollte nur zu gern an dieser Entwicklung teilhaben. Aber schon bald hatte sie die oberste Karrierestufe erreicht und musste feststellen, dass dieses Spezialgebiet an der Westküste deutlich weiter entwickelt war als an der Ostküste. Der Gedanke, an die Westküste zu ziehen, behagte ihr nicht besonders. Aber dort boten sich ihr ganz andere Karrieremöglichkeiten.
»Und was ist, wenn ich den Anforderungen nicht gerecht werde?«, fragte Andi, die immer noch auf Bestätigung aus war.
»Jetzt pass mal auf«, sagte Gene nachdrücklich. »So was will ich von dir nicht hören. Nichts kann dich aufhalten außer deiner eigenen Angst – und wenn du dich von der überwältigen lässt, stehe ich direkt hinter dir und versohle dir deinen hübschen kleinen Hintern.«
»So klein ist der gar nicht«, protestierte Andi, aber dieses Mal klang es humorvoll und nicht wehleidig.
An Andis Hintern war in Wahrheit nicht das Geringste auszusetzen, was ihr jedes heißblütige männliche Wesen, das in ihre Nähe kam, nur allzu bereitwillig bestätigt hätte.
Gene hatte oft etwas Kompromissloses an sich, aber es war genau dieser Glaube, dass man im Leben Entscheidungen treffen und sie bedingungslos durchziehen musste, den Andi so an ihr schätzte. In allen wichtigen Belangen traf Gene für sie beide die Entscheidungen, und so hatte Gene auch entschieden, dass sie von nun an hier in Kalifornien leben würden. Andi hätte nie auf dem Umzug bestanden, so sehr sie ihn sich auch für sich selbst gewünscht hatte. Ihr fehlte immer noch das Selbstvertrauen, das nötig war, um Gene die Stirn zu bieten – mit der Welt nahm sie es auf, mit Gene nicht. Und Gene wusste eben ganz genau, dass Andi nach Kalifornien gehen musste, wenn sie ihre Karriere vorantreiben wollte. Sie selbst hätte gern darauf verzichtet, aber Andi bedeutete ihr zu viel, als dass sie ihr mit ihren persönlichen Interessen im Weg stehen wollte.
In Anbetracht der Umstände war Gene also bereit, ihre Wurzeln zu kappen und auf der anderen Seite des Landes neu anzufangen. Ein Opfer ist nur dann ein Opfer, wenn man etwas Wertvolles für etwas weniger Wertvolles aufgibt, sagte sie sich, eine Philosophie, die ihr viel Kraft gespendet hatte, als sie es wirklich nötig gehabt hatte. Andis Glück ist mir wichtiger als meine eigene zweitklassige Karriere. Also ist es nicht wirklich ein Opfer.
Gene liebte an Andi, dass sie vordergründig sanft und schüchtern wirkte, aber hitzig und willensstark sein konnte, wenn ihr Sinn für Gerechtigkeit geweckt wurde. Dieses Paradox sprach aus Andis Augen genauso wie aus ihren Worten. Ihre Augen besaßen eine magische Eigenschaft, die so beängstigend wie faszinierend war: Sie konnten gleichzeitig bedrohlich und verletzlich dreinblicken. Eigentlich waren es Andis Augen gewesen, in die sich Gene verliebt hatte. Als sie ihr bei ihrer ersten Begegnung ins Gesicht gesehen hatte, war der flehende, hilflose Ausdruck darin rasch in Wut übergegangen … nein, nicht in Wut … in Beharrlichkeit.
Gene drosselte das Tempo, lächelte Andi aufmunternd zu und betrachtete neugierig die Bürogebäude, die neben ihnen aufgetaucht waren. Andi erwiderte das Lächeln. Genes ansteckende Zuversicht hatte ihr Mut gemacht.
»Sieht aus, als wären wir da«, erklärte Gene resolut.
Sie bremste vor einem großen Bürokomplex.
»Wünsch mir Glück«, bat Andi und holte tief Luft.
Gene sah sie streng an. »Das mache ich bestimmt nicht, Süße. Das hast du nämlich gar nicht nötig.«
Gene zog Andi mit der linken Hand zu sich heran, um sie auf den Mund zu küssen. Es gelang ihr immer wieder, Andi aufzumuntern, wenn sie von Angst und Selbstzweifeln überwältigt wurde.
Genau dafür liebe ich dich, Gene, dachte Andi und schloss die Augen. Aber sie sagte es nicht. Stattdessen drückte sie Gene noch an sich, als diese die Umarmung schon längst gelockert hatte, bevor sie sich schließlich losriss und aus dem Auto stieg. Sie wollte etwas sagen, aber sie war immer noch ganz zittrig vor Aufregung und wusste, dass Gene das spürte.
»Jetzt geh rein und hau sie um, Süße!«
Andi warf die Autotür zu und ging auf den Bürokomplex zu. Ohne einen Blick auf die unzähligen Namensschilder der Kanzleien und Buchhaltungsfirmen zu werfen, betrat sie das Gebäude und zeigte dem Sicherheitspersonal ihren Ausweis.
Draußen blickte Gene Andi hinterher wie eine Mutter, die ihre weinende Sechsjährige am ersten Schultag im Getümmel verschwinden sieht. Dann ließ sie den Motor aufheulen, wendete den Wagen aggressiv mitten auf der Straße und fuhr die Strecke zurück, die sie gekommen war. Ihr war klar, dass es ein harter Tag für Andi werden würde – erste Arbeitstage sind immer hart.
Das Handyklingeln riss sie aus ihren Gedanken. Der Anruf kam von SagNein zu Gewalt, einem Krisenzentrum für Vergewaltigungsopfer.
»Hallo«, meldete sich Gene und drückte auf den Knopf für die Freisprechanlage.
Bridget Riley arbeitete in der Abteilung für Sexualverbrechen der örtlichen Polizeiwache. Und ein Anruf von Bridget Riley konnte eigentlich nur eins bedeuten: Es war wieder eine Frau vergewaltigt worden.
Freitag, 5. Juni 2009 – 09.45 Uhr
»Du bist früh dran, Alex.«
Alex Sedaka drehte sich um und sah einen achtundfünfzigjährigen schwarzen Mann vor sich stehen, der ihn strahlend anlächelte. Elias Claymore war viel zu warm angezogen für den südkalifornischen Sommer, womit er vermeiden wollte, dass man ihn erkannte. Er lenkte nicht gern die Aufmerksamkeit auf sich, weil er sonst sofort von Autogrammjägern umringt wurde.
»Ich saß in der ersten Reihe«, erklärte Alex und erwiderte das Lächeln. »So war ich der Erste an der Tür.«
»Wie geht‘s dir, alter Freund?«, fragte Claymore und verschmähte Alex’ ausgestreckte Hand, um ihn stattdessen an die Brust zu ziehen und herzlich zu umarmen.
Alex erwiderte die freundschaftliche Umarmung und folgte Claymore dann durchs Flughafengebäude.
»Was ist mit deiner Show?«, fragte er, während sie auf einen Ausgang zusteuerten.
»Der Sender hat den Vertrag verlängert.«
Elias Claymore war der neue Star unter den Talkshowmoderatoren, seit man im letzten Jahr beschlossen hatte, seine kalifornische Talksendung landesweit auszustrahlen. Manche hielten ihn bereits für den nächsten Montel Williams. Andere wiederum kritisierten diesen Vergleich im Hinblick auf Claymores wenig ehrenhafte Vergangenheit.
»Was macht die Liebe?« Typisch Elias, Gesprächspausen mit einer indiskreten Frage zu füllen.
»Ich bin mit meiner Arbeit verheiratet, das weißt du doch«, antwortete Alex mit einem Zwinkern. »Deshalb habe ich auch nie Zeit, mir deine Talkshow anzusehen.«
»Ach ja? Da habe ich aber was ganz anderes gehört.«
»Was denn?«
»Ach, mir hat da so ein Vögelchen gezwitschert, dass du jetzt mit einer gewissen Fernsehreporterin zusammen bist.«
»Du solltest nicht alles glauben, was die Vogelpropaganda von sich gibt.«
»Warum treffen wir uns dann zum Frühstück und nicht zum Mittagessen?«
»Ich dachte, ihr zeichnet mittags die Sendung auf?«
»Du könntest mitkommen und sie dir live im Studio ansehen.«
»Das werde ich wohl verschieben müssen. Ich treffe mich mit einer …« Alex grinste wie ein kleiner Junge, den man auf frischer Tat ertappt hatte.
Elias grinste zurück. »Hatte das Vögelchen also doch recht.«
»Ich weiß doch noch gar nicht, ob was draus wird. Diese Fernbeziehungen funktionieren normalerweise sowieso nicht. Sie wohnt hier in Südkalifornien, und ich lebe in San Francisco.«
»Und du bist noch nicht über Melody hinweg.«
Alex schwieg. Sie waren Freunde, seit er Claymore vor über zwanzig Jahren als Anwalt vertreten und ein geringeres Strafmaß für ihn ausgehandelt hatte. Mit der Zeit hatten sie gelernt, sich gegenseitig zu vertrauen und zu respektieren. Aber sie hatten auch gelernt, sich gegenseitig zu durchschauen.
»Moment mal«, protestierte Alex plötzlich. »Das ist aber nicht der Weg zum Parkplatz.« Er kannte den Los Angeles International Airport in- und auswendig und hatte sofort gemerkt, dass sie auf die Taxihaltebuchten im Untergeschoss zusteuerten.
»Kein Parkplatz heute, Kumpel. Wir nehmen ein Taxi.«
»Taxi? Übertreibst du diese ganze Inkognito-Geschichte jetzt nicht ein bisschen?«
»Mein Auto wurde gestohlen.«
»Gestohlen? Wann? Wie?«
»Vor zwei Tagen.«
»Stellt dir deine Versicherung denn keinen Leihwagen?«
»Doch, bestimmt. Sobald ich dazu komme, mich mit ihr in Verbindung zu setzen. Bisher hatte ich nicht mal Zeit, den Cops den Diebstahl zu melden.«
»Wenn du gestohlen sagst, meinst du dann Carjacking? Mit vorgehaltener Waffe?«
»Spinnst du? Wenn ich da gewesen wäre, hätte ich die Scheißkerle fertiggemacht. Ich bin ausgestiegen, um eine Zeitung zu kaufen.«
»Ich dachte, dein Mercedes hat eine digitale Zündsteuerung? Sind die nicht angeblich kurzschlusssicher?«
»Nicht, wenn man den Schlüssel stecken lässt.«
Alex starrte ihn mit großen Augen an. »Das ist nicht dein Ernst!«
Claymore hob verlegen die Hände. »Ich bekenne mich der Dummheit für schuldig, Euer Ehren.«
Sie lachten beide und setzten ihr freundschaftliches Geplänkel fort, ohne zu ahnen, dass sich über ihnen ein Sturm zusammenbraute.
Freitag, 5. Juni 2009 – 10.15 Uhr
Das Zimmer war in kaltem, klinischem Weiß gehalten. Es sollte nicht nur hygienisch, sondern auch beruhigend wirken, besaß jedoch die Gemütlichkeit eines Science-Fiction-Filmsets.
»Gut, jetzt bitte stillhalten«, sagte Dr. Weiner und nahm zwischen Bethels Beinen den dritten Abstrich.
Bethel hielt still und zwang sich, nicht an das zu denken, was gerade mit ihr passierte oder in den letzten Stunden mit ihr passiert war. Doch je heftiger sie sich dagegen wehrte, desto schmerzhafter überfluteten sie die Erinnerungen.
»Ich verstehe das nicht«, sagte Bethel und kämpfte gegen die Tränen an. »Wie viele Abstriche brauchen Sie denn noch?«
»Wir nehmen immer mehrere«, erklärte Bridget Riley, die junge Kriminalbeamtin, die einige Meter entfernt stand.
»Aber wozu?«
Bridget hörte an Bethels Stimme, dass die junge Frau all ihre Kräfte zu mobilisieren versuchte.
»Weil manchmal die ganze Probe beim Labortest verbraucht wird und wir vielleicht zur Sicherheit noch einen zweiten Test machen oder eine Probe der Verteidigung aushändigen müssen, damit sie unabhängige Tests durchführen kann.«
Bethel Newton war bereits von allen Seiten fotografiert und gründlich von einer Ärztin untersucht worden, außerdem waren Vaginalabstriche und Fingernagelproben genommen worden. Auch Schamhaarproben gehörten zum Prozedere, aber Bethel war vollständig rasiert. Die im Mundraum entnommenen Abstriche dienten als Referenzproben. Bethels Körper war nun – im polizeilichen Ermittlungsjargon – ein Tatort. Und die Vaginalabstriche und Nagelproben stellten am Tatort gesicherte Spuren dar.
»Ich sehe nicht ein, wozu das gut sein soll«, murmelte Bethel.
»Die Referenzproben sind dazu da, zwischen verschiedenen Spendern zu unterscheiden. Inzwischen gibt es sogar leistungsfähige Verfahren zur DNA-Isolierung aus Sperma.«
»Er hat aber ein Kondom benutzt.« Sie erinnerte sich, wie geschickt er sie mit seinem Körpergewicht fixiert hatte, um das Kondom überzustreifen, bevor er in sie eingedrungen war. So als wüsste er genau, was er tat – als wäre es nicht das erste Mal. Manche Männer sind Experten im Umgang mit BH-Verschlüssen. Dieser Mann war Experte in Sachen Vergewaltigung – und Experte darin, möglichst wenige Beweise zu hinterlassen.
»Wir erwarten auch gar nicht, identifizierbares Sperma im Vaginalabstrich zu finden«, erklärte Bridget. »Aber nachprüfen müssen wir es trotzdem.«
Bethel durchfuhr ein Schauer, aber sie sagte nichts. Sie hatte nicht erwartet, dass es so schlimm werden würde.
»Sie haben ihn gekratzt, vergessen Sie das nicht«, fügte Bridget hinzu. »Deshalb enthalten die Fingernagelproben vielleicht Gewebe- oder sogar Blutspuren, durch die wir an seine DNA kommen. Es kann aber auch sein, dass wir Reste vom Kondom darin finden. Vielleicht hat er es in der Nähe weggeworfen.«
»Na und?«, fragte Bethel verbittert. »Inwiefern hilft Ihnen das dabei, ihn zu erwischen?«
Bridget holte tief Luft und erklärte dann geduldig: »Also gut, gehen wir mal davon aus, dass wir eine leere Kondompackung am Straßenrand in der Nähe des Tatorts finden. Wenn darauf Fingerabdrücke sind und er vorbestraft ist, können wir ihn identifizieren und einen Haftbefehl auf ihn ausstellen. Und angenommen er hat das Kondom wirklich weggeworfen, dann finden wir daran und in den Abstrichen, die wir von Ihnen genommen haben, vielleicht Beschichtungsflüssigkeiten – also Substanzen wie Gleitmittel, Spermizide oder Anti-Haftpulver – und können sie auf chemische Ähnlichkeiten mit Kondomen untersuchen, die wir im Besitz des Verdächtigen finden.«
»Und was beweist das?«, fauchte Bethel verächtlich. »Dass er die gleiche Kondommarke benutzt?«
Bridget legte tröstend eine Hand auf Bethels Schulter. »Beweise sind wie Puzzleteile, Bethel. Wenn wir genügend davon zusammensetzen, haben wir ihn, und wenn wir seine DNA anschließend mit DNA-Proben aus anderen Fällen abgleichen, kriegen wir ihn sogar für mehrfache Vergewaltigung dran. Und dann kannst du es dir als Verdienst anrechnen, ihm das Handwerk gelegt zu haben.«
Bethel wusste, dass diese Schmeichelei reine Taktik war, aber sie erwärmte sich trotzdem für das Argument und nickte.
Zwischen ihr und Bridget begann sich allmählich eine Bindung zu entwickeln, was ganz normal war: Von dem Moment an, in dem Bethel in die Polizeiwache getaumelt war, war Detective Bridget Riley ihr nicht mehr von der Seite gewichen.
Bethel hatte sich zunächst dagegen gesträubt, die vielen Untersuchungen über sich ergehen zu lassen. Mehrmals hätte sie beinahe einen Rückzieher gemacht. Aber Bridget hatte sie zum Durchhalten überredet, indem sie darauf hingewiesen hatte, dass ihre Blutergüsse und inneren Verletzungen auf beträchtliche Krafteinwirkung seitens des Vergewaltigers hindeuteten.
»Es besteht also so gut wie keine Gefahr, dass er einvernehmlichen Geschlechtsverkehr geltend macht«, versicherte Bridget ihr. »Bei Vergewaltigungen im Zuge einer Verabredung kommen Männer manchmal damit durch, aber bei Ihnen war es ja keine Verabredung. Wir müssten uns schon sehr dumm anstellen, damit er diese Ausrede anbringen kann. Und sobald wir den Täter identifiziert haben, kriegen wir ihn mithilfe der DNA dran, die wir hoffentlich aus den Abstrichen oder Nagelproben gewinnen.«
»Aber dafür müssen Sie ihn erst mal finden«, sagte Bethel zögernd.
»Wir gleichen seine DNA mit der landesweiten Gen-Datenbank NDIS ab, aber auch mit der kalifornischen DNA-Datenbank, die vielleicht etwas detaillierter ist.«
Bethel lächelte nervös. Dann sagte sie etwas, das Bridget ziemlich seltsam vorkam: »Was ist, wenn seine Anwälte Sachen über mich ausgraben?«
Freitag, 5. Juni 2009 – 11.05 Uhr
»Wie groß ist denn meine neue Abteilung?«, fragte Andi den hageren, bebrillten Herrn im hellgrauen Anzug, neben dem sie im Großraumbüro an den Schreibtischen entlangging.
Weil es eine Verwechslung bezüglich ihres ersten Arbeitstags gegeben hatte, hatte sie den halben Vormittag in einem Zimmer gesessen und Broschüren und Online-Material über Levine und Webster gelesen, statt eingearbeitet und ihren neuen Kollegen vorgestellt zu werden. Der Personalchef war erst am Montag wieder im Haus, weshalb es Paul Sherman, einem der Kanzleipartner, überlassen blieb, Andi durch das Labyrinth aus Schreibtischen und schulterhohen Trennwänden zu führen, hinter denen die jüngeren (männlichen) Mitarbeiter neugierig hervorspähten, um einen Blick auf die Neue zu erhaschen. Die meisten Frauen konzentrierten sich hingegen auf ihre Kopierarbeiten oder die Akten auf ihrem Schreibtisch und hoben nur kurz den Blick, um die Konkurrenz abzuschätzen.
»Es ist nicht wirklich eine Abteilung«, antwortete Sherman nervös. »Eher ein Bereich innerhalb meiner Abteilung.«
Andi verspürte einen Anflug von Unbehagen, als diese Worte in ihr Bewusstsein vordrangen. »Das verstehe ich nicht. Ich dachte, ich würde hier eine Abteilung leiten.«
Sherman wand sich vor Verlegenheit. Er war nur wenig kleiner als Andi, und doch schien sie ihn um Längen zu überragen. »Na ja, meine Abteilung befasst sich mit fahrlässigem Verhalten jeglicher Art, und in unserer Kanzlei ist die Verschuldenshaftung eben eine Unterabteilung davon.«
»Ich hätte gedacht, dass zwischen böswilligem und fahrlässigem Verhalten ein Unterschied besteht.«
»Fällt beides unter rechtswidrig.«
»Hausfriedensbruch ist auch rechtswidrig«, entgegnete sie, als würde sie mit einem Kind sprechen. »Genau wie Belästigung oder Beleidigung.«
»Ja, aber Verleumdung und üble Nachrede sind vorsätzlich.«
»Verbrechen auch.«
Sherman wirkte peinlich berührt. Auch wenn ihn Andis Konfrontationskurs sichtlich ärgerte, schien es ihm zu widerstreben zurückzuschießen. »Nun ja, ich möchte mich hier nicht als Besserwisser aufspielen. Wenn wir ein Verbrechensopfer zu vertreten haben, werden Sie diejenige sein, auf deren Schreibtisch der Fall landet. Sie sind die Expertin auf diesem Gebiet. Ich bin nur ein einfacher Anwalt für Fahrlässigkeitsfälle.«
Das Unbehagen in Andi wuchs. Ihr war etwas ganz anderes versprochen worden. Die Kanzlei hatte ihr die Stelle ohne Vorstellungsgespräch angeboten, einzig und allein auf Basis ihres Lebenslaufs und der Empfehlung ihres Abteilungsleiters in New York. Was Sherman nun beschrieb, ähnelte so gar nicht der Jobbeschreibung, die sie im Zuge des Stellenangebots erhalten hatte, sondern stellte eher einen Rückschritt dar.
Sie hatte sich zu dem Jobwechsel entschlossen, nachdem ihr klar geworden war, dass sie in New York keine Aufstiegsmöglichkeiten hatte. Aber jetzt sah es so aus, als sei sie hergelockt worden, um auch hier nur auf der Stelle zu treten. Sie fühlte sich betrogen. Abwarten, ermahnte sie sich. Bloß kein vorschnelles Urteil fällen. Vielleicht täuscht der erste Eindruck ja. Vielleicht haben sie hier nur eine andere Kanzleistruktur.
»Lassen Sie mich noch einmal nachhaken, Mr Sherman: Jedes Verbrechensopfer, das gegen den Täter vor Gericht ziehen will, landet auf meinem Tisch?«
Sie beobachtete sein Gesicht genau.
»Solange der Fall ausschließlich in Ihr Aufgabengebiet fällt, ja. Es könnte allerdings auch Bereiche geben, die sich überschneiden, dann müssen wir das diskutieren. Aber niemand wird irgendetwas hinter Ihrem Rücken unternehmen, geschweige denn über Ihren Kopf hinweg. Alles wird auf Konsensbasis entschieden.«
Es war offensichtlich, dass er sie aufmuntern und ihr Mut machen wollte. Dass man sie hier respektierte, lag auf der Hand, da die Kanzlei sonst kaum jemanden vom anderen Ende des Landes eingestellt und ihm ein derart großzügiges Gehalt angeboten hätte, von der Übernahme der Umzugskosten ganz zu schweigen.
»Das klingt ja ganz vernünftig. Ich hatte mir nur etwas anderes vorgestellt.«
»Dann lassen Sie uns doch einfach abwarten, wie es läuft«, schlug er vor. »Sie werden auf jeden Fall eigenverantwortlich arbeiten, und in den allermeisten Fällen wird niemand versuchen, Ihr Know-how in Frage zu stellen. Die anderen Partner werden sich aller Voraussicht nach Ihrem Urteil beugen, schließlich sind Sie die Expertin.«
»Na, dann an die Arbeit«, erwiderte Andi, deren Miene sich allmählich aufhellte.
»Das ist die richtige Einstellung.«
»Also, wo ist mein Büro?«
Sherman wirkte peinlich berührt. »Na ja, es ist nicht wirklich ein eigener Raum«, sagte er nervös. »Wie Sie sehen, arbeiten wir hier im Großraumbüro.«
»Sie meinen, nur die Partner haben eigene Büros?«
»Nein, ein paar andere auch. Aber wir hatten kein Zimmer mehr frei, von den Konferenzräumen einmal abgesehen. Sie bekommen Ihr Büro, sobald wir eine Lösung für unser Platzproblem gefunden haben. Wir müssen nur erst ein bisschen was umorganisieren. In der Zwischenzeit bekommen Sie eine Arbeitskabine in der Ecke – da kriegen Sie den Lärm gar nicht mit.«
Er bemerkte ihren Gesichtsausdruck. »Was ist?«
»Kann sein, dass ich mich damit unbeliebt mache, aber ich möchte eines klarstellen: Für eine Arbeitskabine im Großraumbüro bin ich nicht in Ihre Kanzlei gekommen. Ich habe den Vertrag unterschrieben, weil ich ein eigenes Büro bekommen und sogar eine Abteilung leiten sollte, und nicht, um hier wie ein Stiefkind behandelt zu werden.«
Freitag, 5. Juni 2009 – 14.40 Uhr
»Boah, seht euch diesen Hintern an!«
Alex warf dem schielenden Proleten in zerrissenen Jeans mit der fast leeren Dose Budweiser in der Hand einen wütenden Blick zu. Der Mann drehte den Kopf zu ihm, als wollte er fragen: »Willst du ein großes Ding draus machen?«
Im Grunde wollte Alex das nicht. Aber er war bereit dazu. Die rechtlichen und beruflichen Konsequenzen für ihn als Anwalt machten ihm mehr Angst als die Möglichkeit, zusammengeschlagen zu werden. Der Kerl war zwar größer als er, aber Alex praktizierte Krav Maga, eine israelische Kampfkunst, und schätzte die Chancen ungefähr fifty-fifty ein.
Weil er dem nach Aufmerksamkeit heischenden Trunkenbold keinen Gefallen tun wollte, konzentrierte sich Alex wieder auf den Billardtisch, über den sich gerade eine vierunddreißigjährige, katzenhafte dunkelhaarige Frau chinesisch-amerikanischer Herkunft beugte.
Sie waren im Embassy Billardclub in San Gabriel. Während des Herrenwettbewerbs – das Embassy war der vierte von sechs Austragungsorten der US-Tour – war der Club überfüllt gewesen, aber jetzt, als die Frau in schwarzer Hose und passender Weste den entscheidenden Stoß ihres Frames – wenn nicht gar des gesamten Halbfinal-Matches – anpeilte, war der Saal halbleer.
Nach einigen Sekunden erstarb das Geschnatter der Zuschauer und ging in respektvolles Schweigen über. Gespannt hielten alle im Saal die Luft an und fragten sich, ob Martine Yin es wohl schaffen würde.
Sie führte den Stoß mit entspannter Coolness aus, nicht zögerlich, sondern mit der festen Entschlossenheit einer Spielerin, die genau weiß, dass es für den zweiten Platz keine Lorbeeren gibt. Als die rote Kugel in der rechten Ecktasche landete und die weiße Kugel langsam ausrollte und dreißig Zentimeter vor der linken Bande liegen blieb, brach die kleine Gruppe dankbarer Aficionados, die gekommen war, um sich das Spiel und Martine anzusehen, in anfeuernden Beifall aus. Auch Alex applaudierte begeistert, obwohl er zugeben musste, dass er zu jenen Zuschauern zählte, die sich mehr für Martine als für Billard interessierten.
Mit Unterbrechungen führten sie nun schon seit über einem Jahr eine Beziehung – wenn man es überhaupt so nennen konnte. Alles hatte damit angefangen, dass Martine Alex nach dem Clayton-Burrow-Fall mehrere Monate lang verfolgt hatte, um ihn zu einem Interview zu bewegen. Sie war Fernsehreporterin und hatte über den Fall berichtet, der zu Alex’ berühmtestem geworden war. Zusammen mit anderen Reportern hatte sie sich im Beobachtungsraum neben der Todeskammer befunden, als der schicksalhafte Anruf und mit ihm der Befehl zum Abbruch der Hinrichtung eingegangen war.
Und sie hatte, wenn auch nur aus der Ferne, Alex’ eindringliches Gespräch mit seinem Rechtsreferendar miterlebt, in dessen Folge dieser verhaftet worden war. Die ganze surreale Episode hatte ihren Höhepunkt in einer nächtlichen Verfolgungsjagd mit dem Auto und einem verhängnisvollen Unfall gefunden, der den Kameras der Nachrichtenhelikopter bedauerlicherweise entgangen war.
Nach Abschluss des Falls hatte sich Alex standhaft geweigert, auf Martines Interviewanfrage einzugehen, und als sie dann doch endlich Gelegenheit bekommen hatte, mit ihm zu sprechen, hatte sie den Eindruck gehabt, dass er ihr nicht die ganze Wahrheit sagte. Zunächst war sie fest entschlossen gewesen, seinen Panzer zu knacken, aber irgendwann hatte sie gespürt, dass Alex’ Zurückhaltung mehr mit seinen persönlichen Gefühlen zu tun hatte als mit irgendwelchen harten Fakten, die den Fall selbst betrafen. Schnell war ihr klar geworden, dass Alex ungeachtet des Raubtierimages seiner Profession auch nur ein Mensch war, was sie ihrerseits, wie ihr ebenso schnell klar geworden war, daran hinderte, bei der Ausübung ihres Berufs mit der üblichen raubtierhaften Rücksichtslosigkeit vorzugehen.
Erst durch diese Erkenntnis und die damit einhergehende Abmilderung in Martines Verhalten hatte sich allmählich eine Beziehung zwischen ihnen entwickelt, wenn auch eine Fernbeziehung, was ihr Wachstum immer wieder hemmte. Sie lebte und arbeitete in Los Angeles, er in San Francisco.
»In dein Loch würde ich auch mal gerne was versenken, Baby«, grölte der Prolet laut und schwankte zur Bar, um sich sein nächstes Bier zu holen.
»Warum hältst du nicht einfach die Schnauze?«, fragte Alex und drehte sich zu ihm um.
»Warum kommst du nicht einfach mit raus und regelst die Sache wie ein Mann?«, forderte ihn der Unruhestifter heraus.
»Warum haltet ihr nicht beide die Schnauze?«, blaffte Martine. »Ich versuche mich zu konzentrieren.«
Inzwischen hatte der Schiedsrichter die Hoffnung aufgegeben, dass sich die Situation ohne sein Eingreifen lösen würde. Er rief ein paar Rausschmeißer zu Hilfe, die den Proleten unsanft nach draußen beförderten.
Martine wandte sich wieder dem Billardtisch zu, holte tief Luft, um sich zu sammeln, und lochte erst die schwarze und dann eine weitere rote Kugel ein. Nach einem spannenden Abtausch von Safety Shots war sie mit vier Punkten und acht Frames an den Tisch gekommen, während ihre Gegnerin einundsechzig Punkte und acht Frames auf der Tafel stehen hatte. Ihre Gegenspielerin, eine zierliche Blondine, hatte gerade bei einem verzwickten Snooker einen finalen Stoß über zwei Banden verschossen, was Martine noch einmal die Chance gab, das Match in diesem letzten Frame für sich zu entscheiden.
Aber nur, wenn jeder einzelne Stoß sein Ziel traf.
Sie blieb cool und versenkte noch eine schwarze und eine rote Kugel. Aber dieses Mal rollte die weiße Kugel in Richtung Baulk, so dass sie sich als Nächstes mit einer rosafarbenen statt einer schwarzen Kugel zufriedengeben musste. Sie wusste, dass sie sich jetzt keine Fehler mehr erlauben durfte. Nach der rosa Kugel musste sie die letzte rote einlochen und dann die schwarze angehen. Sie versenkte die rosa Kugel und hatte danach zu viel Abstand zur letzten roten. Die rote Kugel hätte sie dennoch problemlos einlochen können, aber wenn sie sie einfach in die Tasche rollen ließ, würde die weiße Kugel auf der falschen Seite der schwarzen zu liegen kommen. Sie musste die rote Kugel also mit viel Schwung über drei Banden spielen, um hinterher zurück zur schwarzen Kugel am unteren Ende des Tisches zu kommen. Und Schwung bedeutete, dass sie den Stoß mit tödlicher Präzision ausführen musste.
Sie schoss mit Schwung … viel Schwung.
Alex hielt die Luft an und betete.
Unter den Jubelrufen des Publikums landete die Kugel in der Tasche. Und als Krönung blieb die weiße Kugel auch noch auf der perfekten Ausgangsposition liegen, um die schwarze Kugel ein letztes Mal einzulochen. Jetzt räumte Martine ab: gelb, grün, braun, blau, rosa und schwarz. Als der Frame endete, gab es donnernden Applaus. Sie hatte einen Anstoß von achtundfünfzig und gewann den Frame mit zweiundsechzig Punkten.
Dem Publikum gefiel es, wenn ein Match bis zum Schluss spannend blieb, wie nervenaufreibend dies auch für die Spielerinnen sein mochte. Martine musste viele Autogramme geben, bevor sie endlich Gelegenheit hatte, mit Alex zu reden.
»Du warst toll«, sagte er.
»Tu mir einen Gefallen«, erwiderte sie. »Mach das nie wieder.«
»Was habe ich denn …?«
»Du weißt genau, was ich meine. Ich kann es wirklich nicht gebrauchen, dass du dich für mich prügelst. Du musst mir nichts beweisen.«
»Aber er hat …«
Sie brachte ihn mit erhobener Hand zum Schweigen. »Lass uns einen Happen essen gehen«, schlug sie vor und griff nach seiner Hand.
Freitag, 5. Juni 2009 – 15.15 Uhr
»Das Drogenproblem haben wir doch nur, weil der weiße Mann die Ghettos mit billigem Kokain überschwemmt hat!«, brüllte der militante Schwarze ins Mikrofon. »Und die Dinge haben sich immer noch nicht geändert, Bruder Elias, weil wir nach wie vor Onkel Toms wie Sie in unseren Reihen haben, die ihren Brüdern die Schuld an dem Leid geben, das uns der weiße Mann gebracht hat!«
Das Publikum brach in lauten, spontanen Applaus aus, besonders die große Gruppe von Unterstützern, die der militante Schwarze mitgebracht hatte. Sein Gegenpart, ein weißer Rechtsradikaler, hatte Schwierigkeiten, sich vom anderen Ende des Studios über das zustimmende Gebrüll hinweg verständlich zu machen.
Elias Claymore amüsierte sich großartig. Es waren leidenschaftliche Gäste wie diese, die für gute Einschaltquoten sorgten. Die Militanten brüllten sich ihre Wut von der Seele, aber es war Claymore, der dank des neuen Vertrags mehr Geld verdiente.
Claymore war genauso schwarz wie sein militanter Gast. Er war Ende fünfzig, groß und breitschultrig und hatte in seinem bewegten Leben sämtliche Stationen durchlaufen: vom Linksradikalen über den islamistischen Fundamentalisten zum neokonservativen wiedergeborenen Christen.
Die heutige Sendung war als Dreierdebatte zwischen säkularen militanten Schwarzen, Black Muslims und dem Ku-Klux-Klan gedacht gewesen. Aber der militante Schwarze hatte das Streitgespräch an sich gerissen, um gegen schwarze Konservative wie Claymore zu wettern, und die weißen Rechtsradikalen im Studio – die das Thema Drogen überhaupt erst auf den Tisch gebracht hatten – zu Nebenfiguren degradiert.
»Was die unsangetan haben, ist keine Entschuldigung für das, was wir uns selbst antun, Brüder!«, entgegnete Claymore. »Wir müssen aufhören, anderen die Schuld zu geben. Früher waren wir Sklaven des weißen Mannes, jetzt sind wir Sklaven des weißen Pulvers. Ich finde, dass es an der Zeit ist, dass wir die Ketten sprengen und uns ein für alle Mal von diesem Joch befreien!«
Wieder reagierte das Publikum mit donnerndem Applaus, bis auf den kleinen militanten Kader. Claymore sah sich um und las Zustimmung auf den Gesichtern der meisten Zuschauer, ob schwarz oder weiß. Der militante Schwarze hätte sie beinahe für sich gewonnen, aber Claymore hatte sie mit ein paar gut gewählten Worten zurück auf seine Seite gezogen.
Dann ergriff ein Mann im Anzug das Wort, auf dessen Fliege eine Mondsichel abgebildet war: »Wenn Sie glauben, dass die Lösung darin besteht, sich dem weißen Establishment anzuschließen, sind Sie genauso ein Dummkopf wie er.«
»Wovon sprechen Sie?«, fragte Claymore.
»Davon, dass Sie vom Regen in die Traufe gekommen sind und Ihr Volk schon zum zweiten Mal verraten haben.«
Der Mann im Anzug war eine große, schlanke, elegante Erscheinung. Er war ein führendes Mitglied der Religionsgemeinschaft Nation of Islam und galt als Claymores Erzfeind. Auch Claymore hatte früher der Nation of Islam angehört, bis er sich enttäuscht abgewandt hatte.
»Könnten Sie das vielleicht näher ausführen?«
»Ich spreche vom Islam, der Religion des schwarzen Mannes, der Religion, der Sie den Rücken gekehrt haben, als Sie zum Abtrünnigen wurden.«
»Zum Abtrünnigen des Islam oder zum Abtrünnigen der Nation of Islam? Das ist nämlich nicht dasselbe. Malcolm X hat die Nation of Islam verlassen, aber er hat dem Islam nie den Rücken gekehrt. Das hat ihn jedoch nicht davor bewahrt, ermordet zu werden.«
Mit diesem Argument forderte er seine ehemaligen Glaubensbrüder besonders gern heraus. Malcolm X hatte die Nation of Islam verlassen, weil er sowohl von ihrer separatistischen Politik als auch vom Verhalten ihrer Anführer enttäuscht gewesen war.
Aber der gut gekleidete Herr aus dem Publikum würde sich nicht in eine Diskussion darüber verwickeln lassen, wer Malcolm X ermordet hatte. Die Nation of Islam hatte ihren früheren Feind posthum wieder in Gnaden aufgenommen und versuchte, sich vom Attentat auf ihn zu distanzieren.
»Sie sind aber nicht wie Bruder Malcolm, Claymore, und Sie werden auch nie so sein! Bruder Malcolm hat nie getan, was Sie getan haben.«
Mit dieser Anspielung erntete er heftigen Applaus. Jeder wusste, dass Elias Claymore nicht immer so ehrbar gewesen war, wie er sich heute gab. Aber darauf war Claymore vorbereitet.
»Und genau wegen meiner eigenen Schuld muss ich meine Stimme erheben«, sagte er und warf einen professionellen Blick auf die Studiouhr. »Als Sünder habe ich die Pflicht, nichtstumm zu bleiben. Und in der Zwischenzeit lasst uns alle dankbar dafür sein, dass wir in einem Land leben, in dem niemand mehr Sklave sein muss, es sei denn, er will es so. Ich danke Ihnen allen und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Gott segne Amerika!«
Donnernder Applaus erklang. Die Talkshow war vorbei.
Nachdem eine der Kameras nach hinten gefahren worden war, um ihn vorbeizulassen, eilte Claymore aus dem Studio, allerdings nicht ohne vorher mit mehreren begierigen Zuschauern zu sprechen und einigen von ihnen die Hände zu schütteln.
Hinter den Kulissen stand er plötzlich zwei uniformierten Polizisten und einer Kriminalbeamtin gegenüber, die alle nicht älter als dreißig sein konnten, wenn überhaupt. Was ihm am meisten Angst machte, war der unerbittliche Ausdruck auf ihren Gesichtern. Er hatte keine Ahnung, um was es ging, aber er spürte, dass es etwas Ernstes war. Die Mienen der umherschleichenden Fernsehleute wirkten angespannt. Die Kriminalbeamtin machte einen Schritt auf ihn zu und hielt ihm ihre Marke hin.
»Elias Claymore?«
»Ja?«, antwortete Claymore leicht nervös.
»Detective Riley. Ich habe hier einen Haftbefehl auf Ihren Namen.«
»Was wird mir vorgeworfen?«
»Vergewaltigung.«
Claymore warf dem Produzenten einen panischen Blick zu und schluckte. »Ruf bitte Alex Sedaka an. Sofort!«
Freitag, 5. Juni 2009 – 15.30 Uhr
»Das ist das beste chinesische Essen, das ich je gegessen habe«, lobte Alex und führte mit seinen hölzernen Essstäbchen gekonnt einen Bissen Hühnchen Chow Mein zum Mund.
»Das beste zu diesem Preis«, korrigierte ihn Martine, die wegen des Vorfalls beim Snooker-Turnier immer noch angespannt klang. »Wir wollen nicht übertreiben.«
Sie aßen im Embassy Kitchen gegenüber dem Billardclub, auf der anderen Seite des Parkplatzes. Die Gegend sah ein bisschen heruntergekommen aus, aber Alex war durch seine Arbeit an primitive Verhältnisse gewöhnt. Und für Martine galt vermutlich dasselbe.
»Hör mal. Was vorhin passiert ist …« Er war nervös, weil er genau spürte, dass Martine immer noch sauer war.
»Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Lass es einfach in Zukunft.«
Alex war verunsichert. Er hatte gar nicht vorgehabt, sich zu entschuldigen, aber er wollte die schlechte Stimmung aus der Welt schaffen. »Du solltest dir nicht so einen obszönen Mist anhören müssen.«
»Und du solltest dich nicht prügeln müssen, um deine Männlichkeit zu beweisen. Du hast zwei Kinder gezeugt, du hast deine Schuldigkeit getan. Du gewinnst Schlachten vor Gericht – was übrigens das Schlachtfeld ist, auf dem intelligente Männerihre Kämpfe austragen. Für mich brauchst du wirklich keinen dahergelaufenen Proleten zu verprügeln.«
Er fühlte sich geschmeichelt, weil sie »verprügeln« gesagt hatte und nicht »verprügelt werden«.
»Ich habe nicht versucht, irgendetwas zu beweisen. Aber ich dachte, so wie der sich aufführt, kannst du dich vielleicht gar nicht mehr konzentrieren …«
»Verschon mich bitte mit der Nummer! Glaubst du, ich kann mich besser konzentrieren, wenn du dich mit ihm streitest? Jetzt versuch dich nicht rauszureden, Alex: Du wolltest den Helden spielen und mir zeigen, dass du kein verweichlichter Anwalt im Anzug bist, sondern ein ganzer Kerl, der für seine Lady sorgen kann – als ob ich die Sorte Frau wäre, die sich von diesem Macho-Blödsinn beeindrucken lässt! Als ob mir dieses Gehabe nicht längst zum Hals raushängen würde!«
»Na gut, vielleicht habe ich ja überreagiert. Und vielleicht bin ich ein bisschen altmodisch.« Er beugte sich nah an sie heran. »Andererseits glaube ich wirklich, dass es die Pflicht eines Mannes ist, seine Lady zu beschützen.«
»Vielleicht hast du aber auch nur ein paar unaufgearbeitete Probleme.«
»Was soll denn das heißen?«
»Das soll heißen, dass du immer noch an eine andere Lady denkst, von der du glaubst, du hättest sie beschützen müssen.«
An seinem Blick erkannte sie, wie verletzt er war.
»Tut mir leid«, sagte sie leise. »Das hätte ich nicht sagen dürfen.«
»Nein, es stimmt ja. Du hast recht. Ich war nicht da, als Melody mich brauchte.«
»Du hättest gar nicht da sein können. Woher hättest du denn wissen sollen, dass ihr auf dem Nachhauseweg so ein Durchgeknallter mit einer Knarre auflauert? Mach dich deswegen nicht fertig.«
Alex’ Frau Melody war von einem Gangmitglied im Parkhaus der Klinik erschossen worden, in der sie gearbeitet hatte. Melody war Ärztin und hatte Dienst in der Notaufnahme, als in ein und derselben Nacht zwei Bandenmitglieder von entgegengesetzten Enden der Stadt eingeliefert wurden. Sie hatte keine Ahnung, dass der Gangster, den sie behandelte, den anderen Gangster erschossen hatte. Während es ihr gelungen war, den Mann auf ihrem OP-Tisch zu retten, hatte der andere Arzt seinen Patienten verloren. Und die Kumpel des Toten kamen nicht an den Typen heran, der ihren Bruder umgebracht hatte, weil er im Gefängnis saß – in Einzelhaft. Also hielten sie Kriegsrat und beschlossen, dass Melody dafür bezahlen musste.
Inzwischen wusste sie, dass sie in Gefahr schwebte, aber sie weigerte sich standhaft, die Gefahr ernst zu nehmen. Sie lehnte es sogar ab, sich vom Sicherheitsdienst zum Auto begleiten zu lassen, mit den Worten, in ihrem Alter bräuchte sie nun wirklich kein Kindermädchen mehr.
Man konnte es Arroganz nennen oder übertriebenes Selbstvertrauen – jedenfalls hatte sie mit dem Leben dafür bezahlt.
Und in gewisser Weise machte sich Alex bis heute Vorwürfe.
»Ich wünschte nur, ich könnte …« Er brach ab. Martine wusste auch so, was er meinte. Er wünschte sich, die Zeit zurückdrehen zu können. So wie jeder andere auch. Aber wie hatte sein Sohn David, der Physiker war, einmal zu ihm gesagt: Die Zeit läuft nun mal nicht rückwärts.
Er versuchte, an etwas anderes zu denken. »Erklärst du mir, wie du diesen Wahnsinnsschuss hingekriegt hast?«
»Vielleicht solltest du dir das besser von David erklären lassen. Es hat nämlich mit den Newtonschen Gesetzen zu tun. Wenn du den Objektball sehr schnell anspielst und ihn scharf anschneidest, prallt der Spielball in einem schrägen Winkel ab, wohingegen …« Martines Handy klingelte. Sie zog es aus der Tasche und meldete sich mit routinierter, professioneller Eile. »Martine Yin.« Die nächste halbe Minute schien sie aufmerksam zu lauschen. »Okay, ich bin in zehn Minuten da.« Verlegen wandte sie sich an Alex.
»Ich weiß«, kam er ihr zuvor. »Die Pflicht ruft.«
Sie bedankte sich für sein Verständnis und machte sich eilig aus dem Staub. Er zog eine gequälte Grimasse, als Sekunden später ein Automotor aufheulte und ihm klarmachte, dass das Raubtier in ihr zwar schlafen mochte, aber noch lange nicht tot war. Sie war immer noch Journalistin und allzeit bereit, einer guten Story nachzujagen, so wie er rund um die Uhr Anwalt war. Auch wenn er in seinem Beruf zum Glück keine Krankenwagen verfolgen musste.
Er brachte noch genau einen Happen zum Mund, bevor sein eigenes Handy das vertraute Allegro aus Dvoraks Symphonie Aus der Neuen Welt schmetterte.
»Mr Sedaka?«, fragte eine fast schon verzweifelt klingende männliche Stimme am anderen Ende der Leitung.
»Ja.«
»Ich bin der Produzent der Elias-Claymore-Show, und wir haben hier eine etwas unangenehme Situation. Gäbe es vielleicht die Möglichkeit, dass Sie nach L.A. kommen?«
»Ich bin in San Gabriel.«
»Oh, Gott sei Dank! Mr Claymore hat mich gebeten, Sie anzurufen. Er wurde verhaftet.«
»Verhaftet? Weswegen?«
»Irgendein falscher Vergewaltigungsvorwurf.«
Jetzt wusste Alex, warum Martine so übereilt aufgebrochen war.
Freitag, 5. Juni 2009 – 16.50 Uhr
»Gut, das hätten wir«, sagte die Kriminaltechnikerin und nahm den dritten Mundabstrich.
Wie Bethel einige Stunden zuvor gab auch Claymore nun eine DNA-Probe von seiner Mundschleimhaut ab. Man hatte ihm nicht erzählt, dass der Vergewaltiger ein Kondom benutzt oder das Opfer den Vergewaltiger am Arm gekratzt hatte. Je weniger er wusste, desto größer die Chance, dass er sich selbst belastete, indem er Wissen aus erster Hand über das Verbrechen preisgab. Aber er wurde gründlich auf Kratzspuren untersucht, von denen gleich mehrere gefunden wurden.
Das allein war jedoch alles andere als beweiskräftig. Entscheidendes Kriterium war die DNA. Es lagen mehrere gute Proben von Bethel vor. Jetzt brauchten sie nur noch eine eindeutige Übereinstimmung.
Nachdem die Referenzprobe genommen worden war, setzte sich Alex zwanzig Minuten mit Claymore zusammen und besprach mit ihm, wo er sich zum Zeitpunkt der angeblichen Vergewaltigung aufgehalten hatte. Claymore war sich ganz sicher, dass er nichts zu verbergen hatte und die Fragen der Polizei beantworten wollte. Aber Alex blieb misstrauisch; er wusste, dass sogar Schuldige manchmal dachten, sie könnten sich bei der Polizei herausreden. Noch vertrauter war ihm allerdings die Naivität der Unschuldigen, die glaubten, sie hätten nichts zu verbergen. Alex kannte Elias seit vielen Jahren – seit er vor Gericht das Strafmaß wegen Justizflucht für ihn ausgehandelt hatte, nachdem Elias in die Staaten zurückgekehrt war, um für seine Taten gerade-zustehen. Damals hatte ihn Claymores Aufrichtigkeit beeindruckt, seine tiefe Scham über die eigene Vergangenheit. Aber das hatte zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr viel zu sagen. Ein Mensch, der sich einmal ändern konnte, konnte sich auch ein zweites Mal ändern. Tatsächlich bedeutete es nur, dass Alex einen gewissen Einfluss auf Claymore hatte.
Aber Anwälte empfangen Anweisungen von ihren Mandanten, nicht umgekehrt. Nachdem Claymore darauf bestand, mit der Polizei zu sprechen, blieb Alex daher nichts anderes übrig, als seinen Text aufzusagen und dann beiseitezutreten, während die Befragung stattfand. Er wohnte ihr jedoch bei, um sich bei Bedarf einschalten zu können.
Schweigend saß Alex da, während Lieutenant Kropf, ein großer, dünner Mann, der die Ermittlungen leitete, Claymore mit seiner aggressiven, schnellfeuerartigen Befragungsmethode aus dem Konzept zu bringen versuchte.
»Sie geben also zu, dass Sie niemand zum fraglichen Zeitpunkt zu Hause gesehen hat?«, bellte Kropf.
Alex hätte dem Lieutenant gern gesagt, dass er seine Zeit vergeudete; er hatte seine Antwort bereits erhalten und wiederholte die Frage dennoch bis zum Erbrechen. Aber Claymore streckte die Hand aus und hielt ihn zurück.
»Mit zugeben hat das nichts zu tun«, antwortete er in bemüht ruhigem Tonfall. »Ich war allein. Das ist eine Tatsache. Es ist kein Verbrechen, allein zu sein.«
»Nein, aber es hilft, wenn man ein Alibi hat.«
»Glauben Sie, das wüsste ich nicht?«, fragte Claymore ironisch.
In der angespannten Stille, die nun folgte, sah sich Claymore im kahlen Befragungsraum um. Die Einrichtung beschränkte sich auf einen Tisch und drei Stühle, einen für den Lieutenant und je einen für Claymore und Alex. Licht drang nur durch ein hohes, nah an der Zimmerdecke liegendes Fenster herein.
Ein weiterer Polizist stand neben der Tür, beteiligte sich jedoch nicht am Verhör. Er war anwesend, falls der Verdächtige beschloss, »körperlich« zu werden. Außerdem diente er als Zeuge, um den Lieutenant vor falschen Anschuldigungen zu schützen. Obwohl die Befragung mit Claymores Einwilligung gefilmt wurde und auf der anderen Seite der Spiegelglasscheibe ein Techniker saß, gab es Momente – beim Betreten und Verlassen des Raums –, in denen sich der Verdächtige außerhalb des aufmerksamen Kameraauges befand.
»Fällt Ihnen irgendetwas anderes ein, womit Sie beweisen könnten, dass Sie zu Hause waren?«
»Was zum Beispiel?«
»Zum Beispiel ein Telefongespräch? Hat Sie jemand angerufen? Haben Sie jemanden angerufen?«
Claymore schüttelte den Kopf. Das monotone Brummen der Klimaanlage forderte allmählich seinen Tribut. Es nervte noch mehr als das monotone Brummen von Lieutenant Kropfs Stimme während des gleichmäßigen Dahinplätscherns seiner Fragen, in denen mehr als nur die Andeutung einer Drohung lag.
»Das weiß ich nicht mehr.«
»Wenn Sie von Ihrem Apparat aus angerufen haben, taucht der Anruf auf Ihrer Telefonrechnung auf. Heutzutage ist das alles digitalisiert, Sie sollten also einen Einzelverbindungsnachweis anfordern.«
Alex spürte, dass der Lieutenant ihnen tatsächlich helfen wollte, ganz so, als glaubte er selbst nicht, dass Claymore schuldig war.
»Okay«, fuhr Kropf fort. »Wenn Sie sich Ihrer Sache ganz sicher sind, können wir den Einzelnachweis jetzt gleich anfordern.«
Der Lieutenant blickte Alex an, während er das sagte.
»Um diese Zeit?«, fragte Alex skeptisch und sah auf die Uhr.
»Ich kenne einen netten Richter, den wir fragen könnten.«
»Und Sie glauben, die Telefongesellschaft setzt heute Nacht noch alle Hebel in Bewegung, nur weil wir mit einer richterlichen Anordnung winken? Jetzt bleiben Sie mal realistisch!«
Alex wusste genau, was der Lieutenant mit der Aktion bezweckte. Es war zwar keine rechtsverbindliche Unschuldsprobe, aber eine gute Möglichkeit herauszufinden, ob er seine Zeit mit einem todsicheren Verlierer vergeudete oder nicht.
»Okay«, sagte Kropf schließlich. »Wir werden keine Anklage gegen Ihren Mandanten erheben.«
Claymore stieß einen Seufzer der Erleichterung aus.
»Zumindest nicht sofort. Wir warten, bis die DNA-Ergebnisse da sind, und sehen dann weiter.«
Alex lächelte. Es sah aus, als wäre der Sturm wieder abgeebbt, noch bevor er aufs Festland traf. Aber ihm war Kropfs selbstgefälliger Gesichtsausdruck nicht entgangen. Der Lieutenant wirkte ganz so, als hätte er noch ein Ass im Ärmel.
»Nur noch eine Frage, Mr Claymore: Was für ein Auto fahren Sie?«
»Die letzten Tage bin ich nur Taxi gefahren.«
»Aus einem bestimmten Grund?«
»Mein Auto wurde gestohlen.«
»Haben Sie den Diebstahl gemeldet?«
»Noch nicht. Ich hatte keine Zeit.«
»Welche Marke hat Ihr Auto?«
»Es ist ein Mercedes.«
»Welche Farbe?«
»Blau.«
»Ein blauer Mercedes?«
»Aquamarin, wenn Sie es genau wissen wollen.«
Freitag, 5. Juni 2009 – 19.30 Uhr
»So langsam glaube ich, dass sich gar nichts geändert hat«, stieß Andi erbittert hervor.
Sie saßen auf der Veranda ihres Hauses und aßen unter freiem Himmel in der kalifornischen Abendsonne.
»Wie meinst du das?«, fragte Gene mit gezügelter Anteilnahme. Sie unterstützte Selbstmitleid grundsätzlich nicht, erlebte sie doch bei ihrer Arbeit oft genug, was für eine selbstzerstörerische Kraft dadurch freigesetzt werden konnte. Selbstzerstörerisch und durch und durch verführerisch.
Andi attackierte ihr Essen mit einer derartigen Wut, dass Gene lächeln musste. Andi war also nicht dem Fluch der Kapitulation erlegen, sondern bewies Kampfgeist, und das war ein gutes Zeichen. Sie kriegte sich bestimmt im Handumdrehen wieder ein.
»Für was bitte haben wir in New York alles hinter uns gelassen und sind hierhergezogen? Und so was nennen die Abteilung! Nichts als ein bedeutungsloser Titel.«
»Gib ihnen eine Chance, Süße. Das war schließlich dein erster Arbeitstag. Warten wir ab, welche Aufgaben sie dir anvertrauen.«
Gene versuchte, beruhigend und bestärkend auf Andi einzuwirken, weil sie wusste, dass sie genau das von ihr erwartete. Dieses Spiel spielten sie häufiger: Andi zickte herum und beschwerte sich über das Leben, und Gene holte sie auf den Boden der Tatsachen zurück.
»Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl bei der Sache«, fuhr Andi fort. »Eigentlich bin ich hergekommen, um möglichst schnell Partnerin zu werden, und jetzt habe ich noch nicht mal mein eigenes Büro. Die haben mich in eine bessere Besenkammer gesteckt!«
Gene berührte sanft Andis Unterarm. »Das ist sicher nur vorübergehend.«
Ein paar Sekunden lang aßen sie schweigend weiter. Andi war nach wie vor eingeschnappt, und Gene ließ sie in Ruhe. Wenn sie es vorzog, noch ein Weilchen zu schmollen, dann war das ihre Sache. Ich kann nicht ständig ihre Mutter spielen.
Schließlich war es Andi, die das Schweigen brach und das Thema wechselte: »Wie war eigentlich dein erster Tag?«
Gene machte plötzlich einen aufgebrachten Eindruck. »Mein erster Tag? Was? Im Krisenzentrum? Ziemlich hektisch. Aber das bin ich ja eigentlich gewohnt.«
»Habt ihr zu wenig Leute?«





























