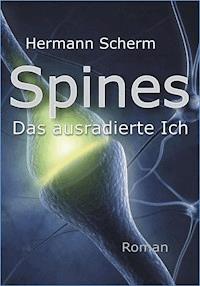
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Von August 1951 bis April 1953 führte die Central Intelligence Agency unter dem Decknamen Operation Artischocke ein geheimes Forschungsprogramm durch. Ziel des Programms war die Erforschung von Möglichkeiten der Bewusstseinskontrolle. Das Programm war nicht das Erste seiner Art – und auch nicht das Letzte. Von 1953 bis in die 1970er Jahre verfolgte die Central Intelligence Agency im Rahmen des Programms Mkultra dieses Ziel weiter. Welche Erfolge dabei erzielt wurden, wissen wir nicht. Und heute? Im 21. Jahrhundert sind die wissenschaftlichen und technischen Möglichkeiten beträchtlich gewachsen. Die Erfolgsaussichten für Experimente auf dem Gebiet der Bewusstseinskontrolle sind so gut wie nie zuvor. Ist unser Ich noch gefeit vor dem Zugriff fremder Mächte? Können wir noch sicher sein, dass wir uns die richtige Antwort geben, wenn wir uns fragen: "Wer bin ich?" Oder könnte es sein, dass das, was wir als unser Selbst wahrnehmen, nicht mehr wirklich und uneingeschränkt unser eigenes Selbst ist? Dass unsere Erinnerungen und Erfahrungen von anderen gesteuert werden? Spines entführt den Leser in ein Horrorszenario, in dem Forschung, Politik und der militärisch-wirtschaftliche Komplex eine unheilvolle Symbiose eingegangen sind, in eine Welt, in der das Ich beliebig manipuliert werden kann. Die Story: Der Berliner Biotech-Firma Gene Design Technologies ist es gelungen, den Code des Bewusstseins zu entschlüsseln. In Experimenten mit freiwilligen Probanden arbeiten die Neurophysiologen der Firma an der Entwicklung von Techniken zur gezielten Beeinflussung von Bewusstseinsinhalten. Als eine der Versuchspersonen in eine Psychose abgleitet und zum Mörder wird und kurz darauf Dr. Langer, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter von Gene Design Technologies, unter mysteriösen Umständen zu Tode kommt, wird deutlich, dass es nicht nur wirtschaftliche Interessen sein können, die Gene Design Technologies antreiben. Dr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hermann Scherm
Spines
Das ausradierte Ich
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Impressum neobooks
1
»Jeder wach verbrachte Tag ist eine Bühne, die, zum Guten oder Bösen, in Komödie, Farce oder Tragödie, von einem einzigen Hauptdarsteller, dem Selbst, beherrscht wird. Und so wird es sein, bis der Vorhang fällt … Auch wenn [das bewusste Selbst] durch viele Aspekte charakterisiert wird, dieses Selbst ist eine Einheit.«
Charles Sherrington, The Integrative Action of the Nervous System, New Haven, 1947
Montag, 8 Dezember 1980. Vier Schüsse peitschen in schneller Folge durch die Lobby des Appartementblocks am Rand des Central Parks. Die Kugeln schlagen zielsicher in den Rücken eines dunkelhaarigen Mannes in Blue Jeans und Lederjacke. Keine gewöhnlichen Kugeln, die sich einfach ihren Weg durch Fleisch und Knochen bahnen, sondern Hohlmantelgeschosse, die beim Einschlag zersplittern und große Zerstörungen anrichten. »That’s a good shot group!«, bemerkt einer der Ermittler vom NYPD anerkennend, »Eine sehr gute Treffergruppe!« Und auch die Waffe, die der Schütze benutzt hat, ist etwas Besonderes. Eine Undercover .38 Special, mit ihrem schlanken, kurzen Lauf eine ideale Waffe für Undercover Detektive und für Leute, die sicher gehen wollen. Die Waffe ist dafür bekannt, dass es keine Versager gibt, keine Fehlschüsse.
Der Schütze, Mark David Chapman, macht keine Anstalten zu fliehen. Der hilflos wirkende junge Mann lässt sich widerstandslos festnehmen. Er bittet die Polizisten, ein kleines rotes Buch mitzunehmen, das neben ihm auf dem Boden liegt. Es trägt den Titel »Der Fänger im Roggen«, von J. D. Sallinger.
»Eine Stimme in meinem Kopf hat immer wieder gesagt, tu es, tu es!«, wird Chapman bei den folgenden Vernehmungen zu Protokoll geben.
Am nächsten Morgen bestimmt eine Meldung die Nachrichten der Welt: »John Lennon ist tot.«
Company: Gene Design Technologies, San Diego
Sector: Biotechnology
Symbol: GDTN
IPO: $ 18.50
Recommendation: Strong buy
This is one of the hottest IPO’s at NASDAQ this year. Don’t miss. Soon there will be news releases that will push the stock over 400 – 500 %.
Gene Design Technologies owns or has exclusive license rights to sublicense an intellectual property portfolio that contains more than 500 issued and pending biotechnology patents worldwide.
The company has researched the genetic background of Alzheimer’s disease since 1998. In a phase II study designed to evaluate the efficacy and safety of AD-11, an Alzheimer’s disease therapy, patients receiving AD-11 displayed clinically and statistically significant improvements in symptoms.
Alzheimer’s disease is a progressive, irreversible brain disorder. Till now there is no known cause or cure. More than 18 million people worldwide are estimated to have Alzheimer’s disease. By 2025, this figure is projected to increase to 34 million people.
An incredible market for GDT!
Don’t miss this great opportunity. Good Trading To You All.
Er las den Text noch ein paar Mal durch, fügte noch ein, dass die Firma so genannte »Booster« in der Pipeline hat, Medikamente zur Verbesserung der Gedächtnisleistung, die das Zeug zum Blockbuster haben, und dann schickte er die E-Mail mit einem Klick an 10.000.000 Adressen weltweit und ging in die Bar, um sich eine Cola Light aus dem Eisschrank zu holen. Es war bereits 2 Uhr morgens, aber er wollte unbedingt noch die Texte für die zahllosen Aktienforen fertig machen, die er in den nächsten Tagen unter einer Reihe von Pseudonymen mit Informationen zu Gene Design Technologies füttern würde.
Er war sich sicher, dass seine Aktionen einige Millionen Dollar in die Kassen von GDT spülen würden. Es war natürlich nicht genau zu beziffern, welchen Effekt er erzielen würde, das hing auch sehr von seinem Geschick ab, überzeugend zu wirken, seinen Auftraggebern waren seine Dienste trotzdem ein fürstliches Honorar wert. Einen Teil davon bekam er für seine hervorragenden Kenntnisse über das World Wide Web und die Möglichkeiten, Trends zu pushen und Informationen zu streuen. Den größten Teil davon bekam er jedoch für seine absolute Verschwiegenheit.
2
Jochen war wie gerädert. Es war erst 19 Uhr, aber er fühlte sich unheimlich müde und erschöpft. Er konnte sich nicht erinnern, dass er schon jemals in seinem Leben so müde gewesen war. Was war bloß los mit ihm? Er hatte doch den ganzen Tag über nichts Besonderes gemacht, jedenfalls nichts, an das er sich erinnern konnte. Es gab absolut keinen Grund für diese Müdigkeit. Er musste sich auf die Couch legen, weil er sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte und schlief sofort ein.
Als er wieder aufwachte, war er schweißgebadet. Sein T-Shirt klebte nass auf seinem Rücken. Er sah auf die Uhr. Es war kurz vor 23 Uhr. Er hatte geschlafen wie ein Stein, und es fiel ihm schwer, sich zu orientieren. Nur mit seiner ganzen Kraft schaffte er es, sich aufzurichten und ins Bad zu gehen.
Fast vier Stunden, er musste verdammt tief geschlafen haben. Durch sein Gesicht zogen sich rote Striemen, die das harte Sofakissen dort hinterlassen hatte. Nach ein paar Händen voll kaltem Wasser kam langsam die Orientierung zurück. Stück für Stück erinnerte er sich wieder. Er war seit dem Morgengrauen den ganzen Tag über wie ein Irrer durch die Stadt gerannt und hatte versucht, sich zu beruhigen. Aber auch jetzt fühlte er sich noch immer gedemütigt und verletzt.
Sie hatten sich geschworen, immer ehrlich zueinander zu sein und alles offen auszusprechen. Ihnen war beiden klar, dass eine Liebe zu Ende gehen konnte, aber sie hatten sich versprochen, dann die Wahrheit zu sagen und keine Geheimnisse voreinander zu haben. Und nun war genau das Gegenteil geschehen. Laura hatte ihn auf widerliche Art und Weise betrogen und gedemütigt, auf für ihn geradezu unfassbare Weise. Auch jetzt konnte er es noch nicht fassen und fühlte einen ungeheueren Schmerz. Warum hatte sie das getan, warum nur?
Er hatte sich so darauf gefreut, sie nach ihrer dreiwöchigen Nordamerikareise wieder zu sehen. Deshalb war er am Abend vor ihrer Rückkehr in ihre Wohnung gefahren, um alles für ein kleines Willkommensfrühstück vorzubereiten, mit dem er sie überraschen wollte. Unterwegs hatte er einen Teller italienische Vorspeisen, eine Flasche Champagner und einen Strauß Blumen besorgt. Voller Vorfreude war er damit die fünf Treppen zu Lauras Wohnung in der Danziger Straße hinaufgelaufen, um die Einkäufe im Kühlschrank zu deponieren und den Tisch zu decken, damit alles für ihre Rückkehr bereit war.
Als er die Tür aufschloss, hatte er einen Anflug von schlechtem Gewissen. Laura war sehr heikel, wenn es um ihre Wohnung und um ihre Privatsphäre ging und hatte ihn ausdrücklich gebeten, die Wohnung nur zum Blumengießen zu betreten, als sie ihm vor ihrer Abreise den Schlüssel übergeben hatte. Aber er sagte sich, dass sie ihm sicher verzeihen würde, wenn sie die Blumen und das leckere Frühstück sehen würde und trat in den Flur.
Er brauchte keine fünf Sekunden, um zu spüren, dass in der Wohnung etwas nicht stimmte. Langsam ließ er den Beutel mit den Einkäufen auf den Boden sinken. Dann blieb er bewegungslos stehen und lauschte. Eindeutig, es war jemand in der Wohnung. Er hörte Geräusche hinter der Schlafzimmertür. Laura konnte es nicht sein, das war unmöglich, sie hatte ihm gestern erst gemailt, dass ihr Flieger morgen früh um 8:25 Uhr landen würde. Vorsichtig und aufs höchste angespannt drückte er die Klinke der Schlafzimmertür nach unten und öffnete die Tür. Was er sah, ließ ihn erstarren. Laura lag splitternackt und lustvoll stöhnend unter einem muskulösen, gebräunten Männerkörper vom Typ erfolgreicher, bodygebuildeter Geschäftsmann. Und es machte ihr Spaß, daran bestand nicht der geringste Zweifel.
Als sie Jochen bemerkte, richtete sie sich ruckartig auf, starrte ihn aus ihrem erregten Körper entgeistert an und schrie: »Was zum Teufel machst Du hier!?«
»Ich wollte Dich überraschen, ich dachte ...!« Jochen sah sie vollkommen perplex an und spürte Schmerz und Verzweiflung.
»Schau nicht so blöd! Was ist denn dabei, wenn ich ein bisschen Spaß hab! Du bist selber schuld, wenn du mir nachschnüffelst. Warum rufst du nicht an, bevor du hier auftauchst? Ich bin eine Frau und ich brauch es eben auch manchmal! Und ich seh verdammt noch mal nicht ein, warum ich es mir nicht woanders nehmen soll, wenn ich es von dir nicht kriegen kann. Was wir sexuell zusammen machen, reicht mir nicht! Aber das ist kein Grund zur Panik! Und jetzt mach, dass du raus kommst. Ich ruf dich morgen an.«
Jochen konnte kein Wort entgegnen. Er stand einfach nur da und rührte sich nicht von der Stelle. Bewegungsunfähig sah er, wie das Muskelpaket sich ein paar Dolce & Gabana Unterhosen anzog und langsam mit seinen breiten Schultern auf ihn zukam. »Worauf wartest Du noch, hast Du nicht gehört, du sollst verschwinden!«
Jochen rührte sich immer noch nicht. Er spürte mit einem Mal eine seltsame Ruhe. Erstaunlich, diese Ruhe, dachte er, wie im Auge des Hurrikans. Als blickte er durch röhrenartige Öffnungen in seinem Schädel nach draußen, sah er diesen Halbnackten in seinen bunten Unterhosen auf sich zukommen, sah, wie sich die Muskeln in diesem wütenden Gesicht vor Aggressivität immer mehr anspannten … und blieb vollkommen ruhig, fühlte nur ein großes, sprachloses Erstaunen, das aus einer schier unendlichen Ruhe in ihm aufstieg. Er stand nur da und wich keinen Millimeter zurück, bewegte sich nicht. Ein kurzes Aufflackern von Irritation huschte über die Iris des Mannes. Dann wurde er vom Zorn über Jochens unverschämte Gelassenheit überwältigt.
Er schaltete mit einem heftigen Ruck in einen hektischen Bewegungsablauf, packte Jochen an den Schultern und drückte ihn in den Flur. »Raus hier, du Arsch, aber dalli!« Er rammte Jochen mit aller Kraft gegen die Wand neben der Eingangstür, riss die Tür auf und stieß ihn ins Treppenhaus hinaus. Dann knallte er die Tür zu.
Jetzt in der Erinnerung war es Jochen unbegreiflich, warum er sich nicht gewehrt hatte. Warum zum Teufel hatte er Laura nicht zur Rechenschaft gezogen, warum nur hatte er sich diese ungeheuere Demütigung einfach gefallen lassen? Er konnte es nicht fassen. Noch Minuten lang hatte er wie betäubt im Treppenhaus gestanden und auf die Geräusche hinter Lauras Tür gelauscht. Dann hatte er das Haus verlassen und war endlose Stunden ziellos durch die Stadt gerannt.
Es war unfassbar, wie Laura ihn behandelte, wie sie ihn einfach abhakte, nach all den Jahren. Er hatte die letzten Stunden verzweifelt auf einen Anruf von ihr gewartet, auf eine Entschuldigung, aber das Telefon war stumm geblieben. Sie hatte ihn einfach aus ihrem Leben gestrichen. Wahrscheinlich hatte sie ihn bereits seit Monaten belogen und betrogen. Und er hatte nichts davon gemerkt, nichts, hatte geglaubt, dass sie ihn liebe und dass sie füreinander bestimmt wären und dass es nur noch eine Frage der Zeit wäre bis zu ihrer Heirat. Und jetzt hatte sie alles zerstört, hatte ihn so unfassbar erniedrigt. Das Bild ihres lustvoll stöhnenden Körpers unter diesem fremden Mann brannte in seinem Hirn. Und plötzlich spürte einen tiefen Hass, wie er ihn noch nie erlebt hatte. Das Gefühl war so stark, dass seine Hände anfingen zu zittern. Er musste sich zwingen, sie ruhig zu halten, als er nach dem Autoschlüssel suchte.
Die Uhr auf dem Armaturenbrett zeigte 0:10 Uhr als er den Zündschlüssel umdrehte und den Wagen startete. In der Hoffnung, sich zu beruhigen, fuhr er ziellos durch die Stadt. Eine Stunde später fühlte er sich immer noch wie im freien Fall. Das Fundament, auf dem er die ganzen letzten Jahre gestanden hatte, war zerbrochen. Nur einmal in seinem Leben hatte er etwas ähnlich Schmerzhaftes erlebt. Als er sieben Jahre alt war, hatten sich seine Eltern scheiden lassen. Er war bei seiner Mutter geblieben und hatte miterlebt, wie sie in der Folge angefangen hatte, zu trinken. Als sie ihren Job verlor, steigerte sie ihren Alkoholkonsum weiter und ließ sich immer öfter von fremden Männern aushalten, um das Geld für den Lebensunterhalt zu beschaffen.
Wenn sie zu Hause Männerbesuch empfing, schickte sie Jochen immer zu einer Bekannten, die in einem Pizzaservice um die Ecke arbeitete. Dort half er dann ein bisschen mit oder saß einfach nur da und trank eine Apfelschorle, während die Bestellungen eingingen oder Nachtschwärmer vorbeikamen, um sich noch eine Pizza reinzuziehen. Eines Abends kam er zu früh nach Hause zurück. Als er die Wohnungstür öffnete, lag seine Mutter nackt auf den Dielenbrettern im Flur. Zwischen ihren Beinen wälzte sich stöhnend ein nach Schweiß stinkender Mann. Als seine Mutter Jochen in der offenen Tür bemerkte, sprang sie schreiend auf, gab ihm ein paar Ohrfeigen und warf ihn aus der Wohnung. Im dunklen Treppenhaus hatte er damals vollkommen verstört gewartet, bis der Freier endlich gegangen war.
Er hielt an einer Tankstelle und kaufte sich drei Flaschen Becks, in der Hoffnung, dass das Bier ihn müde machen würde. Als er versuchte, eine der Flaschen mit einem Feuerzeug zu öffnen, begannen seine Hände wieder zu zittern. Er legte die Flasche beiseite und versuchte, das Zittern in den Griff zu bekommen, indem er seine Fingerspitzen mit aller Gewalt ins Lenkrad grub. Es half nichts, er konnte sich nicht beherrschen. Der Hass auf Laura ließ ihn nicht mehr los und wurde immer stärker. In einem plötzlichen Entschluss startete er den Motor und fuhr zu Lauras Wohnung.
Er parkte den Wagen neben ein paar Mülltonnen, die gegenüber von Lauras Haus am Straßenrand für die Abfuhr bereit standen und sah zu den Fenstern ihrer Wohnung hinauf. Nichts deutete darauf hin, dass Laura noch wach war. Wahrscheinlich lag sie neben ihrem Liebhaber im Bett, glücklich und besudelt von seinem Sperma. Sie lag ruhig in ihrem Bett, unfassbar! Dabei hätte sie es verdient, in einer dieser Mülltonnen zu liegen. In einem Anfall von Hass fing er an, wütend um sich zu schlagen. Wie von Sinnen hämmerte er auf das Armaturenbrett und gegen die Türverkleidung.
Er hielt erst inne, als sein Blick auf einen in eine Decke gewickelten Gegenstand auf dem Rücksitz fiel. Als er begriff, um was es sich handelte, fühlte er eine Art Ehrfurcht in sich aufsteigen. Langsam hob er den Gegenstand nach vorne und schlug die Decke zurück. Im Licht der Straßenlaterne blitzte die Klinge eines Samuraischwerts auf. Er konnte sich nicht erinnern, wann er das Schwert, das seit Jahren über seinem Schreibtisch hing, von der Wand genommen und ins Auto gebracht hatte. Aber das spielte jetzt auch keine Rolle mehr. Die Reflektion der Klinge im Licht weckte eine unendlich leichte Freude in ihm, die mit jeder Sekunde stärker Besitz von ihm ergriff. Andächtig ließ er seine Finger über den kühlen Stahl des Schwerts streichen und empfand nach Stunden der tiefen Verzweiflung endlich eine beginnende Erleichterung. Er stieg aus, schlug das Schwert in seine Jacke und überquerte mit leichten Schritten die Straße. Noch hatte er den Schlüssel zu Lauras Wohnung. Der Gedanke daran brachte ein triumphierendes Lächeln auf seine Lippen. Als er die Haustür hinter sich geschlossen hatte, verharrte er ein paar Augenblicke und lauschte ins Treppenhaus. Dann hob er das Schwert mit beiden Händen und begann, im Dunkeln zu tanzen.
3
Paul Mrozek zögerte einen Augenblick. Die Felsleiste kam ihm jetzt doch verdammt klein vor. Würde er sich daran festhalten können? Und würde sie halten? Der Fels im Elbsandsteingebirge war weich, man musste immer damit rechnen, dass ein Stück ausbrach. Er begann zu zweifeln. Die nächsten sechs Meter musste er nonstop durchsteigen, in dieser Passage gab es keine Stelle, wo er sich ausruhen konnte. Er musste in einem Zug durch. Er hatte es zigmal geschafft. Top rope hatte er die Route bestimmt zwanzigmal in einem Zug durchstiegen, ohne Probleme. Jetzt, ohne Seil bekam er plötzlich die Krise. Er spürte, wie seine Hände leicht feucht wurden und tastete nach dem Beutel mit dem Magnesia. Das half nicht nur gegen die feuchten Hände, das Ritual half ihm auch, seine Nerven wieder in den Griff zu kriegen. »Du hast es zwanzigmal geschafft, du schaffst es auch jetzt!« wiederholte er innerlich immer wieder. Dann wischte er sich die langen blonden Haare aus der Stirn und kletterte weiter. Mit einem ,Dynamo’, einem dynamischen Vorwärtsschnellen, kriegte er die Leiste mit der Linken zu fassen, zog die Rechte nach und hakte die linke Ferse in einem kleinen Vorsprung ein und zog sich mit zwei schnellen Griffen über den Überhang hinauf in das rund fünf Meter lange Steilstück, das er entschlossen hinter sich brachte. Die restlichen zwanzig Meter bis zum Ausstieg waren easy. Als er oben stand und einen Blick in die Wand zurückwarf, spürte er diese wunderbare Euphorie, die ihn immer durchströmte, wenn er sich überwunden hatte, eine Route allein und ohne Seil zu machen, voll auf Risiko. Klar, kalkulierbares Risiko, aber immer auch ein Spiel mit dem Unwägbaren. Dann fühlte er das Leben wie sonst nie, stark und voll unendlicher Kraft.
Er zog das Seil durch den Haken am Ausstieg, klinkte den Achter ein und seilte sich zum Einstieg zurück, wo er seinen Rucksack mit dem Handy deponiert hatte. Er ließ das Telefon immer am Wandfuß zurück. Wenn er abstürzte, war es sowieso unwahrscheinlich, dass er danach noch in der Lage sein würde zu telefonieren.
Die wenigen Kollegen am Institut für Neurobiologie, die wussten, was er in seiner Freizeit machte, schüttelten den Kopf darüber, dass er ohne Seil an teils überhängenden Felswänden kletterte. Aber er fühlte sich gut dabei. Wann immer es möglich war, fuhr er in den Süden, in die Berge. Er liebte die Einsamkeit dort, die nur noch am Limit zu haben war. Auf den einfachen Wegen, in den einfachen Routen war Betrieb ohne Ende. Nur in den Extrembereichen gab es meist noch die Freiheit der Einsamkeit. Er fühlte sich nie wirklich einsam, wenn er allein war. Im Gegenteil, das waren die Stunden, in denen er eine große Geborgenheit fühlte. Wenn er einen Seilpartner hatte, fühlte er sich immer unsicher. Er musste sich darauf verlassen, dass der keinen Fehler machte, musste ihm vertrauen und das fiel ihm schwer, war letztlich unmöglich.
Er schaltete sein Telefon ein. Es war 16:30 Uhr, Zeit nach Berlin zurückzufahren. Gern hätte er noch eine Route geklettert, aber er hatte seinem Vater versprochen, spätestens um 20 Uhr zurück zu sein, und er wollte dieses Versprechen halten.
Er war schon immer ein Einzelgänger gewesen. In den letzten Jahren hatte er jeden Besuch zu Hause vermieden. Vor allem Familienfeste hasste er, an erster Stelle das Weihnachtsfest. Weihnachtsfeste zu Hause waren immer die Hölle gewesen. Soweit er zurückdenken konnte, hatte er sich in der Familie einsam gefühlt. Mit seinen Eltern zu sprechen war ihm schwerer gefallen als mit Fremden. Und jetzt war es zu spät, jetzt war es nicht mehr möglich, ein Familiengefühl aufzubauen, zuviel Geröll lag da im Weg.
Während des Studiums vermied er es strikt, über seine Herkunft zu sprechen. Wenn es sich nicht umgehen ließ, erzählte er einfach irgendwelche erfundenen Stories über seine Geburt, seine Eltern, sein Zuhause – alles Lügen.
Den Tod der Mutter vor einem Jahr hatte er aus ungeheuerer innerlicher Distanz erlebt. Am liebsten wäre er nicht zum Begräbnis gefahren, aber die Tränen seines Vaters am Telefon hatten ihn berührt. Als er zu Hause eintraf, saß sein Vater völlig verzweifelt und stumm in der Küche und weinte immer wieder leise vor sich hin. Dass sein Vater so weinen konnte, hatte er sich nie vorstellen können.
In den Tagen rund um das Begräbnis wurde ihm klar, dass sein Vater sich verändert hatte. Dass irgendetwas mit ihm nicht mehr stimmte, fiel ihm das erste Mal vor dem Leichenschmaus auf. Sie hatten zusammen noch einen kleinen Spaziergang in der Umgebung des Lokals unternommen und sich dann getrennt, weil Paul noch etwas besorgen wollte. Sein Vater hatte es danach nicht geschafft, allein den Weg zum Lokal zurückzufinden. Er hatte auch niemanden nach dem Weg fragen können, weil er den Namen des Lokals vergessen hatte.
Als Paul sich wegen diesem Vorfall besorgt zeigte, regte sich sein Vater auf und wehrte sich gegen eine derartige »Unterstellung«, wie er meinte. In seiner Situation, sei es ganz normal, etwas zu vergessen.
Paul konnte er dadurch nicht beruhigen. Und in den folgenden Tagen verstärkte sich Pauls Besorgnis noch. Im fiel auf, dass sein Vater ängstlicher war als früher, fast wirkte er ein bisschen hilflos. Er hatte manchmal Mühe sich an kurzzeitig zurückliegende Ereignisse zu erinnern und hatte anscheinend einige Geschehnisse in seiner Vergangenheit einfach vergessen.
Paul wusste, was diese Symptome unter Umständen zu bedeuten hatten, es konnte sich um den Beginn einer Alzheimer Demenz handeln. Aber vielleicht waren diese Fehlleistungen seines Vaters ja wirklich nur eine Folge des Schocks, den der Tod seiner Frau ausgelöst hatte. Eines war für Paul jedoch klar, er konnte seinen Vater jetzt unmöglich alleine in dieser Wohnung zurücklassen. Und es gab niemanden außer ihm, der sich um ihn kümmern konnte. Also gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder konnte er seinen Vater ins Pflegeheim bringen, oder er musste sich um ihn kümmern, falls seine Arbeit das überhaupt zulassen würde.
Er konnte diese Entscheidung nicht so einfach aus dem Bauch heraus treffen. Also rief er im Institut an und ließ sich für eine Woche beurlauben. Er wollte die freien Tage mit seinem Vater verbringen und hoffte, in dieser Zeit Klarheit darüber zu gewinnen, wie es weitergehen sollte.
Als er am Abend schweigend neben seinem Vater vor dem Fernseher saß, fühlte er sich vollkommen hilflos. Der Wetterbericht wurde von einem jungen Mann vorgetragen, der vor einer beeindruckenden Dünenkulisse an der Ostsee stand. Paul nahm keine Notiz von den Wetterdaten, die der Moderator verkündete, aber am Ende des Wetterberichts hatte er einen Entschluss gefasst. Er stand auf und packte ein Paar Sachen für sich und seinen Vater ein.
»Morgen früh fahren wir an die Ostsee. Ich glaube, uns beiden tut ein bisschen frische Meerluft gut. Ich weck dich um sieben.« Damit sagte er seinem Vater gute Nacht und ging schlafen.
Die Meerluft wirkte befreiend. Paul fühlte sich wieder besser. Aber der Zustand seines Vaters blieb gleich. Im Gegenteil, Paul bemerkte immer mehr Symptome für eine beginnende Demenz. Sie unternahmen gemeinsam lange Spaziergänge am Meer. Sie sprachen kaum, gingen schweigsam nebeneinander her, und oft ließ Paul seinen Vater auch hunderte von Metern vorausgehen. Und obwohl sie kaum zehn Sätze miteinander sprachen, hatte Paul das Gefühl, dass sie sich immer näher kamen, dass sie sich immer besser verstanden.
Er betrachtete seinen alten Vater wie er vor ihm herging und erinnerte sich an eine kurze Geschichte von Beckett, in der der Sohn mit dem Mantel des Vaters auf einem langen Spaziergang unterwegs ist. Dabei traf er seine Entscheidung, den Mantel des Vaters anzunehmen.
4
»Der Ausschnitt geht hinten bis zu meinen Arschbacken runter«, tippte Sarah in die Tastatur, fischte sich eine Essiggurke aus dem Glas und legte sie der Länge nach auf das Käsebrot.
»Susanne... oder wie zum Teufel du in Wirklichkeit heißen magst?! Du machst mich wahnsinnig! Du siehst bestimmt großartig aus in diesem Kleid. Ich kann’s mir richtig gut vorstellen. Und dazu die Leopardenschuhe! Verdammt! Ich möchte dich jetzt gerne ficken!«, erschien die Antwort auf dem Monitor.
»Und, ich trau mich kaum, es zu sagen... ich hab kein Höschen drunter«, setzte Sarah noch eins drauf.
»Grrr... oh Gott, mir kommt’s! Daran bist jetzt du schuld, Susanne, du kleine Schlampe! Ich muss dich unbedingt kennen lernen!!! Wo und wann können wir uns sehen?«
»Is nicht!!! Das ist gegen die Regeln!!! Alles geht, aber wir werden uns nie sehen!!! Ich schick Dir ein Bild von mir, alles, aber wir werden uns nie sehen!!! – Willst Du?«
»Ja, klar, mach schon! Ich kann’s kaum erwarten.«
»Vielleicht... vielleicht noch heute, vielleicht aber auch erst morgen... vielleicht... Ciao!«
Sarah scrollte ein paar sexy Bilder durch, die sie im Internet gefunden hatte und schickte eins davon los. Dieser kleine, geile Irre würde ihr das sicher abnehmen. Und wenn nicht, auch egal, er würde sicher mit der Vorlage ganz gut zurechtkommen. Sie hatte kein Mitleid mit ihm, schwanzgesteuertes Arschloch! Damit war diese Romanze für sie zu Ende.
5
Dr. Jens Langer nahm gerne den Zug. Ob ICE, IC oder Regionalexpress war ihm egal. Es machte ihm nichts aus, eine halbe Stunde länger unterwegs zu sein. Im Zug konnte er wunderbar nachdenken. Solange er unterwegs war, waren seine Gedanken frei.
Als Kind war er auch gerne mit dem Triebwagen in die Kreisstadt zur Oberschule gefahren. Er mochte das. Der rote Zug brachte ihn für den Vormittag aus der Enge der kleinen Stadt hinaus in die Welt. Es machte ihm Spaß, auf die Gleise zu sehen und unterwegs zu sein.
Schienen waren ihm vertraut. Er hatte unter Eisenbahnbrücken gespielt, war auf den Schienen, die in den nahegelegenen Steinbruch führten, entlang spaziert, verbotener Weise. Aber der Geruch der alten Gleise hatte ihn fasziniert, nach Rost, Schmiere und Teer. Irgendwo gab es das vielleicht noch, an stillgelegten Strecken. Die Schienen, auf denen noch Züge rollten, hatten jedoch keine Romantik mehr, nicht einen Hauch. Auch der Beruf des Eisenbahners hatte viel verloren vom Mythos vergangener Tage, als Schienen verlegen noch eine Pioniertat wahr. Aber noch konnte man träumen im Zug, konnte die Freiheit der Gedanken genießen. Ja, Züge sind Traummaschinen, dachte er kurz und lächelte, weil diese Formulierung ein Klischee war, ein unerträgliches, wie alles, was man schreiben konnte, heutzutage.
Das war ein Klischee, natürlich, ein unerträgliches. Früher wollte er mal Schriftsteller werden. Möglichst ein bekannter Autor, ein Genie. Jetzt war er so weit davon entfernt, wie die moderne Eisenbahn von dem roten Triebwagen mit dem er als 10-Jähriger in die Schule gefahren war.
Ganz entfernt hatte er noch mit dem Schreiben zu tun. Als seine Stelle am psychologischen Institut der Universität gestrichen wurde und er beim besten Willen keine Anstellung in seinem Job mehr fand, hatte er angefangen, Biografien zu schreiben. Keine Biografien von Berühmtheiten sondern Biografien im Auftrag, für einfache Leute. Am Anfang war es mühsam, Kunden zu finden, und er brauchte endlos Zeit für die 150 bis 200 Seiten, die eine solche Biografie in der Regel umfasste, zu lange, um profitabel zu arbeiten.
Das änderte sich mit den Jahren. Er ging jetzt systematischer vor und steigerte dadurch sein Tempo enorm. Wenn er sich reinhing, schaffte er eine Biografie in drei Wochen. Zwei Tage Interview und Recherche beim Auftraggeber und rund zwanzig Tage schreiben. Und das Beste, der Job machte ihm Spaß. Es war interessant, so nah am Leben anderer Menschen teilzuhaben. Er wusste nach der Fertigstellung der Biografie mehr über diesen Menschen als dessen eigene Kinder, wesentlich mehr. Es erstaunte ihn immer wieder, wie weit seine Auftraggeber bereit waren, sich ihm zu öffnen, einem wildfremden Menschen. Und mittlerweile fand er, dass nichts spannender war als das wirkliche Leben, keine Fiktion konnte da mithalten.
Er war schon gespannt auf den neuen Kunden, mit dem er morgen in Zürich zum ersten Interview verabredet war. Es handelte sich um den ehemaligen Leiter der Dermatologischen Klinik, der, zeitlebens von der bildenden Kunst fasziniert, im Alter noch eine Galerie in Zürich eröffnet hatte und auf eine reichhaltige Lebensgeschichte zurückblicken konnte, die er jetzt für die Nachwelt aufzeichnen lassen wollte.
Mit noch größerer Spannung sah er einer Verabredung entgegen, die er für den heutigen Abend getroffen hatte. Seine Tochter Sarah, die er vor zwanzig Jahren zum letzten Mal gesehen hatte, hatte sich telefonisch bei ihm gemeldet und ein Treffen vorgeschlagen. Er hatte Angst vor dieser Begegnung, weil er wusste, dass eine Lawine von Gefühlen nur darauf wartete, in unkontrollierte Bewegung versetzt zu werden. Seine Hände wurden nass vor Angst, wenn er daran dachte. Trotzdem freute er sich, dass dieser Knoten in seinem Leben sich damit vielleicht endlich auflösen würde.
Der Zug erreichte Mannheim. Hier musste er umsteigen und hatte zwanzig Minuten Aufenthalt. Er nutzte die Gelegenheit, um eine Zeitung in der Bahnhofshalle zu kaufen. Als sein Blick auf die Schlagzeile fiel, stockte ihm der Atem. »Kill Bill in Berlin!«, stand da. »Junger Amokläufer tötet seine Freundin mit einem Samuraischwert«. Ohne den Artikel gelesen zu haben, hatte er schlagartig das Gefühl, dass er den Täter kannte. Mit jeder Zeile, die er las, wurde sein Gefühl mehr und mehr zur Gewissheit. Der Täter, der in dem Artikel als Jochen J. bezeichnet wurde, war mit Sicherheit Jochen Jakowski, ein junger Mann, den er gerade als Interviewer in einer Versuchsreihe bei Gene Design Technologies betreute. Die Ähnlichkeiten waren jedenfalls frappierend.
Der Job bei Gene Design Technologies sorgte für die Miete, die er mit seinen Biografien noch nicht erwirtschaften konnte. Seit zwei Jahren arbeitete er dort zwei- bis dreimal die Woche als Interviewer. Ein einfacher Job. Er hörte Versuchspersonen zu, die ihm detailliert aus ihrem Leben und von ihren Erinnerungen erzählten und machte sich parallel dazu Notizen in einem Datenbankraster. Nach dem Interview bearbeitete er die mitgeschnittenen Audiofiles, setzte bei bestimmten Begriffen Marker und stellte sie nach einem exakt vorgegebenen Schema in die Datenbank ein. Während des gesamten Interviews wurden die Hirnaktivitäten und Hirnströme der Probanden mit einem neu entwickelten Scanner aufgezeichnet und über einen Timecode mit den Eintragungen in der Datenbank verlinkt. Zugleich war eine timecode-verkoppelte Kamera auf das Gesicht des Probanden gerichtet und registrierte dessen Mimik. Das Erfassen des Timecodes gehörte mit zu seinen wichtigsten Aufgaben.
Mit Hilfe dieser Langzeitinterviews mit Versuchspersonen unterschiedlichen Alters wollte Gene Design Technologies das Rätsel der Alzheimer-Krankheit lösen und ein Medikament oder eine wirksame Therapie gegen diese grausame Krankheit entwickeln. Ein Milliardenmarkt in einer Situation, in der die Bevölkerung fast aller entwickelten Industrienationen unaufhaltsam vergreiste und die Methusalem-Gesellschaft als gigantische Bedrohung von Wohlstand und sozialer Sicherheit am Horizont stand.
Bis vor ein paar Monaten hatte er einfach seinen Job bei GDT gemacht, ohne viel darüber nachzudenken. In der letzten Zeit waren ihm jedoch mehr und mehr Zweifel gekommen, ohne dass er genau benennen konnte, was ihn beunruhigte. Es war einfach die Atmosphäre bei Gene Design Technologies. Wenn er diesen Glaspalast betrat, der die Form eines großen Tortenstücks hatte, fühlte er eine undefinierbare Bedrohung. Das ist das große Stück vom Kuchen, von dem alle hier was abhaben wollen und wofür sie alle bereit sind, über Leichen zu gehen, dachte er oft, während er durch die automatische Drehtür ins Gebäude geschleust wurde. Der Pförtner im Entree folgte ihm mit einem misstrauischen Blick auf seinem Weg durch die Eingangshalle. Eigentlich war es kein Pförtner, wie man ihn sich gemeinhin vorstellt. Es war ein Schrank von einem Mann, ein durchtrainierter Bodyguard, der eine Waffe unter seinem Boss Jackett trug, wie es Dr. Langer schien.
Die ganze Firma war ein einziger Hochsicherheitsbereich, überall Zugangskontrollen, Patentschutzabteilungen, geheime Entwicklungsabteilungen und Labortrakte. Hier herrschte der gnadenlose internationale Wettbewerb. Patentierte Gene, Viren, manipulierte Zellen. Irgendwie kam ihm das immer komischer vor. Er fühlte sich immer mehr wie in einem modernen KZ der Biotechnologie und konnte sich nicht mehr vorstellen, dass der Output der Firma irgendwann der Menschheit dienen würde.
Er fing an, sich für die Vorgänge bei GDT zu interessieren und machte Kopien von allen Daten, auf die er Zugriff hatte. Es gelang ihm auch, einige Unterlagen aus anderen Abteilungen zu fotokopieren und außer Haus zu schmuggeln. Aber das meiste sagte ihm nichts. Er konnte keine Schlüsse daraus ziehen, bis jetzt jedenfalls noch nicht.
Als er den Artikel über den Schwertmord fertig gelesen hatte, lehnte er sich zurück, schloss die Augen und dachte nach. Jochen war am Nachmittag vor dem Mord bei GDT bei ihm zum Interview gewesen. Dabei hatte ihm Jochen eingehend von Lauras Rückkehr erzählt. Er konnte sich noch genau erinnern, dass Jochen von einem gemeinsamen Frühstück in Lauras Wohnung erzählt hatte, nachdem er sie vom Flughafen abgeholt hatte. Kein Wort davon, dass er Laura am Abend davor mit einem fremden Mann im Bett erwischt hatte. War es möglich, dass Jochen ihn so angelogen hatte?
Jochen war mit Anfang dreißig einer seiner jüngeren Interviewpartner. Er hatte sich zuerst gefragt, warum so junge Leute in ein Alzheimer Forschungsprogramm integriert waren. Aber der Projektleiter hatte ihm gesagt, dass junge Probanden als Vergleichspersonen benötigt würden. Das hatte ihm eingeleuchtet.
Beim besten Willen konnte er sich Jochen nicht als Mörder vorstellen. Jochen war die Sanftmut in Person, er konnte gar nicht aggressiv werden. Vielleicht war es doch nicht Jochen Jakowski, vielleicht handelte es sich doch nur um zufällige Ähnlichkeiten? Andererseits hatte ihm Jochen von dem Samuraischwert erzählt und wie er es erworben hatte, das stimmte alles haargenau.
Er schaltete sein Handy ein, navigierte zu Jochens Nummer, die er im Organizer hinterlegt hatte, und tippte auf den kleinen, grünen Hörer. »Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht erreichbar«, informierte ihn eine Voice-Einspielung. Klar, wenn Jochen in Polizeigewahrsam war, hatte man ihm das Handy abgenommen. Er nahm sich vor, sich bei seiner Rückkehr um die Angelegenheit zu kümmern. Vielleicht konnte er ja helfen.
Komisch auch, dass Gene Design Technologies mit keinem Wort in dem Artikel erwähnt wurde, dachte er noch, bevor seine Gedanken sich wieder auf das konzentrierten, was vor ihm lag.
6
Er aß marinierte Oliven und ein paar Häppchen Seeteufel und beobachtete nebenbei das TV-Window auf der Web Site von Gene Design Technologies. Seit einigen Minuten lief das Live-Streaming von der NASDAQ. Der CEO von GDT trug gerade einige Details aus der Firmengeschichte vor und gab einen Überblick über die Patentrechte, die im Besitz von Gene Design Technologies waren. Am Ende der kleinen Ansprache beglückwünschte ihn der CEO der NASDAQ mit einem langen Händedruck zum erfolgreichen Going Public des Unternehmens.
Jeden Augenblick musste der erste Kurs der neu gelisteten Aktie von Gene Design Technologies bekannt gegeben werden. Gespannt starrten die CEOs und die geladenen Gäste auf die Display-Wand. Endlich leuchtete der erste Kurs in grünen Zahlen neben dem Firmennamen auf: 27.90. Bingo, ein Kursplus von 50,81 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis. Er hatte seinen Job ausgezeichnet erledigt. Seine Auftraggeber würden das mit einer 25 Prozent Prämie auf sein Honorar zu würdigen wissen.
Er schaltete sein Notebook aus und verstaute es in seinem fertig gepackten Handgepäck. Nach einem letzten Check der Zimmer verließ er die Hotel-Suite. In rund zwei Stunden würde seine Maschine nach Genua abheben. Dort würde er drei Stunden auf dem Airport verbringen, die er für einen kleinen Bummel durch die Designer-Shops nutzen wollte, dann war er unter anderem Namen auf eine Maschine nach Berlin gebucht.
Er ging zur Rezeption, bezahlte das Zimmer und bestellte ein Taxi, das ihn in einer Dreiviertelstunde abholen sollte. Dann ging er in die Lounge, ließ sich einen Cappuccino bringen und holte sich ein bisschen Obst vom Buffet.
Am Tisch neben ihm handelte ein englischer Geschäftsmann mit einem Chinesen eine Warenlieferung aus. Er legte ein Foto auf den Tisch, um seinem chinesischen Verhandlungspartner zu zeigen, was er wollte, nannte die Menge, die er in Auftrag geben wollte, und den Preis, den er dafür zu zahlen bereit war. Soweit er von seinem Platz aus sehen konnte, handelte es sich um einen Weihnachtsmann aus Plastik mit einem Leuchtstern auf der Brust. Der Chinese kalkulierte rasch, welchen Aufwand er hatte, und machte ein Gegenangebot. Der Engländer schob sich ein Häppchen in den Mund, schlürfte seinen Tee und gab, während er sich den Mund abwischte, mit zwei knappen Worten zu verstehen, dass er den Preis für einen Scherz halte. Das Gesicht seines Gegenübers zeigte nicht die geringste Reaktion. Er schrieb einen neuen Angebotspreis auf einen Zettel und schob ihn über den Tisch. Der Engländer war einverstanden und schob sich eine Gabel mit Rührei in den Mund. Während er kaute, lief in seinem Gehirn wahrscheinlich bereits das Kalkulationsprogramm. 400 bis 500 Prozent Aufschlag bis zum Endverbraucherpreis waren bei solchen Geschäften üblich.
Er as ein letztes Stück Ananas und nahm den letzten Schluck Cappuccino. Dann wischte er sich den Mund mit der Serviette ab, stand auf und ging in die Lobby. Sein Taxi wartete schon am Hoteleingang. Als er durch die automatische Drehtür ins Freie trat, hatte er wie immer, wenn er ein Hotel verließ, das Gefühl, das alles hinter ihm sich in nichts auflöste. Er gab dem Boy, der ihm die Taxitür aufhielt, ein Trinkgeld und alles war vergessen, als wäre es nie geschehen. Er hatte dafür gesorgt, dass keine Spur zurückblieb.
7
Sie hatte Übung im Auslösen des Reflexes. Schon der erste Vorstoß mit dem Finger war ein voller Erfolg. Sie würgte alles ins Klo. 1000 Gramm Putenwiener mit extra scharfem Senf, zwei Tafeln Schokolade, vier Laugenbrötchen, drei Croissants, zwei Packungen Sesamkekse. Sie hatte gleich nach dem Abendessen angefangen zu fressen. Jetzt fühlte sie sich wieder erleichtert. Sie spülte den Mund aus und gurgelte bis tief in den Rachen, um den ekligen Geschmack der Magensäure los zu werden. Dann putzte sie hektisch die Zähne, eilte ins Zimmer zurück und schaffte die Spuren ihres Essanfalls beiseite. Sie wischte auch den letzten Krümel wie besessen vom Tisch, um ja alles zu beseitigen. Dann saß sie erschöpft da und fühlte sich schuldig und elend.
Es war der erste Anfall seit Wochen. Fast hatte sie das Gefühl gehabt, gewonnen zu haben – und dann das. Sie konnte unmöglich aus dem Haus gehen. Vielleicht doch? Sie ging ins Bad zurück und versuchte, sich zu schminken, konnte sich aber nicht konzentrieren und verschmierte den Lippenstift und die Wimperntusche. Entnervt gab sie auf und legte sich ins Bett. Sie hätte niemals ja sagen dürfen zu dieser Verabredung, NEVER, das wusste sie jetzt, dem war sie nicht gewachsen, noch nicht, vielleicht nie.
Damit war die ganze Therapie umsonst, sie hatte es wieder mal ordentlich verkorkst. All die Wochen hier mit gemeinsamem Essen, die Gruppensitzungen, die Therapiegespräche, alles vergeblich. Ob es den anderen Magersüchtigen, Tittenoperierten um sie herum auch so ging, waren sie alle für den Rest ihres Lebens zu dieser Scheiße verdammt? Sie zog sich die Decke über den Kopf und ließ ihre Gedanken laufen.
Das war ihr Scheiß-Leben. Sie trieb einfach dahin, versickerte. Ihre Moleküle lösten sich auf. Sand, ein Hauch von Grün in einer zerklüfteten Steinwüste, in einer Steppe. Ihr Leben lief einfach dahin, versickerte. Seit Monaten war sie in dieser Klinik, ohne weiterzukommen, ohne Veränderung. Sie platzte vor innerer Energie, sie spürte das Brennen in ihrem Körper, ein schmerzhaftes Feuer, aber konnte nichts tun, war unfähig zu handeln, drehte sich im Kreis, nichts drang nach Außen. Die Zeit verging und sie wurde nur älter und fetter.
Klar, da waren die helleren Zeiten, in denen sie durch die naheliegende Stadt zog, durch die Bars, Malatesta und Bodega und Kikki Bar, und nach den Jungs schaute, gern mal auch was älteres drunter, da war sie im gewissen Sinn Sammlerin.
Irgendwie hatte sie da einen Hau weg. Sie sah ab und an gern in die verfallenen Gesichter ihrer älteren Liebhaber, das hatte was, sie liebte es, das zu studieren. Und klar, das waren immer Bewunderer, auch das hatte sie gern. Dieses alte Fleisch rieb sich gern an jungem und war dankbar, wusste es zu schätzen. Aber auch das junge Gemüse war okay, sie war nicht immer wählerisch.
Manchmal hing sie auch etwas länger fest. Da war Simon, zum Beispiel, ein netter Typ eigentlich. Klar, schon im Methusalemalter mit seinen fünfundvierzig, aber dafür hatte er Flair. Nicht zu letzt wegen seiner 200 Quadratmeter Altbauwohnung am Limatufer, die fast leer war, bis auf ein paar handverlesene Bilder.
Vor dem Immendorf stand sie gern mit einem Glas Champagner und erzählte Simon von ihrer rasierten Möse und dass sie nichts drunter hätte. Das Spielchen liebte sie und Simon schätzte es auch.
Simon hatte auch noch andere Werte. Sie hatte nie Langeweile mit ihm. Und wenn, konnte sie sie sofort totschlagen, mit Ausgehen oder Verreisen oder einfach mit massivem Geldeinsatz.
Simon hatte auch Kultur. Sie hatte ihn kennengelernt, weil sie zufällig neben ihm saß, bei einer Othello Inszenierung. Nach dem Theater waren sie durch den vom Regen duftenden Park an der Limat spaziert. Auf der verlassenen Terrasse eines schon geschlossenen Uferrestaurants hatte sie ihn dann gevögelt. Es war einfach zu süß von ihm, dass er eine Flasche Wodka aus einer Kneipe organisiert hatte, um sie in Stimmung zu bringen, das musste belohnt werden. Dass sie einen Gummi dabei hatte und unheimlich geschickt damit umgehen konnte, verwirrte ihn kurz, ein Moment, in dem er sich nicht mehr so sicher war, ob sie wirklich das kleine unschuldige Mädchen war, für das er sie gehalten hatte. Einen Augenblick lang hatte er sogar gedacht, dass sie eine Professionelle sein könnte, wie er ihr später gestanden hatte, der Süße.
Simon brachte sie auch in Kreise, in die sie ohne ihn nie gekommen wäre. Kunstliebhaber und Kunsthändler mit Kohle ohne Ende. Anwesen über der Stadt, in denen man sich ergehen konnte. Dienstpersonal und Flügel und Areale, die unter Mottos eingerichtet waren. »Darf ich sie jetzt zum Espresso in den Surrealisten Flügel bitten? – Aber gern doch.« Sie genoss das, besonders, wenn sie sich von Simon heimlich befingern ließ zwischen all dem Edelgetue und sich dann auf dem Flügel im Musikzimmer ficken ließ. Und nebenbei lernte sie noch mit Messer und Gabel essen, in der richtigen Einsatzreihenfolge sogar. Das hatte was.
Simon verdiente sein Geld mit Kunst, sagte er jedenfalls. Er verschwand manchmal für eine Woche zu irgendwelchen Kunstmessen. Basel war eine wichtige davon. Und dann kam er immer mit etwas Ausgefallenem zurück, das verdammt teuer gewesen war. Meist brachte er ihr dann auch ein Geschenk mit, das auch nicht billig war. Dabei zeigte er Geschmack. Nur einmal überraschte er sie mit einer alten russischen Ikone, die er ihr schenken wollte. Sie lehnte ab, wohin sollte sie das Ding auch hängen. Es war besser in Simons Küche aufgehoben. Sie platzierte es dort persönlich, direkt über der Spülmaschine.
Aber irgendwie musste Simon nicht wirklich arbeiten, er hatte geerbt und würde noch mehr erben, das war klar, eine Impressionisten-Sammlung zum Beispiel, denn seine Eltern hatten eine.
Wenn Simon unterwegs war, war sie manchmal ein kleines bisschen traurig, weil sie an ihn gewöhnt war. Zum Glück hatte er einen Sohn, der eines Abends einfach plötzlich da war, als sie Simon besuchte, und auf einer Matratze in einem der leeren Zimmer übernachtete. Sie hielt sich nicht zurück, als sie mit Simon vögelte, und stellte sich vor, wie der junge Mann nebenan im Dunkeln lag und sie stöhnen und schreien hörte, das gab ihr einen guten Kick.
Mathieu war neunzehn. Wenn er sie ansah, waren ihr zwei Dinge sofort klar: Erstens, er war extrem verwirrt darüber, dass sein Vater mit einer Frau vögelte, die kaum älter war als er. Zweitens, er fand sie attraktiv und hätte sie am liebsten auch sofort gevögelt. Gegen »Erstens« konnte sie nichts tun. Aber bei »Zweitens« konnte sie Abhilfe schaffen, spätestens, wenn Simon wieder auf Geschäftsreise war. Sie freute sich schon darauf, auf diese interessante Konstellation. Manchmal stellte sie sich vor, dass sie Simon heiraten würde und dann Mathieus Mutter wäre, grotesk, aber auch spaßig.
Sie wusste nicht viel von Simon, mehr als von ihren anderen Liebhabern, aber eigentlich auch nichts. Aber noch weniger wusste er von ihr. Sie gab ihre Spuren nicht preis und verwischte sie sorgfältig. Sie tauchte auf aus dem Nichts und verschwand wieder im Nichts, das war die Regel. Simon wusste nicht, wo sie lebte, kannte ihre Telefonnummer nicht und wusste nichts von ihrer Krankheit. Er ahnte, dass es da ein Geheimnis gab, aber er fragte nur einmal danach und dann nie wieder, als sie ihm die Regel unmissverständlich erklärte. Sie verschwand für Tage, manchmal auch Wochen, wenn sie es einfach nicht schaffte, aus dem Haus zu gehen, und tauchte irgendwann wieder auf und knüpfte an wie selbstverständlich.
Was sie ihm erzählte, war gelogen. Sie erfand ein ganzes Leben für Simon. Sie hatte Spaß daran, diesen Faden zu spinnen, ihr Geheimnis. Dass es sie schmerzte, merkte sie im Normalfall nicht, nur in den dunklen Stunden war sie verzweifelt und wusste, dass es wohl keinen Ausweg geben würde. Wenn sie sich ganz schwach fühlte unter dieser dunklen Wolke, stellte sie sich manchmal vor, dass die Lava der Sonne in ihr Gehirn fließen würde und alles darin löschen würde und dass sie dann ihre Geschichte ganz neu schreiben könnte, neu und leicht, wie der Tau auf den Blättern vor ihrem Fenster, ein leichter reiner schwebender Schimmer – pures Glück.
NEVER! Sie hätte nie zusagen dürfen. Sie starrte an die Decke und versuchte in Gedanken, Zentimeter für Zentimeter, auszumessen wie lang und breit diese trübe, weiße Fläche war, bis sie in eine Art bewegungslose Trance fiel.
8
Dr. Langer bückte sich, um sich eine Cola Light aus der Minibar zu holen. Plötzlich hielt er in der Bewegung inne. Irgendetwas stimmte nicht. Die Fernbedienung für den Fernseher. Er war sich hundertprozentig sicher, dass er sie auf den Couchtisch gelegt hatte, bevor er das Zimmer vor einer Stunde verlassen hatte, um Fitness zu machen. Jetzt lag die Fernbedienung unmittelbar neben dem TV-Gerät. Er sah auf die Uhr. Der Zimmerservice konnte um diese Zeit unmöglich für diese Ortsveränderung der Fernbedienung verantwortlich sein. Augenblicklich spürte er Angst. Er hatte das Gefühl, als hätte man ihm intravenös ein hochpotentes, gefäßverengendes Mittel injiziert, so vehement verkrampfte das körpereigene Adrenalin sein Gefäßsystem. Er verharrte bewegungslos und lauschte. Nichts, es war ruhig, kein Geräusch, das nicht zu diesem Zimmer gehörte, nur das Pochen seines durch die verengten Gefäße gepressten Blutes.
Langsam entspannte er sich wieder. Vielleicht hatte er sich doch einfach nur getäuscht, vielleicht hatte er die Fernbedienung ja doch selbst neben den Fernseher gelegt und konnte sich einfach nicht mehr daran erinnern. Sein Blut zirkulierte wieder im Normalmodus. Er schloss die Minibar und ging zur Couch, um sich zu setzen.
Seit er vor zwei Wochen mit seiner Casio Exilim heimlich einige Probandenunterlagen im Dokumentations-Center von GDT fotografiert hatte, fühlte er sich beobachtet. Er hatte bei der Durchsicht der Unterlagen nichts Ungewöhnliches gefunden, keine Spur von dem, was er erwartet hatte zumindest, aber trotzdem hatte ihn das, was er gelesen hatte, aufs höchste beunruhigt. Er hatte jedenfalls sofort Professor Wohlfahrt, seinen Professor für Neuropsychologie aus seiner Studienzeit, angerufen und sich mit ihm verabredet, um mit ihm über seine Vermutungen zu sprechen. Aber gleich nachdem er den Hörer wieder aufgelegt hatte, war er sich irgendwie bescheuert vorgekommen. Wahrscheinlich bildete er sich das alles wirklich nur ein. Er konnte sich schon vorstellen, wie Professor Wohlfahrt reagieren würde. »Hirngespinste, Langer! Typisch, wie damals in Ihrer Studienzeit, Sie haben sich absolut nicht verändert! Aber da ist nichts dran, vergessen Sie’s! Unsinn ist das!«, hörte er den Professor sagen. Und höchstwahrscheinlich hatte Professor Wohlfahrt damit auch Recht. Das Ganze war Einbildung und löste sich sicher bald in nichts auf.
Jetzt waren andere Dinge wichtig. Morgen würde er seine Tochter nach über zwanzig Jahren zum ersten Mal wieder sehen. Würde er sie überhaupt erkennen, wenn sie in der Lobby des Hotels auftauchte, oder würde er ihr Handy anklingeln müssen, um sie zu orten? Und würden sie sich verstehen, würden sie eine Basis finden, um den gemeinsamen Abend zu überstehen?
Er zog den Ring der Cola Light Dose und nahm einen tiefen Zug. Dann stellte er die Tasche von Berlin Bags, die er für seine Tochter gekauft hatte, vor sich auf den Tisch und starrte sie an. Würde ihr das Ding überhaupt gefallen? Wahrscheinlich nicht, er hatte keine Ahnung, wer sie war, und wusste null über ihren Geschmack. Sicher würde sie das Design der Tasche bescheuert finden. Es war Schwachsinn von ihm gewesen, das Ding zu kaufen. Wahrscheinlich würde er sich nicht trauen, ihr das Ding zu geben.
Er griff, ohne hinzusehen, nach der Cola Light Dose neben sich und verfehlte sie. Verwundert drehte er seinen Kopf Richtung Dose, konnte aber ihre Position nicht mehr deutlich erkennen. Stattdessen tanzte eine Reihe von Nachbildern der Berlin Bag mit ihrem »Stars and Stripes«-Design mit einem großen, grünen Apfel vor seinen Augen. Maßlose Panik erfasste ihn. In Todesangst tastete er mit beiden Händen nach der Dose. Er schaffte es, sie zu greifen, und untersuchte sie. Es musste irgendetwas in der Dose gewesen sein, das für seine plötzlichen Sehstörungen verantwortlich war. Er versuchte, sie mit aller Kraft zu fixieren, um festzustellen, ob sie manipuliert worden war, aber er schaffte es nicht mehr. Sein Sehvermögen nahm mit extremer Geschwindigkeit ab. Mit einem Schlag war ihm klar, dass seine Vermutungen doch richtig gewesen waren. Er suchte nach dem Telefon, um Hilfe zu rufen, konnte es aber nicht finden. Er tastete nach dem Handy in seiner Tasche und wollte einen Notruf absetzen, aber er konnte die Tasten nicht mehr erkennen. Es wurde langsam dunkel vor seinen Augen. Zugleich konnte er sich nicht mehr bewegen. Ich habe doch recht gehabt, dachte er in all dem Wirrwarr. Aber zu spät, ich hätte es früher versuchen sollen. War das sein Ende? Konnte das sein Ende sein? Wie grotesk!
9
Es klopfte, dreimal, dann Stille, zwanzig Sekunden, dreißig Sekunden, dann Antjes Stimme hinter der Tür: »Sarah, beeil dich, wir schaffen das sonst nicht mehr.«
Sie antwortete nicht.
»Sarah, mach keinen Blödsinn!« Antjes Stimme klang streng.
Scheiße, sie hätte nie zusagen dürfen. Jetzt hatte sie Antje am Arsch.
»In fünf Minuten sind wir unterwegs, sonst gibt’s Ärger!« Antje würde nicht lockerlassen, das war klar. Sie hatte keine Chance. Also kapitulierte sie, stand auf und zog ihren Mantel an.
Als sie die Tür aufmachte, starrte Antje sie entgeistert an. »Wie siehst du denn aus? Völlig verschmiert, hast du geflennt?«
»Ne, ich schmink mich unterwegs, ich hab alles dabei.« Sie klopfte auf ihre Handtasche.
»Wenn wir Glück haben, schaffen wir es noch, also mach!« Antje drehte sich mit einem Ruck um und ging voraus zum Parkplatz. Sarah trödelte hinterher.
Antje wirkte wie eine Powerfrau, wie jemand, den nichts umhaut, frech und burschikos mit jeder Menge Chuzpe. In Wirklichkeit war sie aber ein Sensibelchen erster Ordnung und konnte wunderschöne abstrakte Bilder malen. Bevor die Krankheit bei ihr ausbrach, war sie Schwimmerin gewesen, hatte richtig trainiert, für den Olympiakader. Aber dann war mit einem Mal alles vorbei. Einen Rest der Muskeln hatte sie immer noch.
Sie wartete am Auto auf Sarah, die provokant langsam ging und sich beim Einsteigen alle Zeit der Welt ließ.
»Verdammt, reiß dich jetzt zusammen!« Antje knallte die Tür des knallgelben Twingo zu, drehte den Zündschlüssel um und schaltete den CD-Spieler ein. Robbie Williams brüllte auf voller Lautstärke »I got so much love…«. Die Soundanlage in dem kleinen Auto war gigantisch, der ganze Kofferraum war voller Boxen. Die Bässe fuhren Sarah direkt in den Bauch. Ihr wurde schlecht. Wenn sie noch was im Magen gehabt hätte, hätte sie sofort aufs Armaturenbrett gekotzt.
Die Fahrt über die Serpentinen Richtung Autobahn war die Hölle. Antje nahm nicht die geringste Rücksicht. Sie fuhr, als ginge es darum, eine Bergrallye zu gewinnen. Erst als sie endlich auf der Autobahn nach Zürich waren, konnte Sarah wieder aufatmen. Aber kaum hatte sie sich entspannt im Sitz zurückgelehnt, klingelte ihr Telefon. Sie fummelte das Ding aus ihrer Tasche und klappte es auf. Es war ihre Mutter.
»Ja?« Sie hörte, wie ihre Mutter am anderen Ende der Leitung einen tiefen Lungenzug nahm und den Rauch mit großem Druck energisch wieder ausstieß.
»Warum hast du nicht angerufen?« Sarah spürte den Vorwurf in der Stimme ihrer Mutter und hatte plötzlich einen Kloß im Hals. Das hatte ihre Ma drauf, sie beherrschte den tödlichen Einsatz von Nuancen. Dünn wie eine aufs Extrem geschliffene Klinge und genauso gefährlich.
»Ich war bis jetzt mit Antje draußen unterwegs …« Antje sah sie mit einem strengen Blick von der Seite an und zeigte ihr damit, dass sie diese Lüge scheiße fand.
»Sonst hast du immer Samstagnachmittag angerufen.« Der Vorwurf wurde stärker.
»Ich hab grade an dich gedacht und wollte grad anrufen«, log Sarah weiter.
»Und was ist mit Berlin?«
»Wie meinst du das, was ist mit Berlin?«
»Es war ein Brief im Briefkasten, an dich, von der Universität Berlin.«
»Na und.«
»Du hast dir Einschreibungsunterlagen schicken lassen.« Sarah schnürte es den Hals zu.
»Wie kommst du dazu, den Brief einfach aufzumachen!?«
»Du bist seit Wochen weg und ich dachte, es ist etwas Wichtiges! Also hab ich ihn aufgemacht, was ist dabei? Außerdem hab ich recht gehabt. Du musst die Unterlagen bis übernächste Woche einreichen, sonst ist es zu spät!«
»Scheiße, ich find das scheiße, dass du einfach meine Post aufmachst.« Sarahs Mutter gab keine Antwort und fing stattdessen, wie es oft ihre Art war, ein neues Thema an.
»Was machst du grade?«
»Ich bin auf dem Weg nach Zürich.«
»Wo trefft ihr euch?« Die Lungenzüge waren jetzt kürzer und irgendwie fahriger. Sarah konnte die Nervosität ihrer Mutter spüren.
»In irgendeinem Hotel.« Während sie es aussprach, kam ihr der Satz auf eine verdrehte Art verfänglich vor und sie fügte schnell hinzu: »In der Lobby.«
»Lass dich nicht von ihm um den Finger wickeln. Er kann sehr charmant sein, auf den ersten Blick.«
Sarah wusste nicht, was sie darauf sagen sollte, und dachte nach, was dieser Satz wohl zu bedeuten hatte. Sie verlor den Gedanken aber irgendwo im Nichts und konzentrierte sich auf den Atem ihrer Mutter in dem winzigen Lautsprecher an ihrem Ohr.
»Ich will nur verhindern, dass er dir wehtut, Liebes, so wie er mir wehgetan hat, du darfst mich nicht falsch verstehen«, setzte ihre Mutter hinzu.
»Ich versteh dich doch. Ich will ihn mir ja auch nur mal anschauen, damit ich einen Schlussstrich unter das Ganze ziehen kann, was ist denn dabei, wenn ich mir meinen Vater mal anschaue?« Das Wort »Vater« aus ihrem Mund kam ihr extrem seltsam vor, extrem.
»Ich weiß nicht, ob das gut für dich ist. Ich war so froh, dass endlich alles vergessen war, und jetzt fängt alles wieder an. Er hat sich nie um dich gekümmert, die letzten zwanzig Jahre, es war ihm scheißegal, ob es dir gut geht oder schlecht. Und jetzt wo er glaubt, es wäre doch vielleicht nett, eine erwachsene Tochter zu haben, kommt er angekrochen, und du lässt dich auch noch darauf ein. Ich versteh dich nicht. Wir haben es doch schön gehabt, wir beide.«
»Aber Mum, ich will doch nur sehen, wie er ist.«
»Warum tust du mir das an? Ich hab dich gebeten, nicht hinzugehen. Dieses Schwein hat mir so wehgetan.«
»Hey, Mum, ich will ihn mir nur kurz anschauen, nichts weiter.«
»Und warum hast du dir die Unterlagen aus Berlin schicken lassen? Ich dachte es war abgemacht, dass du dein Studium hier fertig machst?«
»Ja, ich weiß, aber ich hab hier eine neue Freundin gefunden, die hat mir ein Zimmer in ihrer Wohnung in Berlin angeboten, wenn ich dort studieren will.« Antje sah sie überrascht an und quittierte diese Lüge mit einem Stirnrunzeln. Davon hörte sie jetzt zum ersten Mal.
»Du willst nach Berlin, weil er dort wohnt. Er hat dir das in den Kopf gesetzt, um dich von mir wegzuziehen. Was hast du mit ihm ausgemacht?«
»Ich hab nichts mit ihm ausgemacht, gar nichts, ich will einfach mal in einer anderen Stadt studieren. Das muss nicht Berlin sein. Ich könnte genauso gut nach Wien gehen oder Hamburg. Ich will einfach mal was anderes kennenlernen, was Neues ausprobieren.«
»Und ich dachte immer, du wärst gern hier. Aber bitte, tu, was du nicht lassen kannst.« Es knackte im Telefon. Ihre Mutter hatte aufgelegt. Sarah ließ das Telefon mit einem Seufzer in ihren Schoß sinken und starrte vor sich hin.
»Warum hast du gelogen? Du hättest ihr einfach die Wahrheit sagen sollen.« Antjes Stimme war klar und direkt, ohne jeden Vorwurf.
»Hab ich doch. Ich hab ihr doch gesagt, dass ich mal was anderes kennenlernen will.«
»Ja, aber du hast um den Brei rumgeredet. Du hast ihr nicht gesagt, dass du dein eigenes Leben leben willst. Dass du es satt hast, wenn sie dich unter Druck setzt. Die ganzen letzten Wochen hier waren für den Arsch. Du bist immer noch zu feig, deiner Mutter zu sagen, was Sache ist!«
»Ja, okay, aber ich kann das einfach nicht. Wenn ich mit ihr rede, kann ich das einfach nicht.«
»Das mit dem Zimmer in Berlin war auch gelogen?«
»Ja. Ich hab mir einfach Unterlagen von verschiedenen Universitäten schicken lassen. Ich will einfach mal raus und was anderes probieren. Und in Berlin gibt es eine sehr gute Fakultät für Biologie. Konnte ich denn ahnen, dass meine Mutter meine Briefe liest, wenn ich nicht da bin?«
Antje dachte einen Moment über das nach, was Sarah gesagt hatte, dann beschloss sie das Thema zu wechseln. »Apropos Biologie… sollen wir später noch zusammen um die Häuser ziehen, ich hab´n frisches Höschen an und würd gern wieder mal die Wirkung meiner Silikontitten am lebenden Objekt testen.«
»Beckenbauer! Schau’n wir mal. Kommt drauf an, wie ich danach drauf bin.«
10
Der Anruf erreichte ihn zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt. Paul war gerade dabei, die Kamera über dem Cortex des Affen zu positionieren, als der Rufton des Handys ihn zusammenzucken ließ. Dieser spezielle Rufton, der ihm sofort signalisierte, dass sein Vater in Schwierigkeiten war. Trotzdem zwang er sich, ruhig zu bleiben, stellte das Telefon auf stumm und führte die Einstellung der Kamera zu Ende. Erst als er die Kamera fixiert und die Position noch einmal kontrolliert hatte, überließ er das weitere Setup des Experiments seinem Assistenten und verließ den Raum.
Er wollte auf keinen Fall riskieren, dass das Experiment floppte und sie die Ergebnisse in die Tonne klopfen mussten. Dazu hatte er zu viel Respekt vor den Leiden der Versuchstiere, die ihm bei Experimenten in vivo, also am lebenden Versuchstier, so deutlich wurden. Gott sei Dank musste er den Schädel nicht selbst öffnen und den Stahlkranzträger fixieren, diese art Dornenkrone, die zum Justieren der Apparate gebraucht wurde. Das war Job der Neurochirurgen, die ihm den Affen für das Experiment anlieferten.
Trotzdem arbeitete er lieber mit Schnittpräparaten, dabei hatte er weniger das Gefühl, ein Tier zu missbrauchen, obwohl das natürlich nicht stimmte, Tiere mussten sterben, um an diese Präparate zu kommen, da führte kein Weg dran vorbei, das war mit ein Fluch des Strebens nach Erkenntnis. Und wenn er an die immense Zahl der Affengehirne dachte, die bis heute auf dem Weg der Erforschung des Gehirns geopfert, ja verstümmelt worden waren, wurde ihm übel.
Draußen im Gang machte er Stopp am Wasserautomaten, zog sich einen Becher, füllte ihn mit Wasser und ging trinkend eine Weile auf und ab. Er brauchte noch ein paar Minuten, bevor er in der Lage war, sich dem Problem zu stellen. Wie unangenehm ihm das alles auch war, es gab keine Chance, davor wegzulaufen, jedenfalls nicht für ihn. Mit dieser Erkenntnis drückte er die Ruftaste.
Sein Vater meldete sich mit einer vollkommen verzweifelt klingenden Stimme. Und diese Verzweiflung übertrug sich ohne Delay. Paul spürte, wie ein Kloß aus Mitleid in seinem Hals zu wachsen begann. Wie immer öfter in letzter Zeit hatte sein Vater sich auf dem Weg in sein Stammcafe verirrt und fand nicht mehr nach Hause zurück. Seine Worte waren konfus. Es war zu spüren, wie viel Kraft es ihn kostete, die Worte zu formen, mit denen er versuchte, auszudrücken, was los war. Er stammelte, und in diesem Stammeln drückte sich der ganze Schmerz aus, den er über seine eigene Hilflosigkeit empfand, den er darüber empfand, das jeder Tag ein bisschen mehr Abschied war, ein bisschen weiter in Richtung völlige Hilflosigkeit und Vergessen führte.
Die Situation traf Paul wie ein rostiges Messer, das sich langsam in seinen Bauch grub, langsam Zentimeter um Zentimeter hinein eiterte. Geduldig ließ er sich beschreiben, wo sein Vater war. Als ihm klar war, wo er ihn finden würde, schärfte er ihm wie einem kleinen Kind ein, dort auf ihn zu warten und auf keinen Fall wegzulaufen. Sein Vater schien ihn zu begreifen, aber redete so wirr, dass Paul noch Minuten brauchte, um ein Ende zu finden, das es ihm erlaubte aufzulegen.
Er ging ins Labor zurück, checkte noch einmal das Setup des Experiments und kontrollierte die ersten Ergebnisse. Dann überließ er alles Weitere seinen Assistenten und verließ das Institut.
Es war Rush Hour. Bis zu seinem Vater würde er bestimmt eine Ewigkeit brauchen. Er versuchte, trotzdem cool zu bleiben und die Ruhe im Auto zu genießen. Der Stop-und-Go Verkehr war auch eine Art Galgenfrist, bevor er wieder massiv mit der Krankheit seines Vaters konfrontiert werden würde.





























