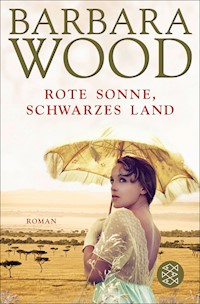9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Als die junge Archäologin Candice an das Sterbebett ihres Professors gerufen wird, fordert er sie auf, eine mysteriöse Keilschrifttafel zu retten. Candice macht sich mit dessen Sohn, Detective Glenn Masters, auf die Suche – eine Suche, die beide in höchste Gefahr bringt. Candice und Glenn geraten in die Fänge eines rätselhaften Geheimbundes, denen jedes Mittel recht ist, um ihre Ziele durchzusetzen. Candice und Glenn müssen der Spur der Flammen folgen, um eine Gefahr ungeheuren Ausmaßes zu bannen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 621
Ähnliche
Barbara Wood
Spur der Flammen
Roman
Roman
Aus dem Amerikanischen von Susanne Dickerhof-Kranz
Fischer e-books
Für meinen Mann, George, in Liebe
Erster Teil
Prolog
Alexandria, Ägypten390 n.Chr.
Obwohl sie sich kaum noch auf den Beinen halten konnte, hetzte die Priesterin durch den dunklen Geheimgang. Hinter ihr lauerte der Tod – bedrohte nicht nur sie, sondern auch alle anderen. Und die musste sie warnen.
Die Bibliothek stand in Flammen.
Die Priesterin strauchelte, schrammte mit der nackten Schulter an der rauen Wand entlang und wäre um ein Haar gestürzt. Aber sie fing sich wieder, rannte weiter, rang nach Luft. Selbst hier, aus sicherer Entfernung, spürte sie die Hitze, atmete den Brandgeruch ein. Würde sie die anderen noch rechtzeitig erreichen?
Während sich Philos das warme Öl von der Haut strich, sinnierte er darüber nach, welch glücklicher Fügung es zu verdanken war, das hinreißendste Geschöpf unter der Sonne für sich zu gewinnen. Artemisia würde dem naturgemäß widersprechen und vorbringen, dass ihr Gesicht zu rund und ihre Nase zu stumpf sei. Für den Hohepriester Philos jedenfalls war sie der Mond; ihre Ausstrahlung schlug jeden Mann unwillkürlich in Bann.
Sie hatten sich gerade geliebt, und jetzt entspannte sich Artemisia in dem parfümierten Wasser ihres privaten Bades. Anschließend würden sie, unabhängig voneinander, wieder in die Bibliothek gehen und sich ihren ernsten Pflichten widmen, ohne etwas von ihrer verbotenen Liebe preiszugeben.
Artemisia sah aus dem dampfenden Wasser zu ihm auf. Wenn Philos zu ihr ins Bett kam, nahm er stets seine Perücke ab. Wie alle Priester rasierte er sich den Schädel, was ihm das Aussehen eines Adlers verlieh, nicht zuletzt wegen seiner markanten Nase, die sie liebte. Philos war der bestaussehende Mann überhaupt. Und er gehörte ihr.
Wenn sie doch nur heiraten könnten!
Dem stand ein ehernes Gesetz entgegen. Bereits vor ihrer Geburt waren sie dem Dienst der Bibliothek und ihrer geheimen Mission geweiht worden. Als Kinder hatten sie das Gelübde der Keuschheit abgelegt, leichtfertig – was wusste ein Kind schon von körperlicher Liebe? Sollte ihre unzulässige Beziehung entdeckt werden, würde man sie aus der Priesterschaft ausstoßen, von ihrer Familie trennen und in die Wüste jagen, um dort zugrunde zu gehen.
Urplötzlich fuhr Philos herum. Ein Geräusch an der Tür. Da kam jemand!
Auch sie hörte es. »Versteck dich!«, zischte sie ihm zu.
Zu spät. Die Tür ging auf. Eine Priesterin aus der Bibliothek stand dort, ihr weißes Gewand an den Schultern zerfetzt. Nacktes Entsetzen stand ihr ins Gesicht geschrieben. Die Anwesenheit von Hohepriester Philos in Artemisias Gemächern nahm sie gar nicht wahr. »Die Bibliothek brennt!«
Jetzt rochen sie den Rauch, und als sie durch die Vorhänge in die Nacht spähten, sahen sie den goldenen Schimmer im Bereich der Bibliotheken. Eilends kleideten sie sich an und stürzten ins Freie.
Der Anblick, der sich ihnen bot, ließ sie erstarren. Prächtige Säulen, Bogen und Kuppeln standen in Flammen. Auf den Straßen drängten sich Menschen, rannten in die brennenden Gebäude hinein, schleppten Stühle, Tische und Bücher wieder heraus, häuften alles zu hohen Stößen auf und hielten Fackeln daran. Ein enthemmter Pöbel bemächtigte sich all dessen, was in und um die Bibliothek greifbar war, raffte Weinkaraffen, heilige Öle, goldene Lampen zusammen.
»Wir müssen ihnen Einhalt gebieten!«, schrie Artemisia, aber Philos hielt sie zurück. Ein furchtbares Bild bot sich ihnen. Priester und Priesterinnen wurden ins Freie gestoßen, und nachdem man ihnen die Gewänder heruntergerissen hatte, auf die Scheiterhaufen gezerrt.
»Wir müssen retten, was noch zu retten ist.« Philos nahm Artemisia bei der Hand und rannte mit ihr in Richtung Hafen, wo seit sechshundert Jahren hohe Wälle die Bibliothek gegen das Meer abschirmten. Hier kannten sie einen geheimen Zugang, und als sie sich durch den von Rauchschwaden durchzogenen Tunnel vorwärts kämpften, begegneten sie anderen Priestern und Priesterinnen, die beladen waren mit allem, was sie vor der aufrührerischen Meute hatten retten können. »Zu den Anlegestellen«, befahl Philos ihnen. »Nehmt mit, was ihr tragen könnt, aber bringt vor allem euch in Sicherheit.«
Philos und Artemisia kämpften sich ins Zentrum des Bibliothekskomplexes vor, ins Sanctum Sanctorum, wo die heiligsten Bücher aufbewahrt wurden. In größter Eile rafften sie die Schriftrollen zusammen und steckten sie unter ihre Gewänder, ohne sich um den erstickenden Qualm und die Hitze zu kümmern, die jenseits der Mauern immer glühender zu spüren war. Zusammen mit ihren Brüdern und Schwestern, die beladen waren mit allem kostbaren Gut, dessen sie habhaft werden konnten, hasteten sie auf den Hafen zu, wurden aber von einem nach Blut und Tod lechzenden Pöbel aufgehalten. »Heiden!«, schallte es ihnen entgegen. »Teufelsbrut!«
Einigen der Priester gelang es nicht, die Menschensperre zu durchbrechen. Die Aufständischen gingen mit Prügeln auf sie los, schlugen sie nieder und zerschmetterten ihnen die Schädel. Philos erkannte, dass es keine Chance mehr gab, zusammen mit Artemisia dieser Meute zu entkommen – nur wenn sie sich trennten, könnte sich vielleicht einer retten. »Geh!«, sagte er und drückte ihr seine Schriftrollen in die bereits voll bepackten Arme. »Nimm dies hier mit. Ich laufe da lang. Sie werden mich verfolgen.«
»Nicht ohne dich!« Tränen strömten ihr übers Gesicht.
»Liebste, die Bücher sind kostbarer als mein armseliges Leben. Wir werden dereinst im Licht wieder vereint sein.«
Artemisia eilte davon. Nur ein einziges Mal wandte sie sich um und musste sehen, wie sich der Pöbel auf den Geliebten stürzte und ihn über die Köpfe stemmte. Die Schreie, die an ihr Ohr gellten, kamen nicht von Philos, sondern von dem Haufen entfesselter Christen, die ihr Opfer zum Scheiterhaufen schleppten und es in die Flammen warfen.
Kapitel 1
Candice Armstrong war gerade im Begriff, die zweitgrößte Dummheit ihres Lebens zu begehen, als es mitten in der Nacht an ihre Tür klopfte.
Zunächst achtete sie nicht darauf. Ein Pazifiksturm peitschte über die Berge von Malibu und drohte die Elektrizität zum Erliegen zu bringen, bevor sie ihre E-Mail beenden konnte, die sie gerade wie besessen in ihren Computer hämmerte – eine verzweifelte Bitte um Hilfe, die noch gesendet werden musste, ehe der Strom ausfiel.
Und ehe aller Mut sie verließ.
Das Licht flackerte. Sie fluchte leise, dann hörte sie das Klopfen an der Tür. Lauter diesmal, beharrlich.
Candice sah auf die Uhr. Mitternacht. Wer mochte das um diese Stunde sein? Sie warf einen Blick auf Huffy, ihre fette Persianerkatze, die sich ungern bei ihrem Nickerchen stören ließ. Die Katze schlief unbeirrt.
Candice lauschte. Vielleicht hatte sie sich nur getäuscht. Bei dem Sturmgeheul, das ums Haus tobte, wäre es nicht verwunderlich gewesen.
Klopf klopf!
Sie spähte durch den Türspion. Da stand ein Mann auf ihrer Schwelle, dem der Regen nur so von den Schultern troff. Sein Gesicht vermochte sie unter dem breitkrempigen Hut, der an die altmodischen Filzhüte aus den vierziger Jahren erinnerte, nicht zu erkennen. Einen Trenchcoat trug der Mann auch. Wie Humphrey Bogart. »Ja bitte?«, sagte sie.
»Dr.Armstrong? Dr.Candice Armstrong?« Die Stimme hatte einen befehlenden Ton.
»Ja.«
Der Mann hielt einen Dienstausweis hoch. Los Angeles Police Department. Er sagte noch etwas – seinen Namen vermutlich –, das allerdings im Donnergrollen unterging. »Darf ich hereinkommen?«, rief er. »Es geht um Professor Masters.«
Candice zog erstaunt die Augenbrauen hoch. »Professor Masters?« Sie öffnete die Tür einen Spalt weit. Der hoch gewachsene Fremde vor ihr war vollkommen durchnässt.
»Wissen Sie eigentlich, dass Ihr Telefon nicht funktioniert?«
Sie zog die Tür ganz auf. »Das passiert hier jedes Mal, wenn es regnet. Kommen Sie herein, Officer. Was ist mit dem Professor?«
»Detective«, korrigierte sie der Fremde und trat über die Schwelle. Candice schlug rasch die Tür hinter ihm zu. »Sie waren schwer zu finden«, merkte der Mann noch an. Als ob er den ganzen Weg hier herauf gefahren sei, um ihr das zu sagen.
Seine Worte riefen ihr etwas in Erinnerung, das Paul, ihr letzter Freund, gesagt hatte, als sie ihre Beziehung beendeten. Sie wollte damals nicht mit ihm nach Phoenix ziehen und dort die Hausfrau spielen, während er seine Anwaltspraxis aufbaute. »Das hier ist kein Zuhause, Candice«, hatte Paul gesagt. »Das ist ein Schlupfwinkel.« Stimmte das? Aber wovor versteckte sie sich denn? Ihre beste Freundin Zora hatte sie gescholten, weil sie Paul ›vom Haken‹ gelassen hatte. Er sei doch ein guter Fang, wie sie meinte, als ob es sich bei ihm um eine Forelle handelte. Candice hatte es gar nicht darauf abgesehen, sich einen Mann ›zu angeln‹, und schon gar nicht, wenn dieser sagte: »Deine Karriere steht sowieso auf der Kippe, dann kannst du mich doch genauso gut heiraten.« Was sie suchte, waren Partnerschaft und eine liebevolle Beziehung. Doch die blieben ihr versagt. Sobald ein Mann merkte, dass nicht er im Mittelpunkt ihres Lebens stand, sondern ihr Beruf, verkrümelte er sich ziemlich rasch wieder. Nach einigen Erfahrungen dieser Art hatte Candice beschlossen, Männern insgesamt aus dem Weg zu gehen.
Insofern vermied sie es auch, den hoch gewachsenen Fremden allzu genau anzuschauen. »Was ist mit dem Professor? Wie geht es ihm? Ist er verletzt?«
Der Mann ließ den Blick durch die Blockhütte schweifen, als ob er eine Bestandsaufnahme des Inventars machen wollte – die ägyptische Statue, der Orientteppich, die Lederottomanen, die Kübelpalmen, die Bilder und Poster vom Nil und den Pyramiden. »Er hatte einen Unfall, Dr.Armstrong. Sein Zustand ist kritisch und er fragt nach Ihnen.« Candice konnte die Züge des Mannes im Schatten der Hutkrempe kaum erkennen, sie sah nur ein markantes Kinn und einen geschwungenen Mund.
»Warum fragt er nach mir?« Sie hatte seit über einem Jahr keinen Kontakt mehr zu dem Professor.
»Ich habe keine Ahnung. Da Ihr Telefon nicht funktioniert, wurde ich hier herauf geschickt, um Ihnen Bescheid zu geben.« Dieser Ton. Schwang da nicht ein leichter Missmut mit?
»Ich hole meine Tasche.«
Während der Polizist sich weiter umschaute, blieb sein Blick an dem großen Müsliriegel neben der Computertastatur hängen. Der Riegel war unberührt, ebenso wie der Becher Schokolade daneben. Ein Mitternachtssnack, der wegen einer eiligen Sache vergessen worden war. Einer E-Mail wegen, wie es aussah.
Die Autoschlüssel in der Hand und den Finger am Lichtschalter, drehte Candice sich an der Haustür noch einmal um und schaute unschlüssig auf den Computerbildschirm mit der E-Mail, die auf den »Senden«-Befehl wartete. Es war ein letzter verzweifelter Versuch, ihre berufliche Zukunft zu retten, indem sie den skandalösen Zwischenfall an Pharao Tetefs Grab aus ihrer Sicht schilderte. Nun gut. Sie würde die E-Mail später abschicken.
Als sie den rechten Vorderreifen ihres Wagens erblickte, seufzte sie laut auf. Ein Pfannkuchen konnte nicht platter sein, und es blieb keine Zeit, den Reifen zu wechseln.
»Ich fahre Sie hin«, grummelte der Polizist. Ein höchst unwilliges Angebot.
Während der Fahrt zum Krankenhaus im zehn Meilen entfernten Santa Monica gab er keine weiteren Erklärungen ab. Er trug immer noch den Hut, aber jetzt konnte Candice seine Züge besser erkennen. Sie schätzte ihn auf Ende dreißig, an beiden Mundwinkeln verliefen tiefe Falten. Die große Nase war gut geformt. Sein Profil erinnerte sie ein wenig an Pharao Thutmosis III. Nicht schlecht aussehend, dachte sie. Der Pharao.
Der Pacific Coast Highway glich einem Albtraum. Wasser spülte über alle vier Fahrspuren, Schlamm rutschte von den Hängen herab, Blitze zuckten über den nachtschwarzen Himmel. Man konnte nicht einmal die Brandung unten am Strand erkennen, und die wenigen Autos krochen nur im Schneckentempo voran.
Candices Gedanken drehten sich um Professor Masters. Wann hatten sie sich eigentlich das letzte Mal gesehen? Vor einem Jahr beim Lunch, als ihr gemeinsames König-Salomo-Projekt beendet war. Sie hatten zusammen gearbeitet, waren sogar Freunde geworden. Aber warum verlangte er jetzt, in dieser Situation, ausgerechnet nach ihr?
Sie beugte sich in ihrem Sitz vor, eine Bewegung voller Ungeduld.
Hin und wieder musterte der Polizist seine Beifahrerin unauffällig von der Seite. Sie schien nervös. Angespannt. In Gedanken versunken. Sie sprach kein Wort.
Für ihn war das ungewohnt. Achtzehn Jahre Polizeidienst hatten seine Sinne geschärft. Die meisten Menschen waren leicht einzuschätzen, bei den anderen brauchte es etwas länger. Candice Armstrong indes überraschte ihn. Eine rasante Fahrt durch die Nacht zu einem Krankenhaus, in dem ein Freund darnieder lag. Das führte gewöhnlich zu nervösem Geplapper. Einer Unzahl von Fragen. Zigaretten. Nur bei dieser Frau hier nicht. Sie hielt den Blick starr auf die Fahrbahn gerichtet, ohne etwas zu sehen. Die Konzentration nach innen gerichtet.
»Jericho«, sagte sie unvermittelt.
Der Polizist wandte kurz den Kopf. »Bitte?«
»Das erste Mal, als ich mit Professor Masters zusammengearbeitet habe, war in Jericho.«
Er blinzelte. Sie führte Selbstgespräche.
Ihre Stimme hatte ihn überrascht. Sie besaß ein tiefes Timbre, klang fest und reif zugleich mit einem Anflug, der ihn unwillkürlich an Eis mit heißer Karamellsauce denken ließ.
»Was ist dem Professor zugestoßen?«, wollte sie wissen. »War es ein Autounfall?«
»Er ist eine Treppe hinuntergestürzt.«
Candice sah ihn ungläubig an. Professor Masters war eine Treppe hinuntergestürzt? »Das hätte sein Tod sein können«, bemerkte sie in Gedanken daran, dass ihr früherer Mentor an die siebzig sein musste.
»Sein Zustand ist kritisch.«
Ein erneutes Donnergrollen, wieder zuckten Blitze über den Himmel. Die mitternächtliche Stunde bekam eine surreale Aura. Nicht sterben, Professor.
Und dann fuhren sie schon vom Highway ab, kurvten über eine Anhöhe und rasten einen Augenblick später den Wilshire Boulevard hinunter, bis vor ihnen die Leuchtschrift KRANKENHAUS NOTAUFNAHME auftauchte.
Der Polizist bog auf den Parkplatz ein. Candice hatte erwartet, dass er sie lediglich absetzen würde, aber er stellte den Wagen in der rot markierten Parkzone ab, führte sie durch eine Doppelschwingtür zu einem Fahrstuhl und drückte auf VIER. Die grelle Neonbeleuchtung enthüllte Fältchen in den Augenwinkeln des Fremden und blondes Nackenhaar unter dem Hut, den er immer noch nicht abgenommen hatte. Zu ihrem Erstaunen bemerkte Candice unter dem Trenchcoat eine Anzugjacke, ein weißes Hemd mit gestärktem Kragen und eine penibel geknotete Krawatte aus blauer Seide. War er von einer Abendgesellschaft abberufen worden?
Zu Candices Erstaunen drängten sich vor der Intensivstation keinerlei Freunde oder Angehörige. Bis auf einen Mann, der sich am Wasserautomaten bediente, lag der Krankenhausflur verlassen da. »Wurde denn niemand benachrichtigt?«, fragte Candice, als sie sich auf der Pflegestation meldete.
»Nur Sie«, erklärte die Schwester und führte Candice zu einem der Betten im grünlichen Licht der Monitore.
Beim Anblick ihres alten Mentors auf den weißen Laken schossen Candice die Tränen in die Augen – der Verband um seinen knochigen Kopf, die Braunüle in seinem Handrücken, der Sauerstoffschlauch in seiner Nase, das Piepsen des Herzmonitors. Das Gesicht des Professors war erschreckend blass. Er sah aus wie eine Mumie.
Candice betrachtete seine Hände, blau angelaufen, wo die Braunüle steckte, und eine Erinnerung stieg in ihr auf, wie diese feingliedrigen Hände an einem alten Papyrus arbeiteten, der in tausend winzige Fragmente zerfallen war. Stunden hatte der Professor damit zugebracht, sie zusammenzufügen. Manchmal brauchte er zwei Wochen, um zwei ausgefranste Fitzelchen zu verbinden. Sie sah ihn vor sich, wie er in mühevoller Kleinarbeit mit der Pinzette ein vergilbtes Teil an das andere legte, jedes mit schwarzen Schnörkeln darauf. »Schauen Sie, Candice«, hatte er ihr bedeutet. »Denken Sie an Ihr Alephbet. Und jetzt passen Sie auf.« Der Professor bezeichnete die zweiundzwanzig Buchstaben der alten hebräischen Schrift als Alephbet, um es vom heutigen Alphabet zu unterscheiden. Sein Leben lang hatte er sich mit der Entwicklung der frühesten Schriftzeichen zu einem verständlichen Buchstabensystem beschäftigt und war somit einer der wenigen Wissenschaftler weltweit, die das alte Hebräisch wie die Morgenzeitung lesen konnten.
Eine dieser Hände nahm Candice nun in die ihren und betete inbrünstig, dass sie in künftigen Jahren noch viele alte Papyri rekonstruieren mögen. Die Lider des alten Mannes flatterten. Ein Moment der Verwirrung, dann das Erkennen. »Candice … Sie sind da …«
»Schhh … Professor, schonen Sie Ihre Kräfte. Ja, ich bin da.«
Sein Blick wanderte unruhig hin und her, seine Atmung wurde flacher. Die kalten Finger klammerten sich um ihre Hand. »Candice … Helfen Sie mir …« Sie beugte sich über ihn, um ihn besser zu verstehen.
Der Polizist hatte sich neben einem der Rollwagen, beladen mit medizinischem Gerät, niedergelassen, von wo er den Professor und seine Besucherin im Auge behalten konnte. Er dachte an die Stunden direkt nach der Einlieferung des Professors. Die Krankenschwester hatte vergeblich versucht, Candice Armstrong telefonisch zu erreichen, und ihre Handynummer war nicht registriert. Der alte Mann jedoch, verwirrt und aufgeregt, hatte darauf bestanden, dass man nach ihr schickte, dem Pflegepersonal zugesetzt, bevor er erneut das Bewusstsein verlor. Der behandelnde Arzt diagnostizierte: »Schädeltrauma … möglicherweise subdurales Hämatom. Wir müssen ihn erst stabilisieren …« Er konnte nur hoffen, dass vielleicht diese Candice Armstrong den alten Mann beruhigen könnte.
Sie hatten ihre Adresse in der Brieftasche des Professors gefunden, sie wohnte in den Bergen von Malibu. Da es sich um einen Notfall handelte, hatte sich der Polizist erboten, sie trotz des Sturms aufzusuchen. Er war darauf vorbereitet gewesen, so lange an eine Tür zu hämmern, bis die Lichter angingen. Stattdessen war sie noch wach gewesen und hatte sofort geöffnet. In angespannter Aufmerksamkeit.
Davon war jetzt nichts mehr zu spüren. Beschwichtigend und geradezu anmutig beugte sie sich über den alten Mann.
Sie musste in den Dreißigern sein, trug eine beige Wollhose mit cremefarbener Seidenbluse, am Hals mit einer altrosa Kamee verschlossen, am Handgelenk eine feine goldene Armbanduhr – sehr weiblich, dachte der Polizist bei sich, und nicht gerade typisch für eine Frau, die in Dreck und Trümmern hantierte. Ihr langes braunes Haar wurde durch eine keltische Spange zurückgehalten, doch ein paar Strähnen hatten sich gelöst und fielen ihr ins Gesicht. Er fand sie eigenartig attraktiv, aber er war schließlich kein Experte.
Ihre Stimme jedoch war einmalig. Weich wie schwerer brauner Honig und doch ein wenig rau.
Candice merkte nichts von den forschenden Blicken des Polizisten. Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Professor gerichtet, beugte sie sich noch tiefer zu ihm hinunter, um seine mühsam artikulierten Worte zu verstehen.
»Mein Haus …«, flüsterte er. »Gehen Sie hin, Candice. Dringend. Bevor … bevor …«
»Alles wird gut, Professor. Keine Sorge. Sie müssen sich beruhigen. Es wird alles gut.«
Aber er wurde immer aufgeregter. »Pandora. Mein Haus.«
»Pandora? Ist das Ihre Katze? Ihr Hund? Soll ich sie füttern? Professor, soll ich jemanden anrufen? Einen Angehörigen? Jemanden von der Universität?«
Sein Kopf schwankte hin und her. »Nein. Nur Sie. Gehen Sie.« Er schloss die Augen. Seine Stirn furchte sich aus Schmerz oder Verzweiflung, Candice wusste es nicht zu sagen. »Der Stern von Babylon …«, flüsterte er.
»Der was?«
Seine Augen blieben geschlossen.
»Professor Masters?«
Er brachte noch drei Worte heraus. »Pandora. Der Schlüssel …« Dann verlor er das Bewusstsein.
Als Candice neben dem Polizisten die Intensivstation verließ, fühlte sie sich elend. Der Professor hatte so klein und verletzlich gewirkt. Vor sieben Jahren noch, als sie beide in Israel zusammen arbeiteten, war er stark wie ein Fels gewesen.
Im Fahrstuhl suchte Candice in der Tasche nach ihrem Handy. »Hoffentlich bekomme ich um diese Zeit noch ein Taxi«, murmelte sie, während sie die Auskunft wählte.
»Ich fahre Sie nach Hause.«
»Ich will nicht nach Hause. Ich muss erst zum Haus des Professors. Ich glaube, ich soll mich um ein Haustier kümmern.«
»Ich fahre Sie.« Wieder so ein halbherziges Angebot, aber sie akzeptierte es.
Sie rannten durch den strömenden Regen über den Parkplatz.
»Bluebell Lane in Westwood«, sagte sie, als sie in den Wagen einstiegen. »Ich weiß die Hausnummer nicht, aber ich werde das Haus wieder erkennen.«
Es lag in einer der besseren Gegenden von West Los Angeles. Eine lange Auffahrt führte zu dem großen, im Tudorstil gehaltenen Gebäude, das von sauber gestutzten Hecken, Rosensträuchern und penibel gepflegtem Rasen umgeben war. Das Haus lag im Dunkeln. Candice sprang aus dem Wagen und rannte durch den Regen davon.
Als der Polizist sie an der Haustür einholte, suchte sie bereits fieberhaft in Pflanzenkübeln und unter der Fußmatte nach dem Schlüssel. »Er hatte etwas von einem Schlüssel gemurmelt. Ich kann ihn aber nicht finden.«
Es gab keinen Schlüssel, aber wie sich herausstellte, war die Haustür nicht verschlossen.
Als sie in der unbeleuchteten Halle standen, rief Candice: »Hallo, Miezekatze. Pandora? Pandora? Hallo?«
Sie lauschte auf ein begrüßendes Miau, auf das leise Tappen von Pfoten auf einem Marmorboden. Aber da war nichts als Stille, die gelegentlich von einem Donnergrollen durchbrochen wurde.
Sie wagte sich weiter ins Innere des Hauses vor. Schaute in dunkle Räume, spähte in schattige Korridore, fühlte sich wie ein Eindringling, während sie unverdrossen »Pandora!« rief. »Pandora! Hier Miezekatze!« Erneut stiegen Erinnerungsfetzen in ihr auf: die Tage bei dem Salomo-Projekt, das Aroma von des Professors Pfeifentabak, seine melodische Stimme, mit der er so weise von lang vergangenen Kulturen sprach. Sie betete insgeheim, dass es ihm bald wieder gut gehen möge. Nach Aussage der Krankenschwester war die Haushälterin anwesend gewesen, als er den verhängnisvollen Sturz tat. Anderenfalls, du lieber Himmel …
Während sie wieder in der rotundenartigen Halle stand, die Hände in die Hüften gestemmt, und sich fragte, wie weit sie überhaupt in dieses Haus vordringen durfte, glaubte sie, ein unterdrücktes Gemurmel zu vernehmen. Als sie bemerkte, dass der Polizist nicht mehr an ihrer Seite war, ging sie zum Fuß der Treppe und schaute hinauf. Da oben, im Schatten, sah sie ihn stehen. Zu ihrer Überraschung sprach er in sein Handy.
Sie konnte nichts verstehen, fragte sich aber, warum er da oben stand. Wonach suchte er?
Aus dem Wohnzimmer fiel ein schwacher Lichtschein.
Candice näherte sich der offen stehenden Tür und fühlte sich instinktiv von dem Bild angezogen, das über dem Kaminsims hing. Im klassischen Stil eines Ingres oder David gemalt, stellte es Pandora dar, nach der griechischen Mythologie eine Erdgöttin, erhaben und gertenschlank, in einem fließenden Gewand, die mit einer wehmütigen Geste auf das Gefäß deutete, das Zeus ihr mitgegeben hatte.
Candice reckte sich hoch und schob vorsichtig das Bild zur Seite.
Nein, dahinter war kein Schlüssel verborgen, auch kein Safe, der einen Schlüssel versteckt halten konnte.
Sie richtete das Bild wieder gerade und trat einige Schritte zurück, um es zu betrachten. Das musste die Pandora sein, von der der Professor gesprochen hatte. Sie konnte sich auch nicht erinnern, dass er während ihrer Zusammenarbeit irgendwelche Haustiere erwähnt hätte.
Da bemerkte Candice den ausgestreckten Arm der Pandora. Obwohl sie auf das Gefäß deutete, das Zeus ihr mitgegeben hatte, ein Gefäß, worin alle Übel der Welt enthalten waren, konnte der blasse Fingerzeig auch so interpretiert werden, dass er aus der Leinwand und über den rechten Rahmen hinaus auf eine kunstvoll gefertigte Holzkiste auf einem Marmorsims verwies. Candice erkannte darin den Zigarrenhumidor, den der Professor auf Reisen stets bei sich zu tragen pflegte. Vor dieser Wand wirkte er irgendwie deplatziert.
Sie hob den Deckel. Ihre Augen wurden groß. Der Humidor enthielt keine Zigarren, nur ein altes Buch.
Als sie Schritte hinter sich vernahm, holte Candice rasch das Buch heraus und hielt es dem Polizisten hin. »Ich glaube, das ist es, wonach der Professor verlangt hat.« Sie deutete auf das Bild.
»Pandora hat mir den Weg gewiesen.«
Er sagte nichts dazu, und während sie im Schatten stand, und die Blitze den Raum mit all seinen Antiquitäten und antiken Schätzen erhellten, fragte sie: »Kann ich das mitnehmen? Ich bringe es morgen früh gleich dem Professor. Soll ich eine Quittung unterschreiben?«
»Ich vertraue Ihnen auch so«, meinte der Polizist.
Während sie die Haustür verriegelten und in den schwarzen Regen blickten, fragte Candice: »Was haben Sie da oben auf dem Treppenabsatz gemacht? Haben Sie etwas herausgefunden?«
Er hielt den Blick geradeaus in die Sturmnacht gerichtet. »Ich habe nur noch einmal auf dem Teppich nachgesehen, wo er gestolpert ist.«
»Ich dachte, ich hörte Sie mit jemandem telefonieren.«
»Mit dem Ehemann der Haushälterin. Sie hatte die Ambulanz angerufen. Ich wollte sie sprechen, aber sie hat ein Beruhigungsmittel bekommen.«
Candice sah ihn nachdenklich an. Seine Kinnmuskeln spielten, seine Stimme hatte einen härteren Klang. Da durchfuhr sie ein alarmierender Gedanke. »Es war kein Unfall, nicht wahr? Wurde deswegen ein Detective mit dem Fall betraut?«
»Ich wurde nicht mit dem Fall betraut. Und es war ein Unfall.«
»Aber warum wurde ein Polizist ausgeschickt, mich zu holen?«
Endlich sah er sie mit seinen umschatteten Augen an. »Ich dachte, Sie wüssten es. John Masters ist mein Vater.«
Kapitel 2
Das Klingeln des Telefons weckte sie.
Im Dämmerlicht des frühen Morgens spähte Candice auf die Uhr. Zu früh für den Anruf aus San Francisco, den sie so sehnlich erwartete, und der ihr bestätigen würde, dass sie den Auftrag in der Tasche hatte und ihre berufliche Zukunft gesichert war.
Sie strich sich das Haar aus der Stirn und griff nach dem Hörer.
»Hallo?«
Schweigen.
»Hallo? Wer ist denn da?«
Klick.
Einen Moment lang starrte sie den Hörer an, dann war sie hellwach. Über die Auskunft holte sie die Telefonnummer des Krankenhauses ein, ließ sich mit der Intensivstation verbinden und erkundigte sich nach dem Befinden des Professors. Insgeheim beschwor sie alle guten Mächte, dass es dem alten Mann schon besser ginge und er bereits mit den Schwestern flirtete. Ein brillanter Kopf, der die Grundlagen religiösen Glaubens wissenschaftlich erforschte, ein genialer Verstand, der noch zwanzig produktive Jahre vor sich hatte, von einer Falte im Teppich zu Fall gebracht!
Sein Zustand war unverändert kritisch. »Wenn er wieder bei Bewusstsein ist«, bat sie die Pflegeschwester, »richten Sie ihm bitte aus, dass Candice Armstrong ihn heute Morgen besuchen kommt.«
»Schon wieder?«
»Was meinen Sie damit, ›schon wieder‹?«
»Sie waren erst vor wenigen Minuten hier, Miss Armstrong.«
»War ich nicht.«
»Aber Sie haben sich in die Besucherliste eingetragen. Ich habe Ihre Unterschrift vor mir liegen.«
Candice rieb sich die Augen. Wahrscheinlich war das noch die Liste von letzter Nacht, die man nicht ausgetauscht hatte. Sie bedankte sich bei der Schwester und legte auf.
Während sie sich unter der heißen Dusche mit Avocado-Gel und Shampoo einschäumte, wanderten ihre Gedanken zu dem zurück, was der Polizist vergangene Nacht im strömenden Regen gesagt hatte. »John Masters ist mein Vater.«
Er hatte noch einmal seinen Dienstausweis gezückt, und diesmal konnte Candice es deutlich lesen: Detective Lieutenant Glenn Masters.
Als er da vom Regen durchnässt, immer noch in Trench und Hut, so vor ihr stand, empfand sie, dass er eher einem Kriminalbeamten am Tatort glich als einem Mann, der in das Haus seiner Kindheit zurückgekehrt war. Zumindest nahm Candice an, dass er hier aufgewachsen war. Sie wusste, dass der Professor seit fünfzig Jahren in diesem Haus lebte; er hatte sich oft genug damit gebrüstet, es von einem Stummfilmstar gekauft zu haben, der seiner Meinung nach immer noch darin herumspukte. »Tut mir Leid«, hatte sie eingelenkt. »Das muss hart für Sie sein. Ich hatte kein Recht, Sie von der Seite Ihres Vaters zu reißen.«
Als er den Ausweis wortlos wieder einsteckte, hatte sie noch gemurmelt: »Ich wusste gar nicht, dass der Professor einen Sohn hat.« Verwundert rief sie sich die lange Zeit in Erinnerung, die sie an der Seite des Professors in Israel verbracht hatte, die Monate und Stunden, die sie dem Salomo-Projekt gewidmet, in denen sie oftmals über private Dinge gesprochen hatten. Doch nie war ein Wort über seinen Sohn gefallen.
Sie waren schweigend zurückgefahren, und als sie vor ihrem Blockhaus anhielten, hatte Candice gefragt: »Detective Masters, Ihr Vater erwähnte einen Stern von Babylon. Haben Sie eine Ahnung, worum es sich dabei handeln könnte?«
»Nein.«
Das alte, ledergebundene Buch in ihrer Schultertasche war ihr wieder eingefallen. Sie hatte es hervorgeholt, vergilbt und zerlesen, mit französischem Titel. »Möchten Sie es ihm nicht bringen? Es schien ihm sehr wichtig zu sein. Er könnte in der Nacht aufwachen, und wenn er das Buch sieht …«
»Sie bringen es ihm. Er hat nach Ihnen verlangt.«
Auf ihren verwunderten Gesichtsausdruck hin hatte er sich zu einer Erklärung bequemt. »Mein Vater und ich haben seit Jahren keinen Kontakt mehr. Als er ins Krankenhaus gebracht wurde, war es nicht die Schwester, die mich angerufen hat, sondern seine Haushälterin. Mein Vater wusste nichts davon. Er wusste nicht einmal, dass ich da war. Als er das Bewusstsein wiedererlangte, verlangte er nach nur einem Menschen: nach Ihnen.« Keine Verbitterung, kein Groll klang in seiner Stimme. Lediglich die Feststellung einer Tatsache.
Dennoch spürte sie jetzt ein schlechtes Gewissen, als ob man ihr die Schuld daran geben könnte, dass ihr Vater nach ihr und nicht nach seinem Sohn verlangt hatte. Insbesondere, da der Professor Witwer war. Wie Candice sich erinnerte, war seine Frau, die Mutter des Detective, vor langer Zeit verstorben.
Bevor er davonfuhr, hatte Glenn Masters noch angeboten, ihren platten Reifen zu wechseln, doch sie hatte abgewunken. Sobald der Regen aufhörte, würde sie den Reifen eigenhändig wechseln, sie hatte keine Garage und pflegte deshalb ihren Wagen unter einer alten Eiche zu parken.
Während sie sich nun im hellen Morgenlicht mit einem Handtuch die Haare trocknete, dachte sie: Merkwürdig, die beiden Männer leben in derselben Stadt und wechseln kein Wort miteinander. Was musste geschehen sein, um eine so tiefe Kluft zwischen ihnen aufzureißen?
Sie zog ihre Jeans an und streifte sich eine rosafarbene Seidenbluse über, einst das Geschenk von einem Börsenmakler, der sie umworben hatte. In Gedanken versunken ging sie in die Küche, wo sie Huffy ihre Frühstücksbrekkies vorsetzte, die diese mit lautem Schnurren begrüßte. Für sich selber bereitete sie einen Instant-Kaffee und nahm das Buch zur Hand, das sie im Haus des Professors gefunden hatte.
Découvertes mésopotamiennes, von Pierre Duchesne, herausgegeben 1840 in Paris. Von immenser Wichtigkeit für Professor Masters, da es ihm keine Ruhe ließ, während er in kritischem Zustand in einem Krankenhausbett lag.
Jemandem, der Professor Masters nicht kannte, mochte es merkwürdig vorkommen, dass das Buch in einem Humidor versteckt war und der einzige Fingerzeig auf sein Versteck von der Figur auf einem Gemälde kam, die geradewegs darauf hinwies. Für Eingeweihte jedoch war gerade dies Anzeichen genug, dass das Buch zu einem äußerst wichtigen und geheimen Projekt gehörte. Wann immer der Professor an einer neuen Theorie arbeitete, trieb ihn stets die Angst um, akademische oder andere Rivalen könnten sein Wissen stehlen; und es war bekannt, dass er seine Notizen und Forschungsergebnisse an den seltsamsten Plätzen in seinem Haus verbarg. Bei ihrem gemeinsamen Salomo-Projekt zum Beispiel hatte Candice einige der wichtigsten Notizen des Professors im Toaster versteckt gefunden.
Die Frage stellte sich nun: Was machte dieses Buch so wichtig? Was hatte es mit dem letzten Projekt des Professors zu tun? Und folgerichtig: Welches war denn das letzte Projekt des Professors? »Finden Sie den ›Stern von Babylon‹ …«
Beim Klingeln des Telefons zuckte Candice zusammen. Reed O’Brian! Der ihr verkündete, dass sie den Auftrag in der Tasche hatte!
»Hallo?«
Wieder nur Stille.
»Hallo? Welche Nummer wollen Sie denn?«
Klick.
Ein Witzbold. Vermutlich einer ihrer ehemaligen Studenten. Wenn sie nur den Hörer daneben legen könnte, aber sie erwartete einen Anruf, der ihr Leben retten würde.
Candice wandte sich erneut dem Buch zu. Aus seinen vergilbten Seiten stieg leichter Modergeruch. Der Text war auf Französisch geschrieben. Am Anfang ihres Studiums hatte Candice neben Latein und Altgriechisch auch Französisch und Deutsch belegt, nachdem ein Großteil der wissenschaftlichen Werke über Ägyptologie in diesen Sprachen verfasst waren. Insofern reichten ihre Kenntnisse aus, um den Titel Entdeckungen in Mesopotamien zu übersetzen und sich einen Eindruck zu verschaffen, worum es in dem Buch ging: Pierre Duchesne, französischer Konsul in Ägypten von 1823–1833, hatte verschiedene Reisen in das Tal von Tigris und Euphrat unternommen, wo er seinem Hobby, der Archäologie, nachging. Über diese Reisen hatte er einen Bericht verfasst und mit Stichen all jener Fundstücke angereichert, die er nach Paris mitgebracht hatte. An diesen Bildern (Statuetten, Fragmente von Flachreliefs, Tafeln mit Keilschrift) war nichts Besonderes, einige wurden von Erklärungen oder Beschreibungen begleitet, wohl weil Duchesne selber nicht genau wusste, worum es sich dabei handelte. Auf jeden Fall war darunter nicht ein Stück, das auch nur im Entferntesten an einen Stern erinnerte, und es gab keine Kapitel oder Untertitel, die auf einen Étoile de Babylon verwiesen.
»Das kann nicht der Schlüssel sein, von dem der Professor gesprochen hat«, murmelte Candice und überlegte, ob sie noch einmal zum Haus des Professors gehen und sich den Humidor etwas genauer ansehen sollte.
Ihre Gedankengänge wurden von einem lauten »Hallo« unterbrochen. Zora stand auf der Schwelle der Terrassentür, eine Freundin, die ein Stück die Straße hinunter in einem ähnlich baufälligen Blockhaus wie Candice lebte.
Zora, eine kräftige, große Frau, war in einen fließenden afrikanischen Kaftan gekleidet, darunter trug sie keinen BH. Außerdem war sie barfuß. An Handgelenken und Fesseln prangten mystische Tätowierungen. Mit ihren vierunddreißig Jahren war Zora eine halbwegs erfolgreiche Künstlerin, die sich in allem versuchte, was ihre Phantasie beflügelte – heute Morgen zum Beispiel waren ihre Arme von Töpferton verkrustet. Aufgrund ihres Hangs zu Astrologie, Kräutermedizin und der Entschlüsselung anderer Leute Aura, wurde kolportiert, sie hätte ihren Namen frei erfunden. Aber nein, auf ihrer Geburtsurkunde stand wahrhaftig Zora Rothstein, Tochter von Abel und Ruth. Wie sie einräumte, hatte sie aus künstlerischen Gründen den Namen Rothstein fallen gelassen. Ihre Bilder, Skulpturen, Keramiken und aufregenden Schmuckstücke waren mit einem dramatischen Zora! signiert.
Geschieden, mit zwei Kindern, bezeichnete Zora sich selbst als neo-feministische Gaia-Anhängerin mit jüdischen Wurzeln und der Tendenz zu heidnischen Bräuchen und weißer Magie. Sie las aus Teeblättern und Tarotkarten und glaubte ernsthaft an die harmonischen Eigenschaften bestimmter Orte auf dieser Erde, zu denen zum Beispiel die Berge von Malibu gehörten. Diese Zora also stand nun auf Candices Schwelle, um wie jeden Montag einen Morgenkaffee zu schnorren, da sie wie gewöhnlich vergessen hatte, am Wochenende einzukaufen. Doch kam sie nie mit leeren Händen. Ihre heutige Morgengabe bestand aus duftenden warmen Zimtbrötchen, frisch aus dem Ofen.
»Zora, was weißt du über einen Stern von Babylon?«, fragte Candice, ohne die Nase aus dem Buch zu heben.
»Schönen guten Morgen auch«, meinte ihre Freundin und setzte Wasser auf. »Schon Nachricht aus San Francisco?«
»Noch nicht. Reed meinte, die Museumskommission würde in dieser Woche zu einer Entscheidung kommen.«
»Du kriegst den Job. Teeblätter lügen nicht.« Auch das Wahrsagen gehörte zu Zoras Neigungen. Egal, was die Teeblätter, Tarotkarten, Kristallkugeln und Tierkreiszeichen verrieten, Zora gab ihrer Freundin immer eine positive Prognose. Sie wusste, dass es kritisch um Candices berufliche Zukunft stand. Nach dem verhängnisvollen Zwischenfall am Grab von Pharao Tetef hatte Candices Karriere einen Knick bekommen, und Zora konnte gut verstehen, dass die Freundin mit ihren vierunddreißig Jahren allmählich in eine Art beruflicher Torschlusspanik geriet.
Das Telefon klingelte erneut. Zora erstarrte, hoffte auf gute Nachrichten. Aber es wurde wieder aufgelegt.
»Schon das dritte Mal heute Morgen. Es klingelt und niemand ist dran.«
»Nicht mal ein Atmen?«
Candice ging in ihr Wohnzimmer und holte ein Nachschlagwerk aus dem Regal. Zora folgte ihr. Dann sah sie die E-Mail auf dem Bildschirm und las sie. »Klingt ziemlich verzweifelt.«
»Findest du?«, meinte Candice zerstreut, während sie das Buch nach einem Stern von Babylon durchblätterte.
»Schätzchen«, sagte Zora milde. »Reed kennt deine Situation. Er kennt auch deine Geschichte. Lass ihn mal machen.« Sie wusste, wie viel dieser Auftrag für Candice bedeutete. Buchstäblich die Rettung. Eine zweite Chance. Einen Traumjob in San Francisco – die Koordinierung einer Fernsehdokumentation über das alte Ägypten mit einem Begleitbuch zur Serie –, dem die Hälfte aller Ägyptologen Amerikas hinterherhechelten! Nur bezweifelte Zora, dass es Candices Anliegen förderlich war, wenn sie Reed O’Brian ständig mit nachträglichen Überlegungen bombardierte. »Das ist wie eine Narbe aufkratzen«, riet sie der Freundin.
»Lass ihn in Ruhe.«
»Ich hab die E-Mail nicht abgeschickt. Ich wurde vorher gestört.«
»Gestört?«
»Ein Detective von der Polizei stand plötzlich vor meiner Tür.«
Zora blieb der Mund offen stehen. »Was hat ein Detective hier zu suchen? Hast du Ärger?«
Candice setzte sie über die nächtlichen Ereignisse ins Bild.
»Wie furchtbar«, meinte Zora, die den Professor kannte. Und dann: »Sieht er denn gut aus, dieser Detective? Ist er ledig?«
Candice rief sich den geheimnisvollen Glenn Masters ins Gedächtnis. Er besaß tatsächlich das gute Aussehen seines Vaters. In jüngeren Jahren war John Masters ein ziemlich attraktiver Mann gewesen. »Doch, ich denke schon«, räumte sie ein. »Auf eine gewisse, angespannt nervöse Art.«
»Ich liebe angespannte Männer. Es macht Spaß, sie aufzulockern. Wie Larry.« Damit bezog sie sich auf ihre neueste Errungenschaft.
»Ich dachte, du magst Larry, weil er Joga praktiziert und grünen Tee trinkt.«
»Ich mag ihn, weil er zwei Eigenschaften hat, die ich an einem Mann am meisten schätze. Er ist reich und wohlhabend.« Zora biss ein Stück von dem warmen, zuckrigen Brötchen ab und fragte kauend: »Dieser Detective also, wirst du ihn wieder sehen?«
Candice antwortete nicht. Sie blätterte jetzt völlig konzentriert in einem Buch, das so dick war wie das New Yorker Telefonbuch.
Wieder typisch, seufzte Zora innerlich. Wenn Candice einmal eine Spur hatte, folgte sie ihr so besessen wie ein Spürhund. Wenn sie diese Zielstrebigkeit doch nur auch einmal bei Männern anwenden würde.
Zora ließ Candices Liebesleben vor ihrem geistigen Auge Revue passieren. Da hatte es Paul, den Anwalt, gegeben; David, den Börsenmakler und Benjamin, der eine Kette von Sportartikelgeschäften sein Eigen nannte; dann Gareth, den Koch und diesen Sowieso-Ägyptologen. Alle so viel versprechend am Anfang und dann aus unerfindlichen Gründen ein Reinfall. Und dieses ganze letzte Jahr nichts, nada, null. Enthaltsamkeit. Candice, die sich sofort in die Berge verkroch, sobald auch nur ein männliches Wesen in ihre Richtung blickte. Versteckte sich in einem Blockhaus mit einer Katze. Das war nicht in Ordnung so. Und das hatte Zora auch immer wieder gesagt. Ohne Erfolg.
»Mist«, murmelte Candice, legte das Buch beiseite und kehrte in die Küche zurück.
Wenn Candices Stimme diesen dunklen Klang annahm, wusste Zora, dass sie unter Spannung stand. Bei den meisten Menschen wurde die Stimme unter Stress höher. Bei Candice, deren Stimme bereits ein warmes Timbre besaß – eine Schlafzimmerstimme, wie Zora befand, als ob sie gerade erst aufgewacht war –, bei Candice wurde die Stimme unter Spannung noch dunkler, verführerischer. Was hätte Zora für so eine Stimme gegeben!
Der Wasserkessel pfiff. »Was ist das?« Zora tippte auf den Deckel des Duchesne-Buches auf dem Küchentisch.
»Der Professor hat mich gebeten, es für ihn zu holen.« Candices Blick fiel auf das verblasste Impressum im Innendeckel des Buches. Stokey’s Buchantiquariat. Figueroa Street. »Hast du je von einem Stern von Babylon gehört?«
Zora goss gerade heißes Wasser über Instant-Vanille-Kaffeepulver in einen riesigen Keramikkrug, den sie vor drei Jahren getöpfert hatte. »Ist das ein anderer Name für den Stern von Bethlehem?«
Candice sah sie überrascht an. »Ja, könnte sein.«
»Könnte aber auch ein Schiffsname sein. Die SS Stern von Babylon. Oder ein Diamant mit einem Fluch darauf, wie der Stern von Indien.« Zora ging zur Terrassentür. »Danke für den Kaffee. Hab ein paar Sachen im Brennofen. Lass mich wissen, wie es dem Professor geht. Und ruf mich sofort an, wenn du Nachricht aus San Francisco hast.«
Das Wechseln des Reifens bot keinerlei Problem – Candice hatte schon in frühen Jahren gelernt, solcherlei Pannen eigenhändig zu beheben. Sie löschte die nicht gesandte E-Mail, schaltete den Computer aus, griff sich die Autoschlüssel und ermahnte Huffy, die sich gerade auf dem Sofa einer ausgiebigen Katzenwäsche unterzog: »Falls Reed O’Brian anruft, sage ihm, dass ich sein Angebot annehme.«
Sie schob das Duchesne-Buch in ihre Schultertasche. Auf dem Weg zu ihrem Wagen überdachte sie noch einmal, was Zora über den Stern von Babylon gesagt hatte. Ob das wirklich ein anderer Name für den Stern von Bethlehem sein konnte? Dieser Gedanke erregte sie. Hatte das Geheimprojekt des Professors etwa mit der Geburt Jesu zu tun?
Kapitel 3
Den verdächtigen Wagen bemerkte Candice zunächst nicht.
Ihre Gedanken drehten sich zum einen um den Professor – nach dem Buchantiquariat würde sie zu ihm ins Krankenhaus fahren –, zum anderen um Reed O’Brian. Vielleicht hätte sie die E-Mail doch abschicken sollen.
Reed kannte alle Einzelheiten des Zwischenfalls bei der letzten Grabungskampagne – die ganze Welt kannte sie. Wenn sie ihm die Geschichte doch nur aus ihrer Sicht erzählen könnte, ihm erklären könnte, was damals tatsächlich vorgefallen war: Wie sie des Nachts im Camp aufgewacht war, ein merkwürdiges Licht im Grab entdeckt hatte, wie sie hineingegangen war, seltsame Geräusche in der Grabkammer gehört hatte, wie sie vorwärts gekrochen war und Professor Barney Faircloth, den Ausgrabungsleiter, vor dem offenen Sarkophag hatte stehen sehen, wie er einen Gegenstand aus der Brusttasche zog und zwischen die Leinenbinden der Mumie steckte, den Sarkophag schloss, Staub auf der Stelle verteilte, wo seine behandschuhten Hände geruht hatten, und sich dann zurückzog, indem er mit einem Besen seine Fußspuren im Sand verwischte.
Wie Candice sich geräuspert hatte. Der Professor herumfuhr. Diese überaus peinliche Situation. Er, mit wesentlich mehr Erfahrung und einem hervorragenden Ruf, sie, die frisch promovierte Ägyptologin.
»Morgen ist der große Tag«, begann er etwas zu forsch. »Morgen werden wir den Sarkophag öffnen und sehen, ob meine Theorie stimmt.« Nach Faircloths Überzeugung stammten die Azteken von den Ägyptern ab, die den Atlantik auf Flößen überquert hätten. Sein Leben lang schon suchte er nach dem Pharao, der diese Expedition initiiert hatte. Und glaubte, ihn nunmehr gefunden zu haben.
Candice hatte nichts zu sagen gewusst. Sie hatten in der steinernen Kammer gestanden, in der es nach Verwesung und Unrat roch, mit dem umstrittenen König aufrecht in seinem vergoldeten Sarg, der angeblich noch versiegelt war.
»Ich wollte nur …« hatte der Professor hinter sich deutend gesagt. »Sichergehen.« Und dann: »Was haben Sie gesehen?«
»Sie haben etwas in der Mumie versteckt.«
Erst auf der Höhe von Vermont und Pico wurde ihr bewusst, dass ihr seit Malibu ständig ein Chrysler Cherokee mit den Kennzeichen einer Autovermietung folgte. Also bog sie, ohne den Blinker zu setzen, ab. Der Chrysler folgte ihr. Sie bog auf den Parkplatz eines kleinen Einkaufszentrums ein, der Chrysler ebenfalls. Sie fuhr wieder los, bog noch einmal ab und schoss dann bei Dunkelgelb über eine Kreuzung, bis ein schwarzer Geländewagen ihren Rückspiegel ausfüllte. Los Angeles war voller Spinner.
Faircloth war so nervös gewesen, dass sogar seine Stimme verschwitzt klang. »Candice, wir alle wissen, dass Tetef der König ist, der die Expedition ausgeschickt hat. Nur wird uns ohne Beweise niemand glauben. Ich habe nur ein wenig nachgeholfen.« Es war ein kleines Amulett mit eingravierter, gefiederter Schlange. Es stammte aus dem Museo Nacional de Antroplogía in Mexico City und sollte nun bei einer Mumie im Niltal entdeckt werden.
Entgegen vorherrschender Meinung hatte Candice die Sache nicht auffliegen lassen. Sie hatte ja nicht einmal gewusst, wie sie sich verhalten sollte. Dr.Faircloth war ihr Held. Ihn zu einer Ausgrabung zu begleiten, war die Erfüllung eines Traums gewesen. Er jedoch hatte die Berufsethik aufs Gröbste verletzt und sie auch noch gebeten, ihn nicht zu verraten. Also hatte sie ein Ferngespräch mit ihrem ehemaligen Doktorvater geführt, einem weiteren renommierten Ägyptologen und zugleich Präsident der Ägyptologischen Gesellschaft von Kalifornien. Sie hatte ihn im strengsten Vertrauen angerufen und lediglich um seinen Rat gebeten. Er aber hatte gesagt: »Ich kümmere mich darum.« Und der Albtraum hatte begonnen.
Da war der Chrysler schon wieder.
Sie behielt ihn im Auge. Sie konnte nicht erkennen, ob der Fahrer weiblich oder männlich war. »Wenn Sie in Ihrem Wagen verfolgt werden, fahren Sie zur nächsten Polizeistation«, hatte die Leiterin des Selbstverteidigungskurses beim CVJM ihnen eingebläut. Schön und gut, nur, wo befand sich die nächste Polizeistation?
Als Candice eine Lücke in der rechten Fahrspur entdeckte, zog sie einfach hinüber, worauf ein BMW-Fahrer ihr wütend den Stinkefinger zeigte. Im dichten Verkehr hatte sie den Chrysler abgehängt. Candice bog in die erstbeste Seitenstraße ab, und kurvte durch ein Wohngebiet zum Wilshire Boulevard, wo der Verkehr noch zäher floss.
Candice hatte nicht wissen können, dass zwischen ihrem Mentor und Faircloth schon immer eine Erzrivalität herrschte. In aller Öffentlichkeit wurde Faircloth vom Präsidenten der Ägyptischen Gesellschaft von Kalifornien degradiert, der diese Demütigung noch steigerte, indem er eine umfassende Untersuchung aller früheren Publikationen, Abhandlungen, Thesen, Vorlesungen, ja sogar Briefe an Herausgeber, auf Irrtümer, Fiktion, Plagiate und Fälschungen hin verfügte. Zeitungsredaktionen witterten einen Skandal, und ein aggressives Nachrichtenteam lockte die unerfahrene Candice in ein Interview für eine populäre Sonntagnachtshow im Fernsehen. Ihre Aussagen wurden aus dem Zusammenhang gerissen zitiert, Kommentare wurden drum herum arrangiert, die Candice in einem völlig falschen Licht erscheinen ließen und den Eindruck erweckten, sie stelle die gesamte Zunft der Ägyptologen als Grabräuber und Scharlatane dar.
Die Reaktion war kurz und heftig. Candices Kollegen befanden, der Vorfall hätte ›intern‹ geklärt werden müssen. Obwohl Faircloths Schuld außer Frage stand, bezichtigte man Candice der Eifersucht, stellte sie dar als eine, die aus Profilierungssucht das Rampenlicht suchte und nur Ärger machte. Mit einem Mal war sie bei Grabungskampagnen nicht mehr willkommen, auch nicht auf Symposien, bei Vorlesungen, wo auch immer Ägyptologen zusammentrafen. Ihre Publikationen verkauften sich nicht mehr, ihre Theorien wurden ignoriert, Geldquellen für Grabungsprojekte blieben ihr verschlossen. Ihre Karriere war praktisch beendet, ehe sie richtig begonnen hatte. Und dann nahte Rettung in Gestalt von Professor Masters, der sie bat, ihn bei seinem König-Salomo-Projekt zu begleiten.
Solche Art Rettung war Faircloth nicht beschieden. Seine Frau verließ ihn, er war finanziell ruiniert und fand schließlich nur eine Anstellung an einer kleinen Hochschule im Mittleren Westen. Und doch hatte er am Ende zu Candice gesagt: »Ich trage Ihnen nichts nach«, und dabei wie hundert Jahre alt ausgesehen.
Als sie das Antiquariat entdeckte, nahm sie die erstbeste Parklücke am Straßenrand, stellte den Wagen ab und stürmte in den Buchladen. Hinter den Buchregalen versteckt, behielt sie die Straße im Auge, wo auch schon der Chrysler Cherokee im Schneckentempo vorbeizog.
Stokey’s Antiquariat erinnerte sie an die alte Fernsehserie Twilight Zone. Selbst die Luft roch alt und muffig. Mit einem Auge auf dem Straßenverkehr, betätigte Candice die Klingel neben der Registrierkasse.
Aus dem Hinterzimmer tauchte der Ladenbesitzer auf, ein gebeugter Mann namens Goff, der in der einen Hand ein angebissenes Pastrami-Sandwich hielt, in der anderen eine Papierserviette. Er stopfte die fettigen Enden des Fleischs in das mit Senf beschmierte Brötchen zurück und wickelte die Serviette darum. Mit einem herzhaften Bissen im Mund erklärte er, sich an das Duchesne-Buch zu erinnern und auch an den Nachmittag vor sechs Monaten, da Professor Masters es gekauft hatte.
»Hat ne Menge dafür bezahlt«, meinte Mr.Goff mit gestopfter Stimme und senfverklebtem Mund. »Duchesnes Antiquitätensammlung ist vor hundert Jahren in Flammen aufgegangen, als sein Haus in der Nähe von Paris niederbrannte. Das machte das Buch umso wertvoller, weil es das einzige Zeugnis von Duchesnes Sammlung darstellte. Glaube sowieso nicht, dass das Buch eine hohe Auflage hatte. Wenn es hochkommt, ein paar Hundert Exemplare. Masters erzählte mir, dass er schon einmal ein Exemplar besessen hätte, das aber bei einem Orkan zerstört wurde, als ein Teil seiner Bibliothek unter Wasser stand.«
Candice konnte sich noch gut an den Vorfall erinnern. Professor Masters war untröstlich über den Verlust eines Teils seiner wertvollen antiquarischen Sammlung gewesen. »Können Sie mir sagen, was dieses Buch so wertvoll macht? Wenn der Professor vor fünf Jahren schon ein Exemplar davon besessen hat, warum hat er dann so lange gewartet, es zu ersetzen?«
»Es ging ihm gar nicht so sehr um das Buch selber, viel mehr um einen besonderen Stich. Ich zeig’s Ihnen.« Goff legte den Sandwich beiseite, wischte sich die Hände an der Hose ab und klappte die einzelnen Buchseiten so behutsam um, wie ein Chirurg beim Offenlegen von Muskelschichten vorgehen mochte. Der Reisebericht stammte aus der Zeit vor der Massenfotografie, insofern handelte es sich bei den Illustrationen um Stiche, die so kunstfertig und detailgenau waren, dass man sie unschwer für Fotos hätte halten mögen. »Hier ist es. Oh!« Ein zusammengefaltetes Stück Papier klemmte zwischen zwei Seiten, es war beschriftet. »Gehen Sie lieber vorsichtig damit um«, meinte Mr.Goff, als er es Candice aushändigte. »Könnte wichtig sein.«
Candice legte den Zettel in ihre Brieftasche und wandte sich dann der Abbildung zu, die Mr.Goff gesucht hatte. Es war eine Stein- oder Tontafel, typisch für die mesopotamische Kultur vorchristlicher Zeit. Diese Art Tafeln wurden zur Archivierung oder im Schriftverkehr eingesetzt. »Sieht aus wie Keilschrift«, murmelte Candice. »Aber ich kann die Sprache nicht identifizieren.«
»Daran war der Professor interessiert. Er sagte, dass die Wissenschaftler seit Jahrzehnten bemüht seien, diese Sprache zu entschlüsseln.« Goff widmete sich wieder seinem Sandwich.
»Er meinte, diese Tafel wäre einzigartig. Es sei noch kein anderes Exemplar mit dieser Schrift gefunden worden. Das Verhalten des Professors … Er hat mir natürlich nichts verraten, aber ich hatte so eine Vermutung, dass er noch einen anderen Stein mit den selben Schriftzeichen gefunden hatte und die beiden vergleichen wollte.«
Candice zog die Brauen zusammen. War Professor Masters etwa auf einen seltenen archäologischen Fund gestoßen?
Im Hintergrund des Ladens sah sie einen Fotokopierer stehen und bat Mr.Goff, den Stich von der rätselhaften Duchesne-Tafel zu kopieren. Das Buch war zu kostbar, um es ständig bei sich zu tragen. Sie würde es an einem sicheren Ort verwahren und das Foto der Tafel später einem guten Freund faxen, der die Schriftzeichen womöglich entziffern konnte.
Während sie wartete, beobachtete sie die Straße. Seit sie den Laden betreten hatte, war der Chrysler nicht mehr aufgetaucht. Gerade als Mr.Goff ihr die Fotokopie aushändigte, klingelte sein Telefon, ein altmodischer schwarzer Apparat mit Wählscheibe. Goff nahm ab, lauschte einen Moment und hielt ihr dann den Hörer hin.
»Heißen Sie Armstrong?«
»Ja, warum?«
»Für Sie.«
Wie war das möglich? Niemand wusste, dass sie hier war. Vorsichtig nahm sie den Hörer, als ob er stechen könnte, und hielt ihn ans Ohr. »Candice Armstrong«, meldete sie sich.
Klick.
»Also …«, setzte sie verwundert an. Und dann fielen ihr plötzlich die morgendlichen Anrufe ein und was sie bedeuten konnten. »Ach du Schreck!«
»Alles okay?«, rief Mr.Goff hinter ihr her.
Sie schlüpfte durch zwei Beinahe-Zusammenstöße – einer mit einem Stadtbus – und handelte sich diverse obszöne Gesten ein, als sie sich in höchster Eile in den nachmittäglichen Berufsverkehr einfädelte. Wenn man sie angefahren hätte, hätte sie dem Polizisten erklärt, dass sie beraubt worden sei, und hätte um eine Polizeieskorte gebeten.
Die regennasse Straße zu ihrem Blockhaus brachte ihren Wagen mehrere Male ins Schlingern, und als sie sich dem Haus näherte, wurden ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt.
Huffy saß miauend mitten auf der Straße. Candice wusste mit absoluter Sicherheit, dass sie die Katze eingesperrt hatte.
Jemand war in ihr Haus eingebrochen.
Jeden Morgen wachte Glenn Masters mit derselben Frage auf: Wird heute der Tag sein?
Der unvermeidbare Tag, an dem er sich in das verwandeln musste, was er am meisten hasste: einen Gewaltmenschen.
Diese Frage quälte ihn beim Duschen, beim Frühstück, beim täglichen Kreuzworträtsel, und dann steckte er seine Dienstmarke ein und fuhr zu seiner Dienststelle bei der Hollywood Division, wo er wieder einen Tag in einer Welt voller Gewalttaten verbringen, sich im Zaum halten und dagegen wappnen würde, selber ein Teil dieser gewalttätigen Welt zu werden.
Die Polizeipsychologin hatte ihn gewarnt, wenn er seine Gefühle unter Verschluss hielt, würde das das Gegenteil bewirken. »Eines Tages werden Sie Ihre Grenzen erreichen und außer Kontrolle geraten«, hatte sie gesagt und ihm geraten, ab und zu Dampf abzulassen.
Leicht gesagt.
Dann hatte sie ihn zu seinem Liebesleben befragt, was sie, wie er fand, nichts anging. Lapidar hatte er geantwortet: »Keine Klagen.« Sherri teilte nicht länger sein Leben. Nach dem Unfall hatten sie sich auseinander gelebt und danach hatte es keine dauerhafte Beziehung mehr gegeben. Glenn konnte es nicht riskieren sich erneut zu verlieben, da er wusste, wie Gefühle miteinander verquickt waren, und wenn er das eine herausließ, würde das andere folgen. Er wusste, dass hinter dem liebenden Menschen, der er sein konnte, der andere, der hasserfüllte Mann lauerte.
Als er sich nun in dem täglichen Chaos auf der Polizeistation umsah, fragte er sich, was zum Teufel er hier eigentlich machte. Nach dem Begräbnis seiner Mutter hatte er sich bei dem Gedanken an ihren gewaltsamen Tod zwei Wochen lang jede Nacht übergeben müssen. Dann hatte er Beruhigungsmittel für den Magen eingenommen, Schlaftabletten und Pülverchen gegen Albträume. Und als er schließlich aus diesem Dämmerzustand erwacht war, mitgenommen aber eiskalt, hatte er ein neues Credo gefunden: Nie wieder Gewalt, nie wieder.
Dennoch war er in den Polizeidienst eingetreten. Und natürlich in die Mordkommission. Auf die Frage von Freunden, warum er sich nicht in ein nettes, friedliches Kloster hoch oben in den tibetischen Bergen zurückzog und sein Leben inmitten der Wolken fristete, hatte Glenn nur zu sagen gewusst, dass es da draußen Kriminelle zu fassen gab, und das konnte nicht auf einem Berggipfel bewerkstelligt werden.
Hier war er nun also, ein gewaltloser Mensch in einer gewalttätigen Welt.
Beim Anblick seines Schreibtisches, der sich unter seiner täglichen Last bog – ungelöste Fälle, Zeugenbefragungen, Beweismittel und Spuren, die es zu verfolgen galt –, hätte Glenn am liebsten mit irgendetwas geworfen. Nicht, dass er so etwas je täte. Glenn Masters geriet nie außer Kontrolle. Kontrolle hielt das Leben und das Universum davon ab, ins Chaos zu driften. Obwohl er heute Morgen wirklich Mühe hatte sich zu bremsen.
Der alte Mann … so zerbrechlich und hilflos in seinem Krankenbett.
So hatte er sich das Wiedersehen mit seinem Vater nicht vorgestellt. In seiner Vorstellung spielte es sich stets in ihrem Haus, in seines Vaters Arbeitszimmer ab. Der alte Mann würde würdevoll in seinem großen Lederarmsessel sitzen und sagen: »Mein Sohn, ich habe dich heute hergebeten, weil ich fand, es sei an der Zeit zuzugeben, dass ich falsch gehandelt habe. Ich hoffe, du kannst mir vergeben.« Glenn würde ihm selbstverständlich vergeben, sie würden sich in die Arme fallen und nach einer so langen Trennung als Vater und Sohn wieder zueinander finden. Stattdessen hatte das lang ersehnte Wiedersehen in einem Krankenzimmer stattgefunden, der alte Mann bewusstlos, nicht einmal ahnend, dass sein Sohn anwesend war.
»Glenn?«
Er drehte sich in seinem Stuhl. Maggie Delaney, seine Kollegin bei der Mordkommission, sah ihn aus großen Augen an. »Ja?«, fragte er.
»Wir haben endlich eine Spur zu dem Pförtner, der meint, etwas gesehen zu haben.« Sie hielt ihm ein Schriftstück hin.
Er starrte darauf. Konnte sich keinen Reim auf ihre Worte machen. Als ob sein hilflos daliegender Vater ihn ebenso hilflos gemacht hätte. War das ansteckend wie ein Virus? Vor seinem inneren Auge sah er das fein gewundene Gehirn, das so viel Wissen, Intelligenz und Verständnis barg, und nun unter Bandagen dahindämmerte. Neuronen, die ins Leere feuerten. »Tut mir wirklich Leid, Mr.Masters«, hatte der Chirurg am Telefon beteuert. »Ich kann Ihnen keine Hoffnungen machen. Wir haben alles Menschenmögliche getan. Bei einem jüngeren Menschen würde so ein Schlag auf den Kopf nicht so traumatisch wirken, aber Ihr Vater ist siebzig …«
War das der Preis, den man für Langlebigkeit zahlte – Gebrechlichkeit und Verwundbarkeit und ein Chirurg, der meinte, wenn man bloß jünger wäre? Während Glenn auf seinen still daliegenden Vater mit den geschlossenen Augenlidern starrte, hatte er sich insgeheim gefragt: Werde ich in dreißig Jahren auch so sein?
Eine andere schreckliche Vorstellung bahnte sich ihren Weg – Glenn sah seinen Vater hilflos am Fuß der Treppe liegen. Wie unwürdig, über eine Teppichfalte zu stolpern und wie eine lieblos weggeworfene Stoffpuppe die Treppe hinunterzufallen und hilflos liegen zu bleiben. Was, wenn Mrs.Quiroz nicht im Haus gewesen wäre? Wie lange hätte sein Vater so den Schmerzen ausgeliefert dagelegen, auf Gedeih und Verderb, bis der Postbote, der Gärtner oder ein besorgter Nachbar ihn gefunden hätte? Dem Himmel sei Dank für Mrs.Quiroz. Glenn hatte noch einmal bei ihr angerufen, doch sie stand immer noch unter Beruhigungsmitteln, wie ihr Ehemann ihm mitteilte. So groß war der Schock gewesen.
Als er das Haus nach so vielen Jahren wieder betreten hatte, waren die Erinnerungen über ihn hergefallen wie Gespenster, die sich nach menschlicher Gesellschaft sehnten. Als ob sie aus den Hauswänden gestiegen wären und sich, Aufmerksamkeit heischend, um ihn versammelt hätten. Geburtstagspartys, Weihnachtsfeiertage, von Mrs.Quiroz aufgetragene Mahlzeiten. Und er, Glenn, in der offenen Tür zum Arbeitszimmer seines Vaters, des Professors, der damals zwanzig Jahre jünger war, über wichtige Arbeiten auf seinem Schreibtisch gebeugt. Der Sohn, achtzehn Jahre alt, wie er auf dieser verhängnisvollen Türschwelle stand, sich nach tröstenden Worten sehnte und verzweifelt wünschte, vom Vater in die Arme genommen zu werden und zu hören, dass die Welt nicht so schrecklich war, wie sie sich ihm plötzlich darbot. Glenn, der sich räusperte. Der Vater, der den Kopf hob. Und dann hatte er in dieser grässlichen Stille die Gedanken seines Vaters gelesen: Wenn du die Uni abbrichst, bringt das deine Mutter nicht zurück, mein Sohn.
Noch am selben Tag war Glenn von zu Hause ausgezogen und hatte sich bei der Rekrutierungsstelle der Polizei von Los Angeles gemeldet. Sein Lebenstraum, in die wissenschaftlichen Fußstapfen des Vaters zu treten, war der Realität einer Laufbahn im Polizeidienst gewichen.
»Großartig. Das ist wirklich gut«, wandte er sich nun an Maggie Delaney. Glenn versuchte, sich auf Naheliegendes zu konzentrieren. Der Pförtner des Highland Avenue Gebäudes meint gesehen zu haben …
Wieder verselbständigten sich Glenns Gedanken und er sah das Bild seiner Mutter vor sich. Eine lang vergessene Erinnerung. Mit leuchtenden Augen hatte Lenore ihm etwas erzählt, und obwohl er damals nicht verstand, wovon sie redete, hing er an jedem ihrer Worte. Aber dann war sein Vater hereingekommen und hatte sie gescholten. »Verwirr mir den Jungen nicht mit deinem Gerede vom Jüngsten Tag und Armageddon. Du hast es versprochen, Lenore.« Sie war verstummt, das Gesicht wie versteinert. Damals hatte Glenn zum ersten Mal das beklemmende Gefühl, dass seine Eltern ein schreckliches, unaussprechliches Geheimnis teilten.
Wie hatte er das nur vergessen können?
Was waren ihre Worte noch gewesen?
Er drückte die Hand an die Stirn, als ob er die Silben aus dem Gehirn pressen könnte.
»Die Letzten Dinge, mein Schatz. Ta eschata auf Griechisch, De Novissimis auf Latein. Die Letzten Tage«.
Das ergab doch keinen Sinn. Seine Mutter sprach nie über religiöse Dinge. Sie war Wissenschaftlerin, ihr gesamtes Weltbild beruhte auf Zahlen und Gleichungen. Warum hätte sie von so esoterischen Vorstellungen wie dem Ende der Welt sprechen sollen?
Ein kalter Schauer lief Glenn über den Rücken. Und er verspürte ein Gefühl der Angst.
»Glenn?« Maggie Delaney wartete auf eine Antwort.
Er furchte die Stirn. Welches Geheimnis verband seine Eltern …? »Wie bitte?«, sagte er.
»Sollen wir diese Spur verfolgen?«
Maggie war nicht die Einzige, die Glenns untypische Zerstreutheit bemerkte. Captain Boyle stand auf der Schwelle und musterte seinen besten Detective mit besorgtem Blick.
Glenn war ein merkwürdiger Fall: unbeliebt bei den Kollegen und zugleich bewundert und respektiert. Er war ein Einzelgänger, das Wort ›Team‹ gehörte nicht zu seinem Vokabular. Und doch hatte er alle Hürden genommen. Einmal auf der Spur eines Kriminellen, gab Glenn Masters nicht mehr auf. Er war cool, nicht der typische Action-Cop. Masters würde nie einen Raum stürmen und aus zwei Pistolen gleichzeitig feuern. Im Gegenteil, er weigerte sich, überhaupt eine Waffe zu tragen. Er war ein Verhandlungsspezialist. Ein Kopfmensch. Der richtige Typ für schwierige Situationen wie Selbstmörder auf dem Dach eines zwölfgeschossigen Gebäudes oder bei Geiselnahmen. Glenn hasste Gewalt und ging ihr, wo er konnte, aus dem Weg. Einige Kollegen hatten sich beschwert. »Er trägt keine Waffe. Gibt uns keine Rückendeckung.« Also setzte Captain Boyle Masters in kniffligeren Situationen ein. Wie der mit dem jungen Mann im Motel und dem Baby auf dem Arm, dem er die Pistole an den Kopf hielt. Oder der mit dem durchgeknallten Drogensüchtigen, der damit drohte, eine Handgranate in eine Kindertagesstätte zu werfen. Situationen, die Verhandlungsgeschick erforderten. Glenns Coolness ließ eine Salatgurke wie eine Chilischote erscheinen.
Allerdings fragte Boyle sich manchmal, wie Masters sich in einer wirklich brenzligen Situation verhalten würde. Aus der er sich nicht mit seiner Redegewandtheit herausmanövrieren konnte, wenn er in die Enge getrieben und Action gefragt war?
Man wusste nie genau, was in Masters vorging. Ein Einzelgänger, wenig Freunde. Er hing nie im Cock n’ Robin, der bei den Kollegen bevorzugten Kneipe, herum. Soweit der Captain wusste, gab es derzeit auch keine feste Beziehung in seinem Privatleben.
Obwohl es da mal eine gegeben hatte, vor ein paar Jahren, eine Bergsteigerin noch dazu. Warum hatte er das Interesse verloren? Wenn man ihn so mit Delaney sah … Maggie Delaney war Kriminalbeamtin in Zivil, Leiterin der Abteilung ›Häusliche Gewalt‹ und derzeit der Mordkommission überstellt. Ihr wohlgeformter Körper zeugte von hartem, täglichem Fitnesstraining, die männlichen Kollegen hatten nur Augen für sie. Sie wiederum schien nur Augen für Glenn Masters zu haben. Nur, dass er das nicht zu merken schien. Boyle rieb sich den schmerzenden Magen. Seine Pensionierung stand kurz bevor – adios Sodbrennen, hallo Fliegenfischen. Nur er und Molly in ihrem Caravan. Er hoffte, in Glenn einen würdigen Nachfolger zu finden. Der Job war reinste Knochenarbeit und verlangte einen kühlen Kopf, und Boyle hatte auf Kosten seiner Gesundheit einen kühlen Kopf bewahrt. Glenn war für diesen Job wie geschaffen, so eiskalt, dass Boyle sich manchmal fragte, ob er überhaupt einen Magen besaß.
Vermied Glenn jegliche Gewalt, weil sie verschüttete Gefühle in ihm hervorrief, womöglich die Ketten zerriss, die seine Empfindungen im Zaum hielten? Das würde eine Menge erklären, zumal gerade jetzt, da Captain Boyle eine Nachricht für seinen Lieblingspolizisten hatte. »Ein Krankenhaus hat angerufen.«
Das war wieder typisch Masters. Nicht einmal seinen befreundeten Kollegen hatte er von dem Unfall seines Vaters erzählt. Boyle trat näher. »Glenn, kann ich Sie mal kurz sprechen? Privat?«
Maggie verließ das Zimmer.
»Ich erhielt gerade einen Anruf von einem Krankenhaus«, hob Boyle mit ratlosem Gesichtsausdruck an. »Ich soll Ihnen ausrichten, dass sie einen Eingriff vorgenommen haben, um den Druck auf das Gehirn Ihres Vaters zu mindern, und dass er jetzt ruhig schläft.« Der Satz stand im Raum wie eine Frage.