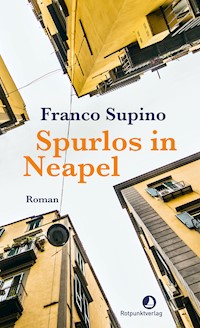
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotpunktverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Blau
- Sprache: Deutsch
Was wäre in Neapel aus ihm geworden, in der Stadt seiner Eltern? Als Kind plagte ihn die Angst, die Schweiz und alle seine Freunde verlassen zu müssen. Darum war es für ihn wie eine Befreiung, als 1980 in Süditalien die Erde bebte und innerhalb von neunzig Sekunden die Rückkehrpläne der Eltern in Schutt und Asche lagen. Nach dem Tod des Vaters, viele Jahre später, begibt sich der Erzähler auf Spurensuche nach Neapel, eine Stadt, deren Sprache er spricht, deren Gesetze ihm aber fremd sind. Auf einer Restaurantterrasse mit Blick auf den Golf von Neapel hört er zum ersten Mal den Namen Antonio Esposito. Ein Allerweltsname, aber dieser Antonio Esposito ist anders, ist ein gestohlenes Migrantenkind aus Westafrika, das in einen Camorra-Clan aufgenommen wurde, eine kriminelle Karriere machte und dann spurlos verschwand. Das mögliche Schicksal des schwarzen Camorrista lässt den Erzähler nicht mehr los. Immer wieder kehrt er nach Neapel zurück, sieht sein verpasstes Leben mehr und mehr in dem von Antonio verwirklicht. Aber was ist aus Antonio geworden? Ist er tot? Hat er eine neue Identität angenommen? Oder lebt er im hoffnungslos überfüllten Castel Volturno als Namenloser unter Tausenden von afrikanischen Migranten?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Was wäre in Neapel aus ihm geworden, in der Stadt seiner Eltern? Als Kind plagte ihn die Angst, die Schweiz und alle seine Freunde verlassen zu müssen. Darum war es für ihn wie eine Befreiung, als 1980 in Süditalien die Erde bebte und innerhalb von neunzig Sekunden die Rückkehrpläne der Eltern in Schutt und Asche lagen.
Nach dem Tod des Vaters, viele Jahre später, begibt sich der Erzähler auf Spurensuche nach Neapel, eine Stadt, deren Sprache er zwar spricht, deren Gesetze ihm aber fremd sind. Unter den vielen Geschichten, die er hier hört, lässt ihn eine nicht mehr los, die Geschichte von Antonio Esposito: ein gestohlenes Migrantenkind aus Westafrika, das in eine Camorrafamilie aufgenommen wurde, eine kriminelle Karriere machte und dann spurlos verschwand. Was ist aus diesem Antonio geworden? Ist er tot? Hat er eine neue Identität angenommen? Oder ist er untergetaucht im hoffnungslos überfüllten Castel Volturno, als Namenloser unter Tausenden von afrikanischen Migranten?
Franco Supino schaut mit einem unsentimentalen Blick auf das ebenso schöne wie abschreckende Neapel. Was sein Protagonist über Antonio Esposito in Erfahrung bringt, ergibt keine lückenlose Geschichte, sondern ein faszinierendes Vexierbild. Die Figuren, die diese Stadt und diesen Roman bevölkern, seien es Camorristi oder Künstler, Handwerker oder Heilige, Kinder der Madonna oder Helden der Vergangenheit, sie alle verbindet eine verzweifelte Zuversicht: »Der Vesuv dampft? Explodieren wird er erst morgen!«
Franco Supino
Spurlos in Neapel
Roman
Der Autor dankt der Stiftung Pro Helvetia für den Kreationsbeitrag und der Franz-Edelmaier-Residenz für Literatur und Menschenrechte, Meran, für das Aufenthaltsstipendium.
Dieses Buch erscheint mit freundlicher Unterstützung von:
Der Verlag bedankt sich dafür.
Der Rotpunktverlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021 bis 2024 unterstützt.
Zitat S. 194 f.: Daniel Defoe, Robinson Crusoe, aus dem Englischen von Rudolf Mast, mare-Verlag 2019, S. 266
© 2022 Franco Supino
www.rotpunktverlag.ch
Umschlagbild: Dan Grysku / Alamy
Lektorat: Anina Barandun
Korrektorat: Lydia Zeller
eISBN 978-3-85869-968-8
1. Auflage 2022
Inhalt
Stammbaum der Familie Esposito
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Stammbaum der Familie Esposito
»Ich habe nichts von eurer Stadt verstanden,ich denke, es wäre unredlich,wenn ich sie beschreiben würde.«
James Baldwin an die Redaktion derneapolitanischen Tageszeitung Il Mattino,Dezember 1980
»Es gibt kein anderes als das autobiografische Erzählen.Man muss versuchen, die eigene Existenz publik zumachen, in der Hoffnung, dass jemand sie verstehe.«
Generoso Picone, Paesaggio con rovine, 2020
1.
Wie hättest du dich in dieser Gesellschaft, der du glücklicherweise entronnen warst, je wieder zurechtfinden wollen, Vater? Diesem dichten Geflecht von Abhängigkeiten und Begünstigungen, in dem jeder, der nicht dazugehört, der keine Beziehungen hat, mit dem Kopf gegen Wände schlägt.
Ich war noch ein Kind und hatte jeden Sommer nur einen Monat Zeit, um diese Welt zu studieren. Ich beobachtete Mario, unseren überübernächsten Nachbarn, der die zweitschönste Villa nach unserer an der Via Nazionale besaß. Wenn man fragte, was Mario, genannt o’Nzurduso, der Aufbrausende, mache, zuckten alle vielsagend mit den Schultern. Seine Frau, die schwermütige Ninella, und seine Tochter, die hysterische Loredana, ließ er wochenlang allein. Ninella machte im Basso, dem Tiefparterre, aus Hartweizengrieß Fusilli, Orecchiette und Cannelloni. Sie stellte sie zum Trocknen vors Haus, die Vorbeifahrenden hielten an und ließen sich die Pasta in Tüten füllen. Loredana hörte man von weitem im Haus schreien, oder man sah sie überschminkt, von den vielen Medikamenten völlig neben der Spur, auf einem Korbstuhl neben den ausgestellten Teigwaren sitzen und rauchen. Loredana war höchstens Anfang dreißig, Ninella hatte die Hoffnung aufgegeben, sie noch zu verheiraten.
Ab und zu fuhr Mario o’Nzurduso mit seinem Tross ein: gut gekleidete Advokaten, kräftige Jünglinge, leichte Mädchen. Ninella musste alles stehen und liegen lassen, um die Gesellschaft fürstlich zu bekochen. Bis tief in die Nacht hörte man an diesen Abenden aus dem Garten hinter dem Haus polternde Ansprachen und quietschendes Gelächter, bis im Morgengrauen Autotüren zugeknallt wurden, Motoren aufheulten und die schicken Autos einzeln wieder davonfuhren. Mario o’Nzurduso, dessen Freundschaft sich mein Nonno rühmte, galt allen als Vorbild. Er hatte, was ein richtiger Mann hier besaß: Geld, Einfluss und Schwierigkeiten mit der Justiz.
Ich fragte mich oft, warum auch mein Nonno den Kaffee ans Tischchen vor der Bar serviert bekam und nie bezahlte. Und das, obwohl seine Lirebündel weithin sichtbar aus seiner Brusttasche quollen. Warum er im Vorbeigehen in die Kühltruhe griff, mir ein Gelato reichte und Zia Gelsomina, wie ich die Barbesitzerin nennen durfte, dazu unterwürfig lächelte.
»Wie geht das?«, fragte ich Nonno. »In der Schweiz muss man, wenn man sich etwas nimmt, dafür bezahlen. Überall, immer!«
»Ich bezahle«, lachte Nonno mich aus, »jeder bezahlt hier, keine Sorge!«
Als ich einmal zu meinem Geburtstag – er fiel mitten in die Sommerferien, die ich wie immer in Süditalien verbrachte – von meiner ehemaligen Tagesmutter ein Päckchen aus der Schweiz erhielt, riss Nonno die Packung auf und reichte dem Postboten, der erwartungsvoll das Fenster seines Dienstautos heruntergekurbelt hatte, lächelnd die Hälfte der darin enthaltenen Schokoladetafeln. Ich schaute der Szene ungläubig zu. »Das gehört mir! Alles!«, rief ich. Der Postbote lächelte zurück, kurbelte das Fenster hoch und gab Gas. Was maßte sich Nonno an! Ich schrie ihn an, die Schokolade habe mir mein »Mueti« geschickt. Ich trat gegen seinen Stock, gegen den Stuhl, auf dem er vor der Tür saß. Nonno befahl meine Mamma zu sich. »Schaff ihn mir vom Hals. Warum flennt er wie ein Femminiello?« Ein ärgeres Schimpfwort als femminiello, das ungefähr »Heulsuse« oder »Weichei« bedeutet, gab es für einen Knaben nicht.
»Ich bitte um Entschuldigung«, sagte Mamma ängstlich und zog mich weg.
Ich war außer mir. Mutter verlangte sofort Ruhe, ich solle mich benehmen, es sei eine Schande, wie ich mich Nonno gegenüber verhalten habe. Und dann, versöhnlich, ich müsse von der restlichen Schokolade nichts abgeben. »Alles für dich. Gut?« Es waren acht Tafeln.
Gar nicht gut, fand ich. Es ging nicht um viel oder wenig Schokolade für mich, es ging um Gerechtigkeit. Ich malte mir Rache aus. Vielleicht, wenn der Postbote wieder vorfuhr, anspucken? Pneu aufschlitzen?
Wir reisten ab, bevor ich zu Handlungen schreiten konnte. Doch das änderte nichts daran, dass ich mir schwor, ich würde es mit denen dort unten aufnehmen. Nicht so wie Vater und Mutter! Ich hätte den Frevel gesühnt, Nonno hin, Neapel her.
Ich hatte nämlich längst alles durchschaut. Warum Onkel Gigi, der als Gerichtspolizist arbeitete, eines Abends auf dem Nachhauseweg angeschossen worden war. Es gab eine Untersuchung, die im Sand verlief, und innerhalb der Familie wurde der Vorfall totgeschwiegen.
Oder was es mit dem immer spendablen Nino, dem Besitzer des immer voll besetzten Ristorante o’Pagliarone mit dem riesigen, immer vollgeparkten Kundenparkplatz hinter dem Restaurant, auf sich hatte. Nonna war Ninos Amme gewesen, deshalb nannte er sie Mamma. Er schaute öfters vorbei und warf dabei ein Auge auf Zia Virgilia, die jüngste Schwester meiner Mutter. Seine Gefühle wurden erwidert, Abend für Abend kam Nino vorbei, schaute der Nonna und der Zia zu, die im Basso für Ninella Teigwaren machten, beim Anrühren des Mehls, beim Auswallen der Klumpen, beim Ziehen der Schnüre. Nino wartete, bis Virgilia sich frisch machte, sich parfümierte. Dann spazierten sie, Nino und Virgilia, Arm in Arm die Via Nazionale hoch. Bis sich Ninos Familie einmischte. Die Tochter der Amme! Das war nicht auf ihrem Niveau.
Dass das Drama öffentlich aufgeführt wurde, änderte nichts am Ausgang der Geschichte. Nino heiratete die Tochter eines Großgrundbesitzers aus Mugnano del Cardinale, Zia Virgilia den erstbesten Pastakunden von Ninella, einen unscheinbaren Migranten aus der Alta Irpinia, der zufällig vorbeifuhr, anhielt, sich sofort in Virgilia verguckte, sich beim Bezahlen erkundigte, ob das Mädchen noch zu haben sei, sich traute, Virgilia anzusprechen, und zu seiner Überraschung sofort den Zuschlag bekam. »Per me va bene«, habe Zia Virgilia gesagt, »für mich geht das in Ordnung«, Hauptsache, sie kam weg, schnell weg von Nino und dem Dorf. Die beiden haben sich dann ins Ausland, in die Schweiz, abgesetzt.
Der steinreiche Nino hielt mit seinem Cabriolet weiterhin ab und zu vor dem Haus der Nonna an, übergab, nach einem kurzen Schwatz, Nonno eine Flasche hochwertigen Aglianico del Vulture oder ein in Wachstuch geschlagenes, gut abgehangenes Stück Rindfleisch aus Ariano. An der Spanferkel-Versteigerung, dem Höhepunkt des jährlichen Dorffests, wenn es darum ging, die Kosten für die Gratiskonzerte auf der Piazza Sant’Anna zu decken, trieb Nino den Preis in schwindelerregende Höhen. Er bezahlte bar, mit Bündeln von Lirescheinen, die der Auktionator mit hoch erhobenen Armen der staunenden Menge vorführte. Das Dorffest zu Ehren von Sant’Anna findet am 26. Juli statt, während der Sommerferien. Ich erinnere mich, dass es zum Abschluss des Heiligenfests jedes Jahr ein einstündiges prachtvolles Feuerwerk gab, inszeniert von den bekanntesten Feuerwerkmeistern aus Neapel. Das allein kostete mehrere Millionen Lire. »Nino zahlt«, sagte Nonno, stolz auf seinen Beinahe-Sohn.
Wie kann man mit einem Restaurant, das fusilli al forno, mit Mozzarella überbackene Teigwaren, und carne alla brace, Grillfleisch, seine Spezialität nennt, so unermesslich reich werden? Eines Sommers war der Pagliarone nur noch Schutt und Asche. Nino, im Gefängnis, wartete auf seinen Prozess. Niemand sagte etwas dazu, ich musste mir die Erklärung selbst geben.
In gleichen Jahr wurde ein anderer Nachbar, er hieß Vito o’Carcerato, der Zuchthäusler, nach fünfundzwanzig Jahren Haft vorzeitig entlassen. Er kehrte zu seiner Frau Mirta, die all die Jahre auf ihn gewartet hatte, zu seinen beiden Eselinnen und zu seiner Arbeit in den Haselnusshainen zurück. Ich wusste, dass er in jungen Jahren im Dienste einer Camorrafamilie gestanden hatte und an der Tötung von Mitgliedern eines rivalisierenden Clans beteiligt gewesen war. Ich hatte in der Schweiz noch nie einen Mörder gesehen. Vitos Bartstoppeln pieksten, denn natürlich mussten wir Kinder ihn, wie alle Erwachsenen hier, zur Begrüßung küssen.
Vito zog gleich nach Tagesanbruch mit einer der Eselinnen los, also lange bevor ich wach war. »Esel muss man immer zu zweit halten«, erklärte uns Mirta, »einzeln gehen sie vor Einsamkeit ein.« Die zweite, jüngere Eselin stand uns Kindern als Reit- und Vergnügungstier tagsüber zur Verfügung.
In diesem Sommer verließ Vitos Sohn, der im Dorfkern wohnte, seine Frau und die gemeinsame dreijährige Tochter und setzte sich mit seiner Geliebten nach Mailand ab. Das hatte schlimmes Gerede für Mirta und Vito zur Folge, es war die reinste Schande. Mirta schämte sich so sehr, dass sie keinen Fuß mehr vor ihr Haus setzte. Vito o’Carcerato ging nicht mehr mit seiner Eselin in die Haine, saß stattdessen den ganzen Tag vor seiner Haustür, schüttelte den Kopf, sprach mit sich selbst, sprach alle an, die vorbeikamen. Auch mich auf dem Weg zu seinen Eselinnen: »Wie kann man so ein om’i’merda, so ein ehrenloser Mann sein?«
Am Ende der Woche fand Mirta Vito o’Carcerato erhängt am Tragebalken des Stalls. »Es musste so kommen«, sagten Nonna, Nonno, Ninella, die herbeigeeilt waren, während mein Vater das Seil kappte und Mamma mir die Hände über die Augen legte.
Nach Vaters Tod begann ich wieder jedes Jahr, und dann auch mehrmals im Jahr, »nach Neapel runterzugehen«. Scendere a Napoli sagen wir, weil für fast alle Italiener Neapel im Süden liegt. Easyjet bot für ein paar Franken einen Direktflug an, mit der Frecciarossa erreichte man Neapel bequem im Zug, aber es lag nicht an der billigen und schnellen Erreichbarkeit, dass ich nun wieder häufiger in die Stadt am Vesuv reiste.
Vater war überraschend gestorben, ohne je ernsthaft krank gewesen zu sein. Vielleicht aus schlechtem Gewissen und weil er meine Reisen nicht mehr sehen und nicht mehr kommentieren konnte, hatte ich das Gefühl, ich müsse zurück, immer wieder zurück, dahin, woher er gekommen war und wo er gerne gestorben wäre, als würde ich suchen, was er – und wohl auch ich – seit Jahren vermisste.
Ich fuhr in unser Heimatdorf, in dem ich seit zwanzig Jahren nicht mehr gewesen war. Jedes zweite Haus entlang der Via Nazionale stand leer. Nach den Eltern meines Vaters waren auch die anderen Nonni, die Eltern meiner Mutter, gestorben. Ihr Haus war von einem Cousin aus England übernommen worden, der es dann aber vorgezogen hatte, die Ferien weiterhin in Griechenland am Meer zu verbringen, anstatt in einem primitiven, zweistöckigen Häuschen an einer verkehrsreichen Straße im Hinterland Neapels.
Das Haus meiner Eltern, etwas weiter oben an der Via Nazionale, war von einem Stadtneapolitaner als Zweit- oder Sommersitz gekauft worden. Als er festgestellt hatte, dass es hier im Sommer nicht viel frischer und wegen der Hauptstraße vor dem Haus und der Autobahn hinter dem Haus schon gar nicht ruhiger war als in der Stadtmitte, ließ er es verfallen. Das hat er nun von seinem Schnäppchen, dachte ich vor den Relikten meines Elternhauses, in das der Verdienst von fünfundzwanzig Jahren Arbeitsmigration geflossen war.
Wenn ich ins Dorf fuhr, besuchte ich Zio Federico, Vaters Bruder, und seine Frau, Zia Marisa, in ihrem Haus, das sie außerhalb des Dorfkerns, auf dem ehemaligen orto, dem Gemüsegarten meines Nonno, erbaut hatten. Federico war in Rente, pflegte, um diese aufzubessern, weiterhin seine Haselnuss- und Kastanienhaine. Verdienen könne er mit der Landwirtschaft jedoch nichts mehr. Die Kastanien waren neuerdings von einem Parasiten befallen, angeblich aus China importiert. Unter Tränen zeigte er mir die verfaulten Blüten. Totalausfall der Ernte, wahrscheinlich müsse man den ganzen Hain roden. Die Haselnüsse seien wegen der türkischen Konkurrenz längst nicht mehr rentabel. Er sammle sie bloß noch ein, damit sie nicht vergammelten.
Ihre Kinder, meine Cousinen, leben im Ausland, in Abu Dhabi und London. Tante Marisa und Onkel Federico halten die Beziehung zu ihren Enkeln via WhatsApp aufrecht.
Wir gingen durchs Dorf. Der Dorfkern, auf einem Hügel erbaut, zeigte noch immer deutlich die Spuren des Erdbebens von 1980. Fast niemand wohnte mehr in den eng aneinandergebauten Steinhäusern. Viele Treppen waren zerbröckelt, die Gassen kaum passierbar. Das Gerüst um die Primarschule oberhalb der Piazza, das man um die Erdbebentrümmer hochgezogen hatte, hing verrostet im Wind. Durch den Bretterzaun hindurch sah ich, dass man das Gelände als Mülldeponie nutzte. Auf einem zerschlissenen Sofa hatte eine Katze geworfen.
Es gab im Dorfkern keinen Laden, keinen Zeitungskiosk, keine edicola, mehr. Nur auf der Piazza bei der wiederaufgebauten Kirche, wo noch spärlich besuchte Messen gelesen wurden, war eine Bar offen, die letzte im Dorf. Das neue Dorf war in die Ebene Richtung Avellino gebaut worden, die Primarschule stand gleich neben den Baracken für die terremotati, die Erdbebenopfer, die noch immer darin lebten. Vor jeder Baracke standen neuwertige Autos.
In den ehemaligen Kastanienwäldern auf den Hügeln rund ums Dorf waren etliche angeblich erdbebensichere Überbauungen hochgezogen worden, hässliche Backsteinwohnblöcke oder pompöse Villen. Es war ein Schlafdorf geworden. Eingekauft, gearbeitet, gelebt wurde in Neapel oder Avellino. »L’hanno fatto morire, questo paese«, sagte Zio Federico, man habe dieses Dorf sterben lassen. Nicht einmal die Prozession und das Fest zu Ehren von Sant’Anna, der Dorfheiligen, finde mehr statt. Die Jungen und die Zugezogenen hätten kein Interesse daran. Niemand wolle mehr das Konzert und das Feuerwerk bezahlen. »Da«, er zeigte in eine Richtung, »wohnen Polen, und da«, er zeigte in eine andere, »Rumänen. Arbeiten in Neapel.«
»Kannst du denn mit ihnen reden?«
»Wie meinst du das? Wir haben keinen Kontakt.«
Zio Federico hatte alles erzählt, was es über dieses Dorf zu sagen gab. Er schaute mich an. Es war unvorstellbar, dass ich noch hier leben würde. Um das Gespräch aufrechtzuerhalten, fragte ich: »Was ist eigentlich aus Sofia geworden?«
Sofia war die Tochter einer Schulfreundin meiner Mutter. Als Siebzehnjährige war sie während ihrer langen Sommerferien einmal bei uns in der Schweiz gewesen. Ich, ein Jahr jünger als Sofia, sollte ihr etwas von der Schweiz zeigen. Also fuhr ich mit ihr nach Luzern. Beim Anblick der Kapellbrücke werde ihr schlecht, behauptete sie. Sie machte sich einen Spaß daraus, vor den Augen eines Stadtpolizisten Abfall auf die polierten Pflastersteine der Altstadt zu schmeißen und keck zu rufen: »Forza, dammi una multa, los, gib mir eine Buße.« Dazu sang sie laut ein Lied von Fabrizio De André: »Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior. Aus Diamanten wächst nichts, aus Dreck wachsen die Blumen.«
Sie prahlte damit, in Neapel Aktivistin bei den Autonomen zu sein und sich jedes Wochenende mit der Polizei zu prügeln. Offenbar hatten sich ihre Eltern von der Schweiz eine Art soziale Kur versprochen. Ich fand sie attraktiv, aber sie war mir nicht geheuer. Sie setzte sich, während ich in der Schule war, in der Altstadt halb nackt auf eine Bank und hoffte, ein Mann würde sie ansprechen. Was hier, natürlich, keiner tat. »Bin ich so hässlich?«, fragte sie mich gereizt, als ich sie nach der Schule vor der Kathedrale abholte, wo sie, eine selbst gedrehte Zigarette im Mund, im Schneidersitz auf der Treppe saß.
»Sofia? Fa la drogata, come sempre. Che disgrazia«, sagte Zio Federico. Sie lebe, wenn sie nicht grad in einer Drogenentzugsklinik sei, auf der Straße.
Um den Besuch abzuschließen, schaute ich auf die Uhr und sagte zu Federico: »Ich muss, mein Schneider erwartet mich.«
Ich hatte nach einem Vorwand gesucht, der meine vielen Reisen nach Neapel rechtfertigte, und hatte ihn in der Person des Meisterschneiders Gennaro Ippolito gefunden. Herrenschneiderei ist in Neapel ein tief verwurzeltes Handwerk: Gearbeitet wird ausschließlich mit Schere, Nadel und Faden. Es gibt keine Reißverschlüsse, die Knöpfe sind an für Laien undenkbaren Stellen angebracht, damit das Kleidungsstück optimal sitzt. Zum Einsatz kommt ausschließlich feinstes, meist in kleinen Webereien gefertigtes Tuch. Mittlerweile arbeiten fast ausschließlich alte Männer in diesen engen Ateliers, eine Zigarette im Mundwinkel, beugen sie sich zehn Stunden am Tag im künstlichen Licht über die Stoffe. Seit sie acht oder zehn Jahre alt sind, also seit über sechzig Jahren, ist das ihr Leben, und ich hege keinen Zweifel an Maestro Gennaro Ippolitos Prognose: Dieses Handwerk wird, wenn seine Generation nicht mehr arbeiten kann, aussterben.
Wenn man sich so einen Anzug von Maestro Ippolito schneidern lassen will, muss man zur Wahl des Stoffs und später zur ersten Anprobe anreisen. Die zweite Anprobe ist nach dem Grobschnitt fällig, schließlich die dritte Anprobe, um die letzten Details anzupassen, bevor der Anzug vom Meister persönlich vollendet wird. Zuletzt muss man ihn nur noch abholen. Das heißt, vier- bis fünfmal musste ich nach Neapel reisen für einen einzigen Anzug. Und bei einem konnte ich es angesichts der aussterbenden Kunst nicht belassen. Wenn ich mir ein weiteres Kleidungsstück machen ließ, egal was, musste ich wieder viermal hin, weil selbstverständlich jeder Stoff anders fällt. Wer als Schneidermeister etwas auf sich hält, nimmt für jedes Stück neu Maß.
Auch in der Schweiz lässt mich meine Herkunft nicht los.
An einem Benefizkonzert, zu dessen Begleitheft ich einen Text beigetragen hatte, traf ich auf Lodovico, einen Dirigenten und Orchestermusiker aus Rom. Lodovico spricht nicht gern Englisch, und so platzierte uns der Veranstalter beim Dinner nach der Aufführung nebeneinander. Wir sprachen über unsere Arbeit, über sein Leben als Musiker und mein Leben als Schriftsteller, über Neapel, die Probleme der Stadt. Ich sagte, ja, ich würde gerne über Neapel schreiben, auch über die Camorra. Vor allem interessiere mich, wie man sich aus einem Clan, in den man hineingeboren worden war, befreien könne.
»Da kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen«, meinte Lodovico und berichtete mir von Maurizio. Lodovico und Maurizio haben beide schwer kranke Töchter, die an einer seltenen Immunschwäche leiden. Alle drei Monate müssen die Kinder in eine spezialisierte Klinik in der Nähe von Rom gebracht werden, wo sie dank teuerster Medikamente für ein paar Wochen aufgepäppelt werden. Zu Hause sind sie höchst pflegeintensiv, können sich nicht eigenständig bewegen, nicht einmal den Kopf schütteln, nicht kommunizieren, müssen gefüttert und gewickelt werden. Für diese Kinder und für die Römer Spezialklinik veranstaltet Lodovico regelmäßig Benefizkonzerte in ganz Europa, und eine Station seiner Reise ist stets die Zürcher Tonhalle.
Maurizio sei ein Muskelprotz mit wilden Tattoos und einem furchteinflößenden Talibanbart, erzählte Lodovico, dabei sei er eine Seele von einem Menschen, sanft und ruhig. Es sei rührend, wie er sich um seine kranke Tochter kümmere, sie liebevoll auf seine Pranken hebe und sie ganze Nachmittage durch den Spitalgarten trage. Wie er sich nicht scheue, sie zu wickeln, zu waschen und anzuziehen. Wie er sich fürsorglich um die anderen Eltern kümmere, Cornetti für alle besorge oder Bier.
»Maurizio war in der Camorra«, flüsterte mir Lodovico ins Ohr, »ein wirklich böser Junge, saß acht Jahre wegen vorsätzlicher Tötung. Zum Glück hat er sich aus dem System lösen können, jetzt arbeitet er als Möbelpacker. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass so ein liebenswürdiger Mensch jemandem ein Haar gekrümmt haben soll. Ich glaube, es würde sich lohnen, wenn Sie Maurizio kennenlernen.«
»Sicherlich«, sagte ich, ohne zu zögern, »würden Sie ihn fragen, ob ich ihn kontaktieren darf?
»Ich rufe am besten gleich an!«
»Nach 23 Uhr?«, warf ich überrascht ein.
Ach, da sei man doch in Neapel gerade fertig mit dem Nachtessen. Lodovico packte sein Handy aus, tippte, hielt den Hörer ans Ohr. Tatsächlich meldete sich jemand. Lodovico konversierte, lachte immer wieder, machte seinerseits ein paar Scherze. Als er das Gespräch beendet hatte, sagte er, während er Maurizios Nummer auf seine Visitenkarte schrieb: »Apposto. Sie können ihn anrufen, er wird Sie gerne treffen.«
Vor meinem nächsten Schneiderbesuch in Neapel rief ich Maurizio an. Er stutzte. Als ich Lodovico erwähnte, erinnerte er sich. Es sei grad eine sehr anstrengende Zeit, klagte er. Falls ich ihn richtig verstand. Er nuschelte beträchtlich. Ich sagte, dass ich nur zwei Nächte in Neapel bleibe, ob wir uns am Mittwoch sehen könnten. Er sprach nicht nur undeutlich, stellte ich fest, er sprach parallel noch mit jemand anderem, in einem sehr kruden Dialekt. »Tu si na cap i cazzi che non vo capì«, hörte ich. Dann wieder zu mir: »Entschuldigung. Mittwoch, 10 Uhr, Piazza Medaglie d’oro. Joy caffè bar. Va buo’? Findest du das?«
Ich war auf die Minute da. Die Joy caffè bar wirkte auf gute Art altmodisch und großzügig. Sie war vermutlich seit den fünfziger Jahren kaum verändert worden. Ich sagte dem gelangweilten Mädchen am Tresen, das kaum die Augen vom Handydisplay heben mochte, ich warte auf Maurizio. Sie reagierte nicht auf den Namen.
»Espresso macchiato«, bestellte ich, »und ein Glas Wasser, nach draußen bitte.«
Ich setzte mich an einen der Tische auf dem breiten Gehsteig, nahm mein Notizbuch hervor und begann den Grundriss der Piazza Medaglie d’oro zu zeichnen. Das Zentrum bildet ein Park mit nackten Platanen und wucherndem Bodengestrüpp. Um den Platz kreist auf mehreren Spuren der Verkehr. Die Zufahrtsstraßen sind nach den mit Goldmedaillen dekorierten Helden des Ersten Weltkriegs benannt. Unter dem Platz hält die U-Bahn-Linie 1, mit direkter Verbindung zum Hauptbahnhof Napoli Centrale. Es gibt etliche Abgänge zur Metro, die teilweise miteinander verbunden sind. Ich betrachtete meine Zeichnung. Dies war der ideale Ort für einen Drogenumschlagplatz. Ich wurde nervös. Polizeikontrollen waren bei den vielen Schlupflöchern schwierig. Um alle Fluchtwege zu blockieren, hätte es eine Armee gebraucht.
Maurizio erschien eine gute Stunde zu spät in Begleitung eines hageren Jungen in einem Nike-Trainer. »Du willst draußen bleiben?«, fragte er mich. »M’a scusà«, sagte er, sich setzend. »Du musst mich entschuldigen. Der Kleinen geht’s nicht gut, sie wollte nicht essen. Wir haben zwei Stunden gebraucht, um sie zu füttern. Dann habe ich sie in die Behindertentagesstätte gebracht. Da geht sie zweimal pro Woche hin, damit Bellamore sich auch mal um was anderes kümmern kann. Marcella, o caffé«, rief er in Richtung Bar.
Maurizio war ein Hüne und hatte wirklich auffällige Tattoos, die sich vom Hals über die Brust bis zu den Armen ausbreiteten. Man konnte sie gut sehen, da er nur ein geripptes, gelblich verfärbtes Unterhemd trug. Den Talibanbart hatte er wegrasiert. Er schaute sich unruhig um, kippte den Inhalt seiner Plastiktüte auf den Tisch. Sieben oder acht Handys fielen auf die Marmorplatte, eines hüpfte vibrierend im Kreis. »Scusami, scusami, ich muss schnell ran.«
Der hagere Junge war hinter Maurizio stehen geblieben, er wurde von der Bedienung nicht begrüßt. Es war anscheinend klar, dass er nichts bestellen würde. Sein Blick blieb keinen Moment ruhig, sein Kopf bewegte sich im Zickzack, vorwärts, rückwärts, nach links und rechts. Seine Hände steckten in den Taschen der Trainerhose. In der linken zeichnete sich ein Messer ab, in der rechten eine Pistole.
»Bellamore war dran«, entschuldigte sich Maurizio. »Was nimmst du? Ein Cornetto? Mit welcher Füllung? Marcella! Porta un cornetto alla crema al signore, sono deliziosi. Die mit Vanille sind wundervoll. Oder lieber eine Pizza? Es gibt eine Pizzeria, gleich da ums Eck, echte neapolitanische Holzofenpizza!«
»Also«, setzte ich an, »Lodovico hat mir erzählt …«
»Lodovico ist ein Genie«, unterbrach mich Maurizio. »Hast du ihn spielen gehört? Ein Genie und ein Heiliger …«
»Ein begabter Musiker. Sehr verdienstvoll, wie er sich einsetzt. Es ist aber auch ein schweres Schicksal, das ihr teilt.«
»Das hier ist ein schweres Schicksal«, Maurizio zeigte auf die Handys, die immer wieder tanzten, ohne dass er ranging. »Nicht mein Kind. Marinella ist ein Geschenk Gottes.«
»Lodovico hat mir gesagt, dass du zu einer Camorrafamilie gehörst, gehört hast, früher, meine ich.« Ich räusperte mich. »Als was arbeitest du jetzt? Stimmt das, als Möbelpacker?«
Ich hatte mein Notizbuch aufgeschlagen und schrieb hinein: Maurizio, traslocatore.
Maurizio lehnte sich vor, sodass sein Leibwächter ihn nicht verstehen konnte, und flüsterte: »Lodovico darf nichts davon erfahren. Versprich es mir. Lodovico ist so ein guter Mensch. Ich möchte ihn nicht enttäuschen.«
Ich wollte traslocatore streichen, aber mein Rollerstift, stellte ich fest, hatte keine Tinte mehr. Ich griff in meinen Rucksack, um einen anderen Stift zu suchen. In diesem Moment machte der guardaspalle, der Leibwächter, einen Satz auf mich zu und wollte mir den Rucksack entreißen.
»Calma, Juri«, wies Maurizio ihn zurecht. »Er macht dir nichts, er hat nur Angst, dass eine Waffe da drin ist. Du hast doch keine Waffe in deinem Rucksack, oder?«
Ich streckte den Rucksack offen hin. Juri schaute aufmerksam in jeden Winkel, richtete sich wieder auf und machte einen Schritt vom Tisch weg.
»Möbelpacker! Neapel ist voller Möbelpacker! Ich schwöre dir, ich würde gerne aufhören. Lieber heute als morgen. Tausend Euro würden uns reichen, mit tausend Euro im Monat würden wir ein Herrenleben führen. Wir haben einen Bauernhof im Matese, den Hügeln an der Grenze zum Latium. Kennst du die Gegend? Ein paar Büffel, etwas Landwirtschaft. Wir wären Könige, und für die Kleine ist die Luft hier in Neapel sowieso nichts.«
Ich verzichtete auf den besseren Stift. »Was ist denn deine Funktion innerhalb der Familie, magst du erzählen?«
Ich sprach ins Notizbuch, als wäre es ein Diktafon.
»Capozona, Zonenchef. Arenella ist unser Viertel. Wir sind die Familie Barella. Das ist mein Bruder Domenico.«
Maurizio griff nach einem Smartphone. Er stellte den Youtube-Kanal einer Lokalzeitung ein und streckte mir das Gerät hin. Die Schlagzeile flimmerte über den Schirm: Razzia al Vomero, arrestato il Boss Domenico Barella. Der Film zeigte Polizeiautos mit blinkendem Blaulicht. Beamte in Montur dringen in ein Gebäude ein. Es ist Nacht. Ein Schwenker nach rechts: Menschen in Schlafanzügen stehen auf der Straße. Die Kamera fährt das Gebäude hoch. Eine Frau schlägt die Läden auf und beschimpft die Polizei wüst. Dann sieht man, wie ein Mann, im Unterhemd, mit wirrem Haar, der offensichtlich im Schlaf überrascht wurde, in Handschellen von zwei Polizisten aus dem Haus geführt wird. Die Kamera bleibt lange auf dem markanten Gesicht. Aus dem Off der Kommentar: »Der Clanchef Domenico Barella ist kaum drei Monate nach seiner Freilassung in seinem Wohnhaus auf dem Vomero wieder verhaftet worden. Er wird für die Ermordung Luigi Petrinis, eines Mitglieds der rivalisierenden Familie Barano, verantwortlich gemacht. Petrini wurde letzten Freitag in einem Attentat auf offener Straße in der Via Gemito erschossen …«
Domenico Barella zwinkert im Vorbeigehen in die Kamera, dann lächelt er in Richtung der Nachbarn im Pyjama, die zwischen Hausausgang und Polizeiauto eine Gasse gebildet haben. Als Domenico an ihnen vorbeischreitet, brandet Applaus auf, und man hört die Leute »Turna ambressa, kehre bald zurück!« skandieren.
Ich gab Maurizio das Gerät zurück.
»Was für Geschäfte macht ihr?«
»Was man halt so macht hier. Drogen, vor allem.«
Ich zeigte auf das Zentrum der Piazza.
Maurizio schüttelte den Kopf. »Nein, keinen Straßenverkauf, ausschließlich Hauslieferdienst. Wir sind hier in einer noblen Gegend. Rechtsanwälte, Ärzte, Unternehmer. Das sind unsere Kunden.«
»Und außer Drogen?«
»Geldverleih. Schutzgeld. Wir betreiben zwei Glücksspiellokale …«
»Aber …?«
»Alle wollen was von uns: Drogen, Geld, Schutz, aber niemand will dafür zahlen … Und jetzt, seit Domenico wieder drin ist, lastet wieder mehr auf mir … Ich war acht Jahre im Gefängnis … Weißt du, was das heißt, acht Jahre? Ich möchte das nie mehr erleben, nicht einen Tag länger …«
Juri, der guardaspalle, räusperte sich und deutete hinter Maurizios Rücken. Aus der U-Bahn-Station kam ein älterer Herr in einem zerknitterten Anzug auf uns zu, eine Aktentasche unter dem Arm. Er erinnerte an einen Beamten, schaute unverwandt zu Boden, erst als er direkt vor Maurizio stand, stammelte er: »Er hat mir die Tür ins Gesicht geschlagen. Ich konnte nichts tun. Er hat wieder nicht bezahlt.«
»Ma che cazzo dici! Was erzählst du für einen Scheiß!« Maurizio war so heftig aufgesprungen, dass der Stuhl hinter ihm den Gehsteig hinunter auf die Straße schlitterte und von einem Auto erfasst wurde. Das Auto bremste. Passanten drehten sich um und schauten.
»Wie viel schuldet er uns. Chillo strunze?«
»Er hat letzten Samstag noch mal bezogen. Zehn Gramm. Macht dreißig Gramm, also fünfzehnhundert.«
»Wann hat er zuletzt bezahlt?«
»Seit Juni nicht mehr. Er hat mit der Polizei gedroht. Du würdest wie dein Bruder enden.«
»Was?« Maurizio fluchte, was sein an Schimpfwörtern reicher Dialekt hergab.
Juri zog seine linke Hand, die mit dem Messer, aus der Hosentasche.
Maurizio schien sich schon wieder beruhigt zu haben. Er nickte, fast resigniert. »OK, Juri, kümmere dich um diesen facc ’e cazz’.«
Er schaute mich an.
»Ich muss gehen«, sagte ich.
»Ruf an, wenn du wieder in Neapel bist. Du musst zu uns zum Essen kommen. Bellamore macht wunderbare pasta e fagioli.« Er beugte sich noch einmal vor: »Wir könnten ins Geschäft kommen. Ich vertreibe erstklassigen Stoff, direkt aus Kolumbien. In Zürich sind die so was von heiß darauf, und bei euch sind die Preise mehr als doppelt so hoch. Mit zehntausend kannst du einsteigen. Damit holst du in der Schweiz spielend hundertfünfzigtausend raus. Überleg’s dir! Du hast ja meine Nummer.«
Stimmt, dachte ich, erst recht nervös. Maurizio Barellas Nummer war auf meinem Handy gespeichert. Ich hatte mit ihm telefoniert, einmal von der Schweiz aus, und gestern zur Absicherung, dass er unser Treffen nicht vergessen würde, aus dem Viertel Pignasecca, wo ich übernachtete. Seine Handys wurden bestimmt alle abgehört. Ich würde bald im Verzeichnis der Verdächtigen der DDA, der Direzione Distrettuale Antimafia, der Antimafiabekämpfungsbehörde Neapels, registriert sein.
2.
Jede Jahreszeit hat in Neapel ihre Vorzüge, außer vielleicht der Hochsommer. Am schönsten ist es im Winter und am allerschönsten im Februar. Es ist die Zeit, in der die frische Luft die Landschaft in die klarsten Farben tunkt. Die Stadt wirkt kernig und ausgeschlafen, das Gelb und Ocker der Palazzi warm und nicht staubig wie im Sommer. Die Wolken am Vesuv und über dem Golf haben Kanten und changieren zwischen Tiefweiß, Napoliblau und Grau-Schwarz. Nicht wie im Sommer, wenn der Dunst Himmel und Meer verschmiert. Als Bewohner des Nordens schätze ich wie eine Eidechse nach Monaten von Frost, früher Dunkelheit und Nebel die südliche Februarsonne, stark wie bei uns die Sonne im Mai. So manches blüht in der Steinwüste der Stadt früher als auf dem Land. Die Rasen und Blumenbeete in den Parks gedeihen in diesen Wochen wie nie mehr im Jahresverlauf, Orangen- und Zitronenbäume haben zu dieser Jahreszeit ihre festen, tiefgrünen Blätter. Endlich sind die Neapolitanerinnen und Neapolitaner wieder gerne draußen! Und auch ich bin unterwegs.
Ich fuhr vom Bahnhof Napoli Centrale zum Bahnhof Gianturco, dem Endbahnhof der Metro-Linie 2 im Osten der Stadt. Mit mir standen einige Touristinnen vor dem Bahnhofsgebäude und versuchten, sich zu orientieren. Ich hatte eine Karte aus dem letzten Jahrtausend in den Händen, die Touristinnen, vor allem Amerikanerinnen, ließen sich von ihren Tablets führen. Sie suchten das Viertel Luzzati, wo die Autorin der Genialen Freundin ihre Protagonistinnen aufwachsen lässt. Wahrscheinlich gibt es Apps mit audiovisuellen Beschreibungen, die die Touristinnen durch den Tunnel, der im Buch beschrieben wird, in das Gebiet des trockengelegten Sebeto-Flusses führen. Ich musste die gleiche Richtung einschlagen.
Ich weiß nicht, was es entlang der Via Gianturco zu besichtigen gibt, außer den Murales, den Wandbildern mit den Kinderdarstellerinnen Lenù und Lila aus der Filmserie, die einige Fassaden zieren. Ich ließ die Schwärmerinnen schauen, ging weiter. Am Horizont begleitete mich der sich wie ausgeschnitten vom Himmel abhebende Vulkan. Der Straßenbelag war löchrig und uneben, sodass ich den Blick nur selten vom Weg heben konnte. Ich ging in Richtung Norden, an Straßen mit malerischen Namen wie Via dello Scirocco und Via Rosa dei Venti vorbei, bis ich endlich, nach fast einer Stunde zügigen Schweizer Wanderschritts, die gezackte Linie des äußersten Wohnblocks des Rione Esposito vor mir sah. Längst war ich der Einzige, der zu Fuß unterwegs war. Hinter der Überbauung erahnte ich die Startbahn des Flughafens, und tatsächlich donnerten später in unregelmäßigen Abständen mächtige Passagierflugzeuge knapp über die Blocks des Rione. Von diesen Flugzeugen aus sieht der Rione wie zwei nicht geschlossene, gespiegelte Ps aus. Entlang der äußeren Straße befanden sich eine Bar, eine Wäscherei und ein Elektrowarengeschäft. Gegenüber war ein eingezäunter Fußballplatz zu sehen. Ich ging den Tönen nach, die ich seit einer Weile hörte: Trompeten- und Fanfarenklänge kamen aus dem Hof des östlichen Ps. Ich bog um die Ecke und sah einen weiten, befestigten, sonnigen Platz voller Menschen. Eine Karnevalsfeier war im Gang. Dutzende verkleideter und geschminkter Kinder standen





























