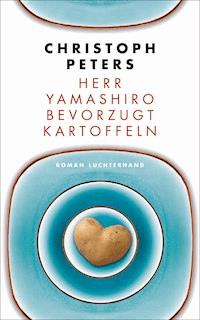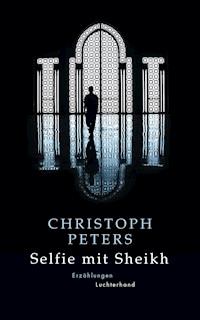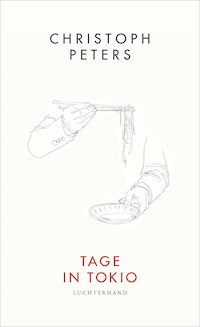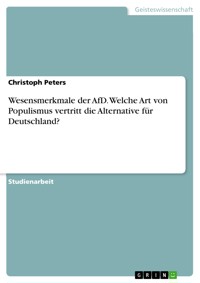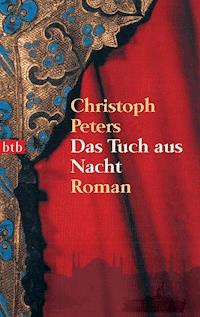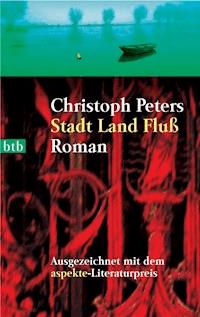
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Ironisch, zärtlich und mit hintersinnigem Humor, in einer präzisen, zuweilen harten, immer poetischen Sprache, verfolgt „Stadt Land Fluß“ die Geschichte der einzigartigen Liebe von Hanna und Thomas Walkenbach: den Weg der großen Gefühle durch die Banalitäten des Alltags, hinein in eine fatale Abhängigkeit, die für Walkenbach nur mit zunehmend raffinierteren Strategien des Selbstbetrugs zu bewältigen ist. Und zusehends treten die wahren Gründe für Hannas Abwesenheit zutage …
Ausgezeichnet mit dem aspekte-Literaturpreis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Ähnliche
Buch
Thomas Walkenbach, dreiunddreißig, ist Kunsthistoriker. Seine Frau Hanna sorgt als Zahnärztin für beider Lebensunterhalt. Doch eines Tages ist Hanna nicht mehr da. Gründe dafür deutet Walkenbach nur an. Um so ausführlicher erzählt er seine Lebensgeschichte, allerdings in der für ihn günstigsten Version. Mit Selbstironie und Galgenhumor zieht er den Leser hinein in die rauhe Welt seiner Kindheit, erzählt vom Studium in der Großstadt, von den ersten ungelenken, dann erfolgreichen Versuchen, Hannas Liebe zu gewinnen, während er auf dem Behandlungsstuhl in ihrer Zahnarztpraxis sitzt. Und zusehends treten die Gründe für Hannas Verschwinden zutage …
Autor
Christoph Peters wurde 1966 in Kalkar (Niederrhein) geboren. Er hat an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe Malerei studiert. Für sein Romandebüt »Stadt Land Fluß« erhielt er u.a. den Niederrheinischen Literaturpreis und den aspekte-Literaturpreis. Christoph Peters lebt heute in Berlin.
Christoph Peters
Stadt Land Fluß
Roman
btb
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der btb-Verlag ist ein Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Copyright © 1999 by Frankfurter Verlagsanstalt GmbH,
Frankfurt am Main Lizenzausgabe mit freundlicher Genehmigung der Frankfurter Verlagsanstalt Umschlaggestaltung: Design Team München Umschlagfoto: o: Corbis; u: Michael Jeiter Satz: Uhl + Massopust, Aalen EM · Herstellung: Augustin Wiesbeck
ISBN 978-3-641-10649-2V002
www.btb-verlag.de
FÜR HILDE
Vorbemerkung
Seit Gabriel Celestes 1605 mit dem Erscheinen des ersten Teils seines berühmten Romans Der gesottene Ochse oder Von der vielfältigen Lust des Fleisches1 die moderne Erzählkunst begründete, haben Schriftsteller aller nachfolgenden Generationen mit Vorreden und Nachworten versucht, den Leser über den Wirklichkeitsgrad ihrer Geschichten zu täuschen. Schon Celestes behauptete, die Berichte über Don Diego da Fama von zuverlässigen Gewährsleuten gehört zu haben, einem maurischen Seefahrer und einem Dominikanermönch aus Toledo nämlich, die jedoch beide, wie Martin Landmann in seinem Buch Maulwurfsschächte2 schlüssig nachgewiesen hat, nie gelebt haben. Die Liste reicht, um nur einige der bekannteren Titel zu nennen, von Magdalena Hunds Das Virginal3, über Sirins berühmtes Skandalbuch Viola4, bis hin zu Lucas Umbras hinreißendem Roman Nadiana5, wobei die Nadja, die ihm den Namen gab, eigentlich Navina heißt. Sie ist die Tochter eines indischen Sikh und der Mutter meines besten Freundes Paul. Umbra behauptete allerdings, Nadja sei Anfang ’72 von Rosenkranz und seinem mystischen Bruder Strohmann in einem feuerroten Fiat X 1/9 (Bertone) gezeugt worden, eine Theorie, die allein durch die Größe des genannten Fahrzeugs ad absurdum geführt wird.
Obwohl sich nach vierhundert Jahren Betrug also eigentlich die Erkenntnis durchgesetzt haben müßte, daß alle Literatur auf Simulation und Mimikry gründet, und sogar die Wissenschaft inzwischen so ehrlich ist, ihre Methoden als zumindest teilweise fiktional zu enttarnen, ist das Verlangen vieler Leser nach Spuren der Deckungsgleichheit von Leben und Werk, Welt und Beschreibung ungebrochen. In schöner Regelmäßigkeit erscheinen geistreiche Feuilletons, wenn endlich intime Tagebücher oder Briefwechsel des einen oder anderen Großschriftstellers veröffentlicht worden sind. Finden sich darin sexuelle Eskapaden, dunkle Obsessionen oder wenigstens alkoholische Exzesse, kann man sicher sein, daß auch die Nachfrage nach Romanen des entsprechenden Autors letztmalig und für kurze Zeit ansteigt. In vielen Buchhandlungen enthalten die Abteilungen Biographien und Modernes Leben inzwischen ohnehin ebenso viele Titel wie das Belletristik- Regal.
Desto nötiger scheint es mir, darauf hinzuweisen, daß die nachfolgenden Aufzeichnungen des Kunsthistorikers Thomas Walkenbach vollständig erfunden sind. Thomas Walkenbach war nicht mein Freund, der sich das Leben genommen und mir seinen Nachlaß anvertraut hat. Ich hatte weder privat noch beruflich je mit ihm zu tun. Ich war weder sein Untersuchungsrichter noch sein psychologischer Gutachter. Ich habe seine Papiere auch nicht beim Erwerb meines Hauses auf dem Dachboden gefunden – ich besitze gar kein Haus. Zwischen meinem und seinem Leben gibt es nicht die geringste Parallele. Er ist Niederrheiner, ich bin Rheinländer, und deren Verhältnis ist – jedenfalls von niederrheinischer Seite – immer ein wenig gespannt gewesen. Ich wurde 1966, also vier Jahre nach Walkenbach, in Oberwesel geboren, mein Vater war Volksschullehrer, meine Mutter Hausfrau. Ich habe in Köln Biologie studiert und arbeite als Ichthyologe am Frankfurter Zooaquarium. Außerdem bin ich im Gegensatz zu Walkenbach Nichtraucher, und am Mittelrhein ziehen wir ein gepflegtes Glas Riesling der niederrheinischen Bier-Schnaps-Kombination vor. Meine Frau heißt Hilde. Sie unterrichtet Latein am hiesigen Mädchengymnasium, obwohl ihr Abitur auch für ein Medizinstudium gereicht hätte. Es geht ihr gut. Daß ihr Name, wie der von Walkenbachs Hanna, mit H beginnt, ist reiner Zufall.
Trotz der umfangreichen Studien, die im Vorfeld dieses Buches notwendig wurden, hält sich meine Liebe für niederrheinische Schnitzkunst nach wie vor in Grenzen. Bei der Suche nach geeigneten Forschungsgegenständen für Thomas Walkenbach fiel meine Wahl allein deshalb auf Henrick Douwerman, weil dessen Lebenslauf nach wie vor gewaltige Lücken aufweist, die ich mit Spekulationen und Halbwahrheiten füllen konnte. Die wenigen gesicherten Erkenntnisse über Douwermans Leben und Werk habe ich größtenteils den Publikationen H. P. Hilgers6 und Barbara Rommés7 entnommen. Letztere war außerdem so freundlich, meine zahllosen Fragen kenntnisreich und – trotz der damit verbundenen Risiken – vor dem Erscheinen ihrer umfassenden Douwerman-Monographie 8 zu beantworten. Des weiteren war Wilhelm Hünermanns Roman Meister Douvermann – Der Bildschnitzer Unserer Lieben Frau9 für den von Walkenbach ganz unwissenschaftlich wiederbelebten Mythos Douwerman trotz seiner miserablen literarischen Qualität sehr hilfreich.
Panofskys Aufsatz Die Perspektive als symbolische Form10 mußte aus dramaturgischen Gründen leider unberücksichtigt bleiben. Ich halte es ohnehin für unwahrscheinlich, daß seine zweifellos treffenden sinnesphysiologischen und wahrnehmungspsychologischen Einwände gegen die Zentralperspektive als ein der Wirklichkeit adäquates Abbildungsverfahren dem Renaissancemenschen bewußt waren.
Besonderen Dank schulde ich meiner wunderbaren Zahnärztin Frau Dr. Andrea Habig und ihren Mitarbeiterinnen, die mir alle zahnmedizinischen Sachverhalte mit Engelsgeduld erläutert haben, selbst wenn andere Patienten deshalb länger warten mußten. Außerdem danke ich Dr. Matthias Bauer, Marcus Braun und Peter von Felbert für manche Anregung und Kritik und natürlich meiner Frau Hilde, ohne deren liebevollen Beistand dieses Buch nicht zustande gekommen wäre.
C.P.
Gabriel Celestes, El buey suelto bien se lame o la desmesurada tendencia a la carnalidad, Madrid 1605
Martin Landmann, Maulwurfsschächte – Literarische Ein- und Ausgänge, Stuttgart 1993
Magdalena Hund, The Virginal, London 1928
W. Sirin, Viola, New York 1955
Lucas Umbra, Nadiana, Berlin 2000
Hans Peter Huger, Stadtpfarrkirche St. Nicolai in Kalkar, Kleve 1990
Barbara Rommé (Hrsg.), Gegen den Strom – Meisterwerke niederrheinischer Skulptur in Zeiten der Reformation, Berlin 1996
Barbara Rommé, Henrick Douwerman und die niederrheinische Bildschnitzkunst an der Wende zur Neuzeit, Bielefeld 1997
Wilhelm Hünermann, Meister Douvermann – Der Bildschnitzer Unserer Lieben Frau, Bonn 1949
Erwin Panofsky, Die Perspektive als symbolische Form, in: Vorträge der Bibliothek Warburg, 1924/25
Nach wie vor liegt der Brief mit dem Befund ungeöffnet da. Ich wandere im Zimmer auf und ab. Drehe Runden um den Eßtisch, gebe mir Mühe, den Brief nicht zu sehen. Ein Esel am Wasserrad, stumpf und unermüdlich. Die Mechanik ächzt, der Brunnen ist leer, Trockenzeit. Ich halte an, stampfe auf, so fest, daß den alten Leuten in der Wohnung unter mir der Putz in die Kaffeetassen rieselt. Und weiter. Bewegung löst Verkrampfungen aller Art. Peripathetik für Stubenhocker. Ein anderes Spiel: Ich versuche, wie als Kind auf den Pflastermustern der Bürgersteige, einen bestimmten Schrittrhythmus einzuhalten. Jetzt ist die Problemstellung anspruchsvoller: Wie nähert man sich innerhalb eines Quadratrasters dem Kreis an? Alternierende Springerzüge – etwas Besseres fällt mir nicht ein. Schräg links, waagerecht, schräg rechts, senkrecht. Mehrfach verknoten sich meine Beine. Das einfarbige Parkett macht die Sache nicht leichter. Durch einen falschen Zug gerate ich in eine Spiralbewegung, drifte nach innen, die Schwerkraft des Zentrums saugt mich unwiderstehlich an, ich zerschelle an der Tischkante. Neuer Versuch. Ich markiere den Ausgangspunkt mit einem Flußkiesel. Vorsichtig, als ginge es ums Ganze, setze ich die ersten Schritte. Allmählich begreifen meine Füße das Gesetz, schaffen die erste Runde. Bald läuft es flüssiger, ich rotiere taumelnd um mich selbst, folge meinem vorgegebenen Kurs, schlingernd, wie ein Planet, der nach einer gewaltigen Kollision noch eben seine Umlaufbahn hält. Dann ein erneuter Fehltritt (mit Absicht, wegen des schrecklichen Endes). Ich verlasse das Gravitationsfeld der Sonne, die Zentrifugalkräfte schleudern mich in die endlosen Weiten des Universums, ich pralle gegen den Schrank.
Es ist gleich vier Uhr, und ich habe heute nichts zustande gebracht. Zum fünften Mal durchsuche ich sämtliche Ablagen nach dem Postkartensatz von Douwermans Xantener Marienretabel, den Astrid mir geschickt hat. Die Karten müssen ganz neu sein, bei meinem letzten Besuch vor acht Monaten lag noch das Schwarzweißphoto von 1970 aus. Den Domherren ist es wider Erwarten nach fünfundzwanzig Jahren gelungen, brauchbare Aufnahmen, insbesondere von der Wurzel-Jesse-Predella, in Druck zu geben.
Im Moment halte ich es am Schreibtisch nicht aus. Unfähig, mich zu konzentrieren, flüchtig, gasförmig. Geist in Diffusion. Alle möglichen Teilchen fliegen in alle möglichen Richtungen, bis der ganze Raum schwächlich nach etwas Undefinierbarem riecht. Um Viertel nach neun der erste Blick in den Briefkasten. Solange er leer ist, halbstündliche Nachkontrolle bis elf. Später kommt die Post nie. Das Telephon funktioniert seit zwei Tagen nicht mehr. Fluchtwege: Für eine Tageszeitung zum Kiosk laufen (hin und zurück gut dreißig Minuten plus fünf Minuten Blättern), sie könnte eine wichtige Nachricht enthalten. Trotzdem Ruhe bewahren. Ein doppelter Cognac, damit das Hirn weich wird. Oder Hemden waschen. Oder Kaffee aufsetzen, den ich dann vergesse. Zwischendrin halbherzige Versuche, zu denken, eine Verbindungslinie zu ziehen, wobei ich keine Ahnung habe, was eigentlich verbunden werden soll. Wahlloses Blättern in den Bildbänden auf der Suche nach etwas Unbekanntem, Übersehenem. Bibliotheks-Paläontologie. Kubikmeterweise Papier umgraben, um das Missing link zu finden, wenigstens ein Fingerglied, einen kleinen Zeh. Oder umgekehrt: Plötzlich taucht eine Perspektivkonstruktion auf (Uccelo? Brunelleschi?), vor Jahren achtlos in der hintersten Gedächtnisreihe abgelegt, ohne Registriernummer, kurz vor dem endgültigen Verblassen. Ich bin sicher, daß sie die Lücke schließen wird, daß sich völlig unerwartete Bezüge herstellen lassen, die ganze italienische Renaissance in neuem Licht. Aber wo ist die Abbildung? Fünftausend Buchrücken lächeln desinteressiert wie die Sphingen von Karnak. In den Kisten mit Postkarten und Photos mache ich seit langem nur noch Zufallsfunde, abgesehen davon, daß ich sie in irgendeinem geliehenen Band gesehen haben könnte, der längst wieder in seinem angestammten Bibliotheksregal verstaubt. Aber von Minute zu Minute bin ich fester überzeugt, daß ich ohne dieses Blatt keinen Millimeter vorankomme, daß meine ganze Arbeit in sich zusammenfällt, unhaltbar ist, wertlos. Natürlich finde ich nichts, bin aber so bis vier, halb fünf beschäftigt, dann kann ich guten Gewissens Feierabend machen. Wie viele Karren Abraum hat Leakey weggekippt, Abend für Abend, ehe ihm eines Tages unter der sengenden Zenitsonne Kenias sein Turkana-Knabe grinsend in die Hand biß. Ausdauer und Geduld und Beharrlichkeit. Morgen wieder.
Ich stelle den Fernseher an, schalte meine sieben Programme durch, Börsendaten, Serengetilöwen, Puppenspiel. Ein Gespräch mit Strafgefangenen: Die Mauern bleiben – Leben nach dem Knast. Davon will ich nichts hören.
Ich schaue durch die verdreckten nikotingelben Wollgardinen auf die Straßenbahnhaltestelle. Mittwochs kam Hanna immer früher aus der Praxis. Vielleicht steigt sie aus, wie sie all die Jahre ausgestiegen ist, sieht zum Fenster hoch, lacht und winkt, wenn sie mich hinter der Gardine erkennt, den Hausschlüssel schon in der Hand. Drückt den Knopf an der Fußgängerampel, obwohl weit und breit kein Wagen zu sehen ist, wartet stur auf Grün. – Dann bin ich schnell in die Küche gegangen, habe den Herd eingeschaltet für Bratkartoffeln, Schnitzel (Hanna liebte Kalbsschnitzel in allen Variationen), Gemüse oder Nudelwasser, und meist blieb noch Zeit, ihr die Tür aufzumachen.
Ich koche gern. Aber jetzt beschränkt sich meine Karte auf gebratene Eier mit Speck, Bananenpfannkuchen und Salbei-Spaghetti. Eine Zeitlang habe ich jeden Tag einen Aufwand getrieben, wie meine Mutter an Weihnachten nicht. Kochbücher studiert, Rezepte verglichen, synoptische Fassungen von Klassikern wie Coq au vin oder Carré d’agneau entwickelt, den halben Morgen Zutaten ausgesucht, mit Fischhändlern gestritten, Metzger zur Weißglut gebracht.
Hanna hat bei Tisch fast immer geredet, oft so ausdauernd, daß sie gar keine Pause zum Essen fand. Alles wurde kalt, schmeckte dann nicht mehr, zumindest war ich überzeugt, daß es nicht mehr schmecken konnte, und gekränkt, weil sie gar nicht merkte, was sie sich da in Fünfminutenabständen zwischen die Zähne schob: daß mein Lammrücken genau auf den Punkt gebraten war, die Sauce wunderbar ausgewogen, die Böhnchen knackig mit einer Spur Knoblauch. Nicht, daß sie schwatzhaft gewesen wäre, jedenfalls nicht im üblichen Sinn. Hanna mußte reden, um Ordnung in ihren Kopf zu bekommen. Ohne Punkt und Komma, ausufernd, angespannt. Ihr Schädel lief ständig über, weil sie nicht in der Lage war, Belanglosigkeiten sofort zu vergessen, auf Abstand zu halten. Vieles erzählte sie drei-, viermal. Die Geschichten irrten wie Ratten in einem Labyrinth durch ihre Hirnwindungen, blieben stecken, kehrten um, wiederholten sich, bis sie endlich ihre Koje entdeckt hatten, Heu und Weizenkörner. Alles schien gleich wichtig und völlig unsortiert, weshalb Hanna sich beim Erzählen immer strikt an die Chronologie hielt. Auf das Nacheinander der Ereignisse war Verlaß, Streichungen konnte man später vornehmen. Erlebnisse mit Patienten, Gebißbefunde, Stolz auf eine besonders gelungene Brücke, Ärger mit dem Labor, weil der Abguß mißlungen war und sie dem hilflosen Opfer zum zweiten Mal das Maul mit dieser gallebitteren Silikonpaste stopfen mußte; die peinlichen Auftritte des Pharmavertreters, der ihr heute Blutungsstiller mit Orangengeschmack, beim nächsten Mal Zahnpolitur auf Bienenwachsbasis aufschwatzen wollte, und regelmäßig Frontberichte vom Kleinkrieg zwischen Frau Almeroth, die schon für Hannas Vater Amalgam gemixt und Speichel gesaugt hat, und Lise, einem siebzehnjährigen Aussiedlermädchen, das Hanna eingestellt hatte und mit einiger Mühe zur Sprechstundenhilfe ausbildete. Etwas abseits Frau Jung, vergeblich um Neutralität bemüht. Lise war tolpatschig, fahrig, überempfindlich, planlos. Sobald ihre Hände nichts zu tun hatten, verschwand sie in Tagträumen. Aber wir mochten sie. Ihr blasses ungeschminktes Gesicht – Lises Vater hielt Make-up für die unmittelbare Vorstufe der Unzucht –, ihren seltsam provinziellen, fast bäuerlichen Charme, den sie ohne Berechnung einsetzte, sinnlich, verspielt und auf altmodische Art rein; ihre ungläubige Freude über Lob oder ein Kompliment.
Lise ist erst vor fünf oder sechs Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen, aus einem hauptsächlich von Deutschstämmigen bewohnten Dorf in der kasachischen Steppe, wo man an den protestantischen Gott und die ferne Heimat glaubte, an das Land der Väter, das gelobte Land. Dort wären die Menschen fromm und fleißig und von Gott deshalb mit den Gütern der Welt reich gesegnet, wohingegen einen hier als aufrechte, aber verschwindende Minderheit die gerechte Abstrafung der russischen Heiden schuldlos mit ins Elend riß. Am Ende ihrer Kindheit, als Lise ihren Platz in der Welt kannte, gelernt hatte, wie man Kartoffeln pflanzt, Hühner rupft, Suppe kocht, die schönen Lieder Ein feste Burg ist unser Gott und He-ho spann den Wagen an, wurde sie in einem wackeligen, aus den Nähten platzenden Überlandbus einige hundert Kilometer nach Baikonur verfrachtet, in eine Sojus-Rakete gesetzt und nach Alpha germani ’90 geschossen. Dort war alles anders.
Ich habe mich immer wieder gewundert, wieviel Hanna über ihre Patienten wußte, wenn sie es denn wußte und nicht bloß schloß. Was kann einer schon groß erzählen, während vier Hände in seinem Mund arbeiten. »Du liest Gebisse wie römische Auguren Hühnerlebern«, habe ich einmal zu ihr gesagt, da war sie für den Rest des Tages beleidigt. Sie speicherte jede Kleinigkeit und rekonstruierte aus Dutzenden von Details ganze Genealogien. Manchmal durchforstete sie den halben Abend alte Patientenkarteien nach längst verstorbenen Urgroßeltern, die vor fünfunddreißig Jahren von ihrem Vater behandelt worden waren. Schon der alte Martinek hatte neben medizinischen Einträgen alles mögliche zu seinen Patienten notiert, wie er behauptete, als Erinnerungsstütze. Bei Gelegenheit, meist sonntags nach dem Kaffee, mußte er sich dann von Hanna anhand der Stichpunkte mit kriminalistischer Hartnäckigkeit nach deren Aussehen, Charakter, wirtschaftlichen Verhältnissen und Schrullen befragen lassen. Sein Gedächtnis war erstaunlich, selten, daß ihm zu einem Patienten nichts einfiel. Er wußte von Skandalen, heimlichen Liebschaften, Ehebruch, kannte die kommunalen Mandatsträger, Bündnisse, Feindschaften, wer wann gegen wen um was prozessiert hatte, Hunderte skurriler Anekdoten. Er erzählte kühl und pointiert, war aber selbst nie verwickelt. Der allseits respektierte Zahnarzt und Jagdpächter Dr. Hans Martinek hatte zeitlebens auf seinem Hochstand gesessen und das Treiben der Sauen beobachtet. Manchmal erkundigte er sich nach Kindern und Enkeln, wunderte sich oder wunderte sich nicht, stellte Ferndiagnosen, machte Therapievorschläge, belehrte Hanna eines Besseren, schimpfte über die gegenwärtige Verteufelung des Amalgams und die Sparpläne des Gesundheitsministers und hieß seine Frau mit distanzierter Bestimmtheit Sherry ausschenken, als sei sie die Sprechstundenhilfe und solle den Bohrer richten.
Hanna liebte ihren Vater abgöttisch. Sie verteidigte ihn gegen jede Kritik meinerseits, vehement und eifernd, als handele es sich dabei um Hochverrat. Ich bin zwiegespalten. Die Zuneigung, die ein Mann für den Vater seiner Frau fühlt, hält sich zwangsläufig in Grenzen. Er war immer schon da, größer und stärker als alle anderen, einen selbst inbegriffen. Er gewährt Schutz, Rechtleitung und Vergebung in Fülle, selbst als halbdebiler Trottel noch, der kaum alleine die Toilette benutzen kann. In seiner Anwesenheit verwandelte Hanna sich in ein kleines Mädchen, das um Papas Anerkennung warb. Sie äußerte nichts, was sein Mißfallen erregte, entgegnete nichts, wenn er Behandlungsmethoden pries, die längst überholt waren, oder politische Ansichten von beispielloser Borniertheit von sich gab. Später, zu Hause, verabscheute sie sich dafür, nahm sich vor, bei nächster Gelegenheit energisch zu widersprechen, aber sobald der Alte selbstherrlich und majestätisch den Kopfplatz am Mittagstisch einnahm, schrumpfte Hanna zusammen, war folgsam und redete nur, wenn sie gefragt wurde.
Im Zimmer über mir fallen Schüsse. Die Leute scheinen schwerhörig zu sein. Das habe ich schon oft gedacht. Sie machen alles laut. Wahrscheinlich leiden die Rentner in der Wohnung unter mir nicht weniger. Das Haus ist fünfundzwanzig Jahre alt. Damals hat sich noch niemand für Schalldämmung interessiert. Es gibt weder Stille noch Dunkelheit. Nie. Bis zehn am Abend kann ohnehin jeder nach Belieben Krach schlagen. Bohrmaschinen rattern, Türen knallen, Schränke werden verrückt; wüste Beschimpfungen, Lustschreie, Lachanfälle, gurgelnde Abflüsse, Popmusik. Wir leben hier öffentlich, sind Lauscher und Belauschte, stehen unter Beobachtung, verurteilen Stimmen. Ich höre Hundegebell. Eine Stahltür wird aufgebrochen und kracht gegen Holz. Überhastete Schrittfolgen hallen durch das Lager einer dubiosen Spedition am Stadtrand: »Hände hoch, Polizei! – Werfen Sie die Waffe weg!« – »Ich habe sie nicht umgebracht.« – Dann der Hauptkommissar, väterliche Strenge über einer Schlucht von Traurigkeit: »Es ist aus, Tom, seien Sie vernünftig.« – Tom sackt auf einen Stuhl und wird von Weinkrämpfen geschüttelt.
Ich weiß nicht, was die Leute an Krimis finden. Tragödien, die früher Jahrhunderte erschüttert und geläutert hätten, verpuffen jetzt im Stundentakt auf allen Kanälen. Zu Tausenden verschwinden die Täter in Untersuchungsgefängnissen, enden im Kugelhagel oder richten sich selbst. Kommissare werden melancholisch, zynisch und endlich auch erschossen. Einer, ein Amerikaner, lief nach sechsundsiebzig Folgen Amok. Beim Zuschauer keine Reaktion, höchstens ein leichtes Kribbeln in der Magengegend, das man Spannung nennt. Ich kenne es von Hanna, die immer wollte, daß ich diese Filme mit ihr anschaue. Oft habe ich dem Mörder gewünscht, daß seine Flucht ein Ende hätte, daß er irgendwo Ruhe fände, einen Ort, um zu begreifen, fernab der Zivilisation, in einem Blockhaus in den Rocky Mountains, aber spätestens am Flughafen wurde er dann doch gefaßt. Vielleicht hatte er noch einige Patronen. Wenn er mit jedem Schuß ein Stück Wild erlegt hätte, wäre er zumindest durch den ersten Winter gekommen. Nach einigen Monaten Aktenverwaltung statt hektischer Fahndung, die Sonderkommission aufgelöst, keine Pressekonferenzen mehr, andere Verbrechen füllen die Zeitungen. Er kann abwägen, ob er sich stellt, ausliefern läßt oder für den Rest seines Lebens als Einsiedler Gold wäscht, Pelztiere wildert, mit besoffenen Indianern Tauschhandel treibt. Vielleicht hält er es auch eines Nachts einfach nicht länger aus. Dieses eine Mal will es dem mürben Hirn nicht gelingen, wach zu werden, sich aus dem Traum zu befreien: der unendlich zähe Widerstand des Abzugs, als wolle er die Tat mit aller Macht verhindern, Millimeter für Millimeter Gewalt, der Finger schmerzt, er wird tagelang schmerzen, dann eine ausgedehnte Phase vollkommener Stille, in der nichts geschieht, bis plötzlich ein dumpfer Schlag durch den Arm fährt, ein Revolver fällt aufs Parkett, noch immer völlig geräuschlos, und daneben eine Tote, für die er sein Leben gegeben hätte. Vielleicht stürmt er schreiend und ohne Schuhe durch die verschneiten Wälder, verballert seine letzte Munition, liquidiert ein halbes Dutzend Krüppelkiefern, bricht zusammen, erfriert. Heldentaten und Verbrechen sind unkompliziert, schnell geschehen. Zufälle, Unachtsamkeiten, Ausnahmezustände. Eine fremde Frau liegt neben dir, gleich, ob tot oder lebendig, gehört ihr das nächste Jahrzehnt. Den Fall mit dem Zuschnappen der Handschellen abzuschließen ist so unsinnig wie die obligatorische Umarmung am Ende von Romanzen, das dezent gebräunte Fleisch in weichgezeichneter Glückseligkeit, schweiß- und faltenfrei, blaue Stunde, ohne Zögern, ohne Angst.
Wir haben uns, seit wir uns kennen, unsere Leben erzählt, Hanna und ich. Das war unsere Art Liebe. Hanna täglich in ihren seltsamen Kreisen, gebetsmühlenartig, so lange, bis sie den endgültigen Wortlaut der Geschichte samt Deutung gefunden hatte. In dieser Fassung wurde sie schließlich gespeichert, ging ins offizielle Repertoire über und konnte bei passender Gelegenheit vorgetragen werden. Ich habe nie erlebt, daß Hanna in Gesellschaft etwas erzählt hätte, was ich nicht bis in Phrasierung und Stimmführung hinein bereits gehört hatte. Während der ersten Zeit habe ich sie oft unterbrochen, um die Sache abzukürzen, weil ich nicht verstand, daß Hanna so die Dinge aus der Beliebigkeit in ihren Besitz überführte. Dann starrte sie mich an, verstört, etwas wirr, aber auch ärgerlich und fuhr unbeeindruckt fort. Wie eine Spinne, die, wenn ihr ein böser Junge das halbfertige Netz zerrissen hat, ja auch kein neues anfängt, sondern einfach da weiterbaut, wo sie stehengeblieben ist, selbst auf die Gefahr hin, ihre Eier am Ende ins Nichts zu legen.
Ich hatte immer Angst, mich zu wiederholen. Nicht aus Furcht, Hanna zu langweilen. Hanna vergaß vieles nach kurzer Zeit. Die Wiederholung selbst schreckt mich, die Gewöhnung an einen bestimmten Wortlaut, der das Vage eindeutig macht und vertreibt. Mir sind die dicken weichen Bildteppiche lieb, an vielen Stellen ausgebleicht, von Motten zerfressen, nur noch ein Schatten ihrer selbst, aber voller zwielichtiger flüchtiger Ahnungen, hier und da noch scharf umrissene Fragmente in leuchtenden Farben, frisch wie am ersten Tag, die winzigen roten Blüten eines knorrigen, wehrhaften Christusdorns, der jahrelang neben der Terrassentür stand und von dem niemand weiß, warum gerade er überlebt hat; leptosome, wenig standfeste Tierfiguren aus grellbunten Pfeifenputzern und krakelig bemaltem Styropor, die nie so gelangen wie in der Bastelanleitung; der schreiende, vor Schmerz, in Todesangst, zum Himmel schreiende, blutüberströmte Maulwurf, dickflüssiges Zinnober auf schwarzem Samt, den Tante Dora mit ihrem langen, schmalgeschliffenen Küchenmesser zwischen den Gitterstäben des Kellerfensters erstach, nachdem er doch auf dem Kiesweg schon mehreren Spatenhieben ausgewichen war, und ich konnte ihn nicht retten. Mit jeder Wiederholung werden die Bilder blasser, fadenscheiniger, bis am Ende der Putz hervortritt, flach und hart und spiegelglatt poliert, der nur das kalte Echo der Worte zurückwirft.
Aber Hanna wollte wissen, wie ich geworden bin, wer ich vor ihr war, gerade so, wie bei ihren Patienten, nur hundertmal genauer. Sie befragte meine Eltern, Onkel und Tanten, blätterte bei jeder Gelegenheit die dicken kunstledernen Photoalben durch, in denen meine Entwicklung bis zum dreizehnten Lebensjahr ausführlich dokumentiert ist, sieben an der Zahl. In den ersten fünf Bänden hat Mutter noch zu jedem Bild einen lustigen Kommentar geschrieben. Hanna brauchte festen Boden unter den Füßen, nicht dieses Puzzle aus zerfledderten Stoffetzen. Also habe ich sie gereinigt, ausgebürstet, nachkoloriert, Stück für Stück vernäht, bis sich zusammenhängende Szenen ergaben. Und allmählich ist darüber auch die Zeit vor Hanna in ihren Besitz übergegangen. Zumindest hatte sie eine Art Vormundschaft darüber. Meine Geschichte ist die, die Hanna verstand. Hätte ich nicht ihr, sondern Regina, Eva oder Astrid erzählt, sähe alles anders aus. Was ich Hanna nicht erzählen konnte, ist irgendwann verschwunden. Vielleicht ist es auch noch da, in einen Kokon eingesponnen, verkapselt und geduldig abwartend, wie die Herpesviren in meiner Lippe, die auf eine schwache Stunde des Immunsystems lauern, auf den nächsten Fieberschub, einen Sonnenstich, einen Vollrausch.
Ich bin jetzt dreiunddreißig, und ein Drittel meines Lebens gehört Hanna ganz. Was mit den ersten zweiundzwanzig Jahren ist, weiß ich, wie gesagt, noch nicht. Gibt es mich unabhängig von ihr überhaupt? Reste von Leinenbinden, eine Handvoll Glassplitter um den Schädel verstreut, die Gürtelschnalle aus Messing, der schmucklose Ring: mein Hügelgrab im Schatten einer Esche, ein Findling als Dach. Ich werde Staubpinsel aus feinstem Marderhaar verwenden, ein Fläschchen Kunstharz, um die morschen Knochen notdürftig zu stabilisieren. Kleine Pappschachteln mit Schaumstoff, mit Watte ausgekleidet und sorgsam beschriftet, nehmen mich auf.
Die Bilder. Die Bilder habe ich für mich. Und die Träume vielleicht, Angst und Schrecken, unbeeinflußt von Mondphasen. Hanna fand Bilder schön oder nicht schön. Zwar ließ sie sich von mir bereitwillig durch Museen und Ausstellungen schleppen, hätte unter anderen Umständen allerdings auch gut darauf verzichten können. Wenn ich ihr wortreiche Erklärungen gab, stilgeschichtliche Einordnungen, gefiel ihr ein Bild gleich viel besser. Ich wollte seit meinem sechzehnten Lebensjahr Kunsthistoriker werden. Vorher wollte ich im Prinzip auch nichts anderes, aber ein Beruf dieser Art existierte bei uns nicht. Ich wollte die Bilder verstehen, die Menschen hinter den Bildern und die Menschen auf den Bildern. Aber das ist nicht Wissenschaft, sondern Liebhaberei. So begründete schon Professor van den Boom sein befriedigend für meine Magisterarbeit. Über meine Karriere mache ich mir keine Illusionen. Sie fällt aus. Ich kann damit gut leben, und Hanna scherte sich auch nicht darum. Man weiß ja, welche Leute die Promotionsstipendien, Assistentenstellen und Universitätspreise bekommen: Papiertiger, Staubmilben. Aus lauter Sorge, eine These nicht beweisen zu können, werfen sie statt Gedanken lieber Anmerkungen zu Anmerkungen zu Anmerkungen aus. Agnes Bleyle, Dissertation über die Floralsymbolik beim Meister des Frankfurter Paradiesgärtleins, 238 Seiten, 657 Fußnoten, summa cum laude. Eva Liebig, meine alte Feindin, hat unlängst in Kleve eine Archivalie entdeckt, der zufolge Henrick Douwerman 1513 mit 140 Gulden verschuldet gewesen ist. Damit reist sie jetzt von Kongreß zu Kongreß.
Anfangs haben viele geglaubt, daß auch aus mir etwas Besonderes würde. Meine Eltern natürlich, aber außerdem die Kindergärtnerin, Lehrer und unser Hausarzt. Etwas Besonderes hieß: Rechtsanwalt, Mediziner, Studienrat. Mein Großvater mütterlicherseits war so sehr von meiner Einzigartigkeit überzeugt, daß er ein Buch über mich begann. Es bricht gegen Ende des dritten Lebensjahrs auf Seite vierundzwanzig ab. Mutter gab mir das Kuvert zehn Jahre nach seinem Tod zusammen mit Briefen und Postkarten. Beim Aufräumen der Kellerschränke war sie darauf gestoßen, und beinahe wäre der ganze Stapel im Müll gelandet. Seine Handschrift kam noch dramatischer daher, als ich sie in Erinnerung gehabt hatte. Mühsam eingeübte Schwünge und Schleifen, ausladend wie bei Autographen aus der päpstlichen Kanzlei, die Großbuchstaben zu wilden Initialen aufgebauscht. Spiralen wickelten sich um die Senkrechten der großen D; Rinder standen wie in einem alten Nachen, der über den blaßblauen Tintenfluß setzte, auf dem Abschwung des R, die Querbalken der T und F flatterten hoch über den Zeilen, Wimpel über Schlachtreihen. Eine andere Zeit wehte herüber, das vergangene Jahrhundert, die Vergangenheit überhaupt, Kaiserreiche, Kanonendonner. Die Vorfahren wisperten sich meinen Namen zu. Aus unserem Stamm wird einer hervorgehen. Aber die Prophezeiung erfüllte sich nicht. Bei meinem letzten Umzug sind die Blätter offenbar endgültig verlorengegangen. Möglich, daß Hanna sie weggeworfen hat.
Die Kunst zu Beginn: fremd, roh, stolz. Gold und Pfeffer. Koggen vor dem Stadttor, die Segel voll Wind. Ein düster geharnischter Mohr im Kreis seiner Getreuen: der Heidenkönig. Die Linke am Knauf des mächtigen Schwerts, in der Rechten das Zepter. Hellebarden, Morgensterne, Bögen, Pfeile, das Löwenbanner. Im Hintergrund tobt ein Kampf. Er wird verlorengehen. Vor dem König sitzt die Königin in einen purpurnen, hermelingefütterten Mantel gehüllt. Ihre Arme scheinen die Erinnerung an einen Säugling zu wiegen. (Das Jesuskind? – Sie ist nicht die Gottesmutter Maria.) Den Armbrustbolzen, der ihr im Hals steckt, sieht man kaum, es fließt auch kein Blut. Zofen ringsherum, kalkweiße Gesichter, aber lächelnd: Ihre Herrin wurde des Martyriums für würdig befunden. Der Himmel hat ein geöffnetes Fenster, Gottvater schaut zu, wohlgefällig, ohne erkennbare Regung. Engel steigen auf und nieder, legen die reine Seele, ein kränkliches, unterernährtes Kind, vertrauensvoll in seine Hände. Der Himmel ist jedoch schon blau, und erste Wolken sind aufgezogen: rechter Flügel des Georgsaltars, A. D. 1484, St.-Nicolai-Kirche, Kalkar, Niederrhein. Der Name des Malers ist nicht überliefert. Eine rätselhafte Geschichte, die mir damals niemand erzählen konnte. Samstag für Samstag eine Dreiviertelstunde Betrachtung, Staunen, vorsichtige Schlußfolgerungen, allesamt falsch. Während der Pfarrer zu Buße und Umkehr rief, auf daß wir nicht dem ewigen Feuer anheimfielen, während das Opfer zur Vergebung unserer Sünden nach der Ordnung Melchisedeks dargebracht wurde, der Segen des dreifaltigen Gottes auf uns kam, Weisung und Trost, Erschütterung und Langeweile, doch auf die entscheidenden Fragen gab es keine Antwort: Wer ist die Frau? Wer der fremde Fürst? Wer hat geschossen? Warum schreit sie nicht?
Hanna hat die Tafel mehrfach gesehen. Sie ist ihr nicht im Gedächtnis geblieben.
Die Legende: Ursula, Tochter aus englischem Herrschergeschlecht, soll mit einem Ungläubigen verheiratet werden. Aber sie hat ihr Herz Gott versprochen. Eine Frist von drei Jahren wird vereinbart, um den drohenden Krieg mit der Sippe des Abgewiesenen zu verhindern. Ursula zieht mit 11000 Jungfrauen nach Rom. Entfacht das Feuer des Glaubens neu. Der Papst legt sein Amt nieder und folgt ihr nach. Auf der Rückfahrt geraten ihre Schiffe in ein verheerendes Unwetter, werden abgetrieben und gelangen über den Rhein nach Köln, das von den Hunnen belagert wird. Alle Gefährtinnen werden erschlagen. Über das Schicksal des Papstes ist nichts bekannt. Aber der Anführer der Barbaren verfällt Ursulas Liebreiz, muß sie besitzen. Sie allein soll sein Weib sein, die Freude seiner Tage und Nächte, sein ein und alles, bis in den Tod. Als sie ihn um Jesu willen zurückweist, eher sterben will, als diese verdammte Menschenliebe aushalten, erschießt er sie eigenhändig mit einem Pfeil. Aber der Pfeil trifft ihn selbst. Sein Kampfeswille ist gebrochen, er befiehlt seinen Truppen den Rückzug, flieht den Ort des Schreckens, verschwindet namenlos in den Wirren der Völkerwanderung. Köln ist frei.
Wir wohnten damals in Niel. Mutter war schon seit zehn Jahren nicht mehr die Dorflehrerin. – Das klingt, als ob sich damals und dort etwas ereignet hätte, und wir wären danach fortgegangen. Aber von Mutter abgesehen, die aus Essen kam, hat bis zu meinem Auszug keiner von uns je woanders als in Niel gewohnt.
Niel gehörte zu Kalkar. Köln lag jenseits des Horizonts und zugleich nahe, Mutters Tanten und Onkel Leonard lebten dort. Niel war ein weitläufiges Dorf. Die Häuser wahrten, außer im Kern, wo sich um Kirche, Pastorat, Schulhaus und Friedhof die vier größten Gehöfte drängten, gebührenden Abstand zueinander. Dazwischen Äcker, Weiden, Koppeln. Es hatte als einzige feste Grenze im Osten den Rhein, nach Westen hin allmähliche Auflösung in Kiesgruben und Brachland, der Süden ging in Weert über, wobei niemand genau sagen konnte, wo Niel aufhörte und Weert anfing. Niel-Nord zerfiel hinter dem Postamt in letzten Melkställen.
Zweimal jährlich Hochwasser, aber der Deich hielt. Wir sahen vom Eßzimmer aus Flaggen und Kajüten dahinter vorbeiziehen, Vater immer ein wenig bang: Vierhundert Jahre zuvor hatte Niel auf der anderen Rheinseite gelegen. Dann war es eine Zeitlang Insel mit Landverbindung bei niedrigem Pegelstand gewesen, am Ende des 17. Jahrhunderts wurde es endgültig linksrheinisch, und bei den Nielern bildete sich eine neue Identität aus. Seitdem rückte der Fluß ab, bis in den fünfziger Jahren die Ufer massiv befestigt wurden. Jetzt ist er zum Stillhalten gezwungen.
Die Wählerliste umfaßte 1962, in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, außer denen der Eltern, 347 Namen. Niel hatte also 349 erwachsene Einwohner. Es gab zwei Bäcker mit angeschlossenem Gemischtwarenladen, einen Schmied, zwei Schreiner, ein Postamt samt Postbeamten, nämlich Hein mit dem tränenden Glasauge, der auch allmorgendlich die Briefe austrug; zwei Wirtschaften, Sahm im Zentrum und Thekaat im Süden, bei denen sich die Stammtische trafen, Hochzeiten, Vereinsfeste und Beerdigungen gefeiert wurden, Beerdigungen fast immer bei Sahm, wegen der Nähe zum Friedhof.
Vaters Großeltern hatten Anfang des Jahrhunderts den kleinen Hof in Südniel gekauft, gleich hinterm Damm, weil auf der anderen Rheinseite kein Stück Acker mehr zu bekommen war. Mein Urgroßvater konnte außer Landwirtschaft nichts. Das Geld stammte von seinem älteren Bruder, der den Familienbesitz bewirtschaftete. Ländereien blieben in unserer Gegend ungeteilt. Söhne, die nicht erbten, mußten sich als Knechte oder Melker verdingen. Die meisten waren kaum in der Lage, einen eigenen Hausstand zu gründen, von Fortpflanzung ganz zu schweigen. Der Zweig verdorrte. Immerhin hatte mein Urgroßonkel bereits ausreichend Vermögen erwirtschaftet, um seinen Bruder abfinden zu können. Der suchte sich eine neue Bleibe und eine Frau. Wir starben nicht aus. Von meiner Urgroßmutter weiß ich nichts, nicht einmal, wie sie hieß, wahrscheinlich Maria oder Anna oder Annamaria.
Manchmal beneide ich Adelige und Großbauern, die ihre Sippen über Jahrhunderte zurückverfolgen können. Sie haben weitverzweigte Stammbäume, die hängen in protzigen Goldrahmen neben dem Kamin. Sie bewohnen Stammlande, zeugen Stammhalter, die immer wieder dieselben Namen tragen, Robert, Johannes oder Wilhelm zum Beispiel, von denen wissen sie allerhand zu erzählen. Fehden, Intrigen, Husarenstücke, Brautraub und Brudermord. Es gibt eine verstoßene Linie, Abkömmlinge des schwarzen Schafs, dessen Erinnerung durch hartnäckiges Totschweigen gewahrt wird. Unsereins kennt vielleicht drei, vier Generationen, danach herrscht Dunkel.
Erbnamen gab es in unserer Familie allerdings auch. Eigentlich hätte ich wieder Jakob heißen müssen, gerufen »Köb«, wie mein Großvater, mein Vater heißt Josef, »Jupp«, wie sein Großvater, immer abwechselnd, aber meine Eltern haben mich, insbesondere auf Mutters Drängen hin, Thomas genannt, und zwar nicht, was noch angegangen wäre, nach dem Aquinaten, sondern nach dem Apostel, dem Zweifler. Als hätte sie von Anfang an ausschließen wollen, daß ich jemals wirklich zu Niel gehören würde. Vielleicht wußte sie auch schon, daß man in Vaters Familie nicht alt wurde, und hoffte, mich vor einem frühen Tod zu bewahren, indem sie die Jakob-Josef-Linie ein für allemal abbrach. Von den Männern hat, obschon sie alle kräftige, äußerlich kerngesunde Leute waren, außer Vater keiner die sechzig erreicht, von den Frauen ist keine siebzig geworden. Wir sind ein Kurzprogramm.
Als Mutter nach Niel kam, Januar 1958, war der Vater meines Vaters – mein Großvater ist er ja genaugenommen nie gewesen – gerade im Alter von fünfundfünfzig an Blasenkrebs gestorben. Vater sagt, er sei ziemlich elend krepiert, und im ganzen Haus habe es noch Wochen später nach Pisse gerochen. Seine Frau, die immerhin sechs Jahre lang meine Großmutter war, starb zehn Jahre später, mit dreiundsechzig an Darmkrebs. Nach mehreren nutzlosen Eingriffen lag sie sieben oder acht Monate zu Hause und wurde von ihren Kindern gepflegt. Die Geschwulst habe sich langsam ins Freie gezwängt. Erst sei da ein erbsengroßes Löchlein gewesen, das nach kurzer Zeit etwas dem Inneren einer Walnuß Ähnliches nach draußen gelassen habe. Als sie tot war, drückte sich ein Fleischkloß von der Größe einer eingeweichten Semmel aus ihrem Leib.
Während ihres Sterbens ging mein Vater, der, obwohl nicht der Erstgeborene, ihr Lieblingssohn war, abends fast täglich zu ihr, um sie zu waschen und die Wunde zu verbinden. Vater löste dann immer auch ihr Haar aus dem Knoten, aufgrund starken Rheumas hatte sie einen fast steifen rechten Arm und konnte es nicht selbst. Er löste ihr Haar, fettig, vom Angstschweiß verklebt, oder strohtrocken, wenn es frisch gewaschen war, das lange alte gelbgraue Haar einer todkranken Frau, die, wenn man den wenigen Photos glauben darf, nie besonders schön gewesen war, Haar ohne Zauberkraft, das sie höchstens in mondlosen Nächten für ihren Mann, meinen verhinderten Großvater, geöffnet hatte, der Sohn öffnete es jetzt, um es zu kämmen, Strähne für Strähne in die Hand zu nehmen, vielleicht zu wiegen, und dann mit der Bürste in kräftigen Zügen vom Scheitel herunterzufahren, was wohl vorher nie ein Mann getan hatte. Vermutlich hätte sie es auch befremdlich gefunden, wenn nicht obszön: unvorstellbar, daß Jakob Walkenbach auf eine derart absonderliche Idee verfallen wäre.
Ich habe sie während ihres Sterbejahres dreimal besucht. Häufigere Besuche hätten sie zu sehr angestrengt, zumal sie zehn Enkel hatte. Ich wußte, daß sie am Sterben war. Sie lag da sehr dunkel im Schlafzimmer, die Blenden waren geschlossen, und die Nachttischlampe gab nur wenig trübes Licht ab. Lag oder saß halb mit zwei dicken Kissen im Rücken in ihrer Hälfte des Ehebetts, während die andere von einem steifen braunroten Stoff bedeckt wurde, der auch über ihre Seite gezogen wurde, wenn sie das Bett noch für länger verließ. Über dem Bett hingen eine nazarenische Lithographie, Anna Selbdritt, und das Kruzifix aus Steinguß. In der hintersten Ecke stand kaum noch erkennbar der Klostuhl, den Vater irgendwo aufgetrieben hatte. Die Luft war stickig. Es roch nach Salbe, Ausscheidungen und etwas Unbekanntem. Sie nahm meine Hände in ihre, ich konnte sie nicht schnell genug wegziehen, und sprach freundlich zu mir.
Ich habe den Geruch jetzt wieder deutlich in Erinnerung. Als Sechsjährigem hat er mir Brechreiz verursacht. Für Hanna verband er sich lediglich mit ihrer Arbeit in der Klinik während des Studiums, im praktischen Jahr: »Ein Krankenhaus riecht nun mal nach Krankenhaus«, sagte sie, »so wie eine Autowerkstatt nach Öl riecht und ein Frisiersalon nach Haarspray.«
Mein Kinderschrecken, nachdem ich begriffen hatte, daß Totsein heißt, jemanden nie mehr wiederzusehen. Er ist geblieben, selbst der Schnaps konnte ihn höchstens für Momente vertreiben. Vielleicht hatte Hanna deshalb keine Angst: Sie kannte den Tod nur aus sicherer Entfernung. Und natürlich auch, weil sie Vertrauen in die Medizin hatte. Und weil von ihren Verwandten niemand vor der Zeit gestorben war.
Es ist ihre entsetzliche Gelassenheit gewesen, die mir Hanna von Stunde zu Stunde fremder gemacht hat, am Ende unerträglich. Wenn sie geweint hätte: »Du mußt bei mir bleiben, Walkenbach, jeden Augenblick mußt du mich festhalten, vor allem wenn es dunkel ist«, das hätte ich verstanden, mir wären Kräfte zugewachsen, ich hätte alles für sie getan. Und jetzt würden wir uns erholen. Wir wären noch einmal nach Italien gefahren, erleichtert oder um zu vergessen, wenigstens für Augenblicke.
Statt dessen: »Ich rege mich erst auf, wenn ich wirklich Grund dazu habe.«
Der Griff, mit dem sie mein Handgelenk umklammert hat, als es zu spät war.
Ich werde diesen Brief ins Altpapier geben, er nützt niemandem mehr.