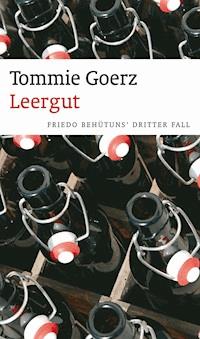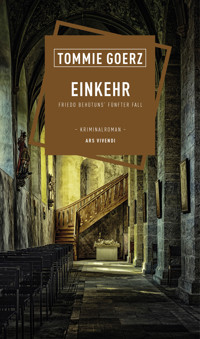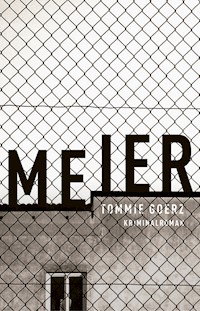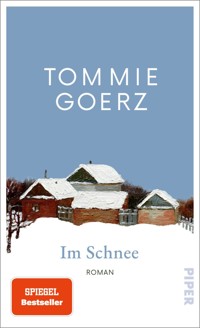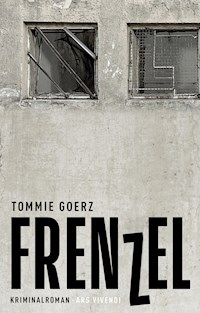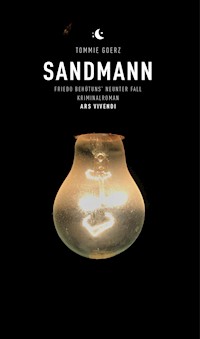Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
An einem Stammtisch irgendwo im tiefsten Franken sitzen die Männer beim Bier zusammen. Schweigen. Und reden sogar. Über den Ort, was so los ist, über Politik, auch über die große. Man ist nicht zimperlich beim Beurteilen der Vorgänge in der Welt, die oft so weit weg ist. Das könnte ewig so weitergehen, doch da, eines Abends, öffnet sich die Tür des Wirtshauses, und die große weite Welt ist plötzlich da: zwei Flüchtlinge, verängstigt, verletzt, gehetzt. Am nächsten Tag sind die beiden verschwunden. Was ist mit ihnen geschehen? Als man auf eine Spur stößt, die hinunter zum Fluss führt, schaltet sich die Kripo ein. Wurde den beiden Gewalt angetan, wurden sie in den Fluss getrieben, ertränkt? Der Nürnberger Kommissar Friedo Behütuns ermittelt – und trifft am Stammtisch wie im Ort auf eine Mauer des Schweigens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tommie Goerz
Stammtisch
Friedo Behütuns’ achter Fall
Kriminalroman
ars vivendi
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (Erste Auflage August 2019)
© 2019 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Lektorat: Dr. Felicitas Igel
Umschlaggestaltung: FYFF, Nürnberg
Motivauswahl: ars vivendi
Coverfoto: © Philip Frowein / plainpicture
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-7472-0052-0
Inhalt
Menu
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
Zu diesem Buch
Danke
Nochmals danke
Vorauseilender Dank
Ein letzter Dank
Der Autor
Menu
Formule à 23 € (Entrée + plat ou Plat + dessert)
Formule à 28 € (Entrée + plat + dessert)
Salade Chicamour (salade verte, tomate, chèvre frais, truite fumée, poivrons confits)
Ou
Melon et Chiffonnade de Jambon cru
Ou
Fondant de Saumon et crevette sauce Hollandaise
¤¤¤¤¤
Suprême de Volaille au Romarin
Ou
Bavette d’Aloyau à l’Échalote
Ou
Dos da Cabillaud au Beurre Blanc Nantais
Ou
Filet de Caille au Vin Jaune
¤¤¤¤¤
Assietté de Fromage
Ou
Coupe de Glace ou Sorbet
Ou
Desserts du Jour
Da ist mir denn erst klargeworden, was Schweinebraten heißt.
Und dazu […] das Kulmbacher Bier, das immer frisch gereicht wurde
Theodor Fontane, »Wanderungen durch die Mark Brandenburg«
I
Das war einfach nur dumm: hierherzufahren, ohne das Wörterbuch einzupacken. Er hatte es daheim liegen lassen. Auf dem Küchentisch, er sah es förmlich noch vor sich. Und da saß er nun und scheiterte an der Speisekarte. Bescheuert. Entrée + plat ou Plat + dessert kostete gegen jede Logik fünf Euro weniger als Entrée + plat + dessert? Zweimal Plat sollte günstiger sein als Plat? Oder hatte er eine Blockade im Kopf? Er verstand es nicht. Die unterschiedliche Schreibweise von Plat, einmal groß, einmal klein, hatte sicher nichts zu bedeuten, das war bestimmt ein Schreibfehler. Und auch hier: Was war Bavette d’Aloyau, was Filet de Caille? Er schaltete sein Handy ein, hoffte auf ein gutes Netz.
Es war der Abend des 26. Juli, ein Donnerstag. Friedo Behütuns, Nürnberger Kommissar und Chef der Sonderkommission Metropolregion Nürnberg, befand sich mitten in Frankreich, gut 800 Kilometer von zu Hause entfernt und auf der Fahrt zu dem Häuschen in der Bretagne, das nach dem tragischen Tod seiner Freundin Julie plötzlich seines war, denn sie hatte es ihm, warum auch immer, ohne sein Wissen testamentarisch vermacht. Südlich von Paris hatte ihn die Müdigkeit übermannt. Eine halbe Stunde hatte er sich gequält und wollte es sich nicht eingestehen, dann aber gab er den Widerstand auf. Es machte keinen Sinn weiterzufahren.
Er hatte diesmal eine neue Route ausprobiert. Autobahn Frankfurt, Karlsruhe, Metz bis kurz vor Reims, bei Châlons-en-Champagne auf die E17 und nach Süden, bei Troyes via E54 wieder westwärts über Sens bis Courtenay, und da endlich runter von der Autobahn. Eintauchen ins Land, das man nur auf den Landstraßen wahrnimmt, spürt. Autobahnen sind überall gleich. Steril. Nur zum Ankommen gebaut, nicht zum Fahren. Auf ihnen ist das Ziel das Ziel, nicht der Weg. Dann aber, noch vor Montargis, hatte ihn die Erschöpfung eingeholt, ihn gepackt und nicht mehr losgelassen. Eigentlich hatte er durchfahren wollen. Nürnberg–Saint-Gildas-de-Rhuys in einem Rutsch, rund 1.300 Kilometer. Musste doch gehen, früher waren sie die mehr als 1.400 Kilometer bis an die Côte d’Argent ja auch am Stück gefahren. Nur Landstraße. Und mit Autos, die noch viel langsamer waren. Mit Käfern oder Enten, die deutlich weniger PS hatten. Schräge Beschreibung eigentlich: Käfer und Enten mit weniger Pferden. Aber Autofahrer waren oft nicht ganz richtig im Kopf, das sah man auch an den Panzern, mit denen sie heute durch die Städte fuhren. Dreieinhalb Tonnen Unsinn für Kleinhirngesteuerte. Er schob den Gedanken beiseite, Dumme gab es immer und überall. Wo war er stehen geblieben? Ach ja, bei der Müdigkeit. Nach 800 Kilometern hatte er es sich eingestehen müssen: Er schaffte es nicht mehr. Mit zunehmendem Alter macht sich halt doch manchmal ein bisschen Vernunft bemerkbar – oder verhielt sich die Vernunft umgekehrt proportional zur Fitness? Je schlapper du bist, desto vernünftiger? Keine Chance, diese Frage jetzt zu klären. Die Augäpfel rollten sich ihm nach hinten, die Lider wurden bleischwer, und es halfen weder Frischluft oder Trommeln aufs Lenkrad noch lauter Gesang. Alles in ihm schrie nach einer Pause. Also hielt er nach einem Parkplatz Ausschau, um sich eine Mütze Schlaf zu gönnen, da sprang ihn bei Sury-aux-Bois unverhofft ein Schild an der Straße an: Hôtel. Chambres. Château de Chicamour. à 1 km – und urplötzlich brach sich der Wunsch nach einem weichen Bett Bahn. Unaufhaltsam. Wahrscheinlich ebenfalls das Alter. Würde er halt erst morgen Nachmittag ankommen, er hatte ja keine Termine. Zumindest wollte er sich das Hotel einmal ansehen. Also bog er gute zwei Kilometer später – in Frankreich muss man die Entfernungsangaben auf Hinweisschildern zu Hotels oder Restaurants grundsätzlich verdoppeln, kein Mensch weiß, warum – nach links ab, als das Schild zum Hotel auftauchte. Und augenblicklich löste sich die Aussicht auf Rettung, also auf ein bequemes Bett, in Luft auf, konnte er seine Hoffnung, hier vielleicht ein Zimmer zu bekommen, nein, es sich überhaupt leisten zu können, begraben. Das war nicht seine Kragenweite. Als er seinen kleinen Ford durch das hochherrschaftlich große, schmiedeeiserne Tor lenkte, sah ihn von weit hinten, halb verdeckt durch uralte Bäume, aus einem riesigen Park ein Schloss an. So majestätisch thronte es da, dass es jeden Ankömmling sofort kleinmachte. Verwinzlichte. Der Adel damals wusste schon, wie er sich über die Plebs erhebt. Ließ sich vom gemeinen Volk, den Armen und Bedürftigen, ein Schloss bauen und sah dann von dort aus auf alles herunter. Gut, dass die meisten dann ab 1789 aus ihren Palästen verjagt worden waren. Liberté, égalité, fraternité. Und in Deutschland? Heute? Die Würde des Menschen ist unantastbar? Hohles Geschwätz, folgenloses. Die Würde des größten Teils der Bevölkerung – und das waren doch Menschen, oder nicht? – wurde permanent und mit aufreizender Selbstverständlichkeit nicht nur angetastet, sondern mit Füßen getreten und verlacht. Wer über viel Geld verfügte, ob als Privatperson oder Unternehmen, konnte politische Entscheidungen in seinem Sinne beeinflussen. Wer wenig hatte, niemals. Das beeinträchtigte die Würde in hohem Maß, kümmerte aber niemanden – auch, weil Eigentum längst nicht mehr verpflichtete, es sei denn zur Demonstration von Macht. Da lag nun also das Schloss und sah, obwohl auf keinerlei Hügel, noch weit entfernt und hinter Bäumen, auf ihn herab. Der Weg dorthin führte in weitem Bogen auf knirschendem Kies durch den Park. Zwang zu Demut und Langsamkeit. Nein, diesen Palast würde er sich nie und nimmer leisten können, außerdem hatte das Schlosshotel wahrscheinlich ohnehin geschlossen, denn es parkte weit und breit kein einziger Wagen davor. Also waren auch keine Gäste hier. Jaguars hätten hier stehen müssen und Rolls-Royce, vielleicht gerade noch Citroëns C6 oder Mercedes Benze ab 500 aufwärts, Porsches hätten hier schon zu ordinär, Maseratis oder Lamborghinis zu vulgär gewirkt. Trotzdem fuhr er seinen Ford furchtlos direkt vor den Treppenaufgang zum Schloss, stieg aus, stieg die Stufen hinauf und probierte die Klinke.
Nicht abgesperrt.
Er öffnete die quietschende Tür, die hakte, weil sie verzogen war, und trat in eine kleine Empfangshalle mit Tresen. Ein Schoßhündchen, zusammengerollt auf einem Sessel, öffnete kurz die Augen, stellte die Ohren auf und drehte sie, schloss dann aber wieder die Augen, schlug zwei-, dreimal mit dem Schwanz und grunzte sich zurück in den Schlaf. Behütuns schaute sich um. Niemand zu sehen.
An der Rezeption fand er ein Telefon mit dem Hinweis, via Nummer 11 den Service zu rufen. Er betätigte die Wählscheibe. Junge Menschen wären wahrscheinlich schon an dieser technischen Anforderung gescheitert. Viel zu analog.
»Oui, juste une minute, s’il vous plaît, j’arrive«, flötete eine Frau aus dem Hörer, und keine Minute später kam sie die geschwungene Treppe herunter.
Ob er ein Zimmer haben könne?
»Oui oui«, selbstverständlich, kein Problem.
»Pour une nuit?«
»Oui.«
»Seulement une personne?«
»Oui, oui.«
Sie sah ihn an. »Avec petit-déjeuner?«
Er nickte. »Combien?«, fragte er vorsichtig. Er sah sich schon abwinken, weil es zu teuer war, und das komische Gefühl der Scham klopfte ganz unwillkürlich an, da er würde zugeben müssen, dass er sich ein Zimmer dieser Preiskategorie nicht leisten konnte oder wollte. Er mochte dieses Gefühl nicht, empfand es als entehrend und kämpfte dagegen an. Und ärgerte sich, dass es überhaupt entstand. Was war das für ein atavistisches Empfinden? Was für eine Insuffizienz? Wozu war das gut?
»64 Euro.« Swassongkattröroh.
64 nur? So billig? Hier in dem Schloss? Er sagte sofort Ja.
Und ob es ein Abendessen gebe?
Selbstverständlich, wenn er wolle. Das Restaurant öffne um 19.00 Uhr.
Madame gab ihm den Schlüssel. Erster Stock, Zimmer 4, Connemara, benannt nach einer irischen Ponyart. Auch die anderen Zimmer waren nach Pferderassen benannt: Haflinger, Shetland, Lipizzan, Appaloosa, Tennessee Walker und so weiter, klapperdiklapp. Warum, kapierte er, als er aus seinem riesigen Fenster sah: Hinter dem Schloss war ein Gestüt, deshalb drehte sich hier alles ums Pferd! Und das Zimmer so französisch, wie es typischer nicht hätte sein können: tiefer, tiefblauer Teppichboden, schwere, tiefblaue Vorhänge, vogelwild vollflächig gemusterte, weiß-blaue Tapete. Tisch, Bett, Stuhl und Schrank alles in weißem Schleiflack. Eine einzige Orgie in Tiefblau und Weiß. Die vielen Muster und die dunkle Farbe machten das Zimmer heimelig und klein.
Er duschte, warf sich aufs Bett und nickte kurz ein. Erfrischt ging er danach hinunter. Unternahm einen kleinen Spaziergang durch den uralten Park, besah sich die halb verfallene Orangerie neben dem Schloss und ging dann hinüber auf die Terrasse, nahm schon mal ein Bier. Und jetzt diese Speisekarte. Er scheiterte bereits am Verständnis der Varianten.
Formule à 23 € (Entrée + plat ou Plat + dessert)
Formule à 28 € (Entrée + plat + dessert)
Menü eins: Vorspeise, Gang oder Gang, Nachspeise für 23 €, Menü zwei: Vorspeise, Gang, Nachspeise für 28 €. Was war da der Unterschied? Er fragte nach – und es fiel ihm wie Schuppen von den Augen: Er hatte das mathematisch gelesen, Punkt vor Strich, das »ou« quasi als Multiplikationszeichen. So was Blödes, total blockiert! Peinliche Nummer. Ihm stieg die Röte ins Gesicht, er schämte sich in Grund und Boden. So also war es zu verstehen: Menü eins war entweder Vorspeise und Hauptgericht oder Hauptgericht und Nachspeise. Wer wollte, konnte auch Vorspeise und Nachspeise haben, dann aber wäre man ziemlich blöd, dachte er sich, und hinterher nicht satt. Variante zwei war ganz normal Vorspeise, Hauptgang, Nachspeise. Das hatte er jetzt verstanden. Nun musste er nur noch wählen.
Okay, jetzt also welche Vorspeise? Schinken mit Melone wollte er nicht, auf Crevetten hatte er auch keine Lust, also blieb nur die Salatplatte des Hauses. Einfache Entscheidung.
Zweiter Gang. Das Beste vom Geflügel, so viel verstand er. Aber was bitte war Bavette d’Aloyau? Er tippte auf seinem Handy, suchte. Bavette? Sabberlatz, Spritzlappen, Bauchlappen. Was auch immer dahintersteckte: danke, nein. Nach Kabeljau stand ihm ebenfalls nicht der Sinn, und Caille war, so sein Smartphone, die Wachtel. An so einem Zwergvogel ist aber nichts dran, dachte er sich. Blieb nur Suprême de Volaille, was immer das konkret war, in Rosmarin. Seine Nachspeise stand ohnehin schon fest. Käse. Er wollte ja satt werden.
Eineinhalb Stunden später sank er mit einem Dreiviertelliter Rotwein, den er sich genehmigt hatte, einem Vorspeisensalat, einer herrlichen, ausgelösten Geflügelbrust samt Schlegel sowie ein paar Stückchen Käse im Magen ins Bett. Jetzt war er in Frankreich angekommen, zumindest hatte sich ihm das Land schon einmal von seiner besten Seite gezeigt und ihn ganz gut aufgenommen.
Er schlief wie ein Stein, fast würde man sagen »traumlos«. Doch als er am Morgen erwachte, blieb er noch liegen – und spürte einem Traum nach. Dem Gefühl, das ihn noch besetzte. Denn da war doch ein Traum gewesen. Luna war ihm erschienen, irgendwie war sie durch seinen Schlaf geschwebt. Hatte ihn bei der Hand genommen, ihn angelacht, sich bei ihm untergehakt. Ausgerechnet Luna. Warum nicht Julie, dachte er, der er doch sehr viel näher war? Warum Luna? Und eine Melodie ging ihm durch den Kopf, uralt, von Udo Lindenberg. Was hatte die jetzt damit zu tun? War die auch aus dem Traum gefallen, von ihm übrig geblieben?
Ich will den Platz in meinem Herzen neu vermieten hieß das Lied, uralt. Obwohl er das ja gar nicht wollte, da wohnte ja noch Julie.
Wann holst du deine Sachen endlich ab bei mir?
Es sind noch so n paar zärtliche Gedanken,
die ich hin und wieder für dich verspür.
Dass sich der Text überhaupt noch in seinem Kopf befand, ja, dass er ihn nicht einmal suchen musste, er einfach so da war, zusammen mit der Melodie … Erstaunlich. Das Hirn ist doch ein riesiger Abfalleimer, dachte er sich, der nie geleert wird. Alles sammelt sich da an, ungeordnet, durcheinander, aufeinandergeschüttet, muffig manchmal, faulig sogar, und dann verändert sich das auch noch alles, gaukelt dir etwas vor, was nie gewesen oder so nie gewesen ist. Vermischt Gehörtes mit Erlebtem und Lieber-so-Gewolltem. Nein, deinen Erinnerungen kannst du nicht trauen, die machen, was du willst. Luna. Woher war die so plötzlich und unverhofft aufgetaucht und im T-Shirt durch seinen Traum gegeistert? Das Lied lief derweil einfach weiter. Ohrwurm.
Ich will den Platz in meinem Herzen neu vermieten,
doch unterm Teppich, da liegt noch so n Gefühl,
nicht besonders groß und nicht besonders intensiv,
aber irgendwie ein Gefühl zu viel …
Schönes Lied eigentlich. Doch Luna? Wie lange hatte er sie nicht mehr gesehen? Zehn Jahre mindestens. Oder zwölf? Eher mehr. Und wie lange nicht mehr an sie gedacht? Er konnte es nicht sagen. Irgendwann war sie ausgezogen aus seinem Kopf, hatte er sie rausgeschmissen, es war nicht anders gegangen. Fünf Jahre waren sie zusammen gewesen, in einer anderen Zeit. Gelitten hatte er wie ein Hund, als sie gegangen war, doch irgendwann ist alles vorbei, auch der Schmerz. Man muss es auch wollen. Muss Erinnerungen verdrängen, begraben, einbetonieren. Das funktioniert. Nur ganz ausradieren kann man sie nicht – und dann kommen sie doch wieder hoch irgendwann, so wie jetzt. Weil das Zeug irgendwo herumliegt. Er schüttelte die Gedanken ab und ging hinunter zum Frühstücken. Danach hatte er den Traum und Luna wieder vergessen.
Am Nachmittag, nach einer dieser so frankreichtypischen, endlosen Landstraßengeraden von Orléans bis Le Mans, weiteren dieser Geraden über Sablé-sur-Sarthe, Craon und Châteaubriant und schließlich einer kurvigeren Strecke über Redon und Vannes parkte er seinen Wagen auf dem Schotter des Seitenweges, der von der Route du Grand-Mont zu seinem Häuschen führte. Endlich da! Friedemann – genannt Friedo – Behütuns hatte kurzfristig Urlaub genommen, es war auch nichts los gewesen, und war der schier unerträglichen Hitze des heimischen Jahrtausendsommers entflohen. 39° C hatten sie schon gemessen, und es war kein Ende abzusehen. Es schmeckte ja nicht einmal mehr das Bier, es wurde viel zu schnell warm, und man konnte gar nicht so viel trinken, wie man Durst hatte. Oder man war umgehend betrunken. Hier aber, nur wenige Meter vom Meer entfernt, war das Klima erträglich. Er schätzte, es waren vielleicht 27, 28 Grad, nicht mehr. Das war gut auszuhalten. Die Entscheidung, hierherzufahren, war richtig gewesen. Er stieg aus und streckte sich, sah sich um. Und sah sofort Arbeit. Die Hecke würde er schneiden müssen, ihre Triebe ragten fast einen Meter in den Weg hinein. Das Gras würde gemäht werden müssen, es stand fast kniehoch, und die Halme kippten schon um. Immerhin war die Wiese hier in unmittelbarer Meernähe grün und nicht so vertrocknet und gelbbraun wie das Gras daheim. Nur – hier war überall Julie. Überall hingen Erinnerungen, die schmerzten. Er würde damit klarkommen müssen. Und werden. Sicher, er hatte es irgendwie erwartet. Aber dass ihre Gegenwart so stark war, so intensiv, das griff ihn an. Er schluckte. Eine Träne lief ihm übers Gesicht, er wollte es gar nicht.
Der Schlüssel lag, eingewickelt in einen Gefrierbeutel als Schutz gegen den Rost, unter dem Stein neben der Eingangstür. Hier lag er das ganze Jahr. Kein Mensch würde ihn dort je vermuten, weil man schon ziemlich blöd sein musste, ihn dort zu deponieren. Machte doch keiner, also würde man ihn dort auch nicht suchen. Er schloss auf. Stockig und abgestanden, fast ein wenig moderig schlug es ihm entgegen. Puh. Behütuns öffnete Fensterläden und Fenster, auch den rückwärtigen Eingang, sorgte für Durchzug. Drehte in dem kleinen, in der Hecke verborgenen Schacht den Haupthahn für das Wasser auf, schaltete im Schuppen am Hauptschalter den Strom ein, schleppte die Gasflasche hinters Haus, schloss sie an. Drehte die Wasserhähne auf und betätigte die Klospülung, ließ die Luft aus den Leitungen. Der Kühlschrank war angesprungen, brummte schon vor sich hin.
Dann setzte er sich erst einmal auf die Terrasse und drehte sich eine. Im Urlaub wollte er sich das genehmigen. Die Fenster müssten auch gestrichen werden, dachte er. Und die Fensterläden. Unglaublich, wie aggressiv doch Meerluft und Salz waren, wie sie Farbe und Holz zusetzten. Auch das Unkraut würde er vom Weg kratzen müssen, sonst hob es ihm irgendwann die Platten hoch. In der Dachrinne hatten sich trockene Piniennadeln gesammelt und ragten über den Rand, auch da würde er hinaufsteigen müssen, sie entfernen, sonst verstopfte das Rohr. Aber hatte er wirklich Lust, das alles zu machen? Da hätte er erst mal mindestens vier Tage zu tun. Wenn’s reicht, dachte er. Außerdem wollte er doch auch Urlaub haben und nicht nur Arbeitsdienst. Aber vielleicht käme er so mit den Erinnerungen an Julie besser zurecht, vielleicht war es dann leichter. Drückte ihn die schmerzende Erinnerung nicht so.
Er pumpte das Rad auf, das im Schuppen stand, und fuhr hinüber in den Ort. Erst einmal Einkaufen. Später briet er sich ein schönes Stück Fleisch, nackt, wie es war, nur mit Knoblauch und frischem Rosmarin, Pfeffer und Salz kamen erst später dazu. Baguette, Rotwein, fertig war das Junggesellenmenü. Jetzt roch es im Haus nach Gebratenem und Fett. Viel angenehmer als Muffel und Moder. Warum bekam man in Deutschland solche Steaks nicht? Was es hier in den Supermärkten gab, war um Klassen besser als das Zeug daheim. Mit einem letzten Stück Baguette wischte er die Pfanne aus.
Eine halbe Stunde später saß er auf einer Bank hoch überm Meer und sah vom Klippenweg hinab dem Sonnenuntergang zu. Segeljachten strömten den Häfen im Golf von Morbihan zu, Möwen standen im Wind über den Küstenfelsen, hinten lag lang gestreckt die Halbinsel Quiberon, noch weiter hinten die Belle-Île, davor die Île-d’Houat. Ein Gleitschirmflieger strich über ihn hinweg, auf einem Klippenvorsprung unter ihm richtete sich ein Paar sein Picknick, und am Weg hinter ihm fuhren laut diskutierend mehrere Kinder auf ihren Rädern vorbei. Es war Ferienzeit. Und ja, es war schön hier, sehr schön sogar. Doch immer auch traurig. Julie. Sie steckte überall, von überallher sprach sie ihn an. Er würde sich daran gewöhnen müssen, damit umgehen. Es war doch schmerzhafter, als er erwartet hatte. Er atmete tief, wieder lief ihm eine Träne übers Gesicht – oder war das nur wegen des Windes?
Hinter der Belle-Île senkte sich die Sonne ins Meer. Eine Formulierung wider besseres Wissen, dachte sich Behütuns, die sich aber hartnäckig in der Konvention hält. Nein, so war es richtig: Die Erde – besser noch: der Teil der Erde, auf dem er sich gerade befand – drehte sich aus dem direkten Strahlenbereich der Sonne heraus. Sauromantisch, so herum. Der Himmel färbte sich rot, der anlandige Wind wurde merklich kühler. Behütuns ging zurück zum Haus.
Als es dunkel war, saß er auf der Terrasse, hatte sich eine Jacke übergehängt und war beim dritten Glas Wein. Er versuchte, die nächsten Tage zu planen. Gegen die Leere und die Erinnerung. Und es ist viel zu tun, wenn ein Haus mit Garten fast ein Jahr lang ungenutzt geblieben war. Wie gut. Aber wollte er das wirklich? War es überhaupt sinnvoll, dieses Häuschen zu besitzen? Er fragte sich das nicht, weil ihn in jedem Winkel etwas an Julie erinnerte, ihre Wärme überall war, sondern ganz rational. Weil es so weit weg war. Und weil es richtig viel Arbeit machte. Er schenkte sich den Rest der Flasche ein. Natürlich hatte er darüber schon nachgedacht, auch auf der Fahrt hierher. Aber er hatte das Thema immer wieder verdrängt. Ja, es war schön, dieses Häuschen zu haben, denn es war Julie. Alles hier war Julie. Und auch, wenn es schmerzte, tat ihre Anwesenheit gut. Aber es war viel zu weit weg von daheim. 1.300 Kilometer. 2.600 hin und zurück. Das waren jedes Mal vier Tage Fahrt. Ziemlich bescheuert. Hecke schneiden, Gras mähen, Fenster, Fensterläden und Türen streichen, sonst zerbröselten sie einem. Die Dachrinnen, das Unkraut, wer weiß, was sonst noch alles zu tun war … Sollte er vielleicht einen Hausdienst beauftragen, wie viele andere der Ferienhausbesitzer hier? Einen Gärtner? Um jeden Monat ein paar Hunderter dafür zu bezahlen? Sicher nicht.
Das Haus blockiert dich, dachte er, weil du immer wieder hierherfahren musst, nirgendwo anders mehr hinkannst. Es nimmt die Freiheit.
Vielleicht sollte er es als Ferienhaus vermieten? Es einem Makler übergeben, damit der sich darum kümmerte? Dann käme vielleicht das Geld herein, das er für den Unterhalt brauchte. Aber dann würden hier ständig irgendwelche fremden Menschen in Julies Sachen wühlen, in ihre Matratzen und Polster furzen, ihre Möbel abnutzen – und er würde im Sommer nicht mehr herkommen können, weil sich die Häuser hier nur zur Hauptsaison vermieten ließen. Während der Ferienzeit.
Was für ein Quatsch, das alles!
Er spürte, wie ein Entschluss in ihm reifte, den er nicht wollte. Gegen den er sich wehrte. Das Häuschen verkaufen? Nein, niemals. Das wäre Verrat an Julie. Das konnte er unmöglich tun.
Oder doch?
Er trank sein Glas leer, löschte das Licht und legte sich schlafen.
Der Gasthof trug den Namen eines Waldtiers, Hirsch oder Reh
oder Hirschkuh, genau weiß ich es nicht mehr.
Robert Louis Stevenson, »Das Licht der Flüsse«
II
Zu Hause litten sie in diesen Tagen weiter unter der Hitzewelle. Es war ein Jahr, in dem alles anders war. Seit April hatte es in Franken nicht mehr geregnet, inzwischen war Anfang August. Nur Sonne, Sonne, Sonne, und es schien mit jedem Tag nur noch heißer zu werden. Schon lange brachten die Nächte keine Abkühlung mehr, und selbst in die Keller kroch bereits unaufhaltsam die Wärme. Dreizehn Grad, so warm war es im Gewölbe unterm Toten Hirsch noch nie gewesen, solange der Hans denken konnte. Sieben, acht Grad waren normal, selbst in den heißesten Sommern, bis auf sechs sank die Temperatur im Winter. Nie darunter. Jetzt aber konnte man schon längst nichts mehr lagern dort unten, der dicke Sandstein war völlig ausgetrocknet und strahlte nur noch Wärme aus. Die ersten Frühkartoffeln waren schon Ende Mai geerntet worden und hatten quasi mit der Einlagerung zu treiben begonnen. Auch bei den Bauern waren die Keller zu warm. Das hatte es noch nie gegeben. Längst waren die Kartoffeln zu einem riesigen, unentwirrbaren Knäuel verwachsen. Mussten sie alles wegschmeißen. Die ersten faulten schon und begannen zu stinken. Der Hans, Wirt im Toten Hirsch, konnte im Keller keine Fässer mehr lagern; die paar, die er noch brauchte, mussten längst oben in den großen Kühlschrank. Am liebsten hätte er eh nur noch Flaschen. Es kam ja fast niemand mehr in den Toten Hirsch, das Gasthaus in Waischmannstein an der Wiesent in der Fränkischen Schweiz. Weil der Hirsch tatsächlich tot war, so tot wie die Wirtin, die Frau von Hans Heiner. Die – seine – Ilse war vor zwei Jahren gestorben, einfach so, beim Klößemachen in der Küche. Ihr war schlecht geworden, sie hatte sich hingesetzt, sich mit der Hand noch über die Stirn gewischt und geseufzt und war dann langsam vom Stuhl gerutscht und hingeschlagen auf den Steinboden. Hatte dagelegen mit dem Kloßteig. Maustot. Seitdem wurde im Hirsch nicht mehr gekocht, nichts mehr gebraten, gab es keine Speisekarte mehr. Nur noch Brotzeit machte der Hans. Habt mich doch alle gern, dachte er. Er drehte ja kaum mehr das Licht an abends. Von außen wirkte das Wirtshaus, als sei es längst zu. Geschlossen für immer. Allerdings – Bier gab es noch und Schnaps. Den brachte ihm der Bayer aus Hetzles. Selbstgebrannt. Zwetschge, Schlehe und Birne. Wenn man aber nur noch eine kleine Brotzeit bekommt, vielleicht ein Käsebrot, Romadur mit Zwiebeln drauf, Paprika und Pfeffer oder mit Musik, dann kommen auch die Leute nicht mehr. Die fahren ja aufs Land, um sich den Magen vollzuschlagen. Billig soll es sein und viel, große Portionen und gut. Eine Menge Fleisch. Schweinebraten, Schäuferla, Kalbsbraten, Rouladen, Rindfleisch, Bratwürste. Klöße, Wirsing, Kraut, Salat. Was aber sollen sie in einem Gasthof, wo sie, wenn überhaupt, nur eine Brotzeit bekommen, ansonsten nur Getränke? Nichts. Dem Hans war es gerade recht.
Seit zwei Jahren ging das im Toten Hirsch jetzt schon so. Seither waren die Fenster nicht mehr geputzt, war die Küche kalt, nichts mehr los. Trotzdem machte der Hans jeden Tag auf, außer am Donnerstag, da war offiziell geschlossen. Reine Gewohnheit. Donnerstag, am Ruhetag, war früher immer geschlachtet worden, und er hatte es beibehalten, dass dann offiziell zu war, obwohl seit dem Tod seiner Ilse auch nicht mehr geschlachtet wurde. Aber sonst hatte der Hirsch offen, so wie’s dranstand. Und es kamen ja auch welche. Vor allem natürlich die paar aus dem Ort, immer dieselben. Die den Toten Hirsch brauchten, weil hier ihr Platz war, ihr Stammplatz. Auch am Donnerstag, Ruhetag hin oder her. War denen wurst, war schon immer so gewesen. Wussten ja nicht, wo sie sonst hinsollten. Weil die Wirtsstube für sie das Wohnzimmer war. So kamen sie wenigstens raus. »Wannst niad fuatgöisd, höisdas dahoam niad ass«, sagt man in der Oberpfalz drüben und hat damit so recht. Gäbe es den Toten Hirsch nicht, säßen die Männer alle daheim. Jeder allein für sich. Oder mit seiner Alten, die bettlägrig war wie die vom Lesau oder garstig wie die vom Pinzberger. Das sagte der zumindest, sonst fand das kaum einer. Aber der musste ja mit der Gunda leben, und da gab’s halt oft Streit. Normal. Laut ging es dann zu, und sie schlugen sich auch öfter mal. Sie hatte schon manchmal ein blaues Auge gehabt. Sie sei gegen die Schranktür gelaufen oder gestolpert, hieß es dann, sie sah ja auch schlecht – und wenn sie ihre dicke Brille nicht aufsetzte, konnte sie schon mal irgendwo dagegenlaufen. Umgekehrt aber kam er auch schon mal mit einem Veilchen oder einer aufgeplatzten dicken Lippe. Denn die Gunda war nicht so zimperlich. Die konnte schon auch mal zuhauen. Und trotzdem liebten sie sich, der Peter und seine Gunda. Oder sie kamen nicht voneinander los, was das Gleiche war. Fast. Sie lebten in der alten Mühle gleich drüben, direkt am Fluss, und manchmal hörte man bis auf die Straße, wie sie sich anbrüllten, aber wen ging das etwas an? Niemanden nichts. Auf jeden Fall hatten ein paar Männer aus dem Ort im Toten Hirsch ihren Platz, schon seit Jahren. Der Lesaus Alfred, den alle nur Fredl nannten und der früher einmal der Bäcker im Dorf gewesen war; der Teuchatzn Mane, der den Linienbus fuhr hinüber nach Bamberg oder Pegnitz und hinauf bis Bayreuth; der Störnhofers Rudolf, Platzwart am Campingplatz unten am Ortsausgang, den alle nur Dschoh riefen aber keiner wusste, warum; und der Brandner Siegfried, der mit seinen achtzig Jahren immer noch in der kleinen Werkstatt hinter seinem Haus droben die Wirbel drechselte für Geigen, Bratschen, Cellos und Kontrabässe in aller Welt. Aus schwarzem Ebenholz. Gemütlich ein paar Stunden am Vormittag, dann kam er herüber und saß hier am Tisch. An seinem Platz. War ein schlauer Fuchs, der Brandner, wie sie hier sagten. Beim Vornamen nannte ihn keiner, höchstens einmal einer Siggers. Er hatte die Stückzahl reduziert und die Preise erhöht – und die Japaner boten jetzt noch mehr, als er verlangte. Überboten sich. Weil sie seine und nur seine Wirbel wollten, keine anderen. Nur die originalen. Ein rund gedrechseltes, längliches Stück Holz mit einem Griff dran, glänzend geschwabbelt und manchmal verziert mit einem kleinen Ring aus Elfenbein oder Gold oben am Scheitel, mehr war das nicht, und der Brandner feixte sich einen. Ab mittags um halb zwei, zwei saß er hier. Zwei Seidla bis fünf, halb sechs, manchmal drei, dann ging er wieder heim. Wie die anderen. Nur wenn was Besonderes war, manchmal, saßen sie länger. Man redete, aber oft sagte man auch nichts. Weil nichts war. Was sollte man da auch reden? Und jetzt, bei der Hitze, war es sowieso zu mühsam. Man bewegte sich möglichst nicht, weil man sonst nur schwitzte. Man schwitzte ja so schon genug, und das Bier wurde viel zu schnell warm.
Der Mais auf den Feldern war verdorrt, die Kartoffeln – Erdäpfel oder Ärbfl oder Bodaggn – waren nicht einmal faustgroß geworden und das Korn höchstens zwei Spannen hoch, die Ähren meist taub. Das Stroh würde knapp werden dieses Jahr, hatten sie gesagt, weil das Korn nicht wuchs. So etwas hatte es noch nie gegeben. Die Wiesen, ausgenommen die unten direkt am Ufer, lagen wie staubige Wüsten, die Böden bretthart und rissig, die Blätter der Bäume vertrockneten am Ast. Wurden gar nicht erst bunt, sondern gleich braun. Die Bäume seien maustot, hatte einer gesagt, längst abgestorben, würden nächstes Jahr nicht mehr austreiben. Müsse man alle fällen, Katastrophe. Was war bloß los mit der Welt?
Ja, und der Sebastian Schweinthal, den sie Wastl nannten, kam auch fast täglich, Landwirt und Schweinemäster. Der trank immer vier, manchmal auch fünf. Aber vier waren es immer. Der hatte vor einem Jahr den Hof an seinen Sohn übergeben, den Anton, und der hatte auf fast vollautomatisch umgestellt. Seither gab es für den Wastl nichts mehr zu tun. Gar nichts. Musste nicht mal mehr die Schubkarren fahren mit dem Mist, das machte jetzt alles »die Maschin«. Der Wastl hatte ebenfalls seinen festen Platz, gleich vorne der erste Stuhl. Sein Anton würde Schwierigkeiten kriegen dieses Jahr mit dem Stroh, das er zum Einstreuen brauchte. Weil es keines mehr gab. Das machte dem Wastl Sorgen.
Und dann waren da immer die Gedanken. Kamen und blieben und quälten. Gingen nicht weg. Früher hatte der Hans einfach dagesessen wie die anderen auch. War ab und zu aufgestanden und hatte ein Bier gezapft, hatte den Fliegen beim Brummen zugehört oder dem Kühlschrank, dem Ticken der Uhr und der Verdauung vom Fredl, in dem es immer gluckerte, hatte die Autos vorbeifahren hören draußen oder dem Schnarchen vom Wastl gelauscht. Der schlief öfter einmal ein. Und schlief fest. Jetzt aber kamen immer öfter die Gedanken. Ließen sich auch nicht abstellen. Weil so viel zu bedenken war.
Der Traum ist aus.
Patrick Modiano, »Eine Jugend«
III
Nein, es hatte keinen Sinn, er hatte sich entschieden. Besser: Es hatte sich entschieden. Es war eine Entscheidung, die sich selber getroffen hatte, er war dabei nur Beobachter gewesen und hatte nichts zu sagen. So hatte er es erlebt. Sie hatte scheinbar aus dem Nichts heraus begonnen zu keimen, war über die Tage gewachsen und größer und größer geworden, immer mächtiger. Aber sie hatte auch die besseren Argumente auf ihrer Seite. Manche nennen das Sieg der Vernunft, Behütuns tat es nur weh. Trotzdem: Wenige Tage nach seiner Ankunft stand er beim Makler unten im Ort, schräg gegenüber von Gemeindehaus und Post.
Verkaufen? Wie war die Adresse, sagten Sie? Route du Grand-Mont? An der kleinen Seitengasse? Der Makler war sofort hellwach. Kaffee? Wie weit vom Meer entfernt, sagten Sie? Er rollte einen Plan aus. Dieses Objekt hier? Nur 200 Meter? Kein Haus mehr dazwischen bis zu den Klippen, freie Sicht aufs Meer? Wie viele Zimmer? Aha, ein großer Wohnraum mit Küche und Kamin, ein Arbeitszimmer, zwei Schlafzimmer, ein Bad, ein WC? Hundertzwanzig Quadratmeter insgesamt? Und das Grundstück? Über dreieinhalbtausend, sagen Sie? Der Zustand ist gut, der des Hauses, meine ich? Na ja, ich muss mir das einmal ansehen, aber eine Million, das kann ich Ihnen direkt sagen, bekommen Sie dafür auf jeden Fall – alleine schon das Grundstück! Das lässt sich ja dreimal teilen, mindestens.
Behütuns hatte verstanden. Würde er verkaufen, würde das Haus abgerissen werden und drei oder vier neue stattdessen gebaut. Das wäre endgültig. Ihm blutete das Herz bei dem Gedanken. Andererseits: Was störte es ihn, wenn er sowieso nicht mehr hierherkam?
Ja, er würde viel Geld dafür bekommen. Aber brauchte er das? Nein. Das brachte einen nur auf dumme Gedanken. Andererseits: Was sollte er mit dem Haus? Es zerriss ihn bei solchen Gedanken.
Zwei Tage darauf, am frühen Morgen, war die Entscheidung auf einmal gefallen. Gegen das Gefühl, für die Argumente. Für die Vernunft. Und für die Freiheit. Gegen die Erinnerung. Gegen Julie. Für das Akzeptieren des Endes. Allerdings: Jetzt konnte er hier nicht mehr sein. Es war, als schämte er sich vor dem Haus, als habe er sich ihm gegenüber schuldig gemacht. Alles hier war jetzt aus, das Urteil gesprochen. Er konnte nicht eine Nacht länger bleiben, konnte nicht, so war es ihm, mit jemandem zusammen sein, den er verraten hatte, verkauft, ans Messer geliefert. Nein, undenkbar. Also packte er seine Sachen, lief noch einmal durchs Haus und überlegte, was er vielleicht mitnehmen sollte, sich bewahren von Julie, aber dann nahm er nichts mit. Es waren ihre Sachen, sie gingen ihn nichts an, er hatte kein Recht darauf. Was er von ihr besaß trug er in seinem Herzen, alles andere war nichts wert. So nahm er Abschied. Für immer. Mit einem Kloß im Hals reiste er ab. Fuhr einfach so los, ohne Plan Richtung Norden. Nach Hause wollte er noch nicht.
Der Makler würde sich um alles kümmern und sich melden. Chopins Nocturnes schallten aus dem CD-Player und füllten melodisch den Innenraum, gespielt von Daniel Barenboim. Die beiden Scheiben hatte er zuletzt doch noch mitgenommen, Julie hatte sie so gerne gehört. Wieder liefen ihm Tränen übers Gesicht.
Das musste jetzt langsam einmal aufhören, schalt er sich und zog den Rotz hoch. Nimm dich zusammen! Die Tränen kamen ihm wieder viel zu oft in letzter Zeit. Das hatte er doch alles schon überwunden. Oder nicht?
Sie sagen, integriert euch; zu denen, die es versuchen, sagen sie,
ihr seht doch, dass ihr nicht zu uns gehört.
Virginie Despentes, »Das Leben des Vernon Subutex 1«
IV
»Ich pack’s nicht. Die sind nicht da!« Polizeimeister Kaipershofer pfiff durch die Zähne. Sein Kollege Mühlwörth, ebenfalls Polizeimeister, nickte, schob sich die Mütze in den Nacken und wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn.
»Die Vögel sind ausgeflogen.«
»Ja, scheinen abgehauen zu sein.«
»Sieht so aus. Vielleicht sind sie noch auf dem Gelände.«
»Sofort alles abriegeln!«
Schlagartig herrschte Aufregung im Bamberger Ankerzentrum im Baumstraßenviertel. Es wurde laut. Die beiden Polizeibeamten Karl Kaipershofer und Willi Mühlwörth lösten Alarm aus und forderten Verstärkung an. Mühlwörth rannte durch den Gang, dem Treppenhaus zu, seine Schritte hallten. Kaipershofer sprach ins Funkgerät. Das spuckte verzerrte Antworten aus, gequetschte Sprache, und knackte. Es war noch vor halb fünf in der Früh. Draußen begannen gerade die ersten Farben zurückzukehren, im Nordosten wurde der Himmel hell, in knapp fünfzig Minuten würde Sonnenaufgang sein. Ein weiterer herrlicher Tag kündigte sich an, einer von vielen in diesem Sommer.
Vereinzelt öffneten sich Türen in den langen Gängen, verschreckte Gesichter schauten heraus, verängstigt und verstört – aber nur für kurze, vorsichtige Blicke, dann schlossen sich die Türen wieder. Leise. Besser, man fiel nicht auf. Abschließen ließen sich die Türen nicht. Das war hier so. Vorschrift. Privatheits- und Rückzugsunterbindung qua ministeriellem Erlass. Eine von zahlreichen gezielten Maßnahmen, um nur ja kein Gefühl von Geborgenheit aufkommen zu lassen. Man wollte diese Menschen hier schützen, aber auch, dass sie wieder zurückkehrten in ihre Heimatländer. Sie sollten nicht hierbleiben.
Keine drei Minuten später schwärmte draußen das Wachpersonal aus auf der Suche nach den beiden Afghanen. Die Asylbewerber Jamal Nasary und Sami Zhowandai hätten abgeschoben werden sollen. Heute noch. Um 8.30 Uhr ging ab Nürnberg der Flug. Früh genug, um der Post der Anwälte zuvorzukommen. Das war der Plan der Behörde unter Leitung und in Verantwortung von Innenminister Joachim Herrmann. Die Post würde erst um neun Uhr zugestellt werden können – leider zu spät. Dann nämlich wären die beiden Afghanen schon in der Luft. Pech gehabt, blöd gelaufen, nichts mehr zu machen. Klappte meistens. Der Schnellere gewann.
Fast 1.400 Menschen lebten hier, für bis zu 3.400 war das Ankerzentrum geplant, so viele konnte man in den Gebäuden der alten US-Kaserne unterbringen. Sechzehn Personen pro Dreizimmerwohnung, für alle sechzehn nur eine Küche, eine Dusche, ein Klo. »Anker« bedeutete Ankunft, Entscheidung, Rückführung, in dieser Reihenfolge. Schon der Name machte klar, was man hier mit den Geflüchteten vorhatte. Es hieß mit Absicht nicht Anke, nein, das »r« musste als Abschluss schon sein. Die Rückführung, das Abschieben waren als Ende des Aufenthaltes bereits mit eingeplant. Von vorneherein. Der Zynismus christlicher Politiker ist pelzig und kennt da keine Grenzen. Lauthals forderten zwar Herrmannisten wie Söderasten von den Menschen, dass sie sich integrierten, aber man sonderte sie konsequent aus, sperrte sie hinter Stacheldraht und gab ihnen dazu keine Chance. Rückführung war das Ziel dieses Zentrums, ganz klar. Alles andere war gelogen.
Seit Jahren gab es dieses Lager, umzäunt und bewacht, aber erst seit heute, dem 1. August, hieß es Ankerzentrum. Es war noch keinen Tag alt, und schon gab es den ersten Vorfall. Denn diesmal schien es, als seien die Afghanen die Schnelleren gewesen. Die Flüchtlinge waren geflohen. Man fand im eisernen, stacheldrahtbewehrten Stahlzaun, der das Lager umschloss, ein Loch, hineingeschnitten mit Bolzenschneider und Akkuflex, gerade groß genug, dass ein kleiner Erwachsener hindurchschlüpfen konnte.
Der Bolzenschneider lag noch neben dem Loch. Er war mit einem blauen Punkt gekennzeichnet. Lackfarbe. Dieses Werkzeug hatten sie bestimmt irgendwo gestohlen. Nur – wie hatten sie es hier hereinbekommen? Wurde so schlecht kontrolliert? Es musste dringend mit den Verantwortlichen des Wachunternehmens gesprochen werden. Oder hatten die zwei Helfer von außen? Die Verwendung einer Flex und auch ihr Fehlen am Tatort deuteten darauf hin.
Sie würden sich die Aufzeichnungen der Überwachungskameras ansehen.
Man gab für die beiden Afghanen intern eine Suchmeldung heraus. Sie würden nicht sehr weit kommen: Einem der beiden Geflohenen fehlte der rechte Fuß, er trug eine Prothese.
Die Abschiebung mit dem Halb-neun-Uhr-Flug aber konnten sie vergessen.
•
Es war noch nicht zehn am selben Tag, da gingen bereits die Beschreibungen der beiden Afghanen samt Bild und dem Hinweis, dass einer der beiden eine Unterschenkelprothese trug, an sämtliche Polizeidienststellen Bayerns. Es wurde nicht offiziell nach den beiden gefahndet, dafür hätte es eines Haftbefehls bedurft, der aber hätte sich nicht begründen lassen. Die beiden Afghanen hatten sich nichts zuschulden kommen lassen, und kein Richter hätte den Haftbefehl ausgestellt. So ging lediglich die Information raus. Die Beamten sollten die Augen offen halten.
Die Hitze wurde schon am Vormittag beinahe wieder unerträglich.
Der Bus war pünktlich und wie fast immer leer.
Judith Schalansky, »Der Hals der Giraffe«
V
Wer mit den Öffentlichen von Bamberg nach Hollfeld fahren will, muss den Bus nehmen, eine andere Möglichkeit, dorthin zu gelangen, gibt es nicht. Zudem muss er Zeit mitbringen und pünktlich am Bahnhofsvorplatz sein, sonst ist der Bus weg. Und er muss wissen, wo genau dort dieser Bus hält bzw. abfährt, denn die Haltestelle ist nicht, wie ihre Bezeichnung »Bamberg Bahnhof« vermuten lässt, direkt am oder vorm Bahnhof, sondern gut zweihundert Meter schräg in die Ludwigstraße versetzt – dort, wo man sie als Ortsfremder und Reisender nicht so ohne Weiteres suchen würde. Ein Hinweisschild zum Haltepunkt gibt es nicht, und wenn man im Bahnhofsbereich herumstehende Personen, die deutlich sichtbar ein Deutsche-Bahn-Logo auf der Jacke tragen, nach dem Abfahrtsort befragt, kann man das Pech haben, zur Auskunft zu bekommen: »Doudmer laid, nah, dou hobbi ka Ahnung, dou mäin S’ an andern frohng. Mir senn vo Nämbärch. Mir kennersi dou ned aass.« Dem Wanderer Ferdinand Fellner zumindest war es so ergangen.