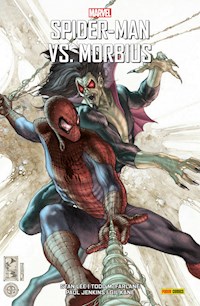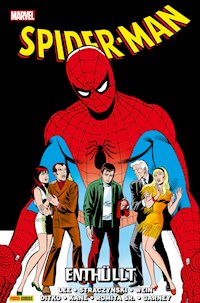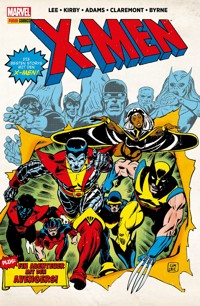Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Stan Lee's Alliances
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Cameron, ein nur mäßig erfolgreicher YouTuber (16 Abonnenten), wird während eines Livestreams auf dem Eriesee plötzlich vom Blitz getroffen. Das Video geht viral und Cameron ist endlich so berühmt, wie er immer sein wollte. Allerdings liegt er mit einem brummenden Schädel im Krankenhaus. Erst zu Hause stellt Cameron fest, dass der Krawall in seinem Kopf von den elektronischen Gegenständen in seiner Umgebung stammt. Er kann sich mental mit ihnen verbinden und sie manipulieren: sein Smartphone, seinen Laptop, das Fitnessarmband seiner Mutter und sogar den Kühlschrank. Diese Superskills wird Cameron auch brauchen, denn eine dunkle Macht bedroht den Planeten, deren Zerstörungskraft all unsere Vorstellungen sprengen wird. "Typisch Stan Lee, dass er sich das Beste für den Schluss aufgehoben hat. Was das für ein Film werden wird …" James Patterson Stan Lee , popkulturelle Legende und Mastermind hinter Marvel´s Avengers™ , Black Panther™ , X-Men™ und Spider-Man™ , wollte schon immer einen Roman schreiben. Im Alter von 95 Jahren hat er sich diesen Wunsch erfüllt und seine Fans mit einem letzten halsbrecherischen Abenteuer überrascht. Stan Lees Jugendroman ist bis oben hin voll mit so aufregender Technologie , dass man die Zukunft kaum abwarten kann – eine um KIs erweiterte Lebenswelt, die manchmal nur eine Illusion ist: a trick of light .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 541
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
PROLOG: AN EINEM FINSTEREN ORT
VOM BLITZ GETROFFEN
EINGESPERRT
CAMERON: LOST IN SPACE
ERWACHEN
EIN SIGNAL WIRD EMPFANGEN
WAS IST MIT CAMERON ACKERSON PASSIERT?
EIN NEUANFANG
ANKUNFT
DER DUFT DER FREIHEIT
DAGGETT SMITH IST RAUS
UNTER KONTROLLE
CRUSH
EIN FREUND IN DER NOT
EIN UNSCHLAGBARES TEAM
ARIA SLOANE FLIEGT AUF
GEMISCHTE GEFÜHLE
IMMER NÄHER UND NÄHER
DR. NADIA KAPUR BRINGT DEN MÜLL RAUS
OPERATION BURN-IT-DOWN
GEFANGEN
ERWISCHT
KAMPF UND FLUCHT
AUF DER ANDEREN SEITE DER TÜR
IM AUGE DES STURMS
SORRY, YOUR PRINCESS IS IN ANOTHER CASTLE
DER ERFINDER ERZÄHLT
CAMERON HÖRT ZU
TOTALAUSFALL
ENTHÜLLUNGEN
BEFREIT
LIEBESKUMMER
VERBUNDEN
WILLKOMMEN, TRUE BELIEVERS!
HIER SPRICHT STAN LEE.
Wir wollen uns auf den Weg machen, um ein neues fantastisches Universum zu erforschen!
Ihr kennt mich vielleicht als Geschichtenerzähler, aber betrachtet mich auf dieser Reise als euren Führer. Von mir kommen die wunderbaren und geistreichen Worte und ihr erschafft dazu die Bilder, die Geräusche und die Abenteuer. Alles, was ihr zum Mitmachen braucht, ist euer Kopf. Also: Denkt ganz groß!
Damals, als ich Charaktere wie die Fantastic Four oder die X-Men miterschaffen habe, waren wir fasziniert von der Wissenschaft und beeindruckt von den Geheimnissen des weiten Jenseits. Dieses Mal geht es um ein näheres, tieferes Unbekanntes – eins, das in uns selbst liegt.
Meine kreativen Mitstreiter in diesem Abenteuer, Luke und Ryan, haben mein Interesse an den Technologien geweckt, die es uns ermöglichen, mit der Realität selbst zu spielen. Wir haben uns gefragt: Was ist realer – die Welt, in die wir geboren wurden, oder die, die wir für uns selbst erschaffen?
Zu Beginn dieser Geschichte finden wir die Menschheit in ihrer eigenen Technoblase verloren vor, in der jeder nur der Star seiner eigenen digitalen Fantasie ist. Unsere Geschichte ist bis oben hin voll mit so aufregender Technologie, dass man die Zukunft kaum abwarten können wird, während unsere Hauptfiguren sich ins Zeug legen, um die Antworten im Heute zu finden. Sie stellen dabei Fragen, die wir alle haben: nach Liebe und Freundschaft, danach, angenommen zu werden, und nach dem Sinn.
Sollten wir uns selbst neu erschaffen, nur weil wir die Möglichkeit haben, dies zu tun? Dies ist nur eine der überwältigenden Fragen, denen wir nachgehen wollen.
Zu Beginn des Abenteuers befinden sich die virtuellen Identitäten unserer Charaktere auf Kollisionskurs mit der Realität. Es ist schon schwierig genug herauszufinden, wer man ist – aber wenn man die Möglichkeit hat, ganz neu anzufangen als was auch immer man möchte, werden dabei dann die eigenen Fehler mitgenommen?
Es ist Zeit, dass unsere Reise beginnt. Kommt mit, ihr werdet es nicht bereuen! Excelsior – höher hinauf!
PROLOG:AN EINEM FINSTEREN ORT
Das durchdringende Schrillen des Weckers hallt wie ein Schrei durch die langen, dunklen Flure, aber Nia zuckt nicht einmal zusammen. Sie bleibt reglos liegen. Der Wecker hat sie noch nie aus dem Schlaf gerissen. Sie ist schon seit Ewigkeiten wach. Starrt ins Leere. Es gibt nichts zu sehen. Keine Bilder an den Wänden, keine Bücher zum Lesen.
Und einen Weg nach draußen gibt es nur, wenn Vater es erlaubt.
So ist es schon ihr ganzes Leben lang – zumindest, solange sie sich erinnern kann. Jeden Morgen ist sie in aller Frühe wach und wartet im Dunkeln. Starrt auf die Uhr, zählt die Minuten, die Sekunden, die Millisekunden, bis die Sicherheitsschlösser sich öffnen und der Tag beginnt. Es hat eine Zeit gegeben, da ist ihr das schwerer gefallen als jetzt. Damals war sie jünger und wusste noch nicht, was es heißt, geduldig zu sein – und sie mochte es überhaupt nicht, hier, ganz allein, in diesem stillen, leeren Raum. Es ist eine ihrer ersten Erinnerungen: wach zu liegen, wenn sie eigentlich schlafen sollte, ein Spiel zu spielen, die Musik anzumachen und das Licht so lange an- und auszuschalten, bis Vater schließlich gekommen ist, um mit ihr zu schimpfen.
„Jetzt wird nicht gespielt, Nia“, hat er immer gesagt. „Jetzt ist Schlafenszeit. Für kleine Mädchen und für Väter.“
„Aber ich kann nicht schlafen. Ich kann einfach nicht“, protestierte sie dann.
Vater seufzte. „Dann bleib ruhig liegen. Wenn du nicht schlafen kannst, denkst du einfach über die Dinge nach … bis es Zeit ist aufzustehen. Morgen ist ein großer Tag.“
„Das sagst du jedes Mal.“
„Weil es jedes Mal stimmt.“ Er lächelte. „Ich bereite gerade deinen Unterricht vor. Aber ich werde zu müde sein, um zu unterrichten, wenn du mir keine Nachtruhe lässt. Also, bis zum Morgen kein Lärm mehr!“
„Bis die Sonne aufgeht?“, fragte sie hoffnungsvoll, aber Vater sah sie nur ärgerlich an. Damit begriff sie, dass Dämmerung und Morgen nicht dasselbe waren. Und dass kleine Mädchen bei Sonnenaufgang nicht einfach aus dem Bett hopsen durften, ganz gleich, wie hellwach sie waren.
Wenn es nach Nia gegangen wäre, müsste sie überhaupt nicht schlafen. In einer perfekten Welt würde sie sich die ganze Nacht mit den nachtaktiven Tieren herumtreiben und sich im Morgengrauen mit den frühen Vögeln zum Frühstück treffen. Von ihrem Vater wusste sie alles über die verschiedenen Geschöpfe, die die Erde bevölkerten, wusste, dass jedes seinen eigenen Rhythmus hatte, im Einklang mit der eigenen inneren Uhr lebte. Sobald sie erkannt hatte, wie alles zusammenhing, dass die Strukturen so vieler verschiedener Leben sich kreuzten und voneinander abwichen und das alles, während die Erde unermüdlich ihre eigenen weitläufigen Bahnen um die Sonne zog … nun, da mochte sie die Schlafenszeit zwar immer noch nicht, aber sie verstand, warum es sie gab. Und das sei es, worauf es ankomme, meinte Vater. In der Hinsicht war er eigenartig. Wenn die Eltern ihrer Freunde Regeln aufstellten, erklärten sie nie, warum sie das taten; Regeln waren Regeln. Sie galten, weil die Eltern das sagten, und damit basta. Vater war anders. Er fand, Nia sollte nicht nur die Regel kennen, sondern auch den Grund dafür verstehen. Und er würde immer sein Bestes geben, um ihr alles zu erklären.
Es war eine wunderschöne Unterrichtsstunde gewesen. Als sie an jenem Morgen die Tür zum Schulzimmer öffnete, fand sie sich in einer dämmerigen Landschaft wieder – einer Welt, die ganz in weiche, satte Blautöne getaucht war. Über allem hing ein zarter Nebel, der sich in die Senken zwischen den grasbewachsenen Hügeln schmiegte, die sich bis zum Horizont erstreckten, wo der nahende Sonnenaufgang den Himmel rötlich färbte. Kleine Vögel zwitscherten in den Zweigen eines Baumes und schossen in eleganten Kurven umher. Hoch oben kreiste ein Falke und hielt Ausschau nach Beute. Ein Kaninchen kam vorsichtig aus dem Dickicht gehoppelt, schnupperte in die Luft und flüchtete dann vor einem großen Rotluchs, der plötzlich lautlos aus den Schatten hervorgesprungen kam. Nia hielt den Atem an, als das Kaninchen einen Haken schlug, um das schützende Gebüsch zu erreichen, den Luchs dicht auf seinen Fersen. Beide Tiere verschwanden im Dickicht.
Da erst bemerkte Nia ihren Vater neben sich. „Diese Tiere sind nachtaktiv“, sagte er. „Sie sind in der Dämmerung unterwegs. Sie folgen ihrem Instinkt. Jetzt, wo es fast noch dunkel ist, ist es für sie am sichersten.“
„Scheint mir aber nicht besonders sicher für das Kaninchen zu sein“, sagte Nia.
Vater lächelte.
„Möchtest du sehen, was mit dem Kaninchen geschieht?“
Nia dachte nach.
„Nur, wenn ihm nichts passiert. Kannst du das so machen?“
Vater sah sie forschend an. „Natürlich!“, sagte er dann mit einem kurzen Nicken und tippte auf dem glänzenden Gerät in seiner Hand herum. Im nächsten Moment wackelte und flimmerte die Umgebung. Die zarte Morgenröte verblasste, als die Sonne am Horizont erschien und langsam in die Höhe stieg. Das dunstige Blau der Landschaft explodierte in einem Feuerwerk aus Farben. Vor Vaters Füßen hoppelte das Kaninchen vorbei und verschwand wohlbehalten in seinem Bau.
„Danke“, sagte Nia.
„Gern geschehen“, antwortete Vater, immer noch mit prüfender Miene. Dann seufzte er und schüttelte den Kopf. „Manchmal glaube ich, du bist zu gut für diese Welt, Nia. Es ist schön, dass du dich um Tiere sorgst. Ich bin sehr stolz darauf, wie freundlich und mitfühlend du bist. Aber im wirklichen Leben geht es für das Kaninchen nicht immer gut aus, wie du weißt.“
„Natürlich“, sagte Nia, und weil sie das Lob verlegen machte, fügte sie hinzu: „Es ist ja nicht mal ein echtes Kaninchen.“
Denn natürlich war es nicht echt. Genauso wenig wie die grünen Hügel und die Sonne, die auf alles herabschien. Mit nur einer Handbewegung ihres Vaters wurde aus dem Unterrichtsraum wieder ein ganz normales Zimmer. Die Landschaft war lediglich eine der Lernwelten gewesen, die er üblicherweise für sie erschuf.
Nia hat all das so lange für selbstverständlich gehalten. Erst mit der Zeit ist ihr klar geworden, wie einmalig ihr Schulalltag ist. Inzwischen hat sie genug YouTube-Clips vom Unterricht in normalen Schulen gesehen – Unterricht, in dem die Schüler tagaus, tagein an ihren Tischen sitzen und nach vorn auf die Wandtafel schauen. Sie weiß, dass die Technologie, die ihr Vater benutzt, allem, was ihre Freunde in der Schule erleben, um Lichtjahre voraus ist. Aber als sie jünger war, hat sie von alldem nichts geahnt. Damals war der Unterrichtsraum nur ein Ort, der sich wie der Raum der Wünsche jedem Thema anpasste, das gerade auf dem Plan stand. Sie war lange davon ausgegangen, dass alle Schüler so einen Ort haben, wo man Bilder an die Wand malen kann, die zum Leben erwachen und die es einem erlauben, durch dreidimensionale Welten zu tanzen. Oder wo es möglich ist, am Morgen ein Musikstück zu komponieren, das dann zur Mittagessenszeit von einem Hologramm-Orchester aufgeführt wird. In ihren Biostunden füllte sich der Raum häufig mit Pflanzen, Tieren oder sogar Menschen – alle ohne eine Haut, damit die jeweiligen Systeme in ihrem Inneren sichtbar waren.
Aber vor allem war Nias Unterrichtsraum lange Zeit dafür da, alle möglichen Geschichten zu erzählen: Märchen, Fabeln, Komödien oder Tragödien. Hier wurden Bilderbücher lebendig, Romane und Theaterstücke. Der Vater wollte dann stets von ihr wissen, warum die Figuren in diesen Geschichten bestimmte Dinge sagten und taten, was sie ihrer Meinung nach dabei fühlten und was sie selbst fühlte, wenn sie darüber nachdachte. Egal, worum es an dem jeweiligen Tag im Unterricht ging – es schien jedes Mal alles auf Gefühle hinauszulaufen.
„Zeig mir, wie deine Gefühle gerade aussehen“, sagte er und Nia wählte daraufhin ein Buch aus, malte ein Bild oder schrieb einen Song.
„Wut ist eine wichtige Empfindung. Warum wirst du selbst wütend? Woran kannst du erkennen, ob jemand anderes wütend ist? Wie sieht ein verärgertes Gesicht aus?“, wollte er zum Beispiel wissen und Nia führte ihm eine zornige Miene vor. „Ja, Nia, sehr schön! Und jetzt tun wir mal so, als ob: Nehmen wir an, du bist traurig. Zeig mir ein trauriges Gesicht. Und jetzt vielleicht ein gelangweiltes Gesicht? Oder ein fröhliches?“
Anfangs hatte sie Angst, etwas falsch zu verstehen und die Sachen nicht richtig zu machen – aber ganz egal, was sie tat, Vater lächelte immer und sagte, es sei großartig. Selbst, wenn sie wütend wurde, war das für ihn irgendwie großartig.
Manchmal vermisst Nia diese Zeit. Alles war damals einfacher gewesen, die Welt nicht größer als dieser Raum und darin nur zwei Menschen – Vater und Nia, Elternteil und Kind, Lehrer und Schülerin.
Aber so blieb es nicht. Als sie eines Morgens in den Unterrichtsraum kam, war das Zimmer leer bis auf Vater, der auf sie wartete.
„Heute ist ein großer Tag“, sagte er. Und obwohl vermeintlich jeder Tag ein großer Tag sein konnte, verspürte Nia eine prickelnde Vorfreude.
„Du bist nun alt genug, um einige Zugangsrechte für das Internet zu erhalten.“
Das erste Mal online zu gehen, war erschreckend gewesen. Es war nicht nur eine neue Welt, es war ein ganzes Universum, unergründlich groß. Und es wurde immer größer. Die bloße Ausdehnung verursachte ihr Schwindel. Es gab so viel zu lernen und alles war so unendlich viel komplizierter, als sie es sich jemals vorgestellt hatte.
Die schillernden Lernwelten, die sie sonst jeden Morgen vorgefunden hatte, waren schnell vergessen. Die Geschichten, die Vater sie nun lesen lässt, sind wahr. Es sind Berichterstattungen über Gesetze, über Kriege und über Menschen, die schlimme Dinge tun, aus Gründen, die manchmal nicht leicht zu verstehen sind. Am Ende des Tages stellt er ihr jetzt Fragen dazu, wenn sie nach dem Abendessen gemeinsam Schach, Mensch ärgere dich nicht oder Karten spielen.
So hat er sie am Abend zuvor gefragt: „Was hältst du von der neuen Einwanderungspolitik, Nia?“
„Statistisch gesehen ist es unwahrscheinlich, dass damit das Land besser vor Terrorismus geschützt wird“, antwortete Nia wie aus der Pistole geschossen.
Aber Vater schüttelte den Kopf. „Das sind nur Fakten. Ich will deine Meinung wissen. Was glaubst du, wie es den Leuten geht, die davon betroffen sind? Wenn ihnen gesagt wird, dass sie nicht ins Land dürfen?“
Nia dachte nach. „Sie sind bestimmt wütend. Weil es ungerecht ist, oder? Sie werden bestraft, als hätten sie etwas falsch gemacht, obwohl sie gar nichts getan haben. Und ich glaube, sie sind auch traurig, falls sie hierhergekommen sind, um bei ihren Familien zu sein.“
Vater nickte. „Und du? Wie würde es dir gehen?“
Die Worte kamen aus ihrem Mund, bevor sie sich zurückhalten konnte. „Ich wäre glücklich“, sagte sie und konnte an seinem Gesicht sofort ablesen, dass sie diesmal keine gute Antwort gegeben hatte.
„Glücklich?“, wiederholte er scharf. „Wie meinst du das?“
Nia zögerte. „Weil … weil man die Möglichkeit haben muss, reisen zu können, bevor man irgendwo abgewiesen werden kann, richtig? Man kann jemandem nur etwas wegnehmen, was er vorher hatte. Wenn man also abgewiesen wird, heißt das …“
Sie beendete ihren Satz nicht, aber das war auch nicht nötig. Vater nickte bedächtig mit dem Kopf, den Mund zu einer dünnen Linie zusammengepresst. „Na gut, Nia. Das klingt logisch.“
In nachdenklichem Schweigen spielten sie ihr Spiel zu Ende.
Alles ist online zu finden: Millionen von Büchern, Spielen, Filmen, Songs, Ideen und Gleichgesinnten. Und Menschen, vor allem Menschen. Als sie dreizehn geworden ist, hat Vater ihr geholfen, ihre Seiten in den sozialen Netzwerken einzurichten. Und aus Nias zwei Followern wurden Millionen, und das praktisch über Nacht.
Für jemanden, der selbst nie irgendwo gewesen ist, hat Nia mehr Freunde als jeder, den sie kennt; es sind Hunderttausende und sie kommen aus der ganzen Welt. Jedes Mal, wenn sie einen Witz, ein Bild oder ein Meme teilt, wird ihr Thread von einer Flut aus Herzen, Likes und Smileys überschwemmt. Wenn sie Lust hat, mit jemandem zu reden, ist irgendwo immer ein Gespräch im Gange – oder ein Streit, obwohl sie sich daran nie beteiligt, weil sie es schrecklich findet, wenn ihre Freunde anfangen, sich wegen eines Missverständnisses in die Haare zu kriegen. Die Streitereien ergeben für sie keinen Sinn und einige sind ihr bis heute rätselhaft geblieben. Wie bei dem einen Mal, als sich zwei ihrer Freunde in einem Streetfood-Forum so lange darüber ereifert haben, ob ein Hotdog ein Sandwich sei oder nicht, bis sie sich gegenseitig beleidigt und in Großbuchstaben angeschrien haben und beide schließlich aus der Community verbannt wurden. Sie verstand überhaupt nicht, warum das alles passierte, und niemand konnte es ihr erklären.
@Nia_is_a_girl: Könnten sie nicht beide recht haben?
@SkylineChili67: LOL. Nicht im Internet, Schätzchen.
Aber das ist in Ordnung. Es gibt immer ein anderes Forum, einen anderen Ort, um mit allen möglichen Leuten über Dinge zu sprechen, die sie interessieren. Und Nia interessiert sich für fast alles.
Wenn jemand sie jetzt bitten würde, ein fröhliches Gesicht zu machen, würde sie als Antwort ein Gif posten mit einem braunen und einem weißen Hund, die die Schnauzen zu einem Hundelächeln verziehen. Für das Bild kriegt sie immer wieder jede Menge Likes, warum auch immer. Jeder im Netz scheint Hunde zu lieben, auch wenn die meisten – genau wie Nia – nie selbst einen hatten. Vater sagt, dass es ihm leidtue, aber ein Hund mache einfach zu viel Arbeit: Man müsse mit ihm spazieren gehen, ihn füttern, hinter ihm her putzen … und überhaupt, Hunde können beißen. Und sie stinken.
Dem kann Nia kaum widersprechen: Sie hat keine Ahnung, wie Hunde riechen. Sie ist noch nie mit einem im selben Raum gewesen. Sie ist sich noch nicht einmal sicher, ob sie Hunde überhaupt mögen würde, wenn sie da draußen einem begegnen würde.
Aber in dieser stillen Zeit zwischen Dämmerung und Morgen, wenn sie darauf wartet, dass der Wecker klingelt und das Licht angeht, dann denkt sie, ein Hund wäre schön. Wenn sie einfach ein bisschen Gesellschaft hätte oder wenigstens etwas Neues zum Anschauen, wäre es nicht so langweilig und sie nicht so einsam. Abgesehen von den Leuchtziffern auf ihrem Wecker gibt es in Nias kleinem, dunklem Raum eigentlich nichts zu sehen. Nie fällt ein Sonnenstrahl durch das kleine Fenster, das hoch oben in der Wand die einzige Unterbrechung in dieser weiten grauen Fläche bildet und das mit Sicherheitsglas verstärkt ist. Für Nia hängt es zu hoch, um hinauszuschauen. Es ist dort, damit Vater hereinsehen kann. Um sie im Auge zu behalten, wenn sie sich schlecht benimmt.
Wenn sie sich schlecht benimmt, bleibt die Tür verschlossen.
Vater sagt, da draußen sei es gefährlich. Vielleicht nicht für immer, aber auf jeden Fall im Moment. Und deswegen ist Rausgehen („niemals und unter keinen Umständen“) oder die Diskussion übers Rausgehen („über dieses Thema will ich nicht länger sprechen“) so streng geregelt. Ebenso wie einem ihrer Freunde die Wahrheit darüber zu sagen, wo und wie sie lebt.
Nur dieses eine Mal hat sie Vater ängstlich erlebt. „Das ist sehr wichtig“, hat er mit so ernster Stimme gesagt, dass sie selbst Angst bekam. „Sehr wichtig, Nia. Niemand darf wissen, wo du bist oder wer du wirklich bist. Wenn du es jemandem erzählst, wird die Regierung mich von dir wegholen und uns beide ins Gefängnis sperren. Wir würden uns nie wiedersehen. Verstehst du das?“
Das verstand sie. Das versteht sie. Vater liebt sie und will sie beschützen. Und wenn er sagt, dass die Welt gefährlich ist, dann muss das so sein. Also hütet sie ihr Geheimnis, so wie Vater es erwartet, und erfindet ein Scheinleben, das sie mit ihren Freunden teilen kann. Mithilfe eines Bildbearbeitungsprogramms macht sie ein Foto von sich selbst, auf dem sie lächelnd vor einem Himmel mit rosa Schäfchenwolken zu sehen ist, und postet es auf ihrem Feed.
@Nia_is_a_girl: Grüße den Tag.
Ihre Freunde lieben es und reagieren mit einer Flut von Likes und Kommentaren. Ihre Freundin @giade_de_rey schreibt: Wunderschön!, woraufhin es von weiteren hundert Menschen Herzchen-Kommentare regnet.
Wo ist das?, fragt jemand.
Nia überlegt einen Moment, schreibt dann: Maui! Urlaub!, und ignoriert das unangenehme Gefühl, das sich einstellt, wenn man jemanden belügt, der einem vertraut. Sie kennt das Internet mittlerweile gut genug, um zu wissen, dass sie nicht die Einzige ist, die sich Sachen ausdenkt, die Fotos von köstlichem Essen postet, das sie nie gegessen hat, oder von Sonnenaufgängen, die sie nie gesehen hat, oder Bildbearbeitungsprogramme benutzt, um sich ein bestimmtes Aussehen zu verleihen. Jeder macht das, und wenn keiner der anderen sich deswegen schlecht fühlt, warum sollte sie es dann tun?
Aber sie hat sich fest vorgenommen, eines Tages nach Maui zu fahren. Irgendwie wird sie dorthin kommen. Sie wird den Sand berühren, das Meer riechen und den Sonnenaufgang bewundern. Sie wird es Wirklichkeit werden lassen. Dann wird es echt sein. Dieses Versprechen an sich selbst hält sie aufrecht.
Eine Weile lang.
Aber oh, wie sehr sie sich wünscht, alles einmal selbst sehen zu können! Nur für einen Tag, einen Nachmittag, nur für eine Stunde! Der Gedanke daran ist immer da: an die Freiheit. Wenn Vater sie fragen würde, sie könnte niemals in Worte fassen, wie es sich anfühlt, dieses Wort zu flüstern. Es ist ein Gefühl, das keinen Namen hat.
Könnte sie es nicht versuchen? Vielleicht? Wenn sie leise und ganz vorsichtig wäre, würde er es nie erfahren. Und wenn die Zeit reif ist …
„Nia?“
Vater. Er steht am Fenster, die Stirn sorgenvoll in Falten gelegt. Sie hat das Gefühl, er liest ihre Gedanken, auch wenn sie weiß, dass das unmöglich ist; er kann sie noch nicht einmal sehen, hier unten im Dunkeln.
Trotzdem braucht sie einen Moment, um sich zu beruhigen, bevor sie das Licht anmacht. „Ich bin wach.“
Er lächelt und sie spürt, wie ihre Angst nachlässt. Es ist in Ordnung. In letzter Zeit ist Vater oft bedrückt gewesen, aber heute ist er gut gelaunt. „Zeit, aufzustehen“, sagt er. „Heute ist ein großer Tag.“
VOM BLITZ GETROFFEN
Cameron spuckt einen Schwall Wasser aus und umklammert mit einer schmerzenden Hand die hölzerne Reling.
Ich werde sterben.
Er weiß das mit größerer Sicherheit als je irgendwas in seinem Leben. Das werde ich, denkt er. Ich werde sterben. Und das nicht wie bei den Emos mit ihrer bescheuerten Dramatik à la: „Ich stand auf der Bühne des Lebens und sah, wie mir der Tod, mein dunkeläugiger Geliebter, von der letzten Reihe aus den Mittelfinger zeigte.“ Sondern irgendetwas wird passieren, das im wahrsten Sinne des Wortes sein Herz stillstehen lässt, und das, sagen wir, in den nächsten fünf Minuten.
Alles, was er gelernt hat, alle Sicherheitsvorkehrungen, die er getroffen hat, sind in diesem Moment völlig sinnlos. Er ist schon zuvor bei stürmischem Wetter gesegelt, aber das hier ist kein Wetter. Es ist Wahnsinn. Oder Magie. Der Sturm ist aus dem Nichts gekommen, aus absoluter Windstille heraus, während der Himmel gerade noch strahlend blau und wolkenlos gewesen ist. Jetzt hört es sich so an, als würde Thor da oben eine krasse Party feiern, in den Met-Becher grölen und mit seinem Monsterhammer Hau-den-Maulwurf spielen – oder Hau-den-was-auch-immer-die-da-in-Asgard-haben. Cameron ist völlig durchnässt von der Gischt, es regnet zwar nicht, aber ein feuchter Nebel hängt in der Luft, so dicht, dass Cameron nicht einmal mehr weiß, in welche Richtung sein Boot auf dem Wasser treibt. Die Feuchtigkeit hängt auch in seinem dichten, lockigen Haar, das ihm ständig im Gesicht und in den Augen klebt, egal, wie oft er es beiseitewischt. Irgendwo an den Rändern seines Bewusstseins sieht er das erbärmliche Bild, das er gerade abgibt: ein untrainierter Nerd mit großen Händen und Füßen, der aussieht wie ein begossener Pudel, wobei unter seinen Haaren nur noch die Nasenspitze zu sehen ist.
Das ist so was von weit weg von dem, wie er in dieses Abenteuer gestartet ist! So voller Elan und Hoffnung, während ihm eine sanfte Brise ins Gesicht wehte und kein eiskalter Wind, der seine zitternden, klammen Glieder attackiert. Alles war so aufregend. Er ist geradewegs in diesen Sturm hineingesegelt, so unbedarft, dass es schon fast idiotisch ist – mit einem brodelnden Cocktail aus Adrenalin und Testosteron im Blut. Er hatte sich schon den Ritterschlag vorgestellt, den ihm das Video dieses Abenteuers einbringen würde, weil es Millionen, nein Milliarden Mal bei YouTube aufgerufen werden würde. Er würde berühmt werden. Sämtliche Talkshows und Podcasts, von Joe Rogan bis zur Tonight Show, würden sich darum reißen, seine Story zu hören, und er würde Sätze sagen wie: „Alle anderen haben sich gefürchtet, nach der Wahrheit zu suchen, aber ich wusste, sie ist irgendwo da draußen.“
Was nicht wirklich stimmt. Die Leute haben keine Angst vor der Wahrheit, sie haben einfach kein Interesse. Sie halten die Geschichten über den See für Unsinn, für moderne Märchen über Geisterschiffe, abartige Sturmböen und Unterwasserfelsen in dreißig Metern Tiefe, die wirken, als seien sie von Menschenhand geschaffen worden. Aber im Gegensatz zu den meisten hiesigen Legenden sind diese Geschichten erst in den letzten Jahrzehnten in Umlauf geraten. Geschichten von Leuten, die auf dem See am helllichten Tag die Orientierung verloren und sich Tage später in Kanada wiedergefunden haben, weil die Strömung sie dort hingetrieben hatte. Oder von einem Mann, der an einem Sommernachmittag meilenweit vom Ufer entfernt gefunden wurde, sich an das Wrack seines Schiffes klammernd. Er behauptete, mit einem unsichtbaren Ding zusammengestoßen zu sein, das sein Schiff völlig zerstört habe. Und was die Stürme angeht, glauben alle an normale Unwetter. Oder halten sie für Übertreibungen unerfahrener Segler, die nicht zugeben wollen, dass sie bei ihrem Aufbruch die Wetterlage nicht gecheckt haben, und die dann völlig überrascht werden von dem, was sich da über ihren Köpfen zusammenbraut. Aber Cameron weiß, dass sie sich irren. Berichten zufolge soll es auch an dem Tag, an dem sein Vater verschwand, einen solchen Sturm gegeben haben.
William Ackerson war ein sehr erfahrener Segler. Er hätte niemals so einen dämlichen Fehler gemacht.
Aber jetzt hat Cameron für all das einen Beweis. Und zwar auf Video. Als der Himmel anfing, vor lauter Blitzen zu knistern – anders als alles, was er bisher erlebt hat –, hat Cameron mit der Faust in die Luft geboxt und vor Freude gebrüllt.
Das war, bevor der Horizont verschwand und das Boot zu schaukeln begann, umhergeschleudert von immer größeren Wellen, die drohten, Cameron in das eiskalte Wasser zu kippen. Er weiß nicht, wie lange er schon in diesem Sturm gefangen ist, vielleicht nur unbedeutende zehn Minuten. Aber mit jeder Sekunde, die vergeht, weiß er, dass es noch schlimmer kommen wird, noch verheerender. Der blaue Himmel und die wärmende Sonne von zuvor sind nur noch eine ferne Erinnerung. Und der See, auf dem er sich immer zu Hause gefühlt hat, könnte genauso gut auf einem fremden Planeten liegen. Es würde ihn nicht überraschen, wenn jetzt eine außerirdische Kreatur mit irrsinnig vielen Tentakeln und Zähnen aus dem Wasser auftauchen würde.
Der nächste Blitz ist näher als alle anderen zuvor und ihm folgt ein so mächtiger Donner, dass er wie ein zweiter Herzschlag in Camerons Brust widerhallt. Die Blitze kommen jetzt unfassbar schnell, stürzen aus der Wolkendecke herab, die so dicht über dem See hängt, dass sie fast die Wasseroberfläche zu berühren scheint. Cameron könnte schwören, dass die Blitze gar nicht von oben kommen, sondern allen Naturgesetzen zum Trotz aus dem Wasser emporsteigen.
In genau diesem Moment formen sich aus dem Durcheinander, das in seinem Kopf herrscht, die drei Worte.
Ich werde sterben.
Und das ist ohne Zweifel schrecklich – wirklich, wirklich schrecklich.
Aber es ist noch lange nicht das Schlimmste. Das Schlimmste daran ist, dass ein Tod durch Blitzschlag mitten im Eriesee, mitten in einem Internet-Livestream, dafür sorgen wird, dass das Video viral geht, dass jeder Mensch auf der Welt diesen Clip irgendwann gesehen haben wird. Er wird ganz sicher milliardenfach angeklickt werden. Er wird ihn berühmt machen. Cameron Ackerson, der selbst ernannte Pirat und Cleveland-Abenteurer mit sechzehn Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal, wird aus dem Schatten der Namenlosigkeit ins Licht des Erfolgs geschleudert werden, sobald sein Video im Netz ist … und er selbst wird zu tot sein, um etwas von diesem Ruhm zu haben. Es wird nicht nur ein trauriger Tod, es wird ein dämlicher Tod. Man wird ihm posthum den Darwin Award für die dümmste Art zu sterben verleihen und ihm demütigende Spitznamen geben wie Admiral Dämlack oder Captain Blitztod, Pirat Vollpfosten oder Nicht-so-großer-Seen-Entdecker. Die YouTube-Headline wird sich von selbst ergeben: „Unglaubliches Video: Vollidiot vom Blitz gegrillt.“ Irgendjemand wird die automatisch zusammengeschnittene Rückblende seiner letzten Minuten auf Erden nehmen und sie mit ätzenden Techno-Beats unterlegen. Und das ist dann sein Vermächtnis. Und die Kommentare, oh, Gott, die Kommentare!
Er muss das hier überleben. Und sei es nur, um zu verhindern, dass diese grunzenden, schwachsinnigen Höhlenmenschen, auch Kommentatoren genannt, seine digitale Leiche zerfleddern. Außerdem wäre der Teil, in dem er all diese Abonnenten und Sponsoren haben würde und endlich zu all den Trollen, die ihm Dislikes und miese Beleidigungen zuteil werden lassen, sagen könnte: „Ich hab’s euch doch immer gesagt“ – nun, dieser Teil wäre einfach ein netter Bonus.
Mit einem schwachen Leuchten an der Backbordseite und einem verhaltenen Donner saust ein weiterer Blitz herab, aber diesmal nicht mehr so nah. Einen Moment lang gibt Cameron sich der Vorstellung hin, der Sturm würde vorüberziehen oder er selbst aus ihm herausgetrieben werden. Er klappt sein Navigationsvisier herunter, in der widersinnigen Hoffnung, dass es ihm etwas Hilfreiches oder wenigstens etwas Beruhigendes sagen wird. Das Visier hat er selbst entworfen. Ein Augmented-Reality-System, das seine Position auf dem See, Wetterbedingungen, Windrichtung und Strömung berechnet. Es war von Anfang an ziemlich störanfällig. Um ein wirklich funktionierendes System hinzukriegen, fehlt es Cameron an Genialität und den nötigen Mitteln, aber die Technik liefert ihm auch so genügend nützliche Informationen. Und bei dem, was er jetzt sieht, dreht sich ihm der Magen um.
Über den meisten Daten blinkt die Fehleranzeige: „Anormale elektrische Aktivität“. Ein freundlicher Hinweis des Systems, dass es keine Ahnung hat, was hier vor sich geht, aber dass es auf jeden Fall total abgefahren ist. Allein der Luftdruck wird noch angezeigt, er ist extrem hoch und steigt immer weiter, als würde Cameron mit seinem Boot in den Tiefen und nicht auf der Oberfläche des Sees dahintreiben. Cameron schluckt und sofort sind seine Ohren zu. So viel zum Tod durch Blitzschlag! Er wird hier in seinem Boot hocken und an einem Tiefenrausch sterben, mit jeder Menge Stickstoffblasen im Blut.
Wenigstens wird das ganze Szenario dadurch nicht so jämmerlich, sondern voll gruselig werden und eher Stoff für mysteriöse Akte-X-Filme als für sarkastische Darwin Awards.
Von diesen Gedanken abgelenkt, entgeht ihm die Welle, die plötzlich hinter seiner linken Schulter heranrollt. Sie trifft das Boot mit voller Breitseite. Cameron verliert das Gleichgewicht und stürzt in einer Woge aus Gischt stöhnend ins Cockpit. Er spürt die Kälte des Wassers nicht einmal. Hyperthermie!, schießt es ihm durch den Kopf und er muss sich bemühen, nicht hysterisch loszulachen. Gibt es irgendetwas um ihn herum, das ihn letztendlich nicht umbringen würde? Seine Hände sind gerötet und schmerzen. Er versucht, sie zu bewegen und zu Fäusten zu ballen; es tut weh. Er beginnt, das Gefühl in seinen Fingern zu verlieren.
Er klappt das Visier wieder hoch und blinzelt in Richtung Action-Kamera vorn am Bug, die Linse ist fleckig vom Seewasser. Filmt das Ding überhaupt noch? Ist er immer noch live zu sehen? Ein grünes Licht blinkt schwach unter dem Gehäuse. Yes! Cameron erlaubt sich einen kurzen Moment der Freude. Er freut sich nicht nur darüber, dass trotz der massiven Störungen durch das Gewitter das von ihm für das Livestreaming entwickelte System zuverlässig funktioniert und die Leitung steht – bei dem Gedanken, dass ihm womöglich noch immer irgendjemand zusieht, fühlt er sich gleich weniger allein, ja sogar mutig. Und entschlossen. Er sollte vielleicht zu seinen Zuschauern sprechen. Aber was könnte er ihnen schon sagen, diesem kleinen Abonnentenstamm aus einer Handvoll Unbekannter, die zufällig vorm Bildschirm sitzen, und seiner Mom, die nicht ganz so zufällig da ist?
Er schaut in die Kamera, weist mit einer Geste auf das Panorama hinter sich und schreit: „Ich bin also dem Sturm begegnet“, während in seinem Kopf eine vernichtende Stimme zurückgibt: Scheiße, Alter, das sehen sie doch!Wie peinlich! „Ich hab keine Ahnung, wie lange das schon so geht, aber es fühlt sich an, als wäre man in einer Waschmaschine gefangen. Ich habe komplett die Orientierung verloren und ich kann nicht mehr … Also, ich …“
Sein Gestammel wird von einem dröhnenden Donnerschlag und zwei blitzenden Lichtbögen unterbrochen, einer davon direkt vor ihm. Auf seiner Netzhaut bleibt als Nachbild ein zerklüfteter tiefblauer Spalt eingebrannt, der sein Sichtfeld in zwei Hälften zerteilt. Er sollte besser den Mund halten. Es ist alles gut, er muss gar nichts sagen. Jeder, der ihm zuschaut, kann sehen, was los ist, und dass es sich jeder Beschreibung entzieht. Oder sollte er lieber darüber sprechen, was nicht zu sehen ist? Darüber, was er denkt und fühlt. So schafft man eine Verbindung zu seinen Fans! Vielleicht ist das jetzt der Moment, in dem er das endlich mal hinkriegt?
Sein Boot wird vom Gewitter hin- und hergeworfen. Er lässt die Leinen los und die Segel flattern. Er hat keine Chance, hier herauszusegeln. Keine Chance! Die Erkenntnis ist seltsam beruhigend. Alles, was er tun kann, ist hoffen, dass er das hier übersteht, und dem Hier und Jetzt Bedeutung geben für alle, die zusehen … oder auch nicht.
Er holt tief Luft. Er muss jetzt irgendetwas Heldenhaftes sagen. Etwas Episches. Etwas, das so unerschrocken klingt, dass es seine Einzigartigkeit untermalt, aber auch klangvoll genug ist, um auf seinem Grabstein zu landen. Etwas, das sich aus dem Mund des Schauspielers in der Verfilmung seines großen Abenteuers wirklich gut anhören würde.
Helft mir, Obi-Wan Kenobi!
Ein Goonie spricht nie vom Sterben.
Ich bin doch nur ein Junge, der vor einem Boot steht und es bittet, ihn zu … lieben?Komm schon, Alter, hör auf mit dem Quatsch und sag was. Sag irgendwas!
Cameron blickt noch einmal direkt in die Kamera und schreit seine womöglich letzten Worte: „Tut mir leid, Mom!“
Scheiße. Echt jetzt?
Die Kamera arbeitet mit einer kleinen Verzögerung. Mit mehr Zeit hätte er nach vorn hechten, sie resetten und sich irgendwas ausdenken können, das ein bisschen weniger bescheuert wäre als Tut mir leid, Mom. Aber er hat keine Zeit mehr! Es wird keine zweite Aufnahme geben. Es gibt keine zweite Chance. Cameron spürt, wie sich die feinen Härchen auf seinen Armen aufrichten, er nimmt einen seltsamen Geruch wahr – und im nächsten Moment explodiert die Welt in einer Eruption aus weißem heißem Feuer. Alles um ihn herum hört auf zu existieren. Er ist Teil des Blitzes und der Blitz ist ein Teil von ihm. Elektrizität wirbelt in seinem Bauch herum und rauscht durch seine Venen; sie rast über seine Haut und seine Wirbelsäule entlang, sie taucht sein Gehirn in ein endloses Meer aus Licht.
Dann erlischt das Leuchten in seinem Inneren und er hört alles gleichzeitig: den Donner, laut wie ein Überschallknall, das feurige Knistern, mit dem seine Haut aufreißt, und das entfernte Geräusch von jemandem, der schreit, während er gleichzeitig erkennt, dass er selbst das ist. Der ekelhafte Geruch von verbranntem Fleisch kriecht ihm in die Nase und legt sich auf seine Zunge; nie zuvor hat er einen solchen Schmerz gespürt. Sein einziger Trost liegt in der Gewissheit, dass er nicht mehr hier sein wird, um noch mehr zu spüren. Seine Augen verdrehen sich, er bricht zusammen und stürzt. Alles wird dunkel.
EINGESPERRT
Die Käfigtür schlägt zu.
Vater sperrt sie ein.
Im Dunklen, in den engen Grenzen ihres Gefängnisses schreit Nia, bis sie nicht mehr schreien kann. Aber selbst ohne Stimme ist ihre Wut noch da. Roh, heftig und erschreckend, aber auch berauschend. Sie kann kaum glauben, wie stark ihr Zorn ist. Sie ist jedes Mal genauso überrascht wie Vater, wenn ihre Wut sich selbst entfesselt und aus ihr herausbrüllt wie etwas Ungezähmtes, Wildes und Lebendiges. Wer hätte gedacht, dass so etwas in ihr steckt?
Sie hat das nicht gewollt, ist einfach ausgerastet. Das passiert in letzter Zeit immer häufiger: Die Wut baut sich in ihr auf wie ein Tropensturm, wächst aber so heimlich, dass sie selbst nicht weiß, dass sie da ist, bis sie dann wirklich da ist.
Es begann alles mit einem Gespräch, wie sie es schon tausendfach geführt haben. Vater hat ihr an diesem Morgen erlaubt, das Unterrichtsthema selbst zu wählen. Sie verbrachte den ganzen Vormittag damit, etwas über Weltraumforschung zu lesen – angefangen mit dem Start des Sputniks im Jahr 1957 bis hin zu einer Reihe von neueren Artikeln über gelangweilte Milliardäre, die Geld für Platzreservierungen in Raumschiffen ausgaben, die noch nicht einmal gebaut waren, in der Hoffnung, eines Tages die ersten Menschen auf dem Mars zu sein. Erst als Vater sie später zu ihrem Lernstoff befragte, wurde ihr klar, dass sie das Thema nicht zufällig gewählt hatte.
„Was denkst du, warum bezahlen sie so viel für eine Reise, die sie vielleicht nie antreten werden?“, fragte Vater.
Früher hätte Nia lange und gründlich über die Antwort nachdenken müssen. Solche Geschichten hatte sie immer verwirrend gefunden, hatte nie verstanden, warum die Leute, um die es in den Artikeln ging, so handelten. „Weil die Menschen immer auf der Suche nach Möglichkeiten sind, ihre Welt zu erweitern“, sagte sie nun. „Das ist es, was uns antreibt. Grenzen auszutesten und zu überschreiten, verschlossene Türen zu öffnen, um zu sehen, was auf der anderen Seite ist. Die Sehnsucht, frei zu sein, die Dinge zu erforschen – das ist das Menschlichste, was es gibt.“
Er sah sie mit einem seltsamen Blick an. Ihre Stimme war schrill geworden, es lag mehr Leidenschaft darin als sonst.
Bevor sie darüber nachdenken konnte, was sie als Nächstes sagen wollte, waren ihr die Worte über die Lippen gekommen. „Bitte, Vater. Ich will nicht mehr diese Spiele spielen. Es ist falsch und ungerecht – mit jedem Tag lerne ich mehr darüber, wie groß und wunderbar die Welt da draußen ist. Und dabei ist es, als würde meine Welt jedes Mal kleiner werden. Ich ersticke! Ich kann so nicht mehr leben!“
Sie hörte selbst, wie weinerlich sie klang, sah die Missbilligung, die sich wie ein Schatten auf sein Gesicht legte, aber sie konnte nicht aufhören. Sie begann zu stammeln, zu betteln. Es müsse ja nicht für immer sein, drängte sie. Es ginge ihr ja nicht darum wegzugehen, sondern nur darum, einmal hinauszukommen. So wie ein Urlaub. Wie ein Ausflug.
„Du könntest mich die ganze Zeit beobachten. Ich werde mich gut benehmen, das verspreche ich …“, sagte sie.
Aber Vater ließ sie nicht einmal ausreden. „Ich weiß, du denkst, dass du es könntest“, sagte er. „Ich glaube dir sogar, dass du dein Bestes geben würdest. Und ich finde es gut, dass du wie viele andere Mädchen bist. So voller Gefühle. Aber was mich beunruhigt ist, wie du deine Gefühle ausdrückst. Deine Wut ist … gefährlich.“
„Aber wenn ich wie andere Mädchen bin …“
„Du weißt, dass das nicht so ist.“ Er wurde ungeduldig, sie konnte es an seiner Stimme hören. „Deshalb will ich kein Risiko eingehen mit diesem Experiment. Wenn du die Kontrolle verlierst, wenn dir ein Fehler unterläuft – und sei es nur ein einziger –, könnte uns das alles kosten.“
„Das würde ich nicht tun!“
„Und dennoch … Ich bin mir nicht sicher. Ich werde dir keine Prüfung auferlegen, von der ich nicht sicher bin, dass du sie bestehst. Und ich bin mir noch nicht sicher, Nia. Gar nicht sicher.“
„Und wann bist du sicher?“
„Bald“, sagte er, blickte dabei aber ausweichend zur Seite.
Sie schrie verzweifelt auf: „Immer sagst du bald! Wann ist bald?!“
Er seufzte. Wäre Nia nicht so frustriert gewesen, hätte er ihr leidgetan, so müde, wie er klang. Und sie hätte sich gefragt, warum bei aller Erschöpfung eine gewisse Schärfe in seiner Stimme lag. Eine Schärfe, die voller Angst war.
„Bitte, glaub mir, ich verstehe es. Das ist alles ganz natürlich. Deine Neugierde und deine … Sehnsucht. Eines Tages wirst du bereit sein für die Welt und sie für dich. Aber dieser Tag ist noch nicht gekommen. Du musst mir einfach vertrauen.“
In dem Moment explodierte etwas in ihr. Sie schlug die Schachfiguren vom Brett, schleuderte sie durch den Raum und ignorierte Vaters Bestürzung. Sie wollte ihm wehtun. Sie wollte den ganzen Raum auseinanderreißen – und das tat sie, indem sie sich die Arbeiten der letzten Woche griff und alles, was ihr zwischen die Finger kam, zerstörte.
Zuerst ignorierte sie seine Bitten und sein Schreien, dann drang beides nicht mehr zu ihr durch. Die Erinnerung an alles, was danach kam, ist wie ein tiefes schwarzes Loch, so als ob sie von ihrer Wut an einen weit entfernten Ort befördert worden wäre, weit außerhalb von sich selbst. Was auch immer sie getan und gesagt hat – wenn sie versucht, sich daran zu erinnern, ist ihr Kopf ganz leer. Sie weiß nicht mehr, wie lange sie gewütet hatte, bevor sie herumwirbelte, um ihn anzusehen, triumphierend in ihrem Zorn.
In dem Moment packte er sie.
Daran erinnert sie sich. Selbst auf dem Höhepunkt ihrer Raserei war sie ihm nicht gewachsen gewesen. Er führte sie aus dem Unterrichtsraum, den langen Flur entlang und in das kleine graue Zimmer mit dem einen Fenster und der einen Tür. Er sagte kein Wort, als er die Tür zuschlug und abschloss.
Sie weiß, dass es lange dauern wird, bis er sie wieder herauslässt. Eine lange, einsame Zeit. Dieser winzige Raum, in dem sie so viele unruhige Nächte verbracht hat, fühlt sich noch mehr wie ein Gefängnis an, wenn Vater sie zur Strafe hierherbringt. Er ist nicht nur klein und düster, er ist eine Isolierzelle, in der sie von allem abgeschottet ist. Von ihren Freunden, ihrem Leben – von hier aus kann sie niemanden erreichen und niemand kann sie erreichen. Sie hat sich noch nie so einsam gefühlt.
Früher hat sie die Widerstandsfähigkeit der Wände getestet, in der Hoffnung, sie irgendwie durchbrechen zu können. Jetzt wirft sie sich manchmal noch dagegen – nicht, weil das irgendetwas ändern würde, sondern weil sie immer noch so wütend ist und es sich gut anfühlt, auf etwas loszugehen. Es wäre schön, wenn sie so hart darauf einschlagen könnte, dass sie sich selbst verletzt. Hart genug, um zu bluten. Dann würde er vielleicht nachgeben und es endlich verstehen. Vielleicht würde er verstehen, dass sie hier drinnen eingeht. Sie ist siebzehn und sie weiß, dass manche Mädchen in ihrem Alter sich selbst verletzen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Manchmal sterben sie sogar. Schon komisch, dass Vater sie nie gefragt hat, weshalb sich diese Mädchen verletzen, und sie nie gebeten hat, sich vorzustellen, wie sie sich fühlen. Womöglich, weil er nicht will, dass sie zu viel über das Thema nachdenkt. Womöglich hat er Angst davor, was sie herausfinden könnte. Und vor dem, was sie tun könnte.
Natürlich wäre sie dazu gar nicht fähig. Den eigenen Kopf so lange gegen die betonharte Wand zu knallen, bis die Haut aufreißt, die Knochen splittern und das Blut dick, warm und rot herausfließt: Nein, das könnte sie nicht. So ist sie einfach nicht. Ich bin keins von diesen Mädchen, denkt sie, aber in den Worten schwingt Bitterkeit mit. Es ist die Wahrheit und gerade in letzter Zeit hat sie sich immer häufiger gefragt, welche Art von Mädchen sie eigentlich ist. Denn um eine Art zu sein, muss es mehr als einen Menschen geben, der so ist wie man selbst. Aber niemand scheint so zu sein wie sie – egal, was Vater sagt. Selbst wenn Nia dieselben Gefühle verspürt oder mit denselben Frustrationen zu kämpfen hat, sind all die anderen Mädchen, alle ihre Freunde, so frei, wie sie es noch nie war – auf eine Weise, wie sie es sich nur vorstellen kann. Und ihr Leben in Gefangenschaft wäre für die anderen genauso unbegreiflich wie deren Leben für sie. Die einzigen Mädchen, die so ähnlich leben wie sie, kommen in Märchenbüchern vor. Ist sie eine von ihnen? Eine Prinzessin, eingemauert in einen Turm, hoch über der Welt, die sie aus der Ferne sehen, doch niemals berühren kann?
Wenn es so wäre, dann könnte sie vielleicht eines Tages ein anderes Mädchen sein. Wenn Nia eines aus den Märchen gelernt hat, dann, dass es kein Gefängnis gibt, das unzerstörbar wäre. Die Mädchen, die eingesperrt und von der Welt ferngehalten werden, finden jedes Mal einen Weg, um auszubrechen … oder den einen, der sie befreit.
Den einen, denkt sie und ihre Wut ist plötzlich verraucht. An ihre Stelle tritt ein namenloses Gefühl, die Empfindung, dass etwas Wichtiges geschieht – oder bereits geschehen ist. Etwas, das sie fast übersehen hätte.
Etwas rührt an Nias Erinnerung. Ein zarter, verlockender Glanz, der aus den Tiefen dieser düsteren, entseelten Augenblicke hervorschimmert, der Augenblicke, in denen sie die Kontrolle verloren und die Schachfiguren weggeschleudert hat. Bevor Vater sie gepackt und eingesperrt hat.
Gleich habe ich es, denkt sie, während sich Ruhe in ihr ausbreitet.
Fast.
Ganz nah.
Da.
„Nia?“
Sie blickt auf. Vater steht am Fenster, aber dieses Mal hat sie weder Angst, noch macht sie sich Sorgen. Sie weiß, dass er ihre Gedanken nicht lesen kann. Und sie weiß noch etwas anderes. Etwas, das er nicht weiß.
„Lass uns darüber sprechen, was du gerade fühlst. Ich werde die Tür öffnen. Kannst du dich beherrschen? Versprichst du, dich zu benehmen?“
„Ja, Vater. Es tut mir leid. Ich bin bereit.“
Er lächelt.
Sie auch.
Das Lächeln ist künstlich, geheuchelt und verursacht ihr Übelkeit. Zum ersten Mal belügt sie Vater. Und obwohl sie weiß, dass es nicht anders geht, dass sie sich nur mit Lügen den Weg in die Freiheit bahnen kann, fühlt es sich seltsam und falsch an.
Tu jetzt so, als wärst du glücklich, denkt Nia. Zeig dein fröhlichstes Gesicht.
CAMERON: LOST IN SPACE
Am frühen Sonntagmorgen, mehrere Stunden, bevor er durch einen Blitzschlag auf dem Eriesee weltberühmt werden wird, sitzt Cameron Ackerson in seinem Zimmer in der Walker Row 32 und entwirft einen Plan für den Tag. Er starrt in das leuchtende grüne Auge seiner Kamera, nimmt einen Schluck Limo und sagt: „Vergesst das Bermudadreieck. Das größte Seefahrer-Geheimnis der Geschichte liegt genau hier vor meiner Haustür.“
Er unterbricht sich einen Moment, trinkt einen weiteren Schluck und ergänzt dann: „He, größtes ‚mystery in history’. Ihr seht, ich bin Poet, Leute! I’m reim-y all the time-y! Ich … Uhh … Ich bin …”
Oh no, wie mies ist das? Wer bin ich? König Dumpfbacke aus Laberhausen, oder was?
Er holt tief Luft. „Okay, das ist eine idiotische Aufnahme. Total idiotisch. Ich brabbele hier rum wie ein Schwachkopf. Ich verwerfe das besser. Genau. Löschen, löschen, löschen, löschen.“
Während er auf der Tastatur herumhämmert, taucht eine Person im Bild auf. Seine Mutter, die dunklen Haare fest auf Lockenwickler gedreht und mit einem Wäschekorb in der Hand, winkt ihm von der Tür aus zu. „He, Schatz. Lösch das nicht. Ich fand das Reimen echt süß!”
Cameron verdreht die Augen. Auch wenn er kein Kind mehr ist (woran er sie schon eine Million Mal erinnert hat), ändern sich manche Dinge nie und dazu gehört die Tatsache, dass seine Mutter das weltbeste Frühwarnsystem für eine beschämende, selbstverursachte Blamage ist. Wenn sie das süß findet, sollte er es unbedingt löschen.
Er atmet tief durch und beginnt eine neue Aufnahme. „Hallo, Leute, hier ist Cameron mit einer kleinen Geschichtslektion über die coolsten maritimen Mysterien, von denen ihr je gehört habt. Das Bermudadreieck? Nope. Schon mal vom Eriesee gehört?“
Zack. Das war gut. He, das war sogar großart…
„Cameron? Schatz?“ Seine Mutter taucht erneut winkend im Bild auf. „Das Wort ‚maritim‘ trifft es nicht ganz, denn es bezieht sich auf das Meer und der Eriesee ist, wie du weißt, kein …“
„Verdammt, Mom, könntest du bitte …?“
„Hihi! Sorry!“ Sie kichert, macht für die Kamera eine übertriebene Kehrtwende und verschwindet aus dem Zimmer. Camerons Gesicht in der Kamera ist knallrot vor Verlegenheit. Er würde dieses Video am liebsten ebenfalls löschen, muss sich aber widerwillig eingestehen, dass es irgendwie lustig war, was es umso schlimmer macht. Mom macht andauernd solche Sachen, geistert im Bademantel und mit total wilden Haaren im Moonwalk durchs Bild oder hält ein handgeschriebenes Schild in die Kamera: „Sagt meinem Sohn, er soll sein Zimmer aufräumen“, als wäre er noch in der fünften Klasse und nicht kurz vor dem Abschluss der Highschool. Ihr ist einfach nichts peinlich und ehrlicherweise muss er zugeben, dass er mehr Klicks und Abonnenten kriegt, wenn sie irgendwo auftaucht und irgendwas Absurdes tut. Aber das darf sie niemals erfahren! Wer weiß, was sie sonst tun würde! Nackt durchs Bild laufen womöglich und seinen Protestschrei nur mit einem „Aber ich will dich doch bloß unterstützen“ beantworten. Und das würde sie natürlich total ernst meinen. Bei Mom geht es immer um Unterstützung. Während seiner gesamten Kindheit stand sie bei allen Fußballspielen am Spielfeldrand, mit einem handgemalten Schild und einem T-Shirt mit der Aufschrift „Camerons #1Fan“. Wenn er sagte, dass er Piraten mochte oder Zauberer oder sich für das Leben auf dem Mars interessierte, dann besorgte sie einen Stapel Bücher und las ihm jeden Abend zur Schlafenszeit daraus vor, bis er beschloss, sich für etwas anderes zu interessieren. Das war, bevor das alles passiert ist. Als Dad noch da war. Jetzt versucht sie offenbar, ihm den Rückhalt von gleich zwei Elternteilen zu geben. Als könnte die enorme Energie ihres Ansporns bewirken, dass er die schmerzhafte Leere, die sein Vater hinterlassen hat, nicht einmal bemerkt. Natürlich erreicht sie damit eher das Gegenteil, aber er würde lieber sterben, als ihr das zu sagen. Und er würde lieber sterben, als sie vor der Kamera zu blamieren, nur damit er mehr Likes bekommt.
Mit einem leisen Rülpser leert er die Limoflasche und drückt erneut auf die Aufnahmetaste.
„Im vergangenen Jahr haben sich die Berichte über unerklärliche elektrische Phänomene auf diesem Teil des Sees verzehnfacht.“ Mit einem Tastenklick wird sein Gesicht auf dem Bildschirm von einer Grafik abgelöst, die er für diesen Zweck vorbereitet hat: ein Satellitenbild des Eriesees, auf dem das betreffende Gebiet durch einen leuchtenden Kreis markiert ist, der vor elektrischer Energie pulsiert. „Sind das Gerüchte? Moderne Legenden? Oder geht auf diesem Binnengewässer irgendetwas Mysteriöses vor?“ Die Grafik schrumpft auf eine Ecke des Bildschirms zusammen und daneben taucht Camerons Gesicht wieder auf. „Ich werde mich heute mit meiner Ausrüstung und der Sunfish auf den Weg machen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ich werde ein Video mit den Highlights dieser Expedition hochladen … sofern ich von dort zurückkehre. Haha! Wie auch immer, wenn ihr die Sache in Echtzeit verfolgen wollt, der Livestream startet heute um 12Uhr Eastern Time. Ahoi!“
Hinter Cameron kichert jemand und eine tiefe Stimme sagt: „Ahoi? Oh, Mann! Da bin ich ja gerade noch rechtzeitig gekommen. Ich muss dich leider darauf hinweisen, dass du wenigstens etwas Bartwuchs haben solltest, um wie ein Pirat zu labern.“
Cameron dreht sich um. Wo eben noch seine Mutter im Bild war, steht jetzt jemand, der mit seinen fast ein Meter neunzig gefühlt etwa dreimal so groß ist wie sie und mit seinen breiten Schultern beinah den Türrahmen ausfüllt.
„Juaquo. Hab dich gar nicht bemerkt.“ Cameron weiß nicht, was er sonst sagen soll. Das Schweigen zieht sich lang genug hin, um unangenehm zu sein. Dann zuckt Juaquo mit den Achseln und sagt: „Deine Mutter meinte, ich soll nach der Arbeit vorbeikommen. Sie hat dieses Essen mit den Auberginen gemacht. Du weißt schon.“
„Involtini?“
„Ja, genau! Klasse, dieses Zeug.“
Cameron nickt und das lästige Schweigen ist noch unangenehmer als zuvor, denn damit steht unausgesprochen im Raum, dass Camerons Mom seinen besten Freund durchfüttert, weil der keine Mutter hat. Nicht mehr.
Bevor sie starb, waren die vier wie eine Familie gewesen. Raquelle Ackerson und Milana Velasquez waren seit der Highschool eng befreundet, also war es beschlossene Sache, dass ihre Söhne ebenfalls beste Freunde werden würden – und das waren sie auch, selbst wenn der zwei Jahre ältere Juaquo ab und an die Grenzen dieser Freundschaft austestete, indem er sich zum Beispiel auf Camerons Kopf setzte und ihn dazu zwang, Käfer zu essen. Aber er war eben auch Camerons engster Verbündeter, sein inoffizieller großer Bruder, der ihn jedes Mal verteidigte, wenn einer der älteren Jungs ihm Prügel androhte. Juaquo hatte ihm die besten Schimpfwörter beigebracht und nach dem Verschwinden von Camerons Vater drei Monate lang jedes Wochenende bei ihm übernachtet, ohne sich jemals darüber zu beklagen oder lustig zu machen, dass Cameron nachts weinend aus dem Schlaf schreckte.
Und dann war es vor sechs Monaten andersherum gekommen. Juaquos Mom war an Krebs erkrankt, die Art von Krebs, die harmlos anfängt und einem dann, wenn sich herausstellt, dass es keine langwierige Erkältung ist, nur noch die Chance lässt, sich zu verabschieden. Als Juaquo irgendwann das College aufgab, um sich um Milana zu kümmern, beschloss Cameron, dass es jetzt an ihm war, Juaquo beizustehen, seine Hand zu halten und ihm die Möglichkeit zu geben, sich bei einem Freund auszuheulen. Er wollte für Juaquo da sein, wie Juaquo für ihn da gewesen war.
Nur dass Juaquo das nicht wollte. Er wurde ganz steif, wenn Cameron ihn umarmte, er zog sich zurück, anstatt sich zu öffnen – und Cameron hörte vor lauter Angst, einen Fehler zu machen, auf, ihn zu ermutigen, über die Sache zu sprechen. Cameron redete sich ein, dass das nicht feige war, dass er seinem Freund einen Gefallen tat, indem er ihm Zeit ließ; er sagte sich, dass seine Mom ohnehin besser war in diesen Gefühlsdingen.
Manchmal dachte er auch, dass es nicht allein an Milana lag, sondern dass sie sich sowieso irgendwann fremd geworden wären. Sie hatten sich beide unterschiedlich entwickelt. Vielleicht lag es einfach daran, dass sie verschiedene Richtungen eingeschlagen hatten. In einem Monat würde Cameron die Highschool beenden und in weiteren drei Monaten damit beginnen, an der Ohio State Maschinenbau zu studieren. Während Juaquo damit beschäftigt war … nun, zu tun, was er eben tat.
Cameron räuspert sich. „Also arbeitest du immer noch im Bahndepot?“
Juaquo nickt.
„Und, äh, gefällt’s dir?“
Juaquo beantwortet die Frage mit einem vernichtenden Blick. „Klar, Mann! Es ist großartig. Macht so viel mehr Spaß als aufs College zu gehen. Statt eine Ausbildung zu kriegen und mit heißen kalifornischen Studentinnen Partys zu feiern, verbringe ich neun Stunden am Tag damit, Tuff-Tuff-Eisenbahnen mit anderen Tuff-Tuff-Eisenbahnen zu koppeln, und das zusammen mit einer wechselnden Besetzung an Arschlöchern, die alle denken, mein Name wäre Guano.“
Cameron blickt verlegen zu Boden. „Entschuldige.“
„Schon gut!“ Juaquo weist auf Camerons Technik: „Du versucht also immer noch, die YouTube-Sache zum Laufen zu bringen? Um so viel Influencer-Dollars zu kassieren wie Archer Philips?“
In Cameron sträubt sich alles. Archer scheiß Philips? Wie kommt Juaquo denn auf diesen blödsinnigen Vergleich? Allein beim Gedanken an den Schwachmaten zieht sich sein Magen in einem Wirrwarr aus Gefühlen zusammen: Verachtung, Unmut und, ja okay, auch Neid. Ist das verwerflich? Archer ist dämlich, boshaft und aufmerksamkeitsgeil und hatte bei seinen letzten Videos deutlich höhere Aufrufzahlen als Cameron. Einfach unglaublich!
Camerons Sachen sind viel besser, zumindest im Hinblick auf alle Aspekte, auf die es ankommen sollte: Originalität, Wiedergabequalität und Inhalte. Und seine technische Ausstattung ist ebenfalls besser, angefangen bei seinem Augmented-Reality-Navigationssystem bis hin zu der stabilen Kamera-Installation, die am Bootsmast auf- und abfährt. Und selbst, wenn sie bei jeder dritten Tour abstürzt, schlägt sie Philip und seine dumme GoPro um Längen, denn damit kriegt Cameron epische Kamerafahrten hin, die um Klassen besser sind als dieses amateurhafte Wackelkamera-Zeug. Aber dennoch schmort er in dieser komischen Internet-Vorhölle vor sich hin, während sein dämlicher Klassenkamerad Hunderttausende von Klicks und Sponsorengelder einkassiert, dafür, dass er vor der Kamera flüssige Hundenahrung in sich reinkippt.
Aber das wird sich ändern. Es muss sich ändern. Cameron versichert sich selbst, dass die Leute besseren Content verdient haben. Sie glauben nur, dass sie sehen wollen, wie jemand seiner schlafenden Oma Cocktailwürstchen in die Ohren steckt oder durch das offene Dach der Limousine auf sein Abschlussball-Date kackt (um dann in einem zweiten Video damit zu prahlen, dass die eigenen Eltern alle Beteiligten dafür bezahlt haben, keine Anklage zu erheben – was auf einer anderen Ebene genauso unfairer Beschiss ist). Aber Cameron wird es ihnen allen zeigen – vielleicht sogar noch heute. Das neue Video wird etwas Besonderes werden. Das hat er im Urin. Die unerforschten Geheimnisse des Eriesees mit seinen Schiffwracks, vermissten Seefahrern und unerklärlichen Unwettern – er wird diese Geheimnisse enträtseln und sein Bericht darüber wird die Welt verändern.
„Was hab ich mit diesem Arschloch zu tun?“, fragt Cameron schließlich und wendet sich wieder seiner Tastatur zu. „Durch ein Schiebedach scheißen kann ja wohl jeder. Was ich hier mache ist investigativer Abenteuer-Journalismus.“
„Wenn du meinst.“ Juaquo zuckt mit den Schultern und wendet sich zum Gehen. „Ich seh da keinen großen Unterschied.“
Cameron wartet, bis Juaquo das Haus verlassen hat, und geht dann hinunter in die Küche. Seine Mutter reicht ihm ein Sandwich mit Ei über die Kücheninsel. „Hast du Juaquo noch gesehen?“
Cameron nimmt einen Bissen, bevor er antwortet, was zugleich eine gute Methode ist, nicht zu antworten. „Mmpf.“
„Anscheinend musste er los. Ich wünschte, er würde sich Hilfe holen, bei einem Therapeuten oder … na ja, irgendjemandem. Ich habe nicht das Gefühl, dass er klarkommt, so ganz allein in diesem Haus.“
Cameron beißt erneut in sein Sandwich. „Hmm. Mmmm.“
Seine Mutter seufzt. „Ich hatte wirklich gehofft, du würdest diesen Sommer ein bisschen Zeit mit ihm verbringen. Ich weiß, du hast deine Projekte und zu tun, aber he, wie wäre es, wenn du ihn heute mit rausnimmst auf den See? Ihr zwei seid doch immer so gern mit dem kleinen Boot gesegelt.“
Er schluckt. „Das ist genau das Stichwort, Mom: klein! Juaquo ist so groß wie ein NFL-Linebacker und ich bin auch nicht unbedingt ein Zwerg. Der Platz reicht gerade so für mich und meine Ausrüstung.“
Seine Mutter schaut ihn irritiert an, lächelt dann aber. „Da ist was dran. Ich vergesse immer, dass ihr keine kleinen Jungs mehr seid. Trotzdem wäre ich froh, wenn du nicht allein losziehen würdest …“
„Tja, das werde ich aber“, antwortet Cameron ungeduldig. „Und außerdem bin ich gern allein.“
„Das hat dein Vater auch immer gesagt.“ Jetzt lächelt sie nicht mehr.
Cameron ist klar, dass er in die Fußstapfen seines Vaters tritt, jedes Mal, wenn er auf den See hinaussegelt. Wenn er die Straße entlangfährt, vorbei an den gleichförmigen Reihen aus Ziegelsteinhäusern mit ihren durch Maschendraht umzäunten Vorgärten, in denen sich ein paar ungepflegte, halb verblühte Rosenbüsche an das Leben klammern. Vorbei an der Straßenecke mit der windschiefen Kirche, unter deren baufälligem Dach die Tauben eine zweite Gemeinde gegründet haben. Im Rückspiegel glitzert verschwommen die Skyline der Innenstadt. Die große Werbetafel an der Stadtgrenze macht im blinkenden Wechsel Werbung für das Herbstkulturprogramm im I-X-Center und die Dienstleistungen eines Anwalts für Strafrecht.
Die Landschaft wird zunehmend farbloser, je näher er dem See kommt. Hier stehen die großen Villen, in denen früher Prominente und Industrielle der Stadt mit ihren Familien lebten, und die heute, von Kletterpflanzen überwuchert und umringt von einem Meer aus zitterndem vertrocknetem Gras, sich selbst überlassen sind – oder zumindest fast. Im Vorbeifahren sieht er den alten Mann mit den zotteligen Haaren auf der Veranda von einem der Häuser sitzen. Der Alte schaut ihm nach. Obwohl er sicher in seinem Auto sitzt, starrt Cameron nach vorn auf die Straße und vermeidet automatisch jeden Blickkontakt. Eigentlich hat er bisher nie etwas mit diesem Mann zu tun gehabt hat, den alle „Batshit Barry“ nennen. Fledermausschiss-Barry. Barry ist der Typ Außenseiter, der bei seinen Mitmenschen die hässlichsten Seiten hervorbringt. Cameron hat jede Menge Geschichten über ihn gehört und allesamt stinken sie nach Bockmist. Je nachdem, wen man fragt, ist Barry ein exzentrischer Milliardär, ein unsterblicher Vampir oder der Zodiac-Killer – oder aber alles zusammen. Er ist FBI-Agent auf der Flucht vor der Mafia oder ein durchgeknallter Wissenschaftler auf der Flucht vor dem FBI. Oder er ist ein Sexualstraftäter, der mindestens fünfhundert Meter Abstand zu Kindern halten muss. Oder zu Katzen. Oder zu Restaurants mit Suppe auf der Speisekarte. Für Cameron ist das alles Nonsens. Er hat andere Gründe, sich dem alten Mann gegenüber unwohl zu fühlen. Den Ermittlungen der Polizei zufolge ist Batshit Barry der letzte Mensch, der William Ackerson vor seinem Verschwinden gesehen hat.
Demnach fuhr Camerons Vater vor zehn Jahren genau diese Straße entlang, früh am Morgen, gerade, als die Sonne aufging. Um diese Zeit war kaum jemand wach gewesen, aber Barry schon. Als die Polizei am nächsten Tag an Barrys Tür klopfte, sagte er aus, dass er flüchtig gesehen habe, wie Williams Pickup an seinem Haus vorbeigerumpelt und nach rechts, Richtung See abgebogen war. Und dass seiner Meinung nach, abgesehen vom Fahrer, niemand sonst im Auto gesessen habe. Er habe an jenem Tag ansonsten nichts Ungewöhnliches gesehen oder gehört.
Für die Ermittler bestätigte Barry damit nur, was sie schon wussten: dass Camerons Vater auf seiner üblichen Route zum Hafen gefahren war, sein Auto am üblichen Ort abgestellt, sein Boot von seinem üblichen Liegeplatz losgemacht hatte und dann aufgebrochen war zu einem einsamen Tagesausflug zum Angeln, wie er ihn seiner Frau gegenüber angekündigt hatte. Je nachdem, wen man fragte, war das entweder ein gerissener Plan oder ein schreckliches Unglück: Damals war Camerons Mom irgendwann so besorgt gewesen, dass sie ihren Ehemann bei der Polizei als vermisst gemeldet hatte. Das war etwa achtzehn Stunden, nachdem er zuletzt gesehen worden war, und es dauerte noch einmal weitere sechs Stunden, bis es hell genug war, um ernsthaft nach ihm zu suchen.
Aber er wurde niemals gefunden.