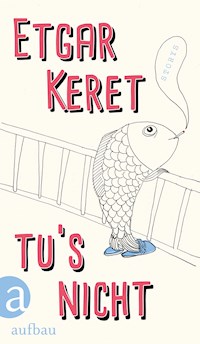17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der neue Story-Band von Etgar Keret – von der New York Times als »Genie« gefeiert – zeigt den weltberühmten Schriftsteller einmal mehr in Bestform.
Etgar Keret ist Großmeister der kurzen Form und Meister darin, die Schrecken unserer Zeit in absurde, surreale und berührende Geschichten zu verwandeln. In seinem neuen Band entwirft er mit Originalität, Humor und tiefer Menschlichkeit apokalyptische Szenarien, die den existenziellen Fragen des Lebens nachspüren. Und schafft Welten, in denen man nur einmal »Ich liebe dich« sagen darf und unser letztes Wort Badminton ist; mit TV-Shows, in denen man ein Auge verliert, um der Freundin seine Liebe zu beweisen, und Welten, in denen Zeitreisen mit ihrem Schlankheitseffekt beworben werden. Inmitten dieser Endzeitstimmung präsentiert uns Keret eine weitere unwiderstehliche Halluzination in Buchform, die das Leben feiert.
»Etgar Keret ist der Großmeister einer Gattung, die nur er schreiben kann: die Etgar-Keret-Kurzgeschichte. Sie ist weise, absurd, witzig, sehr traurig, völlig verrückt und zutiefst vernünftig. Keret wird von Buch zu Buch besser darin, Etgar-Keret-Geschichten zu schreiben; dieser Band ist der bisherige Höhepunkt seines Schaffens.« Daniel Kehlmann.
»Keret erzählt so wunderbar, dass dem Leser nichts anderes übrigbleibt, als Tränen zu lachen.« NZZ.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Etgar Keret, bekannt für seine Kurzgeschichten, die auf schräg-surrealistische und oft düster-komische Weise die unscheinbaren Momente des Lebens beleuchten, gehört zu den originellsten Schriftstellern seiner Generation. In seinem neuen Story-Band entwirft er Welten, in denen man nur einmal »Ich liebe dich« sagen darf und unser letztes Wort »Badminton« ist; mit Fernsehshows, in denen man zum Liebesbeweis ein Auge verliert und der Großvater als Eichhörnchen reinkarniert. Im Mittelpunkt stehen jedoch immer seine ganz gewöhnlichen Figuren, die von den menschlichen Bedürfnissen und der Brutalität der Welt gezeichnet sind. Zwischen Selfie-Sticks, Reality-TV und rasanter technologischer Entwicklung entsteht so ein skurriler, zutiefst menschlicher Raum.
Über Etgar Keret
Etgar Keret, geboren 1967 in Ramat Gan, Israel, ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen Schriftsteller Israels. Er gilt als Meister der Kurzgeschichte, seine Short-Story-Bände sind in Israel Bestseller und werden in 40 Sprachen übersetzt. Sein letzter Band »Tu's nicht« wurde mit dem National Jewish Book Award ausgezeichnet und stand auf den Jahres-Besten-Listen von The Guardian, The Times, Financial Times und vielen weiteren. Etgar Keret schreibt auch Drehbücher und Graphic Novels. Er lebt mit seiner Familie in Tel Aviv.
Mehr zum Autor unter etgarkeret.com und aufbau-verlage.de.
Barbara Linner studierte Judaistik, Orientalistik und südost-europäische Geschichte. Sie übersetzt auch Assaf Gavron, Yiftach Ashkenazy, Jehoschua Kenaz, Judith Katzir, Ron Leshem und Joshua Sobol. Sie lebt in München.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Etgar Keret
Starke Meinung zu brennenden Themen
Storys
Aus dem Hebräischen von Barbara Linner
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Eine Welt ohne Selfie-Sticks
Gondola
Kein Zurück
Mesopotamische Hölle
Mitzwa
Moderner Tanz — (für Inbal)
Solo — (für Takafumi)
Wie neu
Genesis, Kapitel 0
Oliven oder der Weltuntergangsblues
Starke Meinung zu brennenden Themen
Autokorrektur
Die Zukunft ist nicht, was sie einmal war
Gruppentour
Draußen
Hund um Hund (alias Auge um Auge) — (für Fida)
In der Schlange
Director's Cut
Gravitation
Chinese Singles Day
Schlaflosigkeit
Zen für Anfänger — (für Tamara)
Eichhörnchen — (für Dana und Omri)
Das Leben: Eine angebrachte Enthüllung
Hypothetische Frage — (für die geliebte Nurit)
Gesundheitszigarette
Und wer weiß besser als wir
Erdbeben — (für Diego)
Ohne Reue
Kanten
Für die Frau, die alles hat
Andacht
Polarbär
Impressum
Für Chamutal
Eine Welt ohne Selfie-Sticks
Im Nachhinein betrachtet, hätte ich Nicht-Debbie nicht anschreien sollen. Debbie selbst hat immer gesagt, dass Schreien überhaupt keine Lösung ist. Aber was soll der Mensch machen, wenn er eine Woche, nachdem er sich unter Tränen von seiner Freundin am Flughafen verabschiedet hat, weil sie für ihre Promotion nach Australien geht, in einer Starbucks-Filiale im East Village auf sie stößt und sie so tut, als sei nichts gewesen?
Als ich sie in dem Café sah, schikanierte sie gerade die Frau an der Kasse mit Fragen über deren Milchersatzprodukte, und als ich sie fragte, wie es kam, dass sie nach New York zurückgekehrt war, ohne mir etwas davon zu sagen, blickte sie mich befremdet an und sagte ungeduldig: »Hören Sie, Mister, ich weiß nicht, wer Sie sind. Sie verwechseln mich sicher mit jemand anders.« In der Sekunde brannten bei mir alle Sicherungen durch. Oder sagen wir, dass ich nach über zwei Jahren Beziehung eine angemessenere Reaktion erwartet hätte. Anstatt zu diskutieren, stand ich also einfach mitten im Starbucks und brüllte in allen Einzelheiten sämtliche ihrer intimen Erkennungsmerkmale heraus, inklusive der Narbe an ihrem Rücken vom Sturz bei unserem Ausflug im Yosemite-Park und dem fetten behaarten Leberfleck in ihrer linken Achselhöhle. Nicht-Debbie antwortete nicht, starrte mich nur mit schockiertem Blick an, während mich zwei Mitarbeiter der Filiale nach draußen zerrten.
Ich setzte mich auf eine Bank am Straßenrand und fing an zu weinen. Fünf Wochen vorher, als Debbie mir sagte, dass sie nach Australien gehen würde, war ich am Boden zerstört, aber ich verstand, dass diese Trennung Vorrang vor uns hatte: Ihr hatte man ein Promotionsstipendium an der Universität Sydney angeboten, und ich hatte gerade eine Position als Teamleiter in einem der renommiertesten Big Data Start-ups in New York erhalten. Der Abschied war echt schmerzhaft, aber lange nicht so schlimm und erniedrigend wie diese befremdliche Begegnung im Starbucks.
Während ich noch weinte, spürte ich eine zarte Hand auf meiner Schulter, und als ich den Blick hob, sah ich Nicht-Debbie vor mir. »Versteh doch«, sagte sie im Flüsterton zu mir, »ich sehe vielleicht aus wie Debbie, samt dem Leberfleck und allem, aber ich bin nicht sie, ehrlich nicht!«
Ich und Nicht-Debbie setzten uns in ein anderes, hübscheres Café an der Third Avenue. Sie bestellte einen schwachen Cappuccino mit viel Schaum, genau wie Debbie, und betrachtete mich mit einem prüfenden Blick, den ich kannte, und dann fing sie an, mir die verrückteste Geschichte zu erzählen, die ich je im Leben gehört hatte. Wie sich herausstellte, hieß auch Nicht-Debbie Deborah, aber sie war an diesem Morgen nicht aus Australien in New York eingetroffen. Sie kam aus einem Paralleluniversum. Kein Witz, das war es, was sie mir zwischen zwei Schlücken von ihrem schwachen Cappuccino erzählte. Und nein, sie war nicht infolge einer außerirdischen Offensive oder eines fehlgeleiteten wissenschaftlichen Experiments des amerikanischen Militärs hier gelandet, sondern im Rahmen einer TV-Gameshow, die sich »Es lebe der kleine Unterschied« nannte und momentan die höchsten Einschaltquoten in ihrem Paralleluniversum hatte.
Im Rahmen der Sendung werden fünf Kandidaten in ein Paralleluniversum geschickt, das alles enthält, was sie in ihrer eigenen Welt haben, bis auf eine Sache. Und genau darum geht es, die Teilnehmer müssen herausfinden, was in ihrer Welt existiert, in der neuen aber fehlt. Der erste Mitspieler, dem es gelingt, das fehlende Detail zu finden und mit lauter Stimme die Antwort auszusprechen, kehrt noch in der gleichen Sekunde ins Fernsehstudio seines eigenen Universums zurück und erhält unter dem Beifallssturm des Publikums den Preis von einer Million Dollar. Während der Gewinner die Million feiert, sind die anderen Teilnehmer des Wettbewerbs gezwungen, den Rest ihres Lebens in der Parallelwelt, in die sie geschickt worden sind, weiterzuleben. Was sich nach einem echt harten Preis für die Verlierer anhört, aber auch eine Menge Spannung ins Spiel bringt. In ihrem Fall jedoch juckte das Nicht-Debbie überhaupt nicht, weil sie keinen Freund hatte und schon seit Jahren nicht mehr mit ihren Eltern redete.
Diese komische Geschichte, die mir Nicht-Debbie erzählte, klang sogar für eine Lüge zu abseitig, und die Art, wie sie sie erzählte, war so dermaßen authentisch, dass ich sie glauben musste. In der letzten Runde, sagte sie, hatte ein Arbeitsimmigrant aus Ghana gewonnen, der herausgefunden hatte, dass das, was in der Parallelwelt fehlte, in die die Wettbewerbsteilnehmer geschickt worden waren, Selfie-Sticks waren. »Fucking Selfie-Sticks, kapierst du das?«, sagte Nicht-Debbie. »Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, da draufzukommen.« Ich fragte sie noch ein bisschen aus. Es stellte sich heraus, dass auch sie, wie Debbie, klinische Psychologie studiert hatte, aber nicht daran interessiert war, zu behandeln oder einen Doktor zu machen und deswegen auf einem Verwaltungsposten in irgendeinem reichen Upstate-College hängengeblieben war. Ich erzählte ihr von meinem Abschied von Debbie. Wie ich sie vor einer Woche zum Flughafen begleitet und den Terminal nicht verlassen hatte, bis ich ihr Flugzeug nach Australien aufsteigen sah. Sie nickte und meinte, das ergebe Sinn. Die Spielteilnehmer würden nie zu dem Erdteil geschickt, wo ihre Gegenstücke lebten, und wenn Debbie nicht nach Sydney geflogen wäre, dann wäre Nicht-Debbie wahrscheinlich, statt in New York aufzutauchen, in der Antarktis oder in Auckland gelandet. »Ich bin froh, dass sie weggegangen ist«, sagte sie und lächelte mich mit diesem Lächeln an, das mich zweieinhalb Jahre zuvor dazu gebracht hatte, mich in Debbie zu verlieben. »Auckland in allen Ehren, aber nichts geht über New York.«
Nachdem wir den Kaffee ausgetrunken hatten, beharrte Debbie darauf zu bezahlen, und eine Sekunde bevor wir uns trennten, sie war praktisch schon am Gehen, bot ich an, ihr dabei zu helfen, den Wettbewerb zu gewinnen. Um herauszufinden, was in dieser Welt gegenüber ihrer Welt fehlte, müsste sich Nicht-Debbie so viel Informationen wie möglich und so schnell wie möglich beschaffen, wobei ich ihr als Computermensch, der auf Datenbanken spezialisiert war, sehr behilflich sein könnte. Ich sah, dass Nicht-Debbie zögerte, und schränkte sofort ein, falls eine Hilfe von mir oder die Benutzung von Computern etwas sei, das gegen die Spielregeln verstieße, dann … Aber Nicht-Debbie unterbrach mich lächelnd.
»Das ist es nicht«, sagte sie. »Ich will dich einfach nicht in die ganze komplizierte Geschichte mit reinziehen … Ist ja nicht so, dass ich bloß irgendeine für dich bin.«
Ich erklärte ihr, dass das überhaupt nicht kompliziert sei. Ich war zwar zweieinhalb Jahre mit Debbie zusammen gewesen, aber sie sei Nicht-Debbie und wir hätten uns erst heute getroffen, und wenn es ihr passen würde, würde ich ihr gerne dabei helfen, die fehlende Sache zu suchen. Und wer weiß, nebenbei vielleicht sogar ein Fernsehstar im Paralleluniversum werden (Nicht-Debbie hatte mir nämlich erklärt, dass die Mitspieler rund um die Uhr gefilmt wurden und die Zuschauer jeden von ihnen auf einem eigenen Kanal verfolgen konnten).
Gegen vier Uhr morgens, nach neun Stunden pausenloser Suche durch technologische, geographische und kulinarische Datenbanken (in einer der Folgen der Show war die Parallelwelt eine Welt ohne Ahornsirup gewesen, ist das zu glauben?), sagte Nicht-Debbie, sie könne die Augen nicht mehr offen halten. Ihr zu Ehren bezog ich das Bett in meinem kleinen Appartement frisch, und sie schlief innerhalb einer Sekunde ein. Ich setzte mich hin und betrachtete die schlafende Nicht-Debbie. Es war seltsam, aber ich hatte das Gefühl, dass ich sie in den neun Stunden besser kennengelernt hatte als meine Debbie in den ganzen zwei und nochwas Jahren, die wir zusammengewohnt hatten. Die Möglichkeiten, die sie im Laufe der Suche nach dem fehlenden Element aufgeworfen hatte, offenbarten ihre Träume, Sehnsüchte und Ängste. Nicht dass sie meiner Debbie nicht ähnlich gewesen wäre, aber sie hatte auch etwas anderes an sich: Sie war offen, mutig, faszinierend und wild. Ich weiß nicht genau, wie man das nennen soll, wenn so was mit einer passiert, die zugleich deine Exfreundin ist, der du aber vorher nie begegnet bist – jedenfalls verliebte ich mich. Und während Nicht-Debbie bei mir in der Wohnung schlief, so nah, dass ich das Shampoo von ihren Haaren riechen konnte, stellte ich mir die vier anderen Spielteilnehmer der Sendung vor, wie sie weiter fliegende Katzen suchten, elektrische Ohrputzstäbchen, Deodorant für Augenbrauen oder was auch immer, das in ihrer ursprünglichen Welt existierte und hier fehlte. Ich wusste, es würde genügen, dass einer von ihnen es schaffte, das Ding zu finden, damit Nicht-Debbie hier bei mir bleiben würde, für immer. Ich spürte, wie auch mir die Augen zuzufallen begannen.
Nicht-Debbie weckte mich um ein Uhr mittags. Sie berichtete mir etwas aufgeregt, dass die durchschnittliche Zeit, die die Teilnehmer in den früheren Sendungen gebraucht hätten, um auf die Lösung zu kommen, bei elf Stunden lag, aber jetzt suchte sie schon über einen Tag lang. »Das war’s«, sagte sie. »Bestimmt hat es einer von den anderen schon rausgefunden.«
Ich versuchte, sie zu ermutigen. Man könne es ja nie wirklich wissen, es wäre doch möglich, dass auch die anderen jetzt verwirrt in Manhattan, oder wo sie auch immer gelandet waren, herumwanderten und sie immer noch gewinnen könnte. »Vielleicht«, sagte Nicht-Debbie und lächelte plötzlich, »aber die Wahrheit ist, dass ich mir von dem Moment an, als ich bei der Show mitgemacht habe, vor allem ausgemalt habe, wie ich in dem Spiel verliere und ein neues Leben in der Parallelwelt anfange, ein besseres und weniger quälendes Leben als das, was ich dort gehabt habe.« Ich schwieg, und sie sah mich mit einem weichen Blick an, anders als alle Blicke, die ich jemals bei Debbie gesehen hatte. »Ganz ehrlich?«, sagte sie und berührte mein Gesicht mit ihrer Hand. »Was spielt es für eine Rolle, was in dieser Welt fehlt? Die Hauptsache ist, dass du da bist.«
Im Bett fragte ich sie, ob sie die Pille nehme, worauf sie erwiderte, sie würde doch stark hoffen, dass sie von allen möglichen Parallelwelten nicht ausgerechnet in einer ohne Kondome gelandet sei. Es war ein Scherz, doch als sie es sagte, konnte ich sehen, wie sie eine Sekunde zögerte, bevor sie den Satz vollendete, in der Befürchtung, es würde vielleicht doch stimmen und genügen, dass sie es aussprach, um in ihre Welt zurückgeschickt zu werden und uns damit für immer zu trennen. Nach dem Sex schlug ich ihr vor, dass wir die Datenbanken in den Bereichen Astronomie, Geopolitik und Geschichte durchsuchen könnten, aber sie sagte, sie würde lieber noch einmal mit mir schlafen.
Danach brachen wir zu einem Spaziergang im Central Park auf und aßen Würstchen. Nicht-Debbie sagte, in der Welt, aus der sie komme, sei sie Vegetarierin aus Gewissensgründen, aber sie habe das Gefühl, dass es hier, weil das ja gar nicht ihre Welt sei, ganz in Ordnung sei, Würstchen zu essen.
»Ich will nicht gewinnen«, sagte sie zu mir, als wir im Park am Teich standen. »Ich will nicht zurück. Ich will hier sein, mit dir.« Den Rest des Tages verbrachten wir im Zentrum der Stadt und zeigten einander die Orte, die jeder von uns in Manhattan am meisten liebte.
Auf die Art gelangten wir zur Trinity Church. Es war bereits Abend geworden, und die Kirche war märchenhaft beleuchtet, sie wirkte mehr wie aus einem Disney-Film als ein echter Ort. Ich erzählte ihr, dass ich vor zehn Jahren, als ich gerade erst in die Stadt gekommen war, per Zufall an dieser Kirche vorbeikam und noch am gleichen Tag einen Schwur abgelegt hatte, dass ich, sollte ich heiraten, es hier tun würde. Nicht-Debbie lachte und sagte, wie gut, dass ich die Kirche schon bestimmt hätte, bliebe jetzt bloß noch, eine zu finden, die einverstanden sei, mich in ihr zu heiraten.
Die Kirche war ziemlich leer, und von dem Moment an, als wir sie betraten, sah sich Nicht-Debbie unruhig um, als wäre sie auf der Suche nach etwas. Ich fragte sie, ob alles in Ordnung sei, und sie sagte, ja, sie verstehe bloß nicht, wo er sei. Als ich sie fragte, wer, bedachte sie mich mit einem Blick, als ob ich irgendwie schwer von Begriff wäre, und sagte: »Gott.« Nach einem kurzen Schweigen fügte sie hinzu: »Das ist eine Kirche, oder?« Ich nickte, und sie sagte: »Dann kann es nicht sein, dass er nicht da ist.« Ich versuchte, sie zu beruhigen. Ich erklärte ihr, dass ich persönlich nicht an Gott glaubte, dass aber auch die, die an ihn glaubten, sagten, es sei nicht möglich, ihn zu sehen.
Nicht-Debbie schüttelte langsam den Kopf und sagte: »Moment mal, dann gibt es in deiner Welt Kirchen, Moscheen und Synagogen und alles ist genau wie bei uns, nur Gott ist nicht wirklich drin? Kapierst du, das ist einfach eine Welt ohne Go…« Sie schaffte es nicht, diesen Satz zu beenden. Zumindest nicht in meiner Welt.
Sechs Jahre sind seitdem vergangen, und ich versuche immer noch, mir auszumalen, was mit Nicht-Debbie ab dem Moment passiert ist. Wie sie im strahlenden Scheinwerferlicht im Fernsehstudio eintraf und von Jubelstürmen des Publikums und Komplimenten des aalglatten Moderatorengespanns empfangen wurde, die ihr verkündeten, dass sie eine Million Dollar gewonnen habe. In meiner Phantasievorstellung freut sie sich manchmal und weint Tränen vor Glück, aber meistens ist sie traurig, lässt ihren Blick durch das Studio schweifen, sucht nach mir und findet mich nicht. Das Herz will sich vielleicht gerne ausmalen, dass sie glücklich ist, aber das Ego – das Ego beharrt stur darauf zu glauben, dass jener Tag, den wir zusammen verbracht haben, für sie genauso bedeutungsvoll war wie für mich.
Weniger als ein Jahr, nachdem sie mir durch die Finger entglitten war, heiratete ich Debbie in der Trinity Church. Das Leben in Sydney hatte ihr nicht behagt, und zwei Monate nach ihrer Rückkehr in die Stadt beschlossen wir, ganz spontan, zu heiraten.
Der Sex mit ihr reichte übrigens nie an die Höhepunkte heran, die ich mit Nicht-Debbie hatte, aber er war angenehm und vertraut, und wir bekamen zwei niedliche, hübsche Kinder, Jack und Deborah-Junior, die lernen würden, in einer Welt ohne Gott zu leben, wie ich.
Gondola
Unter seinem Foto bei Tinder stand, dass er Oschik hieß, 38 Jahre alt, verheiratet ohne Kinder, und auf der Suche nach jemandem für eine ernsthafte Beziehung. Dorit, die sich in der Welt des Online-Datings bereits auskannte, war noch nie auf ein so merkwürdiges Profil gestoßen. Das etwas spießig formulierte Gesuch in Kombination mit seinen hohen Wangenknochen und den riesigen blauen Augen machte sie neugierig genug, um sich mit ihm treffen zu wollen. Der einzige Oschik, den sie jemals gekannt hatte, war ein Onkel von ihrem Vater gewesen, ein Versicherungsagent aus Netanya, und den hatte ein Hai gefressen. Das war eine Riesengeschichte damals, und während der Schiva fiel eine fürchterliche Fernsehreporterin über Dorit und Rotem, ihre große Schwester, her und bestand darauf, sie zu interviewen. Rotem sagte der Reporterin, dass Oschik jetzt ein Engel sei und sie sich ewig an ihn erinnern würde, und als die Reporterin Dorit fragte, woran sie sich in zwanzig Jahren am meisten von Onkel Oschik erinnern würde, stotterte Dorit, sie würde sich immer daran erinnern, dass ihn ein Hai gefressen hatte.
Zu ihrem ersten Treffen wollte sich Oschik um fünf Uhr nachmittags in einem Roladin-Café verabreden. Die Männer, die Dorit über die Apps kennengelernt hatte, wollten sie unbedingt immer in ihrer Wohnung treffen – hätten sie gekonnt, hätten sie das erste Date wohl gleich im Schlafzimmer ausgemacht –, aber er wollte nicht nur ein Treffen am Nachmittag in einem Oma-Café, sondern sagte auch, dass er nach einer Stunde wieder gehen müsse, denn am Abend würde er mit seiner Frau zu einer Hochzeit im Süden fahren.
Sie saßen einander gegenüber und nippten an ihren Kaffeetassen. Dorit fragte sich, wie lange es wohl dauern würde, bis sie zur Sache kommen würden, aber Oschik ließ sich Zeit. Sie spürte, dass er von ihr angezogen war und ihn das ein bisschen befangen machte. Er stellte ihr lauter altväterliche Fragen: wie war ihre Kindheit, was waren ihre größten Ängste, welche Musik hörte sie freitagnachmittags am liebsten, wenn die Welt um sie herum zum Schabbat hin langsamer wurde. Das ganze Vorgehen und die Atmosphäre glich mehr einer Verabredung in der Jugendgruppe der Bnei Akiva als dem Vorspiel zu einem Tinderfick. Es war eigenartig, doch auf eine gewisse Weise tat es Dorit gut. Viel lieber erzählte sie Oschik, wie Rotem ihr als Siebenjährige beigebracht hatte, sich nicht zu fürchten, wenn sie ein Rad schlug, als auf die Frage eines tätowierten Hipsters, den sie nur wenige Minuten zuvor auf der Dating-App nach rechts gewischt hatte, nach ihrer Meinung zu Analsex zu antworten. Dieser Oschik war wirklich an ihr interessiert. Mehr als nur interessiert, er verliebte sich. Und mit zweiunddreißig, nach einer viel zu langen Beziehung mit einem egoistischen Hightechtyp, der die Welt und Dorit als einen Algorithmus ansah, den man knacken musste, passte ihr so ein sanfter, empfindsamer Oschik jetzt gut. Sanft, empfindsam und verheiratet.
Der Bildschirmschoner seines Handys zeigte ein Foto von ihm und seiner Frau in einer Gondel. Als sie danach fragte, stotterte Oschik, das sei ein altes Bild von einer Reise nach Venedig und wechselte sofort das Thema. Als er auf die Toilette ging, fotografierte Dorit seinen Bildschirmschoner mit ihrem Handy ab und sah sich das Foto dann später zu Hause wieder an. Oschiks Frau war hübsch, hübscher als sie. Sie hatte goldbraune Locken, einen langen Hals und eine makellos reine Gesichtshaut. Egal, wie sehr Dorit das Bild vergrößerte, es gelang ihr nicht, in diesem Gesicht auch nur ein winziges Pickelchen oder eine einzige Sommersprosse zu entdecken. Auf dem Foto lächelte seine Frau mit strahlend weißen Zähnen und trug einen teuer aussehenden Ehering, während Oschik neben ihr nachdenklich blickte und keinen Ring trug. Auch zu ihrer Verabredung in dem Café war er ohne Ring erschienen. Auf dem Foto in der Gondel sahen die beiden sehr entspannt aus, aber irgendwie nicht wie ein Paar. Oschiks linker Arm lag auf der Schulter seiner Frau, doch die Berührung hatte nichts Erotisches oder Knisterndes an sich. Sie wirkte alles andere als romantisch, eher wie eine Umarmung mit einem Kameraden aus der Armee.
Auch ihr zweites Treffen fand in einem Roladin-Café statt. Dieses Mal wollte Dorit zahlen, aber Oschik weigerte sich. Er hatte sich eine Quarktasche bestellt und erzählte, dass er als Soldat jedes Mal, wenn er dazu verdonnert wurde, in der Basis zu bleiben, zur Kantine ging und sich mit einer Quarktasche tröstete. Dorit fragte ihn, ob das oft passiert sei, und er nickte und sagte fast stolz, dass er anscheinend der schlechteste Soldat in der Geschichte der israelischen Armee gewesen sei.
Sie hatten eine wirklich nette Unterhaltung, an deren Ende Oschik vorschlug, zu ihr nach Hause zu gehen. Er versuchte es ganz beiläufig klingen zu lassen, doch Dorit merkte, wie angespannt er war. Sie sagte zu ihm, er sei echt süß und sie würde gerne mit ihm zu ihr nach Hause gehen, aber bevor irgendwas zwischen den beiden starten könne, müsse sie verstehen, was die Sache mit seiner Frau sei. Es gebe viele Verheiratete auf Tinder, aber Oschik sei der Erste unter ihnen, der in seinem Profil geschrieben habe, dass er eine ernsthafte Beziehung suche. »Was heißt das genau?«, fragte sie lächelnd. »Wie ernst kann das sein, wenn du verheiratet bist?«
Oschik nickte: »Wenn du das so sagst, klingt es wirklich idiotisch.« Sie fragte ihn, ob seine Frau wisse, dass er sich mit ihr traf, und er stotterte, nein, aber sie würden ohnehin nicht miteinander schlafen, sie seien mehr so etwas wie Freunde. »Ich suche eine ernsthafte Beziehung, ehrlich!«, sagte er und streichelte zaghaft Dorits Hand. »Aber ich weiß auch, dass ich sie wohl nie verlassen werde, und das ist mir wichtig, dass das offen auf dem Tisch liegt. Damit du nicht plötzlich das Gefühl hast, ich hätte dir ein falsches Pferd untergejubelt.« Dorit meinte lächelnd, sie würde Pferde durchaus lieben und außer ihrem Großvater kenne sie niemand, der diesen Ausdruck noch benutze.
Der Sex mit Oschik erinnerte sie an ihre Gymnasialzeit, im guten Sinne. Alles war auf fast kindliche Art und Weise erregend. Er streichelte, küsste und leckte sämtliche Körperteile von ihr und schien die ganze Zeit unglaublich beglückt und dankbar. Während sie miteinander schliefen, schloss Dorit die Augen und dachte an eine Million Dinge, auch an die Gondola, wie sie seine Frau bei sich nannte. Sie verspürte keinerlei Schuldgefühl. Sein Körper zeigte ihr in jedem gemeinsamen Moment, wie ausgehungert er nach Berührung war, und wenn er das zu Hause nicht bekam, gab es keinen Grund, weshalb er es nicht von ihr bekommen sollte. Besonders, wenn er ihr dabei auch noch das Gefühl vermittelte, sie sei die begehrenswerteste Frau auf der Welt.
Am Anfang sah Dorit hauptsächlich ein kurzes Verhältnis darin. Eine Art exzentrisches und etwas abseitiges Kapitel in ihrem sonst eher stromlinienförmigen Leben, etwas, worüber sie einmal lächelnd erzählen könnte: Wie sie mit einem Typen gegangen war, der es jedes Mal von Neuem aufregend fand, wenn sie sich küssten, und der ihr zu den Treffen Quarktaschen, gefüllte Schokoriegel, Cornetto-Eis und Puddingbecher mitbrachte. Oschik war vielleicht nicht der wortgewandteste Mensch, den Dorit kannte, aber er war gutherzig, lustig und neugierig, und er liebte sie so, dass etwas von dieser Liebe sie ansteckte. Und sie redeten über alles. Fast alles. Über seine Frau redeten sie nicht. Als sie einmal versuchte, ihn nach ihr zu fragen, erklärte er ihr, wenn Dorit und er miteinander schliefen, hätte er nicht das Gefühl, sie zu betrügen, aber wenn er mit ihr über sie redete, dann schon. Deshalb bemühe er sich, gar nichts über sie zu sagen, nicht einmal wie sie hieß. »Auch ihr sage ich kein Wort über dich«, versuchte er zu scherzen, aber Dorit lächelte nicht. Sie sagte zu Oschik, dass ihr das ganze Arrangement als Geliebte einmal gut gepasst habe: Im Jetzt zu sein, nichts zu erwarten und vor allem, dass niemand etwas von ihr erwartete. Aber nachdem sie nun ein Jahr zusammen seien, genüge ihr das nicht mehr. Sie wollte mehr: Zusammenwohnen, ein Kind, eine Tochter oder einen Sohn, nicht jetzt gleich, aber irgendwann, an Feiertagen gemeinsam bei ihren Eltern beim Abendessen sitzen. Und wenn die Beziehung zwischen ihm und der Gondola wirklich so freundschaftlich und rücksichtsvoll sei, wie er behaupte, würde sie das sicher verstehen und ihn gehen lassen.
Oschik blickte sie mit seinen riesigen blauen Augen an und schien den Tränen nahe. »Du willst also, dass wir damit aufhören, weil ich am Pessachabend nicht mit zu deinen Eltern fahre?«, fragte er. »Matzeknödel und lahme Witze von Onkel Morris, das fehlt uns zu unserem Glück?«
»Ja«, sagte Dorit. »Nichts zu machen. Von allen Frauen auf der Welt hast du die eine komische erwischt, der es gefällt, wenn ihre Männer nicht mit einer anderen verheiratet sind.«
»Das ist nicht fair«, flüsterte er. »Ich hab dir schon beim ersten Treffen gesagt …«
»Stimmt«, unterbrach ihn Dorit. »Du hast mir gesagt, dass es einen Haken bei der Geschichte gibt. Damals war das für mich in Ordnung. Aber jetzt ist der Moment gekommen, wo du zwischen dem Haken und mir wählen musst.«