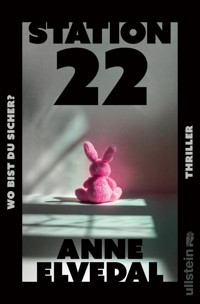
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine düstere Klinik. Zwei vermisste Frauen. Ein Alptraum, der nie endet. Krankenschwester Ida ist beliebt auf der Station 22. Ihre Patientinnen vertrauen ihr blind – bis eine von ihnen verschwindet. Während alle von Flucht sprechen, bohrt sich ein brutaler Verdacht in Idas Bewusstsein. Sie selbst wurde als Kind entführt und kehrte mit ausgelöschtem Gedächtnis zurück. Als eine zweite Frau verschwindet, wird es zur grausamen Gewissheit: Idas Peiniger hat sie aufgespürt. Um die Opfer zu retten, muss sie in die Abgründe ihrer Psyche steigen und die Mauer durchbrechen, die sie vor der Wahrheit schützt. Die Thriller-Sensation aus Norwegen endlich auf Deutsch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Station 22. Wo bist du sicher?
Anne Elvedal ist eine renommierte norwegische Autorin. Sie wurde mehrfach für den Amanda Award nominiert und war an dem international preisgekrönten Dokumentarfilm »Königin ohne Land« beteiligt. Neben ihrer Tätigkeit als Autorin ist sie ausgebildete Krankenschwester und arbeitete zuvor in der psychiatrischen Gesundheitsversorgung. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Asker, Südnorwegen. »Station 22« ist ihr erster Thriller für Erwachsene.
In der untersten Schublade fällt mir etwas Rosafarbenes auf. Ich ziehe es hervor.Und da. Ist es, als ob. Alles erstarrt.Alle Geräusche verschwinden. Als ob jemand, plötzlich, mir die Ohren zuhält, doch gleichzeitig, die Sinne schärft. Das Einzige, das ich höre. Ist mein eigener Atem.Ein.Aus.Mit jedem Mal schneller.Der Fußboden zittert, die Wände, ich?Ich atme ein. Ich atme aus. Ich kneife die Augen zusammen. Ich bin wach.Ich richte den Blick wieder auf meine Hand. Sie zittert. Ich schwitze, mir ist heiß, mir ist kalt. Ist das meine Hand?
Anne Elvedal
Station 22. Wo bist du sicher?
Thriller
Aus dem Norwegischen von Andreas Brunstermann
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
ISBN978-3-8437-3670-1
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel Du kan kalle meg Jan bei Cappelen Damm, Oslo.
Deutsche Erstausgabe© 2024 by Anne Elvedal© der deutschsprachigen Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Friedrichstraße 126; 10117 Berlin 2025 Alle Rechte vorbehalten.Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenUmschlagmotiv: © zero-media.net / MidjourneyAutorenfoto: © Rudjord FarteinWir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44 b UrhG ausdrücklich vor.Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an [email protected] powered by pepyrus
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Danksagung
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Motto
Ich bin nicht das, was mir passiert ist, ich bin, was ich beschließe zu werden.Carl Gustav JungProlog
Sie weigerte sich, die andere Socke anzuziehen. Ständig weigerte sie sich, etwas anzuziehen. Ein Haargummi. Einen Gürtel. Den Maulkorb. Kleine Teile seiner Kostüme. Erinnerungsstücke, hatte sie angefangen, sie zu nennen. Denn sie erinnerten sie daran, an dem kleinen Teil festzuhalten, den sie schaffte zu verstecken. Der sie am Leben hielt. Der immer noch sie selbst war. Den ihr wegzunehmen ihm niemals gelingen sollte.
Jetzt wedelte er mit der schlaffen Socke vor ihrer kleinen Nase herum. Würde er sie ihr zur Strafe in den Mund stopfen? Die Socke pendelte von einer Seite zur anderen, wie ein tickendes Metronom, das darauf bestand, den Takt der Situation zu bestimmen. Unnachgiebig. Erstickend. Ihr Herz schlug aufsässig dagegen an, während sie der Socke mit dem Blick folgte. Bestimmt war sie irgendwann mal weiß gewesen. Jetzt war sie eher gelb. Ein abgeschnittener und umgenähter Zipfel eines Lakens, der verdammt dankbar sein sollte, ein neues Leben bekommen zu haben.
Manchmal fragte sie sich, ob er recht hatte. Doch heute nicht. Heute spitzte sie die spröden Krallen und fletschte die neu gewachsenen Zähne. Scherte sich nicht darum, dass er danach die Glühbirne an der Decke herausschrauben und sie somit in die Dunkelheit stoßen würde. Dann würde sie nur die Augen schließen und nach Hause zu Mama entfliehen.
Sie konnte die Arme nicht rechtzeitig vor den Kopf heben. Die Hand war schneller. Die Faust, heute. Etwas bricht. Wird zerschmettert. Das Licht beginnt zu zittern. Oder ist sie es?
Sie liegt auf dem Fußboden, atmet nicht. In einer roten Weihnachtsrobe aus glänzendem Samt. Rote Schleife im dunklen, gelockten Haar. Rote, blutige Lippen. Mädchen versteckt, vergessen.
Um ihre Schenkel breitet sich eine lauwarme, feuchte Pfütze auf dem Fußboden aus. Sie weint nicht. Nicht mehr. Stattdessen bewegt sie die Lippen, lässt Töne heraus, zart, stark, eine Frage. Dieselbe Frage, die sie wieder und wieder gestellt hat, in diesen zerstückelten Tagen, Wochen, Monaten, die sich zu einem versteinerten Inneren verwickelt haben, das niemals zerbersten darf, niemals. »Wie heißt du?«, fragt sie.
Vielleicht kann ein Name ihn zu einem Menschen machen?
Die Hand, die sie heruntergedrückt hat, streicht ihr über das Haar, liebevoll. Sie versucht, ruhig zu liegen, aber der Bauch windet sich in Krämpfen, der Darm sehnt sich verzweifelt nach Nahrung. Wie viele Tage ohne Essen werden es noch sein? Die Reue schleicht heran, als ob sie in den Schatten gelegen und gewartet hätte. Jetzt kriecht sie in die Adern hinein. In letzter Zeit ist das öfter passiert. Jetzt wünscht sie sich nur, dass er sie hochhebt, ihre Wunden reinigt, ihr etwas anderes gibt als das rosa Hasenohr, das sie in Fetzen zerkaut hat, ihr ein Schlaflied vorsingt. Seine Hand ist warm. Wärmt mich. Ich halte sie. Halte sie fest. »Bitte, sag doch«, flüstere ich. »Ich werde es auch nicht weitererzählen. Versprochen.«
Sein Atem kommt näher. Weht wie eine Flamme. Brennt Löcher in meine Wange. Will er wieder zubeißen? Das Stückchen abbeißen. Das letzte. Mich. Nein? Er flüstert zurück, dass ich ein braves Mädchen war. Dass ich eine Belohnung verdiene. Seine Worte krabbeln in mein Ohr wie Larven: »Sag Jan zu mir.«
1
Verloren. Das ist die beste Beschreibung, die ich gerade über Fanny abgeben kann. Sie sitzt ganz vorn auf der Bettkante, ihre schmalen Füße hängen ein paar Zentimeter über dem Fußboden, eingeschnürt in die selbst gestrickten Wollsocken der Mutter. Ich mustere sie einen Augenblick, wie um ihr ein paar zusätzliche Sekunden zu verschaffen, ehe ich sie in die Welt zurückstoßen muss, vor der sie sich so sehr fürchtet.
Sie hat mich nicht wahrgenommen. Auch ihre Eltern nicht, die ich in das nackte Zimmer gelassen habe, in dem sie sich seit drei Monaten verschanzt. Ihr bleiches Gesicht ist zum Fenster gerichtet, auf dem die tief stehende Herbstsonne Fettflecken von tastenden Fingern und einer Nasenspitze anstrahlt, doch darauf starrt sie nicht. Ihr Blick ist nach innen gewendet, auf den Strom der Gedanken, der ihren Körper so knöchern, so zerbrechlich gemacht hat. Das dünne dunkle Haar ist zu einem strammen und hohen Pferdeschwanz gebunden, der ihre markante Kinnpartie, die ungeschminkten Augen und den Überbiss betont, der dazu führt, dass ihr Mund nur selten ganz geschlossen ist. Wüsste ich nicht, wer sie ist, hätte ich getippt, dass sie dreizehn Jahre alt ist, vielleicht vierzehn, mitten im Umbruch von Kind zu Erwachsener, aber sie ist achtzehn und volljährig. Jedenfalls alt genug, um hinter verschlossenen Türen in der psychiatrischen Klinik Østmarka zu sitzen, in der Station 22, Spezialabteilung für erstmals erkrankte junge Erwachsene mit psychischen Leiden und Drogenproblemen. In den Bericht werde ich schreiben, dass sie einen zuversichtlichen Eindruck macht.
Zumindest muss ich an dieser Darstellung festhalten. Ich habe versucht, Bescheid zu geben. Ich habe gesagt, dass Fanny meiner Meinung nach vorgibt, gesünder zu sein, als sie ist. Dass sie vermutlich Gedanken hat, die sie nicht zu erzählen wagt, weil sie sich einzig und allein wünscht, ein normaler Teenager zu sein. Doch ihr Psychologe hat sich entschieden, auf das restliche Pflegepersonal zu hören. Sie haben eine junge Frau beobachtet, die wegen Verfolgungswahn zur Untersuchung und Behandlung hergekommen ist und die gut auf Medikation und Milieutherapie, Realitätsorientierung und einen festen Rahmen anspricht. Ein Mädchen, das auf der Flucht vor der Angst war, aber jetzt zurückgefunden hat zum Schlaf, zum Appetit und zum Lächeln. Sie sei schon zu lange hier, meinen die anderen. Es gebe viele, die kränker seien und den Klinikplatz weitaus mehr brauchten.
Als ich auf sie zugehe, quietschen meine Gummisohlen, wie ein Echo all der unglücklichen und gequälten Schreie, die an den hundert Jahre alten Backsteinwänden haften. Ein Duft nach Kokos weht mir zu und verrät mir, dass sie sich heute Morgen die Haare gewaschen hat, obwohl sie es auch schon gestern während der Abendschicht getan hat. Ein Versuch, den Aufenthalt wegzuschrubben? Ich strecke den Arm aus, um sie von dort zurückzurufen, wo sie sich gerade befinden mag, aber genau da friert die Sekunde ein.
Ich habe etwas entdeckt.
Gleich hinter dem Knöchel meines Handgelenks.
Ein Haar.
Ein schwarzes, einsames Haar. Es ragt steif und rebellisch aus der Haut hervor.
Die natürlichste Reaktion wäre jetzt, die Hand zurückzuziehen, zu lächeln, glaubwürdig zu versichern, dass ich etwas vergessen habe, und hinauszugehen, mich in einem Winkel zu verstecken und dem Haar das Lebensrecht zu entziehen. Aber ich bin dazu erzogen worden, meine Impulse zu bekämpfen. Daher führe ich jetzt die Bewegung aus. Ich berühre Fanny leicht an der Schulter, und während ich sie gleichzeitig freundlich anspreche, ziehe ich die Hand schnell zurück und vergrabe sie tief in der Hosentasche.
Genau davor wurde ich gewarnt. Genau das geschieht, wenn ich einen anderen Menschen zu nah heranlasse: Ich werde unaufmerksam.
Fannys fragender Blick umfängt mich.
Ich lächle. »Bist du bereit?«
Sie nickt schwach.
An der Tür hat die Mutter bereits die schwarzen Schnürstiefel vom Boden aufgehoben. »Komm, Schatz, jetzt fahren wir nach Hause.«
Sie wartet nicht auf eine Reaktion, streift Fanny bloß die soliden Schuhe über und zieht sie fast aus dem Bett. Obwohl die Mutter klein und zierlich ist, vom Typus satt von einem kärglichen Salat, ist sie stark, eine wütende Bärin. Sie reicht ihrer Tochter eine abgenutzte hellblaue Windjacke, die sie von zu Hause mitgebracht hat, aber Fanny macht keine Anstalten, sie anzuziehen.
»Draußen ist es kalt«, sagt die Mutter.
Fanny ist stumm. Ihre Arme hängen trotzig an den schmalen Hüften herunter. Die Mutter hebt das Brustbein, sodass sich die Knöpfe an dem engen Vintage-Mantel spannen.
»Hast du erzählt, dass du morgen einen Termin in der Poliklinik hast?«, frage ich in dem Versuch, einen weiteren Streit abzuwehren.
Fanny nickt erneut. Ich weiß, dass sie es erzählt hat. Ich habe es den Eltern ebenfalls gesagt.
Die Mutter weicht meinem Blick aus. Verstärkt den Griff um die Windjacke.
»Wir werden Punkt zwölf Uhr da sein«, sagt der Vater. »Kein Problem.«
Er schenkt mir ein dankbares Lächeln, das sich bis in die runden Wangen ausbreitet. Am ersten Abend, als er uns sein einziges Kind überlassen musste, hatte er mir das gleiche Lächeln geschenkt und gesagt, wie gut es doch sei, zu sehen, dass wir vom Personal ganz normal wirkten. Er war am häufigsten hier zu Besuch, jeden Abend, mit Bärenumarmungen und Schokoladenbären. Wenn die Mutter dabei war, sind sie Hand in Hand gekommen, um die Distanz und die Entfremdung zwischen ihnen zu verbergen.
»Papa? Hast du es?«, fragt Fanny.
»Natürlich.« Er zieht ein flaches, viereckiges Paket aus der großen Jackentasche. Das grelle Logo des Familienbetriebs prangt auf beiden Seiten des Reißverschlusses, den er kaum zubekommen hat. Er geht auf die sechzig zu, und obwohl er ein aktiver Handwerker ist, hat er es nicht so gut wie seine vierzehn Jahre jüngere Frau geschafft, dem Verfall des Alters entgegenzuwirken.
Fanny greift nach dem Geschenk und hält es mir entgegen. »Das ist für dich, Ida. Weil du so lieb zu mir gewesen bist.«
Ich weiß nicht, ob es an der Zartheit in ihren Augen liegt, daran, dass ich nie zuvor ein Geschenk von einer Patientin bekommen habe, oder an der Tatsache, dass Fanny sich auf dem Weg hinaus in eine Welt befindet, die tatsächlich völlig grausam ist, jedenfalls muss ich jetzt hart schlucken, damit meine Stimme fest bleibt.
»Fanny. Ich habe doch bloß meine Arbeit gemacht.«
»Sie haben viel mehr als das getan«, sagt der Vater. »Ohne Sie wäre es nie so gut gegangen, Ida.«
Ich widerspreche nicht. Ich habe mehr getan, als ich tun musste. Ich habe nicht nur einen guten und individuellen Patientenplan erstellt und dafür gesorgt, dass Fanny Vertrauen, Krisenbewältigung und Fortschritt erlebt hat; ich habe meine Pausen ausgelassen und ihr stattdessen ein Gespräch oder einen Spaziergang angeboten, ein paar extra Käsesandwiches, ich habe eine Extrarunde Tischtennis gespielt, sie extra lange im Zeichen- und Malzimmer gelassen, ihr meine Lieblingsbücher ausgeliehen, ihr die Hand gehalten, wenn es Schlafenszeit war. Ich bin die Einzige, die ihre Angst wirklich verstanden hat.
»Pack es ruhig aus«, sagt Fanny.
Ich folge ihrer Bitte. Erwähne nicht, dass wir vom Personal verpflichtet sind, alle Geschenke in den Besprechungsraum zu legen. Es ist eine Schachtel Schokoladenherzen. Feine Schokoladenherzen, die zwischen den Fingern leicht zerbrechen.
»Oh, vielen Dank«, sage ich. »Ich liebe Schokolade.«
Fanny lächelt mit der natürlichen Scheu eines Kindes. »Ich weiß. Du bist genau wie Papa.«
»Fanny hat Sie wirklich lieb gewonnen«, sagt der Vater. »Sie wissen ja gar nicht, wie viel es uns bedeutet, dass Sie sich so sehr um unser Mädchen gekümmert haben.«
Die Mutter dreht mir den Rücken zu, und mit gereizten Bewegungen durchforstet sie den leeren Kleiderschrank.
Ich nehme Fanny in den Arm. Sie wirkt angespannt. Ich würde sie eigentlich gern länger an mich drücken, ziehe mich stattdessen jedoch zurück. Sie darf nicht merken, wie besorgt ich bin. Dass ich denke, sie wird aus dem Nest geworfen, ehe sie flügge ist; dass ich befürchte, sie wird eine von denen, die in ein paar Wochen oder Monaten zurückkommen, jedes Mal ein bisschen kränker.
»Ich begleite euch hinaus«, sage ich und will schon die große Tasche nehmen, die zu packen ich ihr gestern Abend geholfen habe, doch der Vater hindert mich daran.
»Das übernehme ich.« Er wirft sich die Tasche über die Schulter und tut so, als ob er wegen des Gewichts zu Boden gedrückt würde, entlockt Fanny ein spontanes und süßes Lachen, ehe er den Arm um sie legt und sie gemeinsam den Gang entlangschlendern.
Die Mutter knallt die Schranktüren zu und dreht sich zu mir um, bleibt stehen, ihr ganzes Ich zittert jetzt.
»Ich glaube, wir haben alles eingepackt«, sage ich und schaffe es nicht, mich zurückzuhalten: »Wir haben sogar alle Hautzellen und abgeknipsten Zehennägel in einen verschließbaren Beutel gelegt.«
Damit niemand beweisen kann, dass deine Tochter hier eingewiesen war.
Sie lacht nicht, wie ihr Mann es getan hätte. Vielleicht hätte sie es lustiger gefunden, wenn ich Haare gesagt hätte, aber im Augenblick muss ich vermeiden, mich auf Haare zu fokussieren.
»Und was passiert, wenn er sie weiterhin quält?«, fragt sie.
Sie sieht mich direkt an. Sie hat die gleichen braunen Augen wie Fanny, doch ihre sind verhärtet.
»Dann müssen Sie ihr Sicherheit und Realität vermitteln und …«
Weiter komme ich nicht.
»Realität müssen Sie sich wohl am ehesten selbst vermitteln«, spuckt sie mir entgegen. »Ihr habt ja nicht mal ansatzweise versucht herauszufinden, wer dieser Stalker ist!«
Sie blockiert die Tür, und mich überkommt der Drang, sie an die Wand zu drücken und sie aufzufordern, ihre Tochter zu unterstützen, sie zu sehen und sie nicht in ein Paar Schuhe zu zwängen, die ihr gar nicht passen. Stattdessen versuche ich es mit meinem bestmöglichen Beruhigungslächeln, während ich nach einer Antwort suche, die uns beiden aus der Klemme helfen kann.
Fanny hatte kaum den Fuß über die Schwelle der Station 22 gesetzt, als die Mutter mich mit Erklärungen überfiel, dass Fanny nicht krank sei, dass es ein grober Fehler sei, sie von der Akutstation hierher zu verlegen, eine Kränkung, ein Gesetzesverstoß. Dieser Mann, der Stalker, sei natürlich real. Mehrere Wochen lang habe er ihr aufgelauert, auf der Straße, vor der Schule, vor dem Trainingscenter, vor dem Haus. Anfangs glaubten die Mutter und der Vater, es sei bloß die Rede von einem gleichaltrigen Jungen, der übermäßig an ihr interessiert war; dass Fanny überreagierte, dass sie wegen der ganzen Schularbeiten gestresst und erschöpft sei. Doch nach einer Weile wurde die Angst vor dem Unbekannten so lähmend, dass Fanny nicht mehr zur Schule ging, nicht mehr zum Training, dass sie aufhörte, Freunde zu treffen, zu essen, zu schlafen. Als sie eines Nachts schwarze Müllsäcke vor ihr Fenster klebte und sich mit dem größten Küchenmesser ausrüstete, begriff der Vater, dass diese Person, von der die Tochter hartnäckig behauptete, sie stehe im Garten, sich eigentlich im Inneren ihres Kopfes befand. Also brachte er Fanny zum Arzt. Die Mutter meinte, sie hätten besser zur Polizei fahren sollen.
»Fanny wird jetzt durch fähige Fachleute in der Poliklinik eine sehr gute und auf sie abgestimmte Nachbehandlung bekommen«, sagte ich. »Wenn es etwas gibt, das Sie wissen möchten oder das Ihnen Sorge bereitet, können Sie sich direkt an die Klinik wenden.«
Ich versuche, professionell zu klingen, erfahren, denn die Mutter hat mehrmals zum Ausdruck gebracht, dass eine psychiatrische Krankenschwester über eine große Portion Lebenserfahrung verfügen sollte, um gute Arbeit zu leisten, was ihrer Meinung nach jedoch mit achtundzwanzig Jahren niemand hat. Jedenfalls niemand, der obendrein auch noch dick ist und nicht mal weiß, wie er auf sich selbst achten soll.
Ein paarmal hatte ich Lust, ihr zu erzählen, dass zwanghaftes Essen meine Methode sei, auf mich selbst zu achten, meine Methode, zu überleben. Diese Extrakilo sind meine Festung, meine Verteidigungsanlage, genauso wie die langen gebleichten Haare, die blauen Kontaktlinsen, die haarlose Haut, die täglich ein Haarentfernungsritual über sich ergehen lassen muss.
Die Mutter verschwindet wie ein lautloser Donnerschlag zur Tür hinaus.
Ein paar Minuten später habe ich mich in der Personaltoilette eingeschlossen. Fanny ist auf dem Weg nach Hause, ein Zettel mit meiner Telefonnummer steckt in ihrer Gesäßtasche. Ich fische meinen kleinen roten Kumpel aus dem BH: ein Schweizer Armeemesser mit vierunddreißig Funktionen. Ich klappe die Pinzette aus und zupfe das Haar samt der Wurzel heraus. Dann schlucke ich es mit drei Portionen Wasser aus dem Hahn hinunter.
Trotzdem werde ich nicht ruhiger.
2
Barbro legt das Handy auf den Tisch und blickt mich an. Krümmt sich. »Also, ich habe nur geschrieben, dass wir noch hier sitzen? Seitdem hat er nicht geantwortet? Aber, ja, er ist sicher beschäftigt. Er fährt ja gern durch die Gegend und wedelt mit seiner Rute …« Sie gähnt kurz. »Also, ich meine Angelrute!« Die unattraktive Röte deutet darauf hin, wie peinlich es ihr ist, etwas geäußert zu haben, das einem Freud’schen Fehler gleicht. Sie nimmt ihre Lesebrille ab, die an einer Schnur um ihren Hals befestigt ist, und versucht, sich mit dem halben Liter Bier zu ertränken. Wir sitzen in einer der abgeranzten Kneipen in einem der alten Brauhäuser in Bakklandet. Zwischen schiefen Holzwänden und einem altersmäßig breit gefächerten Klientel fügen wir uns ganz unbemerkt ein. Ich habe einen Tisch in der Ecke gewählt, wo ich die Wand im Rücken und einen Blick auf die Tür habe. Von dort kann sich keine Überraschung unbemerkt heranschleichen.
Nach der Arbeit habe ich eine lange Fahrradtour gemacht. Das hat nicht geholfen. Zum Abendessen habe ich mir eine doppelte Portion bereitet. Das hat auch nicht geholfen. Die schwelende Unruhe will nicht nachlassen, sie hat sich durch die Haut gepresst, kribbelt, kratzt. Womöglich liegt es an dem Haar. Womöglich liegt es daran, dass ich mehr für Fanny hätte tun sollen. Womöglich ist es auch gar nichts Besonderes. Es ist keine unbekannte Unruhe. Dieser Widersacher kommt des Öfteren unangemeldet zu Besuch, und an den Tagen, an denen er sich weigert, wieder zu gehen, gibt es bloß eins, das ihn wieder verjagen kann.
Barbro versucht, das stumme Handy zu ignorieren, während sie von dem Versuch zu reden beginnt, einem Ableger Wurzeln wachsen zu lassen, und dann wie üblich in einem langen und uninteressanten Monolog verschwindet. Vor den Fenstern strömt die ruhige Nidar vorbei. Die Stühle und Tische des Außenbereichs der Bar auf einem Kahn sind hereingeholt worden, die Bewirtschaftung im Freien ist für den Rest des Jahres eingestellt. Die rot gestrichene Brücke Gamle Bybro erstreckt sich quer über den Fluss, auf ihr steht ein eng umschlungenes Liebespaar und schießt in der Dämmerung ein Selfie. Diese Brücke ist meine erste Erinnerung an Trondheim. Mama und ich fuhren schon am ersten Tag hierher, gleich nachdem wir nordwärts in diese wetterfühlige Küstenstadt geflüchtet waren. Mama meinte, es könne uns Glück bringen, unter den prachtvollen Holzbögen von Lykkens Portal umherzuwandeln.
Ich denke immer an Mama, wenn ich mit Barbro unterwegs bin. Obwohl Barbro zehn Jahre jünger ist, mit breitem Nordmøre-Akzent spricht und keine Ähnlichkeit hat: Barbro ist wohl niemals schön gewesen. Ihr Haar ist dünn und ohne Glanz, das Gesicht zu länglich, die Augen stehen zu weit auseinander. Während Mama, was die äußere Form betrifft, sich klassisch und neutral kleidet, bevorzugt Barbro formlose und farbenfrohe weite Blusen. Eines haben sie dennoch gemeinsam, sie riechen gleich: nach Verbitterung darüber, dass das Leben nicht so geworden ist, wie sie es einst erträumten.
Barbro lässt die Hand über die Tischkante schleichen und berührt das Handy. Eine leere Displayfratze. Ich nippe am Bier, während sie eine neue Nachricht schickt. Es ist wie eine Wiederholung unseres letzten Stadtbummels. Und dem davor.
»Vielleicht solltest du ihn feuern?«, sage ich. »Du sagst doch zu allen, dass sie sich nicht mit jemandem von der Arbeit einlassen sollen.«
Sie überhört mich. Wie üblich. Vielleicht habe ich es nicht laut genug gesagt.
»Vielleicht hat er eine extra Nachtschicht übernommen und ist jetzt zu Hause und schläft«, sagt sie. »Alan springt ja immer ein, wenn jemand krank ist. Hast du schon gehört, dass er sich nächstes Jahr für die Pflegeausbildung bewerben will?«
In der Regel bekommen Studenten aus verschiedenen Gesundheitsbereichen die Extraschichten bei uns, aber Alan bekam dennoch im Frühjahr die Möglichkeit, ein paar Probeschichten bei uns zu machen, obwohl er keinerlei medizinische Erfahrung mitbrachte. Barbro hatte ihn am ersten Tag in die Arbeit eingewiesen, was sie als Fachbereichsleiterin und unmittelbare Vorgesetzte auf der Station 22 eigentlich hätte delegieren können, delegieren sollen, denn es dauerte Stunden. Danach war sie verzaubert. Alan sei außerordentlich geschickt im Umgang mit den Patienten, sagte sie, doch eigentlich meinte sie, dass sie sich von seinen übertriebenen Flirtattacken bezaubern ließ. Ich kann sie gut verstehen. Es ist sicher nicht leicht, ein ewiger Single, kinderlos und über fünfzig zu sein, schon weit hinaus über das Mindesthaltbarkeitsdatum, wenn man den Männern in ihrem Alter glauben soll. Natürlich ist es verführerisch, sich an das schmale Angebot zu klammern, das man in aller Heimlichkeit bekommt. Barbro sieht nicht, dass Alan sie ausnutzt, dass er bloß jedes Mal zu ihrer weit geöffneten Tür hereinschleicht, wenn er sich langweilt oder gerade keine andere Frau am Haken hat.
Ich bin eigentlich auch nicht besser. Jedes Mal, wenn es mich zu sehr juckt, schicke ich Barbro eine Nachricht, weil ich weiß, dass sie zu einem Stadtbummel immer Ja sagt. Sie hat sonst niemanden, der mit ihr ausgeht, und ich habe auch keinen, den ich fragen kann. Barbro ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt, als dass sie Fragen über mich oder meine Geschichte stellt. Sie hat kein Verlangen und keine Hoffnung, was eine enge Freundschaft angeht.
Jetzt ist sie wegen der ausbleibenden Antwort von Alan offenbar verletzt, bemüht sich aber gleichwohl um eine passende Erklärung. »Er hilft bestimmt seiner Hauswirtin, den Garten für den Winter vorzubereiten. Er ist ja immer so nett zu ihr.«
Vielleicht hat er Sex mit ihr, würde ich am liebsten sagen, vielleicht hampelt und sabbert und keucht er gerade auf einer vertrockneten und faltigen Neunzigjährigen herum, aber zum Glück verkneife ich es mir. Ich sollte Mitleid haben mit Barbro, die an der kindlich naiven Vorstellung über das Gute im Menschen festhält, ich sollte Sympathie aufbringen für ihre ewige Sehnsucht, geliebt zu werden, stattdessen jedoch geht sie mir auf die Nerven. Es ist, als ob ihre mangelnde Selbstbehauptung in allen um sie herum nur das Schlimmste hervorlockt, eine unbewusste Projektion, die Bekannte und Unbekannte dazu bringt, auf ihr herumzutrampeln, ob nun bewusst oder unbewusst, und sie ihre Meinung über sich selbst bestätigt bekommt.
Es plingt in einem Handy, und Barbros Gesicht hellt sich auf. Es verdunkelt sich genauso schnell wieder, als sie begreift, dass ich eine Nachricht erhalten habe. Ich fische das Handy aus der Tasche und denke, die Meldung muss von Fanny sein. Dass die Rückkehr nach Hause zu überwältigend geworden ist und sie sich jetzt unsicher und ängstlich fühlt und das Bedürfnis hat, zu reden. Während meiner Abendschichten sind wir um diese Zeit immer spazieren gegangen. Es fiel ihr leichter, sich zu öffnen, wenn sie mir nicht in die Augen sehen musste, und unsere rhythmischen Schritte erschufen einen natürlichen Gesprächsfluss. Sie hatte sich um so viele Dinge Sorgen gemacht; dass sie in mehreren Schulfächern hinterherhing. Dass sie die falsche Ausbildung wählen könnte. Dass sie schuld war an den häufigen Streitereien der Eltern. Dass sie sich der Mutter gegenüber nie gut genug fühlte. Dass sie so wenige Freunde hatte. Dass die wenigen Freunde, die sie hatte, nicht mehr mit ihr herumhängen würden, wenn sie wüssten, dass sie verrückt geworden war. Dass sie niemals einen Freund bekommen würde. Dass sie sich außen vor fühlte, bei allem und allen, anders. Dass sie ihre Schwächen, sich selbst, verachtete. Es gab so vieles bei ihr, das in mir widerklang. Auf eine ganz andere Art, als ich es bei anderen erlebt habe. Deswegen war es so schwer, sie auf Abstand zu halten. Deswegen hätte ich ihr nie meine Telefonnummer geben sollen.
Es ist keine Nachricht von Fanny, nur eine Klavier-App, die mich vermisst. Ich blocke die Mitteilungen der App und versuche, meine Unruhe zu dämpfen, indem ich den Atem anhalte, bis meine Lunge ihn von selbst wieder ausstößt. Sinnlos.
Die Tür geht auf, und ich hebe den Kopf. Spüre die Erwartungen steigen, als eine fröhliche Truppe in meinem Alter hereinkommt. Lachend setzen sie sich an einen freien Tisch. Die ersten Minuten erzählen alles. Da entsteht der entscheidende Kontakt. Es muss gar kein langer Abend werden.
Die Jungen sind allerdings viel zu beschäftigt mit den hübschen schlanken Mädchen in ihrer Begleitung. Die wenigen anderen Männer im Lokal habe ich bereits als zu alt abgeschrieben. Die Grenze ist maximal zehn Jahre älter als ich.
»Wollen wir weiterziehen?«, frage ich.
Barbro blickt auf mein halb volles Bierglas. »Willst du nicht austrinken?«
»Das ist mir zu lasch.«
»Du bist viel zu anspruchsvoll, Ida.«
Ich stehe auf, und Barbro nimmt mein Glas und kippt den Rest in sich hinein, ist zu beschwipst, um zu merken, dass es alkoholfreies Bier ist. Sie möchte in eine der Musikkneipen, die sie so gern mag, aber ich bin ungeduldig und überrede sie, sich auf den Gepäckträger zu setzen, und so radeln wir fort von Kopfsteinpflaster und niedrigen Holzhäusern, wir fahren am Fluss entlang, bis wir zu dem runden, roten Gebäude kommen, das beständig und solide an der Elgeseter Brücke thront: der Studentenclub Samfundet, eine Zirkusmanege, die immer den einen oder anderen willigen Idioten beherbergt.
Wir wandern aufs Geratewohl durch die Gänge, ehe wir uns im Edgar Kafé niederlassen, wo krächzende Vinylplatten die Ohren füttern. Barbro schickt neue Nachrichten an Alan, während ich versuche, den Blick von einem der Jungen am Nebentisch aufzufangen, anscheinend gehören sie nicht zu den hoffnungsvollen Neuen des Semesters, diese wirken eher unbesorgt, haben ihre Truppe, eine Zugehörigkeit gefunden. Im Sommer habe ich sie vermisst. Die Stadt ist viel zu mager ohne all diese abenteuerlustigen Studenten. Wir ziehen weiter und landen im Klubben, wo ein Poetry-Slam im Gange ist. Ein Typ mit Rastazöpfen steht auf der Bühne und raubt mit seinen originellen Reimen dem ganzen Saal den Atem. Wir finden ein paar freie Plastikstühle in der letzten Reihe, und ich bekomme sofort Augenkontakt mit einem bärtigen Kerl, der schräg zwei Reihen vor uns sitzt. Ein paar Jahre jünger als ich, tippe ich. Auf seinem rasierten Nacken schauen die Ohren eines tätowierten Tigers über den Kragen seiner Jeansjacke. Er ist nicht der Typ, der ständig zwischen den besten Angeboten wählen kann, das sehe ich an der Art, wie seine Augen meine Brüste verschlingen. Dennoch ist er so selbstsicher, dass er an einem Donnerstagabend allein hierherkommt, auf der Jagd nach einem ungezähmten Tigermädchen.
Barbro fällt in den lebhaften Applaus mit ein. Sie steckt die Finger zwischen die Lippen und pfeift so laut und lange, dass ich schon fürchte, sie treibt den Tigerjungen fort. Als ein neuer Wortkünstler die Bühne betritt, wird sie mehr und mehr von ihrem Telefon vereinnahmt. Dann will sie plötzlich nach Hause, obwohl es bis Mitternacht noch lange hin ist. »Wir müssen ja morgen früh zur Arbeit«, sagt sie.
Ich gehe mit zur Garderobe und hole unsere Jacken. Ich wünschte, ich könnte jetzt auch nach Hause fahren und schlafen, aber wenn es mich derart juckt, ist das unmöglich.
»Fahr ruhig schon, ich muss noch aufs Klo«, sage ich.
Sie zieht mich in den Versuch einer Umarmung, ein linkischer Wangenknochenpuff gegen meine Stirn, und dann sehe ich sie aus der Tür verschwinden, ehe ich zurück zu den Poeten gehe und mich an die Wand des Zuschauerraums stelle. Ich beobachte den Tigerjungen, als er entdeckt, dass mein Stuhl leer ist. Ich sehe seinen spähenden Blick. Die Freude, als seine Augen mich wieder einfangen. Ich lächele. Habe an meinem Hemd noch einen zusätzlichen Knopf geöffnet.
Während die Jury den Gewinner des Abends küren soll, kommt er freimütig zu mir herüber. Blinzelt mich an. »Wer bist du?«, fragt er.
Er hat mehr getrunken, als mir lieb ist, sein Blick ist rot und zerflossen.
Ich sage ihm nicht meinen Namen, das wäre die langweiligste Antwort. Schenke ihm nur einen ebenso direkten Blick. Vielleicht studiert er Philosophie. Der scheinbar ernste Aufreißerspruch kommt jedenfalls nicht von einem Realisten.
Der folgende ist ordinärer: »Lust auf ein Bier?«
»Vielleicht danach«, sage ich.
»Das dauert ’ne Weile, bis hier Schluss ist.«
»Nachdem wir beide auf dem Klo waren.«
Ich habe mich nur selten in einem Typen geirrt und ein Nein kassiert. Jetzt breitet sich unter den dünnen Bartstoppeln ein schiefes Lächeln aus. Ich wähle die Behindertentoilette. Er kichert, als ich hinter uns die Tür abschließe, und verrät damit, dass er vielleicht doch nicht so erfahren ist, wie ich dachte. Ich spiele ebenfalls die Unsichere, bis er schließlich den ersten Schritt macht und mich küsst, überraschend zärtlich. Ich helfe ihm, die Hose herunterzuziehen. Es scheint so, als hätte er Deo auf seine Boxershorts gesprüht. Das ist immerhin besser als der Geruch der verschwitzten, eingesperrten Schlangen, die mir ein paarmal begegnet sind. Ich knöpfe mir selbst die Hose auf. Er küsst mich auf den Hals, sein Bart raspelt, die Hände grapschen umso hungriger, je mehr die Begierde die Schüchternheit überschattet. Ich führe seine Hände fort von meinem Schritt, und er versteht, dass er Zutritt zu dem anderen Eingang bekommt. Das lässt ihn fast durchbrennen, und ich schließe die Augen, empfange ihn, finde den Rhythmus, fließe dahin, in diesem ruckartigen Tanz, bin hier, hier und jetzt, mittendrin – bis alles, das an ein Gefühl erinnert, abflacht und ich taub werde, das Jucken hört auf, geht weder in Plus noch Minus über, wird nur auf Null gestellt.
Danach lehne ich das Bier dankend ab und verlasse ihn, bevor er dazu kommt, mich zu verlassen. Draußen vor dem roten, runden Haus ist die kühle Septemberluft mit Nieselregen durchsetzt. Ich hebe den Kopf und lasse mir von den kleinen Tropfen die Wangen kitzeln. Ich sollte das hier öfter machen. Solche Momente geben mir Kraft.
Ich nehme das Handy und schicke mit zwei schnellen Daumen eine Nachricht.
3
Ich fahre nicht nach Hause. Radle stattdessen in die entgegengesetzte Richtung, über den schmalen Weg, der bei Samfundet beginnt und an dem üppigen Hochschulpark entlangführt. Einer der Orte, die ich in der Stadt am meisten mag. Natürlich bin ich nicht zu oft hier. Niemals zweimal pro Woche, am liebsten nicht öfter als zweimal pro Monat. Mamas Warnung ist mir immer noch ins Gedächtnis gehämmert: Ein Gewohnheitstier ist ein leichtes Beutetier. Jetzt will ich den wolkenlosen Augenblick ausnutzen und hier warten, bis ich eine Antwort auf meine Nachricht bekomme.
Ich fahre zum Hauptgebäude der technisch-naturwissenschaftlichen Universität Norwegens hinauf, die ganz oben auf dem Hügel thront und vom Nidarosdom inspiriert ist, der auf der anderen Seite des Flusses in die Höhe sprießt. Während die mittelalterliche gotische Kathedrale seinerzeit zur Abschreckung böser Geister mit grotesken Wasserspeiern geschmückt wurde, hat die Fassade dieses Gebäudes geschnitzte Tiermasken mit unheimlichen Grimassen. Schutz ist stets ein Teil der menschlichen Instinkte gewesen. Sei es vor realen oder vor eingebildeten Gefahren.
Ich halte an und sauge die robuste Frontpartie in mir auf. Leuchtende Rechtecke und Bogenfenster glotzen mich in der Dunkelheit hellwach an. Auf beiden Seiten der massiven Eingangstür aus heller Eiche ragen zwei Pilaster empor. An der Spitze gibt es zwei leere Flächen, wo Platz für Skulpturen ist. Ich habe gehört, dass sie geschaffen wurden, um die Studenten träumen zu lassen. Damit sie sich bei jedem Erklimmen dieses langen Hügels vorstellen, dass eines Tages eine Statue von ihnen selbst dort steht. Hätte ich selbst entscheiden dürfen, wäre ich für das Masterstudium hierhergekommen und Diplomingenieurin geworden. Ich hatte ein natürliches Interesse für alle Arten von naturwissenschaftlichen Fächern. Doch ich wurde gezwungen, alles Natürliche zu unterdrücken. In der Schule musste ich so tun, als ob ich Algebra und Faktorisierung nicht verstand. Ich konnte keine zu guten Noten bekommen. Ich durfte nicht auffallen. Deshalb wurde ich Krankenschwester, jemand, der sich immer in die Menge einfügen und die Arbeitsstelle wechseln kann.
Ich blicke aufs Handy. Die verschickte Nachricht wurde gelesen, jedoch habe ich keine Antwort bekommen. Ich hätte Lust, eine neue zu schicken, doch im selben Moment kriecht die herbstliche Dunkelheit in mein Inneres, und ich begreife, wie elend und erbärmlich ich aussehen muss, wie ich hier stehe, empfänglich für meine egoistischen Impulse, quengelig, kurz davor, eine Blaupause von Barbro zu werden. Eine Windböe reißt den letzten Rest von Hochmut mit sich und lässt mich nackt und beschämt zurück. Manchmal dachte ich, dass sich der Tod so für andere anfühlen muss, wenn man begreift, dass man auf der Außenseite steht, abgeschnitten von allem, das nah und fern ist, und es keinen Rückweg mehr gibt.
Manchmal habe ich mich gefragt, was der Tod für mich bedeuten wird. Ich lasse eine schlanke Ida Hansen auf einer der leeren Säulenflächen über der Eingangstür stehen, ehe ich nach Midtbyen radele, zum besten Burgerladen im Zentrum, wo ich zwei von den größten Exemplaren kaufe. Auf dem Heimweg schüttet es, aber ich schere mich nicht darum. Das labile Trønder-Wetter, das manchmal mit allen Jahreszeiten an einem einzigen Tag funkeln kann, ist mir recht, ich mag es, wenn mir kalt ist oder ich nass werde, wenn der Wind tief bis ins Rückenmark zieht, das macht mich wach und alarmbereit.
Die Burger sind lauwarm, als ich die Tür zu einem der niedrigen Holzhäuser in Ila aufschließe, zu der gemütlichen Wohnung, in der ich mich seit letztem Sommer als illegale Untermieterin aufhalte. Eine kleine, möblierte Zweizimmerwohnung mit offener Küchenlösung, zähen und zerkratzten Holzfußböden, Stuck an der Decke, Omageruch in den Wänden. Ich setze mich an den wackeligen Holztisch und drücke die Fleischstücke in mich hinein, begleitet von Chopins Nocturnes, die ich neulich entdeckt habe, zweihundert Jahre nach allen anderen. Durch das Fenster habe ich Ausblick auf den Ilapark, einen Mittelpunkt in diesem zentrumsnahen Stadtteil, wo die Industrie durch grüne Lungen und Straßenkunst ersetzt wurde. Auf der anderen Parkseite stehen ebenfalls kleine Holzhäuser. Mit alten elektrischen Anlagen. In Trondheim hat es deshalb viele Brände gegeben. Nicht alles im Leben können wir vorhersehen.
Ich esse alle Schokoladenherzen zum Dessert. Ich achte immer darauf, so viel zu essen, dass ich Bauchschmerzen bekomme. Die darauffolgende Übelkeit sorgt für eine innere Lähmung, aber nicht jetzt, jetzt ist die Unruhe zurück, heute Abend ist sie unbezähmbar. Das ist nicht normal. Ich schalte Chopins romantische Gefühlsduseleien auf dem Handy aus. Was habe ich mir bloß gedacht? Mir wurde doch klar mitgeteilt, dass ich ihn außerhalb der Arbeitszeit nicht kontaktieren soll. Ich lösche die unbeantwortete Nachricht und knülle die Burgerschachteln zusammen, drücke fest zu, drei mal drei, alles muss neun ergeben, doch als ich aufstehe, kitzelt es in meinem Nacken. Ein Gefühl, beobachtet zu werden.
Ich trete näher ans Fenster, spähe hinter dem Vorhang ins Freie hinaus. Draußen, unten auf dem Bürgersteig, steht ein Mann, allein, er hat mir halb den Rücken zugewandt. Die Kapuze an seinem Sweatshirt ist so groß, dass sein Gesicht dahinter so gut wie verborgen ist. Die Hose spannt um seine Schenkel, er ist durchtrainiert und liegt über meinem Maximalalter, über den Dreißigern, ich kann es seiner Haltung ansehen, die Energie, die er ausstrahlt, junge Männer sind viel unsicherer oder arroganter. Wohnt er in der Nähe? Arbeitet er in der Gegend? War er zu Besuch bei einem Kumpel, bei der Familie? Ich kann mich nicht erinnern, ihn hier schon mal gesehen zu haben. Kann er mir von Midtbyen aus gefolgt sein? Wollte mir meine Unruhe das vermitteln? Dass ich nicht gut genug aufgepasst habe?
Ich werfe einen Blick auf die Wohnungstür. Die Türkette und die drei soliden Riegel aus Stahl sind verschlossen. Das Bedienungsfeld für die Alarmanlage blinkt, ich erinnere mich, beim Hereinkommen den Perimeterschutz aktiviert zu haben, eingeübte Routinen, die automatisch ausgeführt werden.
Oder? Das Haar. Ich bin unaufmerksam gewesen.
Ich drehe mich wieder zu dem Mann um. Sein Nacken ist leicht gebeugt, er schaut aufs Handy. Sieht er zu mir? Hat er die Kamera auf Selfiemodus gestellt und filmt mich im Verborgenen?
Neben ihm hält ein Taxi. Ohne verstohlen über die Schulter zu blicken, klettert der Mann rasch auf den Rücksitz. Die Tür schlägt zu. Der Wagen fährt weg. Ich ziehe die Vorhänge zu. Ich überreagiere. Es ist bloß ein schlechter Tag.
Als ich unter die weiche Bettdecke krieche, merke ich, wie müde ich bin, wie gut eine Pause sein wird. Zum Glück hatte ich nie Schlafprobleme, eher umgekehrt, ich schlafe zu viel. Ich schließe die Augen und gehe sofort zu der einfachsten Methode über, den Kopf schnell frei zu bekommen, eine alphabetische Aufzählung von was auch immer, Namen, Substantive, Filme, Bücher, sich reimende Wörter, heute wähle ich Orte in Norwegen, drei für jeden Buchstaben: Alta, Arendal, Asker …
Jäh erwache ich von einem scheppernden Geräusch. Will aufstehen, bleibe jedoch liegen. Schaffe es nicht, mich zu rühren. Mein Atem hat ausgesetzt. Am Fußende steht eine Gestalt. Ein Mann. Ich sehe nur seine Umrisse. Sein Gesicht ist in der Dunkelheit verborgen. Dennoch spüre ich seinen Blick. Wie intensiv er ist, lähmend. Ehe er plötzlich, nach zweimaligem Blinzeln, verschwindet – und ich begreife, dass es nur die Reste eines weiteren Albtraums sind.
Nicht jedoch die Alarmanlage. Die heult. Meine Hand erwacht zum Leben und zieht das Taschenmesser aus dem BH, klappt automatisch das längste Messerblatt aus, während ich das Zimmer mit den Augen abscanne. Die Schlafzimmertür ist geschlossen, der Riegel vorgeschoben. Das Fenster ist zu. Es dauert einige Sekunden, bis mir dämmert, dass nicht die Alarmanlage das Geräusch verursacht, die klingt ja anders, lauter. Was klingelt, ist mein Handy.
Ich finde es unter dem Kissen. Das Display zeigt eine unbekannte Nummer an. Es ist 05:11 Uhr. Ich habe noch nie um diese Zeit einen Anruf bekommen. Ich lasse es ein weiteres Mal klingeln. Sehr wahrscheinlich geht es um Mama.
Ich wische mit dem Finger über den Bildschirm und halte ihn mir ans Ohr. »Ja, hallo?«
Ich bereite mich darauf vor, eine professionelle, nüchterne Stimme zu hören, einen Krankenpfleger, Arzt, Priester. Doch am anderen Ende höre ich nur schnelles Atmen.
»Hallo?«, wiederhole ich.
»Fanny«, flüstert eine Stimme in mein Ohr.
Ich blicke erneut aufs Display, versuche herauszufinden, ob die Telefonnummer mir sagen kann, wer das ist, doch die unbekannte Zahlenreihe, die nicht neun ergibt, zittert mir bloß entgegen.
»Wer ist da?«
Eine klamme Stille.
»Hallo? Wer ist da?«, frage ich, lauter jetzt.
»Hier ist Frøydis Strand. Fannys Mutter.«
Die Stimme ist vertraut, und dennoch fremd.
»Ist was passiert?«, frage ich. »Mit Fanny? Ist sie wieder in der Klinik?«
»Fanny ist verschwunden.«
Das Fremdartige, in das ihre Worte eingepackt sind, knistert jetzt.
»Was meinen Sie mit verschwunden?«, frage ich.
»Hören Sie nicht, was ich sage?«, schreit mir Frøydis ins Ohr. »Dieser verfluchte Teufel hat sie geschnappt!«
4
Ein Regenschauer hat einen rauen, erdigen Geruch von den Gärten und Grasebenen auf der Lade-Halbinsel, nördlich des Zentrums, mitgenommen. Seit ich von dem Anruf geweckt wurde, habe ich nicht mehr geschlafen, dennoch bin ich spät dran. Wusste nicht, was ich machen sollte. Ob ich zu Hause bleiben, rausfahren, jemanden anrufen sollte. Ich habe alle Online-Zeitungen überprüft. Da steht nichts über ein entführtes Teenagermädchen.
Ich trete fester in die Pedale, fahre auf das Krankenhausgelände, radele zwischen den soliden Bäumen auf beiden Seiten der Straße, runzelige Hundertjährige, stumme Zeugen von Winter und Frühling der menschlichen Natur. Als Fanny eingeliefert wurde, waren die Blätter grün und frisch und boten Schatten vor der Sommersonne, jetzt haben sie begonnen, auf den Boden zu fallen.
Ich schließe das Fahrrad vor der Station 22 an und eile in den Keller, in den Umkleideraum, ziehe das Arbeitszeug an, sehe auf die Uhr. Vierzehn Minuten nach sieben. Die Morgenbesprechung wird gleich beginnen. Haben die anderen von Fanny gehört? Ist sie inzwischen nach Hause gekommen?
Als ich zum Besprechungsraum in der ersten Etage komme, herrscht lebhafte Stimmung. Alan steht breitbeinig in der Mitte und unterhält die Tages- und die Nachtschicht mit einer Geschichte, die ich schon einmal gehört habe. Von dem 22,3 Kilo schweren Lachs, den er im Sommer aus der Nidar geangelt hat. Mit großkotzigem Bergen-Dialekt, vermischt mit trønderschen Begriffen und polnischem Akzent, erzählt er von dem intensiven Kampf, den Lachs an Land zu ziehen. Von den Herzkrämpfen, die er plötzlich bekam, und der Überzeugung, dass nun er selbst und nicht der Monsterlachs ins Himmelreich geschickt werden würde. Bevor er entdeckte, dass in seiner Brusttasche bloß das Handy vibrierte.
Barbro lacht am lautesten.
Mir ist übel. Ich habe zu viel gegessen, zu wenig. Ich muss mich darauf konzentrieren, dass niemand mein Zittern bemerkt. An dem großen Besprechungstisch presse ich mich auf einen freien Stuhl neben Barbro und ergreife ihren Arm. »Habt ihr nichts von Fanny gehört?«
Barbro sieht mich fragend an, als ob sie meine Anwesenheit erst jetzt bemerkt. »Wer?«
»Fanny Strand. Die gestern entlassen wurde. Sie ist in der Nacht verschwunden.«
»Verschwunden?«
»Ja. Die Mutter hat mich gegen fünf angerufen und …«
»Hat die Mutter dich zu Hause angerufen?«, unterbricht Barbro mich und dämpft die Stimme. »Ida. Du weißt doch, dass du weder Patienten noch Angehörigen deine Nummer geben darfst?«
»Ich … weiß nicht, woher sie die hat, aber sie sagt, dass Fanny entführt wurde.«
Barbro drückt ihr Doppelkinn auf die Brust. »Entführt?«
Sie sagt es laut, aber niemand sonst scheint es gehört zu haben. Sie sind zu sehr damit beschäftigt, Kaffee bei Alan zu bestellen, der den Job als Barista an der Kaffeemaschine übernommen hat.
»Ja«, sage ich. »Von diesem Stalker.«





























