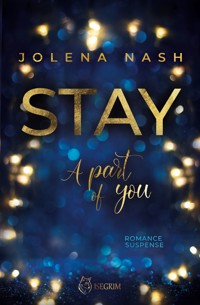
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ISEGRIM
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eva, frisch getrennt und sinnsuchend, jobbt als Aushilfe im Diner ihrer besten Freundin Susan in Nashville. Bei einem Überfall rettet der smarte FBI-Agent Max Harrison Eva das Leben. Sie ahnt nichts von der Vergangenheit des faszinierenden Mannes und verliert sich in einer berauschenden Liebesbeziehung, die in ihr nie gekannte Gefühle erweckt. Unerwartete Wendungen und Ereignisse, die nicht nur ihre Liebe, sondern auch beider Leben bedrohen, führen zu einer atemberaubenden Achterbahn der Emotionen, die sie in ihren Grundfesten erschüttert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jolena Nash (Ps.), 1987 an der Ostseeküste geboren, ist ausgebildete kaufmännische Assistentin, Musikalienhändlerin und Fitness-Trainerin. Inspiriert von einer Reise nach Nashville, Tennessee, vereinte die USA-Liebhaberin unter anderem ihre Leidenschaft für Country-Musik und Sport in ihrem Debütroman: Stay - A part of you und der Fortsetzung, Stay - A part of us.
Heute wohnt sie mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in einem beschaulichen Ort in Bayern.
Inahltsverzeichnis
PROLOG
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHSZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
ACHTUNDZWANZIG
NEUNUNDZWANZIG
DREIßIG
EINUNDDREIßIG
ZWEIUNDDREIßIG
DREIUNDDREIßIG
VIERUNDDREIßIG
DANKE
Vollständige e-Book Ausgabe 2023
© 2023 ISEGRIM VERLAG
ein Imprint der Spielberg Verlagsgruppe, Neumarkt
1. Auflage 2023
Originalausgabe: »STAY - A part of you«
Copyright©2023 ISEGRIM VERLAG
in der Spielberg Verlag GmbH, Neumarkt
Lektorat: Michael Lohmann
Bildmaterial: © shutterstock.com
Covergestaltung: Ria Raven www.riaraven.de
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
ISBN: 978-3-95452-119-7
www.isegrim-buecher.de
Das schönste Geschenk ist gemeinsame Zeit.
Denn keiner weiß, wie viel uns davon bleibt.
PROLOG
Geschlagene zwei Stunden sitzen wir hier schon im Auto, in der glühenden Mittagssonne von D.C.
Wir parken auf der gegenüberliegenden Straßenseite vom ›Torino d’Italia‹, unsere Blicke starr auf die Eingangstür gerichtet. Russo und Berlusconi sollen sich da drinnen aufhalten. Seit wir hier stehen, ist niemand mehr ins Restaurant hineingegangen oder herausgekommen.
Ich wische mir zum wiederholten Mal den Schweiß von der Stirn, dann rührt sich etwas. Vier dunkel gekleidete Männer kommen durch die Eingangstür nach draußen, stellen sich auf den Gehsteig und sehen sich um. Sie wirken hoch angespannt.
Nur wenige Sekunden später fährt eine schwarze Limousine vor.
Dann erblicke ich Paolo Antonio Russo das erste Mal leibhaftig. Er ist wirklich hier, unser Kontaktmann hatte recht. Bisher kannte ich Russo nur von Bildern aus unseren Akten oder von Videoaufzeichnungen.
Er trägt einen perfekt sitzenden beigen Anzug, mit einer gleichfarbigen Weste darunter und einer braunen Krawatte, die farblich auf seine Schuhe abgestimmt ist. Trotz seines eher zierlichen Körperbaus strahlt er eine gewisse Art von Größe und Macht aus.
»Glaub mir, der Anzug kostet mehr als du im Jahr verdienst«, sagt Perez, mein Partner. Er lächelt, aber ich bemerke seine Anspannung.
Berlusconi und Russo verabschieden sich, dann steigt Russo mit seinen Männern in die Limousine.
Wir folgen seinem Wagen zwanzig Minuten lang, durch den dichten Verkehr, die Massachusetts Ave Richtung Nordwesten, bis die Limousine hinter den riesigen Stahltoren einer Villa mit toskanischer Bauweise verschwindet.
Perez biegt um die Kurve und hält in der Nebenstraße. Von hier aus haben wir direkten Blick auf das Anwesen. Russo wird von einer jungen dunkelhaarigen Frau empfangen. Zusammen gehen sie in die Villa.
»Seine Tochter. Er ist wohl hier, um sich zu verabschieden, bevor er für eine Weile zurück nach Italien geht«, sagt Perez. »Ich kann es nicht glauben, wir haben ihn. Fordere sofort Verstärkung an!«
Ich tue, was er sagt, und gebe Russos Standort durch.
»Sind unterwegs«, sage ich. »Und du bist dir sicher, dass er heute noch abreist?«
Perez sieht mich mit starrem Blick an. »Wenn wir ihn heute nicht erwischen ... dann war’s das!«
Er trommelt mit den Fingern auf das Lenkrad und blickt immer wieder auf die Uhr.
Plötzlich öffnen sich die Stahltore und zwei von Russos Männern laden Gepäck in den Kofferraum.
»Verdammt. Sie werden nicht rechtzeitig hier sein. Er darf mir nicht wieder entwischen«, murmelt Perez.
Er schlägt mit der Hand auf das Lenkrad und steigt aus dem Wagen.
»Hey, hey, hey, was hast du vor?«, rufe ich ihm durch das geöffnete Fenster nach.
»So nah war ich ihm noch nie, wir werden das selbst erledigen und ihn uns schnappen. Uns läuft die Zeit davon. Kommst du jetzt mit oder lässt du mich die Arbeit allein machen?«
»Perez, das ist Selbstmord! Du weißt nicht, wie viel Männer noch drinnen sind ... lass uns warten bis die Verstärkung ...«
Er schnaubt. »Wie ich es mir gedacht habe. Scheiß drauf!« Perez steuert unbeirrt auf das geöffnete Tor zu.
Verdammter Mist! Ich springe aus dem Wagen und folge ihm. Als ich auf seiner Höhe bin, wirft er mir einen Blick zu und nickt.
Adrenalin schießt durch meinen ganzen Körper. Zusammen können wir die zwei Männer beim Auto ausschalten.
Im Haus bisher keine Spur von weiteren von Russos Männern. Mit beiden Händen klammere ich mich an meine Glock, während der Schweiß über mein Gesicht rinnt.
Perez macht einen pfeifenden Laut. Er nickt Richtung Treppe. Wir geben uns Deckung und schleichen die Stufen hinauf. Oben hören wir Stimmen aus einem der vielen Zimmer. Mit dem Rücken zur Wand folgen wir den Lauten.
Ein paar Meter hinter mir öffnet sich eine Tür und jemand tritt in den Flur. Ruckartig drehe ich mich um und ziele auf die Person. Sie starrt mich mit ihren dunklen Augen an.
»Padre, sono qui«, schreit sie plötzlich, was im ganzen Haus nachhallt.
Ich habe keine Ahnung, was die Worte bedeuten, was ich aber sicher weiß, dass sie Ärger mit sich bringen.
Dann geht alles ganz schnell. Einer von Russos Männern kommt aus dem Raum gelaufen, zielt auf uns und verfehlt Perez nur um ein Haar.
Russos Tochter nutzt die Gelegenheit und läuft davon.
»Mach schon, ihr nach! Lass sie nicht entkommen! Ich geb dir Deckung«, schreit mich mein Partner an.
Ich folge ihr den langen Gang entlang. »FBI! Sofort stehen bleiben!«, rufe ich ihr hinterher.
Als der Gang endet und es nicht weitergeht, bleibt sie mit dem Rücken zu mir stehen.
»Hände hoch! Ganz langsam.«
Hinter mir fallen Schüsse. Bei jedem hoffe ich, dass es Perez nicht erwischt hat.
Sie macht keine Anstalten, meinen Anweisungen zu folgen.
»Tun Sie, was ich sage! Nehmen Sie Ihre Hände hoch, verdammt noch mal!«
Ich hab keine Ahnung, ob sie mich nicht versteht oder nicht verstehen will. Ich spreche kein Italienisch, lediglich an ein paar Wortbrocken aus Schulzeiten kann ich mich erinnern. »Fare ... alto!«
Sie dreht sich langsam in meine Richtung, dabei greift sie in ihre Handtasche. »Devo dirgli addio ... è ancora così piccolo«, sagt sie. Ihr Blick wirkt flehend.
Ich reiße meine Augen auf. »Hände hoch! Zwingen Sie mich nicht zu schießen!«, schreie ich ihr entgegen.
Dann zieht sie mit einer schnellen Bewegung einen Gegenstand aus ihrer Tasche und ich ... den Abzug.
Mit weit aufgerissenen Augen sinkt sie zu Boden.
Was hab ich getan?
Mein Sichtfeld verschwimmt. Es ist das erste Mal, dass ich auf einen Menschen schießen musste. Ich stütze mich an der Wand ab, einen Moment scheinen alle meine Sinne und Instinkte wie ausgeschaltet.
Nachdem das Rauschen in meinen Ohren abklingt, höre ich Schreie und weitere Schüsse hinter mir. Ein Schuss schlägt dicht neben mir in der Wand ein.
Ich hebe meinen Blick und sehe Russo mit erhobener Waffe auf mich zu stürmen. Sein Gesicht schmerzverzerrt, wütend.
Ich kann nicht mehr rechtzeitig reagieren ... oder will ich es nicht? Er schießt erneut und trifft mich an der linken Schulter. Mit einem zerreißenden Schmerz gehe ich stöhnend zu Boden.
Noch nie zuvor habe ich solche Schmerzen verspürt, körperlich wie seelisch. Ich habe ihn verdient.
Ich blicke in die starren Augen von Russos Tochter. In die Augen, denen ich gerade das Leben genommen habe. Neben ihrem leblosen Körper liegt der Gegenstand, den sie aus ihrer Tasche gezogen hat. Ein Handy.
Ich habe sie getötet.
Ich weiß nicht, wie lange ich hier schon liege, wie viel Zeit vergangen ist, aber als ich die Stimme von Perez neben mir höre, drehe ich meinen Kopf in seine Richtung.
»Hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt, Junge. Ein Krankenwagen ist schon auf dem Weg.« Er deutet mit dem Kopf nach hinten.
Russo liegt in Handschellen auf dem Boden, umstellt von mehreren FBI-Agents. »Wir haben ihn.«
Perez grinst.
Ich kann es nicht glauben, dass er grinst. Wie kann er grinsen, wo ich gerade einem Menschen das Leben genommen habe.
»Seine Tochter, ich habe sie ... getötet.«
»Du meinst, du hast versucht, dein eigenes Leben zu schützen ... das wird dir niemand zum Vorwurf machen. So, ich muss dann mal ... einen der meistgesuchten Ganoven verhaften.« Er klopft mir auf die gesunde Schulter und geht zu Russo.
Einer meiner Kollegen verarztet mich notdürftig, hilft mir hoch und führt mich die Treppe hinunter. Im Eingangsbereich setze ich mich auf einen Stuhl und warte dort auf den Krankenwagen.
Alle FBI-Agents im Haus klatschen, als Perez Russo in Handschellen die Treppe hinunterführt.
Als sie an mir vorbeikommen, stoppt Russo plötzlich und starrt mich ausdruckslos an.
»Me l’hai portata via. Du hast sie mir genommen ... die Zeit wird kommen, da werde ich dir alles nehmen!«
EINS
Heute war das letzte Mal, dass ich einen Fuß in diese Bar gesetzt habe. Ich werde mit ihm reden, jetzt gleich – kein Aufschieben mehr.
Ich eile die finstere Straße zu unserem Haus entlang. Ich will endlich das machen, was mich erfüllt, wofür ich so hart gearbeitet habe – und einen Mann, der das versteht und mich dabei unterstützt. Denn ich bin es so leid, ständig von einem Haufen Idioten begrabscht und blöd angemacht zu werden. Ich bin dessen so unendlich müde. Welcher Mensch hält das auf Dauer aus, Tag und Nacht zu arbeiten? Während mein Mann ...
... eine Mischung aus billigem Fusel, Schweiß und abgestandener Luft steigt mir in die Nase, nachdem ich die Haustür geöffnet habe. Bitte, nicht schon wieder! Ich knalle die Tür hinter mir zu. So heftig, dass das Bild von der Wand rutscht und mir vor die Füße fällt. Scherben. Mist! Ich seufze. Was für ein Nachhausekommen! Ich lasse meine Tasche von der Schulter auf den Boden sinken. Der Rauch steht wie dichter Nebel in der Luft, durch den ich mir den Weg durch die leeren Pizzakartons ins Wohnzimmer bahne.
»Nimm deine verdammten Füße von meinem Tisch«, blaffe ich Mike an, einen von Andrews fragwürdigen Freunden. »Hier wird nicht geraucht. Wie oft soll ich das noch sagen?«
Ich reiße ihm die Kippe aus dem Mund und drücke sie in einer Tasse aus, in der sich bereits ekliger Zigarettensiff befindet.
Ist das meine Lieblingskaffeetasse? Sie haben sie als Aschenbecher benutzt? Andrew weiß genau, wie viel mir diese Tasse bedeutet, weil sie ein Erbstück meiner Oma ist. Wie kann er es zulassen?
»Es ist auch Andrews Haus und der stellt sich nicht so an wie du. Also entspann dich! Trink ein Bier ... und bring mir auch noch eins mit.« Er widmet sich wieder der Spielekonsole. »Ha, jetzt habe ich dich gleich am Arsch, Spencer!«, sagt er zu seinem Sitznachbarn.
»Wo ist er, Mike?«
»Was weiß ich, im Schlafzimmer oder so ... brauchst es gar nicht versuchen ... nicht mehr ansprechbar«, sagt er, ohne seinen Blick vom Fernseher zu lösen. »Aber keine Sorge, Shelly hat alles im Griff.«
Er sieht mich an und zwinkert.
Seine Ex ist wieder hier? Ich spüre, wie mir sämtliche Gesichtszüge entgleiten. Wie oft habe ich ihm gesagt, dass ich sie hier nicht mehr sehen will? Wann zum Teufel kapiert sie endlich, dass Andrew sich für mich entschieden hat? Sie hatte ihre Chance.
Ich stapfe ins Schlafzimmer.
Das glaube ich ja nicht. Sie liegt in unserem Bett, mit dem Rücken eng an Andrew gekuschelt, der seinen Arm um sie geschlungen hat.
»Raus aus unserem Bett, Shelly!« Ich packe sie am Bein und ziehe sie bis ans Bettende.
Sie reißt die Augen auf. »Bist du bescheuert? Nimm deine Griffel von mir!«, schreit sie mich an. Mit dem anderen Bein tritt sie nach mir.
»Dann nimm du deine gefälligst von meinem Mann und such dir einen eigenen!«
»Hey, hey, ... was ist denn los?« Andrew reibt sich die geröteten Augen.
»Was los ist? Was hat sie in unserem Bett zu suchen?«
»Scheiße, Eva, Baby, ich dachte, du bist es ...« Er blickt mich reumütig an. »Okay, schon gut, tut mir leid, es ging mir nicht gut. Shelly hat sich um mich gekümmert.«
Ich nehme mir eins der Kissen vom Bett und schmeiße es auf ihn. »Ja, das habe ich gesehen ...«
Er setzt sich unbeholfen auf und streckt mir seine Hand entgegen. »Komm schon, Baby.«
Shelly steht schmunzelnd aus dem Bett auf.
Blöde Kuh! Am liebsten würde ich ihr das Gesicht zerkratzen. Ich werfe ihr einen vernichtenden Blick zu. »Verschwinde endlich, Shelly, verdammt noch mal!«
Sie rührt sich keinen Zentimeter. »Du hast mir überhaupt nichts zu sagen.«
Ich spüre das Blut in meinem Kopf aufsteigen und mache einen Schritt auf sie zu, die Hände zu Fäusten geballt. Andrew steht auf, wankt, greift nach meinem Handgelenk und hält mich zurück. Er sieht zu Shelly und nickt Richtung Tür.
»Na, dann noch viel Spaß, Andrew, wir sehen uns«, flötet sie mit zuckersüßer Stimme. Im Vorbeigehen stößt sie an meine Schulter.
»Und komm bloß nicht wieder«, schreie ich ihr hinterher.
»Bitch«, nuschelt sie kaum hörbar, als sie unser Schlafzimmer verlässt.
Ich stoße ihn von mir weg. »Was zum Teufel soll der Scheiß?«, blaffe ich ihn an.
»Ich habe doch schon gesagt, dass es mir nicht gut ging. Und du warst ja mal wieder nicht da.«
»Was? Ich war mal wieder nicht da? Das kann doch nicht dein Ernst sein?« Hat er vergessen, dass ich das nur wegen ihm mache?
»Ja, Andrew, weil ich fast jede Nacht in der Spelunke deiner Mutter arbeite, anstatt das zu machen, wofür ich jahrelang studiert habe. Du hast gesagt, es wäre nur vorübergehend. Und im Moment bin ich die Einzige, die für uns Geld verdient.« Ich schüttle den Kopf. »Das Geld, das du mit deinen Freunden anschließend versäufst oder verspielst. Ich habe es so satt, Andrew.«
»Wenigstens habe ich Freunde.«
»Du meinst, so tolle Freunde wie Shelly, diese Schlampe?«
»Sag so was nicht über sie.«
»Ich sag nur die Wahrheit. Oder versucht sie nicht, dich die ganze Zeit anzubaggern? Und auch jeden anderen Kerl, der ihr über den Weg läuft?«
Seine Augen wirken bedrohlich. »Hör jetzt auf damit!«
Aufhören? Jetzt fange ich erst an.
»Wie war das? Hat sie nicht vier Kinder von drei verschiedenen Männern? Oder waren es vier verschiedene? Weiß sie überhaupt noch, wer die Väter sind?«
»Halt die Klappe!« Er schubst mich unsanft an die Wand, und steht jetzt direkt vor mir. Der Alkoholgeruch drängt sich aus all seinen Poren an die Oberfläche. Es riecht. Er ist mir unangenehm. Ich wende meinen Kopf von ihm ab.
»Du kennst sie doch gar nicht richtig. Du hast ihr nie eine Chance gegeben. Shelly ist eine tolle Frau.«
»Klar. Dann hättest du vielleicht lieber sie heiraten sollen anstatt mich.« Was er wahrscheinlich auch getan hätte, wenn sie sich damals nicht getrennt hätten, als er in Deutschland stationiert wurde. Aber er hat mir geschworen, dass er über sie hinweg ist und dass ich mir keine Sorgen machen müsse. Soll ich das noch glauben, nach dem, was ich eben gesehen habe? Sie taucht hier ständig auf, wenn ich nicht da bin.
»Ja, vielleicht hätte ich das wirklich tun sollen ... immerhin ist sie mehr Frau, als du es jemals sein wirst.«
Mein Kopf schnellt in seine Richtung. Ich suche seinen Blick, aber er sieht mich nicht an.
»Andrew, ist das dein Ernst? Das ist nicht fair und das weißt du. Gibst du mir etwa die Schuld dafür …?«
Schweigen.
Seine Stirn in Falten gelegt, reibt er sich mit den Fingern über die Nasenwurzel.
Nein, er meint es nicht so. Er würde mich nie absichtlich so verletzen. Er weiß doch, wie sehr ich darunter leide. Es ist wegen des Alkohols … er weiß nicht, was er da gesagt hat.
Ich ergreife seine Hand. »Wenn man etwas sagt, das man nicht so meint, dann ... wäre eine Entschuldigung angebracht ...«
Er hebt seinen Kopf. Seine Augen sind kühl und ausdruckslos.
Oh, mein Gott!
»Du hast es so gemeint?« Meine Augen fangen plötzlich an zu brennen. Wie konnte ich mich nur so in ihm täuschen?
»Wie kannst du nur so etwas sagen?«
»Du meinst die Wahrheit, Eva?« Er sieht mich mit verächtlichem Blick an.
Mein Herz hämmert wie wild gegen meine Brust. Meine Hände ballen sich erneut zu Fäusten.
»Vielleicht liegt es auch an dir und du bist in Wahrheit der Schlappschwanz«, spucke ich ihm entgegen.
Seine Hand holt zum Schlag aus. Reflexartig kneife ich die Augen zusammen. Ich warte auf den Schlag – aber er kommt nicht. Vorsichtig öffne ich meine Lider. Andrew fixiert mich, angespannter Kiefer, Lippen zusammengepresst. Tränen rollen über mein Gesicht.
»Andrew ... was ist nur los mit uns?« Ich strecke ihm die Hand entgegen.
Er weicht zurück. »Du solltest gehen«, presst er hervor.
Das tue ich.
Meine Füße baumeln schwerelos über dem langsam dahinfließenden Missouri River. Genauso langsam wie der Whiskey Schluck für Schluck meine Kehle hinunterfließt. Ich trinke nicht oft Alkohol, aber heute habe ich das Gefühl, ihn zu brauchen. Ich kann es nicht fassen, wie es zwischen uns geworden ist. Er ist nicht mehr derselbe. Unsere Ehe ist nicht mehr dieselbe. Was ist aus dem stolzen und liebevollen Mann geworden, in den ich mich verliebt, für den ich meine Stadt, mein Land und sogar den Kontinent verlassen habe?
Dabei sollte doch alles besser werden ... hier ... mit ihm. Er hat mir so viel versprochen, dass sich hier meine Wünsche und Träume erfüllen und dass er mir niemals wehtun würde.
»Sie wollen doch nicht etwa springen, oder?«
Ich zucke zusammen, als mich ein hochgewachsener Mann, ein paar Meter von mir entfernt, aus meinen Gedanken reißt. Unter seinem Hut spitzen einige graue Haare hervor.
»Was? Oh, nein, ich ... keine Sorge, ich muss nur etwas allein sein und nachdenken.« Ich bemühe mich um ein Lächeln.
»Hilft Ihnen das Zeug dabei, die richtige Entscheidung zu treffen?« Er deutet auf meine Papiertüte mit dem Whiskey.
Ich zucke mit den Schultern.
»Es gibt durchaus Momente im Leben, in denen ein Sprung ins Ungewisse genau das ist, was man braucht. Nur so kann man herausfinden, wie tief und kalt das Wasser wirklich ist«, sagt er.
Ich nicke gedankenverloren und blicke hinunter ins schwarze Nass. Als ich meinen Blick hebe, sehe ich nur noch seine Umrisse, bis er vollkommen von der Nacht verschluckt wird. Jetzt liegt es an mir, ich muss mich entscheiden, ob ich weiterhin gegen den Strom schwimme oder mit der Strömung, auch wenn ich nicht weiß, wohin sie mich führen wird. Als ich meinen Entschluss gefasst habe, mache ich mich auf den Weg.
Seine Freunde sind weg und das Haus gespenstisch still, als ich zurückkomme. Ich hole meinen Rucksack aus der Garderobe im Flur und öffne ihn.
Es sind nicht viele Dinge, an denen ich hänge oder die mir hier etwas bedeuten. Diese wenigen Sachen werde ich mit mir nehmen.
Ich schnappe mir meine Lieblingstasse vom Couchtisch. In der Küche befreie ich sie von dem Siff, wasche sie aus und rolle sie in ein Geschirrtuch ein.
Anschließend stecke ich sie in den Rucksack.
Im Wohnzimmer nehme ich das Bild von der Wand, das mir am meisten bedeutet: darauf die Menschen, die mir am wichtigsten sind … die es waren, die ich am meisten vermisse … meine Oma und mein Vater. Auch das stecke ich in den Rucksack.
Auf Zehenspitzen schleiche ich ins Schlafzimmer. Andrew liegt schwer atmend auf dem Bauch. Normalerweise ist er in dem Zustand nicht leicht zu wecken, trotzdem versuche ich, mich nahezu lautlos durch das Schlafzimmer zu bewegen.
Langsam öffne ich die knarrenden Kleiderschranktüren und schiebe ein paar Klamotten in den Rucksack. Mein Blick fällt auf das oberste Schrankfach, das ich nur schwer ohne ein Hilfsmittel erreichen kann. Ich stelle mich auf die Zehen und strecke mich, so weit ich kann. Meine Fingerspitzen ertasten den braunen Umschlag, ich ziehe ihn vorsichtig zum Rand. Als ich ihn richtig fassen kann, ziehe ich ihn heraus, dabei fällt eine kleine Schachtel klappernd auf den Holzboden.
Verdammt! Ich erstarre und halte den Atem an, als Andrew aufstöhnt und sich im Bett herumdreht. Bitte nicht aufwachen!
Sekunden vergehen. Erst als ich sicher bin, dass er noch immer schläft, hole ich wieder Luft. Der Umschlag ist nach wie vor verschlossen. Ich bin froh, dass Andrew ihn nie gefunden hat. Es war die richtige Entscheidung, ihm nichts davon zu erzählen. Ich stecke den Umschlag in den Rucksack, danach nähere ich mich unserem Bett.
Wie oft ich ihm schon beim Schlafen zugesehen habe – wie jetzt. Wie oft ich schon neben ihm geweint habe. Wie oft ich schon nachts allein auf dieser Brücke saß. Wie oft es auch war, dieses Mal war das letzte Mal.
Meine Finger gleiten über seine Haare, während sich meine Augen wieder mit Tränen füllen. So kann ich nicht weiterleben, so schwer es mir auch fällt, aber wenn ein Mensch nicht um dich kämpft, hat er nur darauf gewartet, dass du gehst.
Mein Blick fällt auf unser Hochzeitsbild auf der Kommode. Ich gehe hinüber und nehme es in die Hand. Mit dem Foto nach unten lege ich es auf die Kommode zurück.
Meine Finger drehen und ziehen so lange an meinem Ring, bis er sich von meinem Finger löst. Auch ihn lege ich neben das Bild auf den Schrank. Dann verlasse ich das Schlafzimmer, unser Haus und meinen Mann ...
Zwei Stunden Fußmarsch liegen hinter mir und alles, was mich begleitet, ist der kleine Rucksack, in den mein ganzes Leben zu passen scheint. Gerade als sich meine Füße weigern, auch nur einen einzigen weiteren Schritt in diese Nacht zu gehen, hält ein großer Truck neben mir.
Die Beifahrertür öffnet sich und warmherzige, mit Falten umrahmte Augen blicken mich an. Unaufgefordert steige ich ein. Alles besser, als hier draußen weiterzulaufen.
»Wo soll’s denn hingehen?«, fragt er.
Ich hebe meine Schultern und lasse sie wieder fallen.
Er sieht mich an und nickt. »Ich bin auf dem Weg nach Nashville, Tennessee. Wie hört sich das an?«
Schluchzend halte ich mir die Hände vor das Gesicht.
»Oh, Schätzchen, was ist denn los? Kein guter Ort?«
Ich wische mir die Tränen von den Wangen. »Doch.« Ich nicke. »Das ist er. Er ist perfekt.«
»Na, wer sagt’s denn …« Er löst die Handbremse und dreht das Radio lauter, aus dem die unverkennbare Stimme von Johnny Cash dringt.
ZWEI
Ein Jahr und sechs Monate später
Ich tue es schon wieder.
Weil es das ist, was ich am besten kann – laufen … weglaufen.
Am Ufer beschleunigen sich meine Schritte, jetzt renne ich, so schnell ich kann. Die dunklen Schatten sind mir auf den Fersen, sie tauchen immer wieder auf und lassen sich nicht abhängen. Eisige Luft macht sich erbarmungslos in meiner Lunge breit und jeder Atemzug wirkt wie ein Dolch in meiner Brust. Eigentlich sollte ich wissen, wie es geht, trotzdem atme ich viel zu flach, viel zu schnell und viel zu unkontrolliert. Nach ein paar Meilen geben meine Beine nach und ich falle kraftlos auf die Knie. Ich ringe nach Luft.
›Erschöpft‹ ist nicht annähernd das Wort, das beschreibt, wie ich mich fühle. Ich bin müde, ausgebrannt und innerlich leer. Und ich weiß nicht, ob diese Leere irgendjemand wieder füllen kann, irgendwann.
Ich kämpfe mich wieder auf die Beine, denn das kann ich am zweitbesten. Ich kehre um und jogge den Weg zurück. Inzwischen ist nicht nur meine Nase frei, sondern auch mein Kopf, von all den Gedanken, die ich nicht haben sollte.
Pünktlich zum Sonnenaufgang bin ich zurück und blicke in den Horizont, an dem das erste Glimmen der Sonne zu sehen ist. Das Einzige, was die Stille des beginnenden Tages durchbricht, sind die fröhlichen Gesänge der Vögel.
Als ich mich meinem Haus nähere, sehe ich Susans Auto in meiner Einfahrt stehen. Sie steht auf der Veranda und winkt mir zu.
»Susan, was machst du denn hier?«
Sie antwortet nicht. Als ich die Veranda erreiche, lächelt sie mich zaghaft an.
»Ist was passiert?«, frage ich. Normalerweise taucht sie hier nicht so einfach auf. Eigentlich taucht hier draußen niemand einfach so auf, um mich zu besuchen. Dafür lebe ich viel zu abgelegen von allem.
»Nein. Darf ich meine beste Freundin nicht besuchen? Außerdem wollte ich mal sehen, wie es mit den Renovierungsarbeiten vorangeht.«
Ich blicke auf meine Uhr. »Um sieben Uhr morgens?«
»Schlechte Nacht gehabt? Du siehst echt fertig aus, Eva.«
Ich zucke mit den Schultern.
»Willst du einen Kaffee? Ich mach uns einen.«
»Nein. Ich will wissen, was los ist.«
»Nichts.«
Sie räuspert sich. »Wie lange kennen wir uns jetzt schon? Eineinhalb Jahre?«
Ich nicke.
»Du weißt, du kannst mir nichts vormachen … konntest du noch nie. Also raus mit der Sprache.«
»Es ist nur … Shelly … sie ist schwanger.«
»Von Andrew?«
»Höchstwahrscheinlich. Deswegen haben sie wohl so schnell geheiratet.«
»Woher weißt du das?«
»Ist nicht so wichtig.«
»Eva, komm schon, vergiss die beiden. Sie sind es nicht wert, auch nur einen weiteren Gedanken an sie zu verschwenden. Sei froh, dass du da weg bist.«
»Ja … du hast recht.« Ich deute ein Lächeln an. »Und sagst du mir jetzt, warum du hier bist?«
Sie legt sich eine Hand in den Nacken und tritt von einem Bein auf das andere. »Na ja … die neue Bedienung im Diner …«, beginnt sie.
»Danny?«
»Diana. Sie hat gekündigt.« Sie seufzt. »Und ich habe Katie schon vor Wochen versprochen, dass wir dieses Wochenende zu Mum und Dad fahren. Sie freut sich schon so lange darauf, ihre Großeltern wiederzusehen.« Susan macht ein betrübtes Gesicht. »Rebecca ist noch im Urlaub … und Monica arbeitet ohnehin mehr Stunden, als sie eigentlich wollte …«
»Susan, sag mir einfach, wann du mich brauchst. Ich springe für dich ein. Jederzeit. Das weißt du doch.«
»Ich brauche dich am Freitagabend.«
Ich nicke.
Susan atmet hörbar aus. »Eva, ich weiß, du hast selbst viel zu tun mit den vielen Übersetzungsaufträgen und den Sportkursen, die du gibst … ich würde dich auch nicht fragen, wenn es nicht wichtig wäre. Aber …«
»Ich weiß.«
»Danke, Eva, wirklich … du bist die Beste.«
»Ich weiß.«
»Geh duschen, ich lade dich zum Frühstück in den Diner ein. Dann kann ich dir alles noch mal zeigen.«
»Hört sich gut an.« Ich lächle.
Im Diner bedient Monica bereits die ersten Frühstücksgäste. Susan und ich setzen uns, wie gewöhnlich, an unseren Mädels-Tisch.
»Hey, guten Morgen, ihr zwei, was kann ich euch bringen?«, fragt Monica.
»Hey, Monica, für mich die Blaubeer-Pancakes und einen Kaffee bitte.«
»Hmm, sollten wir ihr sagen, dass es momentan nur Filterkaffee gibt?«, wendet sich Monica an Susan und schmunzelt.
»Filterkaffee?«
»Ähmm, ja, der Vollautomat hat letzte Woche den Geist aufgegeben. Ich habe schon eine neue Maschine bestellt, nur wird die Lieferung noch etwas dauern«, sagt Susan.
»Okay, was soll’s, ich werde ihn mal probieren.«
»Und ich nehme das französische Frühstück und einen Early Grey. Danke, Monica«, sagt Susan.
Nach wenigen Minuten kommt Monica mit dem Tee und dem Kaffee an unseren Tisch. Ich nehme mir die Tasse, halte sie mir unter die Nase und ziehe den Kaffeeduft tief ein. Vorsichtig nippe ich an der dampfenden Flüssigkeit und setze die Tasse gleich wieder ab. »Wow. Wirklich schlechter als erwartet.«
Susan lächelt mich entschuldigend an.
»So und hier habe ich euer Frühstück, lasst es euch schmecken.« Monica stellt die Teller ab und verschwindet anschließend wieder hinter dem Tresen.
»Na, noch einen Kaffee, oder bist du fertig?«
»Nein, danke, sicher keinen Kaffee mehr.«
Susan lacht. »Komm, ich zeig dir, wo du alles findest. Viel hat sich ja eigentlich nicht verändert, seit du hier aufgehört hast zu arbeiten, aber sicher ist sicher.«
Ich folge Susan hinter den Tresen, um nach zwanzig Minuten festzustellen, dass alles noch so ist, wie ich es in Erinnerung hatte.
»Vergiss nicht, die Alarmanlage anzuschalten, bevor du gehst. Der neue Code ist eins, zwei, drei, vier«, flüstert sie.
»Wie einfallsreich.«
»Was denn? Du weißt doch, mein Hirn ist wie ein Sieb. Diesen Code kann ich mir gerade noch so merken … ach, und hier noch ein neues ›relish‹-T-Shirt und eine Schürze für dich.« Sie reicht mir die Sachen, die sie unter dem Tresen hervorholt. »Hmm, fast wie in alten Zeiten, was? Könnte ich mich glatt wieder dran gewöhnen, dass du hier arbeitest.«
»Ja, vielleicht komme ich ja wieder auf den Geschmack, wer weiß?«
»Sag das nicht zu laut.« Susan lacht. »Danke noch mal. Du hast was gut bei mir … und das Trinkgeld kannst du natürlich behalten.« Sie zwinkert mir zu.
»Danke, wie großzügig von dir.«
Am Freitagabend um sieben Uhr sitze ich im Auto, auf dem Weg zu meiner Schicht im Diner. Eine gute halbe Stunde später bin ich am Ziel.
»Bereit für den Feierabend, Monica?«, frage ich, als ich den Diner betrete.
»Oh ja, so was von … du kommst genau richtig.« Sie befreit sich von ihrer Schürze.
»Gut, dann zieh ich mich gleich um.« Hinten tausche ich mein dunkles Shirt gegen das weiße ›relish‹-T-Shirt und binde mir die Schürze um die Taille. Der Geruch von Fleisch und Bacon quillt durch die Küchentür. Ich öffne sie.
»Hi, John, wie geht’s?« Ich gehe auf ihn zu. »Was riecht denn hier so köstlich?«
»Eva … hab schon gehört, dass du uns heute die Ehre erweist. Schön, dich wiederzusehen.« Er sieht mich lächelnd an und wischt sich die Schweißperlen von seiner kahlen Stirn.
»Ja, auch schön, dich zu sehen.« Ich klaue mir eine Scheibe Bacon vom Teller.
»Sicher doch … in Wirklichkeit hast du es doch nur auf meinen Speck abgesehen.« Er greift sich an die Hüften und lacht.
»Ups, du hast mich wohl durchschaut.« Ich zwinkere ihm zu. »So, dann mach ich mich mal an die Arbeit. Monica wartet schon. Bis später.«
John nickt mir zu.
»Tisch 8, hat eben gezahlt. An Tisch 7 kommt noch ein Bacon Burger. John weiß Bescheid. Denen da drüben habe ich erst die Speisekarte gebracht …«
Monica zeigt auf Tisch 5. »Ach ja, und an Tisch 3 habe ich gerade Kaffee nachgeschenkt, er meldet sich, wenn er noch etwas braucht.« Sie reibt sich die Augen. »Wenn du sonst keine Fragen hast, verabschiede ich mich mal … war ein langer Tag.«
»Nein, ich komme zurecht. Geh nur.«
»Gut. Dann viel Spaß und einen schönen Abend.«
»Danke. Gute Nacht, Monica.«
Nach ein paar Minuten betätigt John die Klingel. »Hier, Schätzchen, der Burger für Tisch 7.«
Ich schnappe ihn mir und eile zum Tisch, an dem mich der junge Herr sehnsüchtig erwartet.
»Der Bacon Burger?«, frage ich.
»Ja.« Er streckt mir beide Hände entgegen. »Danke.«
»Lass ihn dir schmecken.«
Anschließend befreie ich die leeren Tische vom dreckigen Geschirr und wische sie mit einem Lappen ab. Als auch alle anderen Gäste mit Getränken und Essen versorgt sind, lasse ich mir von John ein Sandwich zubereiten. Die sind immer noch die besten. Daran hat sich nichts geändert.
Um kurz nach zehn kommt John zu mir an den Tresen. Er hat sich bereits von seiner Küchenkleidung befreit.
»So, ich bin dann auch mal weg. Kommst du zurecht, Eva?«
»Klar, was für eine Frage. Ach, John … danke für das unglaublich leckere Sandwich.«
Er lächelt und winkt mir zum Abschied.
Von meiner Energie am Morgen ist inzwischen nichts mehr zu spüren. Vielleicht habe ich mir doch etwas zu viel zugemutet für einen Tag. Nach dem morgendlichen Joggen war ich voller Tatendrang. Ich habe nicht nur das komplette Haus geputzt, ich habe es auch noch geschafft, alle kaputten Verandadielen auszutauschen, was ich jetzt deutlich im Rücken spüre. Ich fühle mich wie eine Batterie, die ihren Saft verloren hat und wieder aufgeladen werden will.
Ich blicke zur Uhr, kurz vor elf. Dabei fühlt es sich wie mitten in der Nacht an. Zeit für Kaffee.
Ich nehme die Kaffeekanne von der Platte – die steht inzwischen seit Stunden dort – schenke mir eine Tasse ein und nehme einen Schluck. Ach komm, das Zeug kann doch keiner trinken. Wieder komme ich zu der ernüchternden Erkenntnis: Der Kaffee hier ist momentan ungenießbar.
Ich kippe den Kaffee, wenn man ihn so nennen kann, in die Spüle.
Moment. Susan hat doch noch irgendwo … ich gehe in die Küche und mache ein paar Schränke auf. Ha, da ist sie ja. Mit dem French-Press-Kaffeebereiter gehe ich zurück hinter den Tresen. Da alle Gäste versorgt sind, nutze ich die Gelegenheit und bereite mir meinen eigenen Kaffee zu. Kurze Zeit später ist der ganze Raum von frischem Kaffeeduft erfüllt.
Schon besser. Ich sauge den Duft tief ein und genieße jeden einzelnen Schluck davon. Augenblicklich fühle ich mich wacher.
Mein Blick wandert von Tisch zu Tisch. An Tisch 3 halte ich inne. Der Gast dort hat lange nichts mehr bestellt. Oder habe ich es übersehen? Nein, so vertieft, wie er auf seinen Laptop starrt, sicher nicht. Er legt die Stirn immer wieder in Falten und fährt sich mit der Hand durch die Haare. Dann hämmert er weiter auf die Tastatur ein. Was wohl so wichtig ist? An was er so hoch konzentriert arbeitet? Hat es mit seinem Beruf zu tun? Ist er Schriftsteller und schreibt an seinem neuen Krimi? Nein, auch wenn ich nur einen Teil seines Gesichts sehen kann, wirkt er auf mich nicht wie ein Schriftsteller. Ein Arzt vielleicht. Nein. Ein Anwalt, der sein Plädoyer verfasst …
Das ist es. Sein Mandant zählt auf ihn, er muss den Fall gewinnen. Das würde seine finstere Miene und die Falten auf seiner Stirn erklären. Er greift nach seiner Tasse, ohne den Blick vom Bildschirm zu lösen, und nippt daran. Oh Mann, er trinkt doch nicht wirklich diese Plörre? Wer so spät noch so konzentriert arbeitet, sollte wenigstens einen guten Kaffee trinken.
Ich nehme eine neue Tasse aus dem Regal, schenke ihm von meinem frisch zubereiteten Kaffee ein und gehe zu seinem Tisch.
»Sie sehen so aus, als könnten Sie den noch vertragen?« Ich strecke ihm die Tasse entgegen. Er sieht nicht einmal von seinem Laptop auf.
»Nein danke, für heute habe ich schon genug Kaffee getrunken«, sagt er. Seine Stimme klingt tief und warm.
So leicht lasse ich mich nicht abwimmeln.
»Aber diesen sollten Sie unbedingt probieren. Einen besseren haben Sie sicher noch nicht getrunken.« Ganz schön überheblich, Eva. Aber jetzt habe ich seine Aufmerksamkeit. Er sieht zu mir, hält meinen Blick fest und schiebt sein markantes Kinn etwas hin und her. Als überlege er, ob ich dieselbe Bedienung bin, die ihm vorhin den Kaffee gebracht hat. Das erste Mal an diesem Abend sehe ich sein ganzes Gesicht. Sofort fallen mir seine Augen auf, die die Farbe des Ozeans haben. Ebenso tief und unergründlich.
Er fährt sich ein weiteres Mal durch seine etwas zerzausten, dunklen Haare. Ein leichtes Schmunzeln umspielt seine Lippen. Sein zuvor angespanntes Gesicht hellt sich auf.
»Okay, warum nicht.« Er löst seinen Blick von mir und widmet sich wieder seinem Laptop. Ich stelle die Tasse auf den Tisch und begebe mich wieder hinter den Tresen.
Mein Blick wandert immer wieder zu ihm. Jetzt probier schon! Dann ist es so weit, er greift nach der Tasse und nimmt einen Schluck davon. Er stellt sie mit ausdrucksloser Miene zurück auf den Tisch. Dann hält er inne und greift erneut nach ihr. Er trinkt einen weiteren Schluck. Scheint ihm zu schmecken. Ich kann mir ein Lächeln nicht verkneifen. In dem Augenblick hebt er seinen Blick und sieht zu mir.
Oh Mist! Schnell lenke ich meine Aufmerksamkeit auf das Glas in meiner Hand, das ich poliere.
»Können wir bitte zahlen?«, ruft eines der vier jungen Mädchen an Tisch 5.
Ich gehe zu ihnen und kassiere ihre zahlreichen Cocktails ab. Dabei sind sie gerade alt genug, um überhaupt Alkohol zu bekommen. Nachdem auch sie gegangen sind, ist jetzt nur noch Tisch 3 besetzt.
Ich begebe mich hinter den Tresen, dort beuge ich mich hinunter, um den Geschirrspüler einzuräumen.
»Sie haben nicht übertrieben …«
Ich zucke zusammen und richte mich auf. Der Gast von Tisch 3 steht mir gegenüber und blickt mich an.
»… was den Kaffee angeht. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht erschrecken.«
»Schon gut. Freut mich, dass Ihnen der Kaffee geschmeckt hat«, sage ich ein wenig zu leise.
Er sieht mir direkt in die Augen, so lange, bis ich seinem intensiven Blick nicht mehr standhalten kann. Plötzlich fühle ich mich wie ein Stück Kohle, das vor sich hin glüht. Verlegen sehe ich nach unten, bevor ich meinen Blick wieder in seine Richtung hebe. Noch immer sieht er mich, mit seinem durchdringenden Blick an.
»Sind Sie neu hier? Ich habe Sie hier noch nie gesehen …«
»Das Gleiche könnte ich Sie fragen …«, sage ich.
Er schenkt mir ein hinreißendes Lächeln, das nur einen Moment lang anhält, bevor es wieder erlischt. Sein Gesicht wird ernst, mit der Hand, fährt er sich ein weiteres Mal durch die Haare und schüttelt dabei leicht den Kopf, als würde er mit etwas kämpfen – mit sich.
Er legt die Laptoptasche und seine Jacke auf dem Tresen ab. »Ich würde gern zahlen … damit Sie auch Feierabend machen können. Bin gleich wieder zurück.« Er geht um den Tresen herum, den Flur entlang zu den Toiletten. Ich bekomme nur ein Nicken zustande.
Was zum Teufel war das? Ich schüttle leicht benommen den Kopf. Inzwischen ist es kurz vor zwölf, der Feierabend ist zum Greifen nah. Gedanklich bin ich schon in meinem Bett, als die Glocke über der Tür noch einmal läutet. Ich seufze innerlich.
Echt jetzt?
Lächelnd drehe ich mich zur Tür, um die neuen Gäste angemessen zu begrüßen. Mein Lächeln erlischt, als zwei maskierte Männer mit Waffen in den Diner stürzen.
DREI
Ich schaufle mir zum zweiten Mal eine Ladung eiskaltes Wasser ins Gesicht, in der Hoffnung, meine Gedanken wieder in den Griff zu bekommen. Bisher konnte ich immer auf meinen Instinkt vertrauen, auch jetzt habe ich keinen Zweifel daran, dass er richtig liegt. Es ist keine Option ihm nachzugeben, aber wie lange werde ich es schaffen, ihn zu unterdrücken. Soll ich ihn ignorieren?
Ich spüre sofort, wenn mir eine Person gefährlich werden könnte und gerade schrillen alle Alarmglocken in meinem Kopf. Meine Hände auf das Waschbecken gestützt blicke ich in den Spiegel, ich schüttle den Kopf. Nein. Ich sollte hier schnellstmöglich verschwinden, um es gar nicht so weit kommen zu lassen und nicht in Versuchung geführt zu werden. Es hätte keinen Sinn.
Andererseits ist heute vielleicht der richtige Zeitpunkt, alles hinter mir zu lassen und wieder nach vorn zu sehen. Ich blicke auf den Ring an meiner linken Hand. Nur mit großer Mühe kann ich ihn vom Finger lösen. Ich halte ihn ins Licht und lese die Schrift innen.
Was tue ich hier nur? Es ist nicht richtig, ich muss hier raus, und zwar schnell.
Gerade als ich den Ring wieder anstecken will, höre ich jemanden schreien. Es ist eine tiefe, männliche Stimme und sie kommt aus dem Gastraum. Ich schiebe den Ring in die Hosentasche. So leise wie möglich, öffne ich die Toilettentür und trete auf den Flur, in dem immer noch der Duft nach gebratenem Fleisch hängt.
»Kasse auf, sofort!«, schreit jemand.
Ein Überfall? Ernsthaft? Jetzt? Ich blicke zur Decke und atme tief aus. Soll das irgendein Zeichen sein? Oder ein schlechter Scherz?
Also gut. Ich mache ein paar Schritte Richtung Gastraum und blicke vorsichtig um die Ecke, direkt in die verängstigten Augen der Bedienung. Sie schüttelt ganz leicht den Kopf und sieht dann sofort wieder weg. Wäre die Situation nicht so ernst, würde ich sicherlich schmunzeln über ihren Versuch, mich schützen zu wollen. Dabei werde ich derjenige sein, der sie beschützen wird.
Sie hat keine Ahnung, wer ich bin.
VIER
»Hände hoch und rühr dich ja nicht vom Fleck«, schreit mich einer der beiden an. Er kommt mit erhobener Waffe auf mich zu. Ich erstarre und merke, wie die Panik in mir hochkriecht und sich in meinem ganzen Körper ausbreitet. Sie macht mich vollkommen bewegungsunfähig. Ich stehe nur da und starre in den Lauf seiner Waffe.
»Hände hoch, habe ich gesagt!«
Komm schon, Eva, reiß dich zusammen, wenn du hier heil rauskommen willst. Tu einfach das, was er sagt. Ich hebe meine Hände genau so weit hoch, dass er sie sehen kann.
»Ist noch jemand hier?«, will der andere, etwas kleinere Typ wissen.
Mein Mund öffnet sich, aber er ist so trocken, dass kein Ton nach außen dringt. Schweißperlen sammeln sich auf meiner Stirn.
»Antworte!«, schreit er..
Mein Blick fällt flüchtig auf die Jacke und die Laptoptasche. Ich schlucke kräftig, um meine Kehle zu befeuchten. »Nein ...«, flüstere ich. »Ich bin allein hier.«
Oh Gott, bitte, lass sie schnell wieder verschwinden, und zwar bevor sie merken, dass ich gelogen habe.
Der Kleinere geht zurück zur Tür. Er legt seine Hände an die Scheibe und sieht in die Dunkelheit hinaus.
»Kasse auf, sofort«, befiehlt der Größere. An seinem Hals sehe ich Teile eines Tattoos.
Als ich mich zur Kasse drehe, entdecke ich den Gast von Tisch 3 im Flur, er nähert sich uns langsam. Unsere Blicke treffen sich. Ich schüttele kaum merklich den Kopf und sehe dann wieder zur Kasse. Hoffentlich kapiert er es.
Bitte lass ihn Hilfe holen. Ruf die Polizei, bete ich.
»Aufmachen, verdammt noch mal!«, brüllt der Größere. Er kommt um den Tresen herum auf mich zu und packt mich an den Haaren. Ich drücke die Taste und die Kassenschublade springt uns entgegen. Er stößt mich weg und steckt den kompletten Inhalt der Kasse in seinen Stoffbeutel. Der andere kommt zurück zum Tresen. Er sieht auf den Laptop.
Scheiße!
»Was ist das hier?«, fragt er und sieht mich an.
Nein, bitte nicht, ihr habt, doch was ihr wollt. Geht doch endlich wieder. »Das ... das sind meine Sachen, ich wollte gerade gehen«, sage ich mit einem Zittern in der Stimme.
Er nimmt die Jacke und hält sie hoch. »Blödsinn. Willst du uns verarschen?«
Der Typ mit dem Tattoo packt mich an den Haaren und zieht mich mit sich vor den Tresen.
»Wem gehört das … wer ist noch hier?« Er hält mir den kalten Lauf seiner Waffe an den Kopf.
Mein Herz klopft mir bis zum Hals. Adrenalin rauscht durch meine Adern. Mir fällt keine plausible Erklärung ein. Was soll ich sagen?
»Mir. Die gehören mir«, höre ich den Mann von Tisch 3 mit ruhiger Stimme sagen. Er hält seine Hände hoch und kommt auf uns zu. Was macht er denn da, das darf doch nicht wahr sein! Ich sehe ihn an und schüttle wieder den Kopf. Spiel jetzt bloß nicht den Helden! Wäre er doch nur hinten geblieben, ich hatte die Sache unter Kontrolle – mehr oder weniger.
»Stehen bleiben.« Der kleinere Typ geht auf ihn zu. Die Waffe auf den Kopf des Gastes gerichtet.
»Blöde Schlampe, du hältst dich wohl für besonders schlau, was?«, sagt der Typ mit dem Tattoo und blickt mich wutentbrannt an. Er löst seinen Griff aus meinen Haaren. Stattdessen packt er mich mit seiner prankenartigen Hand am Hals und drückt zu. Sofort bleibt mir die Luft weg. Ich reiße meine Augen auf und versuche, seine Hand von meinem Hals zu lösen. Erfolglos. Undefinierbare Geräusche kommen aus meiner Kehle. Als auch seine zweite Hand meinen Hals packt, bekomme ich Todesangst. Vor meinen Augen beginnt es zu flimmern. Scheiße, ich will noch nicht sterben. Verzweifelt versuche ich, mich mit Armen und Beinen zu wehren, ihn von mir loszubekommen. Ich schaffe es, mein Knie zwischen uns zu bringen und es ihm in die Weichteile zu stoßen. Ein tiefer Laut kommt aus seiner Kehle. Er lässt mich los und ich schnappe gierig und hustend nach Luft. Genauso wie er es tut. In dem Moment greift der Gast von Tisch 3 nach der Waffe des anderen neben ihm. Er entwaffnet ihn mit einem gezielten Griff und bringt ihn mit nur einem Schlag an den Kehlkopf zu Boden. Noch leicht benommen blicke ich zu ihm.
»Geh!« Er deutet mit dem Kopf Richtung Tür.
Bevor ich reagieren kann, trifft mich ein Schlag mitten ins Gesicht. Ich taumle zurück und knalle mit dem Hinterkopf an den Tresen und gehe zu Boden.
»FBI! Sofort die Waffe runter!«, höre ich, noch bevor alles für einen Moment dunkel wird.
Ich blinzele, komme wieder zu mir. Sofort schmecke ich das Blut in meinem Mund. Meine Lippe fühlt sich an wie ein geplatzter Gummischlauch. Ich lege meine Hand an meinen Kiefer und schiebe ihn vorsichtig hin und her. Er fühlt sich, soweit ich das beurteilen kann, nicht gebrochen an. Mit der Zunge taste ich meine Zähne ab. Gott sei Dank. Zwischen den umgekippten Barhockern ziehe ich mich zum Sitzen hoch. Verdammt, mein Kopf. Als ich meinen Hinterkopf berühre, zucke ich zusammen. Ich betrachte meine zitternde Hand. Da ist Blut.
»Waffe runter!«, sagt der Typ von Tisch 3 bestimmt und zielt mit einer Waffe in der Hand auf meinen Angreifer. Ich sehe zu ihm auf. Was ist hier nur los? FBI, habe ich das richtig verstanden?
»In spätestens einer Minute wird hier ein Aufgebot von Cops und FBI durch die Tür marschieren und dann sollte keine Waffe mehr auf mich gerichtet sein«, sagt er mit ruhiger Stimme.
»Scheiße. Waffe runter, sonst knall ich die Schlampe ab.« Er hält seine Waffe auf mich gerichtet.
»Bis jetzt ist es noch bewaffneter Raubüberfall.« Er sieht mich für einen Bruchteil einer Sekunde an. »... mit Körperverletzung. Sie wollen doch nicht wirklich jemanden töten?«
»Halt’s Maul. Sonst knall ich euch beide ab ... steh endlich auf, Greg, verdammte Scheiße noch mal.« Der andere liegt immer noch am Boden und hustet.
»Nur noch dreißig Sekunden – die kennen da keinen Spaß, wenn ein FBI-Agent mit einer Waffe bedroht wird. Das wird nicht gut für euch ausgehen.« Er schüttelt seinen Kopf. »Waffe runter, wenn ihr das überleben wollt.«
Ich frage mich, ob er auf Verhandlungen und Geiselnahmen spezialisiert ist. Mein Herz schlägt mindestens zwei Mal so schnell wie sonst. Die Anspannung liegt so unerträglich schwer in der Luft, dass man sie zerschneiden könnte. Ich wage es nicht, mich auch nur einen Zentimeter zu rühren. Ich würde ein gutes Ziel abgeben. Angespannt halte ich die Luft an.
»Komm schon, Ed, nimm die Waffe runter. Ich will nicht sterben«, fleht ihn der Typ am Boden mit gebrochener Stimme an. Ed sieht abwechselnd zur Tür und zum FBI-Agent.
Schließlich senkt er seine Waffe.
»Schieb sie zu mir rüber und dann auf den Boden legen, Kopf nach unten und die Hände hinter dem Kopf verschränken. Jetzt!«
Beide tun, was er sagt. Keine Sekunde zu spät – in diesem Moment kommt ein Haufen bewaffneter Cops in den Diner gestürmt.
»Polizei, Hände hoch und keine Bewegung!«
Der FBI-Agent von Tisch 3 legt die Waffe auf den Tresen. In der anderen Hand hält er ihnen seine Marke entgegen. Die Hände leicht erhoben. »Special Agent Max Harrison. Bewaffneter Überfall, zwei Täter«, sagt er und nickt in deren Richtung. »Lage gesichert.«
Ein Officer nickt ihm zu – dann nimmt er die Hände runter. Die beiden Täter werden in Handschellen gelegt.
Agent Harrison kniet sich vor mich. »Hey. Wie ist dein Name?«
Mein Blick wandert zu den beiden Angreifern, die gerade abgeführt werden. Als ich nicht reagiere, nimmt er mein Gesicht in seine Hände und dreht meinen Kopf vorsichtig in seine Richtung. Er mustert mich. Mein Herz rast. Immer noch oder schon wieder?
»Wie heißt du?«
»Eva«, antworte ich und sehe in seine tiefblauen Augen.
»Hey, Eva, mein Name ist Max, ich bin vom FBI.«
Ich nicke. »Ja, ich weiß, habe ich schon mitbekommen.«
Er lächelt. »Es ist vorbei. Du bist in Sicherheit.«
Ich nicke erneut. Seine Hände liegen immer noch warm auf meinem Gesicht. Meine Wangen glühen unter ihnen und sein Blick scheint mich zu hypnotisieren.
»Bist du so weit okay, kannst du aufstehen?«
Ich könnte, aber möchte ich das jetzt?
»Ja, ich denke schon«, antworte ich.
Er lässt mein Gesicht los und nimmt meine Hände, die jetzt sicher in seinen liegen. Er hilft mir hoch und führt mich zum nächsten Tisch. Mein Kopf dröhnt und alles um mich herum dreht sich. Ich lasse mich auf einem der Stühle nieder. Max stellt sich schützend neben mich. Als würde er befürchten, dass ich anderenfalls vom Stuhl kippe. Ein Typ in verwaschenen Jeans und Pulli kommt zielstrebig auf uns zugeeilt.
»Max, wolltest du nicht schon am Nachmittag Feierabend machen?«, scherzt er und klopft ihm auf die Schulter. »Alles gut?«
Max nickt.
»Oh. Hi, Special Agent Daniel Walker«, sagt er und reicht mir seine Hand.
»Eva«, sage ich und ergreife sie.
Er ist etwas kleiner als sein Kollege, sein struppiges rot-blondes Haar wirkt, als sei er erst aufgestanden.
»Brauchen wir hier ein Krankenwagen?«, fragt uns einer der Officers.
»Ja, bitte«, antwortet Max.
»Nein«, schalte ich mich ein. »Ich brauche keinen Krankenwagen ... mir geht’s gut.«
»Hmm, sollen wir denn jemanden anrufen?«
»Nein, nicht nötig. Danke.« Alle drei tauschen ihre Blicke untereinander aus.
»Okay, dann brauchen wir noch Ihre Personalien, haben Sie einen Ausweis dabei?«
»Ja, in meiner Handtasche ... die ist hinten im Büro.«
Der Officer nickt. »Bleiben Sie sitzen, ich hole sie.«
»Danke.«
Als er mit meiner Tasche zurückkommt, setzt er sich mir gegenüber an den Tisch. Ich gebe ihm den Ausweis, dabei fällt meine Greencard auf den Boden. Max, der immer noch an meiner Seite steht, hebt sie auf und wirft einen Blick auf sie, bevor er sie mir zurückgibt. Der Officer notiert sich meine Daten und schiebt meinen Ausweis über den Tisch zurück zu mir. Max kommt mir zuvor und nimmt ihn an sich. Er sieht ihn sich an, als würde er ihn auswendig lernen. Dann reicht er ihn mir.
Der Officer stellt Max und mir Fragen zum Tathergang und schreibt mit. »Ms Hall, Sie müssen in den nächsten Tagen zu uns aufs Revier kommen, damit wir noch Ihre detaillierte Aussage aufnehmen können. Für heute wäre es erst mal alles – wir melden uns bei Ihnen. Ruhen Sie sich aus. Alles Gute.«
»Okay. Danke.«
»Ach, eins noch ... wem gehört der Diner?«, fragt er.
Oh Mist. Ich muss Susan Bescheid geben.
»Meiner Freundin. Susan Scott. Sie ist aber gerade nicht in der Stadt, sie ist mit ihrer Tochter übers Wochenende zu ihren Eltern gefahren ...«
»Haben Sie ihre Kontaktdaten? Dann kümmere ich mich darum.«
»Ja, Moment.« Ich gebe sie ihm.
Er bedankt sich bei mir und geht zu seinen Kollegen.
Als ich mich zu hastig vom Stuhl erhebe, sehe ich überall Sternchen aufblitzen. Mein Kopf fühlt sich wie ein zu groß aufgeblasener Luftballon an, der jeden Augenblick platzen könnte. Ich stütze mich am Tisch ab.
»Sicher, dass Sie nicht zum Arzt wollen?«, fragt mich Agent Walker und hält dabei stützend meinen Arm. Er und Max sehen sich an.
»So lasse ich dich nicht nach Hause gehen. Und schon gar nicht allein.« Max sieht mich mit finsterer Miene an. »Entweder ich fahre dich jetzt ins Krankenhaus oder ich rufe einen Krankenwagen, der dich dort hinbringt.« Sein Gesichtsausdruck lässt keine weiteren Verhandlungen zu.





























