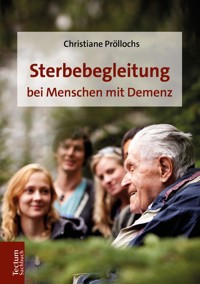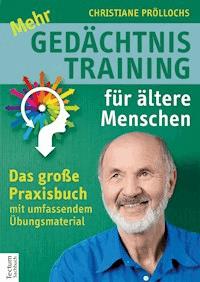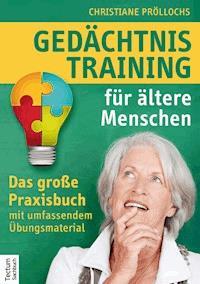19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wohlstand, Hygiene und Medizin haben die durchschnittliche Lebenserwartung in wenigen Jahrzehnten fast verdoppelt. Kehrseite der Medaille: Mit dem Alter wächst das Risiko für eine Demenzerkrankung und damit für soziale Isolation in der letzten Lebensphase. Das Sterben wird für viele Demenzkranke zu einer einsamen Angelegenheit - professionell gehandhabt und sozial tabuisiert. Christiane Pröllochs sucht nach Konzepten zur Begleitung sterbender Demenz-Patienten. Was brauchen diese Menschen, damit sie in Vertrauen und Geborgenheit ihr Sterben leben können? Welche Themen- und Problembereiche verbinden sich mit einer solchen speziellen Sterbebegleitung? Unter welchen Rahmenbedingungen findet sie statt? Welche gesellschaftlichen, institutionellen und individuell-persönlichen Voraussetzungen braucht es für gelingende Sterbebegleitung bei demenzkranken Menschen? Und wie lässt sich schließlich verhindern, dass Demenzkranke am Lebensende isoliert sind? Leserstimmen: "Eine gelungene Einführung und ein lesenswerter, informativer Überblick zur Hospizarbeit heute." Prof. Dr. Rainer Treptow, Professor für Erziehungswissenschaft an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen "Sprachlich sehr schön zu lesen, wissenschaftlich fundiert und zugleich berührend geschrieben." Dr. Gottfried Kusch, Arzt für Innere Medizin, Geriatrie und Palliativmedizin am Tübinger Paul-Lechler-Krankenhaus "Eine solche Zusammenschau der Konzepte hat mir noch gefehlt. Beim Lesen fühlte ich mich bestätigt, dass ich mit meiner Arbeit auf dem richtigen Weg bin." Angelika Wenning, Altenpflegerin, Einrichtungsleitung des Otto-Mörike-Stifts in Weissach-Flacht
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Christiane Pröllochs
Sterbebegleitung bei Demenzkranken
© Tectum Verlag Marburg, 2010
ISBN 978-3-8288-5611-0
Bildnachweis Cover: © diephosi| iStockphoto.de
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der ISBN 978-3-8288-2401-0 im Tectum Verlag erschienen.)
Besuchen Sie uns im Internet unter www.tectum-verlag.de
www.facebook.com/Tectum.Verlag
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort und Dank
1 Einleitung
2 Sterben
2.1 Sterben einst und heute
2.1.1 Gesellschaftliche Bedingtheit des Umgangs mit Sterben und Tod
2.1.2 Sterben in der postmodernen Gesellschaft
2.1.3 Tod: Das Ende des Sterbeprozesses
2.1.4 Wann beginnt das Sterben?
2.2 Das Hospiz-Konzept
2.2.1 Die historische Entwicklung der modernen Hospizbewegung
2.2.2 Die Entwicklung der Hospizbewegung in Deutschland
2.2.3 Die Hospiz-Idee
2.2.4 Ehrenamtlichkeit
2.3 Das Palliative Care-Konzept
2.4 Hospiz und Palliative Care in Deutschland heute
2.5 Die „hospizliche Haltung“: Sterbende Menschen begleiten
2.5.1 Hilfe, Beistand, Begleitung
2.5.2 Dialogische Haltung: Begegnung auf Augenhöhe
2.5.3 Konzept „Total Pain“: Bedürfnisse Sterbender
3 Demenz
3.1 Krankheitsbild
3.1.1 Krankheitsverlauf
3.1.2 Diagnostik und Behandlung
3.1.3 Malignität
3.2 Theoretische Erklärungsansätze demenziellen Verhaltens
3.2.1 Theorie pathophysiologischer Veränderungen
3.2.2 Umweltbezogene Modelle
3.2.3 Modell der unerfüllten Bedürfnisse
3.2.4 Theorie der Retrogenesis
3.2.5 Phänomenologischer Zugang zum Erleben Demenzkranker
3.3 Ansätze der Betreuung an Demenz erkrankter Menschen
3.3.1 Milieutherapeutischer Ansatz
3.3.2 Ansatz der Personzentrierten Pflege
3.3.3 Validation
3.3.4 Basale Stimulation
3.3.5 Biographiearbeit
3.3.6 Mäeutisches Konzept
3.3.7 Prä-Therapie
3.3.8 Zusammenfassung
4 Sterbebegleitung bei Demenzerkrankten
4.1 Stand der Forschung
4.2 Der Sterbeprozess bei Demenzerkrankten
4.2.1 Problem der Prognostizierbarkeit
4.2.2 Erleben des eigenen Sterbens
4.2.3 Bedürfnisse sterbender Demenzkranker
4.2.4 Besondere Herausforderungen für Pflegende
4.2.5 Zentrale Themenbereiche im Zusammenhang von Sterben und Demenz
4.3 Kommunikation mit sterbenden Demenzkranken
4.4 Palliative Care in der Sterbebegleitung von Demenzkranken
4.5 Lebensqualität
4.6 Symptommanagement
4.7 Familie und Entscheidungen
4.7.1 Künstliche Ernährung
4.7.2 Antibiotika-Behandlung
4.7.3 Klinikeinweisung
4.8 Nicht-medikamentöse Interventionen
4.9 Spirituelle Pflege
4.10 Konzept der Pflegeoase
5 Rahmenbedingungen für die Sterbebegleitung bei Demenzerkrankte
5.1 Versorgung zu Hause
5.1.1 Versorgung zu Hause – und ihre Grenzen
5.1.2 Situation der Pflege zu Hause
5.1.3 Über das Sterben sprechen .
5.1.4 Bedarfe und Lücken in der Versorgung
5.2 Implementierung einer Hospizkultur in Einrichtungen der Altenpflege
5.2.1 Voraussetzungen für die Implementierung
5.2.2 Ansätze der Implementierung
5.2.3 Qualitätssicherung und Standards
5.2.4 Qualifizierung von Mitarbeitenden
5.2.5 Schlussfolgerung
5.3 Ansätze zur Verbesserung der palliativen Versorgungssituation
5.3.1 Ethische Fallbesprechungen und Ethikkomitees
5.3.2 Kriseninterventionsplanung
5.3.3 Rechtliche Voraussetzungen
5.3.4 Vernetzung der unterschiedlichen Berufsgruppen
5.3.5 Ehrenamtliche in der Begleitung sterbender Demenzkranker
5.3.6 Gesellschaftliches Bild von Demenz
6 Zusammenfassung und Ausblick
7 Persönliches Nachwort
8 Literaturverzeichnis
Vorwort und Dank
Die Begleitung sterbender Menschen liegt mir seit einigen Jahren am Herzen. Nachdem ich in der eigenen Familie erleben durfte wie bedeutsam die letzte Zeit im Leben eines Menschen für ihn selbst und die Angehörigen sein kann, wurde ich auf die Tübinger Hospizdienste e.V. aufmerksam und schloss mich ihnen an. Seither ist die Hospizarbeit zu einem wichtigen Teil meines Lebens geworden. Durch die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Thematik hat sich mein Blick nun noch einmal erweitert. Und er hat sich vertieft in der Fokussierung auf die spezielle Zielgruppe sterbender Demenzerkrankter. Im Laufe des Schreibens eröffneten sich mir neue Perspektiven. Ich begab mich in einen intensiven Prozess der Auseinandersetzung, stellte meine Ansichten in Frage, vor allem, was das Thema Tod und Sterben im gesellschaftlichen Kontext betrifft und welchen Stellenwert Hospiz und Palliative Care darin einnehmen. Insbesondere auch, welchen Risiken die Hospizbewegung dabei ausgesetzt ist, damit aber auch, welche Chancen und Aufgaben sie hat, gesellschaftlich zu Veränderungen in Richtung mehr Menschlichkeit beizutragen.
Danken möchte ich allen Ehrenamtlichen der Tübinger Hospizdienste e.V. Viele von Ihnen durfte ich ausbilden, einige über Jahre hinweg in monatlichen Fallbesprechungsgruppen begleiten. Mit und von ihnen habe ich viel gelernt über das, was „hospizliche Haltung“ genannt wird. Eine Haltung, die sich nicht auf die Sterbebegleitung beschränken lässt, ja, in der Sterbebegleitung gar nicht möglich ist, wenn sie nicht in der eigenen Persönlichkeit wurzelt und im alltäglichen Leben Fuß fasst. Den Ehrenamtlichen widme ich daher diese Arbeit mit großem Respekt und in tiefer Dankbarkeit.
Mein Dank geht auch an Frau Helene H., die ich in der Anfangszeit meiner eigenen Hospizausbildung begleitete und von der ich lernte, wie beglückend der Kontakt und die Begegnungen mit einem an Demenz erkrankten Menschen sein kann, selbst wenn er nicht mehr sprechen kann und langsam auch das Gehen verlernt. Ich werde nie vergessen, wie viel Liebe zwischen uns floss und wie beschenkt ich jedes Mal von ihr fort ging.
Ich danke meinen Kolleginnen in der Beratungsstelle für ältere Menschen und deren Angehörige e.V., für die vielen guten Erfahrungen wechselseitiger Ermutigung und Unterstützung und für Literaturhinweise und Zeitschriftenartikel, die sie mir zur Verfügung gestellt haben.
Bei Hartmut Deutschmann bedanke ich mich für die Hilfe in allen technischen Fragen, insbesondere beim Formatieren, sodass ich die Arbeit von Anfang an mit viel Spaß schreiben konnte. Herbert Lemcke danke ich für das kritische Gegenlesen der Arbeit, seine präzisen Nachfragen und konstruktiven Anregungen.
Herrn Professor Dr. Treptow danke ich für seine Unterstützung meines wissenschaftlichen Arbeitens und sein offenes Ohr für meine Fragen.
Darüber hinaus danke ich allen, die mich in dieser Zeit mit ihrem Interesse und in Gesprächen begleitet haben, besonders meinem Mann Tilmann.
1 Einleitung
Jeder Mensch muss sterben. Dank der rasanten Fortschritte der Medizin dürfen wir heute mit einer wesentlich längeren Lebensspanne rechnen als die Menschen jemals zuvor in der Geschichte. Die Lebenserwartung beträgt heute für Frauen etwa 82 und für Männer 77 Jahre.1 Noch vor 100 Jahren wurden Frauen nur circa 58 Jahre alt, Männer lebten durchschnittlich 52 Jahre.2
Die segensreiche Entwicklung der längeren Lebensspanne bringt mit sich, dass es einen immer höheren Anteil an Menschen gibt, die an einer Demenz erkranken, denn Alter ist der Hauptrisikofaktor für Demenzerkrankungen. Heute leben in Deutschland etwa 1 Mio. Menschen mit dieser Krankheit. Bis zum Jahr 2050 wird sich ihre Zahl verdoppeln.
In früheren Zeiten starben Menschen zu Hause, in den Familien. Sterben war Teil des Lebens. Kinder kamen von klein auf damit in Berührung, es gab Rituale für Abschied und Trauer. In unserer heutigen Gesellschaft ist es nicht mehr selbstverständlich, direkt und persönlich mit dem Sterben konfrontiert zu werden. Menschen sterben in Kliniken und Pflegeheimen, der Tod ist ein „heimlicher Tod“ (Ariès) geworden. Die moderne Hospizbewegung bemüht sich seit den späten 1960er Jahren, Sterben, Tod und Trauer wieder einen Platz zu geben und als zum Leben zugehörig zu vermitteln. Doch noch immer gehört Sterben zu den gemiedenen Themen in unserer Gesellschaft, die geprägt ist von Zielstrebigkeit, Leistungsorientierung und Effizienzdenken. Das Nachlassen von Kräften und Fähigkeiten will nicht so recht dazu passen, und dem Prozess des Sterbens einen Wert zuzusprechen, widerspricht der Logik unserer anderen Teilsysteme immens. Sterben und Tod machen Angst und werden daher gern in die Hände von Experten3 gelegt und hinter die Mauern von darauf spezialisierten Einrichtungen gedrängt.
Ein zweites stark angstbesetztes Thema ist in unserer Gesellschaft der geistige Abbau durch eine Demenz. „Vor dieser Krankheit haben die meisten Deutschen mehr Angst als vor dem Tod“4. An Demenz zu erkranken ist für viele Menschen gleichzusetzen mit würdelosem Dahinvegetieren. Die Angst führt zur Meidung des Kontakts mit Betroffenen und damit zu deren Isolation.
So ist offensichtlich, dass Demenzerkrankte in besonderem Maße gefährdet sind, in ihrer letzten Lebensphase sozial isoliert zu werden, da sie die Umgebung mit zwei Angst auslösenden Tatsachen konfrontieren: dem Sterben und der Demenz. Sterbende Demenzkranke geraten leicht in eine vierfache Isolation: (1) Isolation auf Grund der Demenz, die den Sterbenden in seiner eigenen Welt leben lässt, (2) Isolation durch die für die umgebenden Menschen Angst auslösende Situation, dass er ein Sterbender ist, wodurch sie sich von ihm zurückziehen, (3) Isolation durch das soziale Umfeld, das sich die Wesensveränderungen nicht erklären kann und das Unverständliche meidet, und schließlich (4) Isolation durch die Institution Altenpflegeheim, die an reibungslosen Abläufen interessiert ist, die der Demenzkranke durchkreuzt.5
Gerade Einsamkeit und Isolation aber fürchten Sterbende in der Regel am meisten.
Dieses Buch beschäftigt sich mit der Frage nach Konzepten der Begleitung sterbender Demenzerkrankter. Was brauchen diese Menschen, damit sie in Vertrauen und Geborgenheit ihr „Sterben leben“6 können? Welche Themen- und Problembereiche beinhaltet Sterbebegleitung bei demenzerkrankten Menschen? Unter welchen Rahmenbedingungen findet sie statt? Welche gesellschaftlichen, institutionellen und individuell-persönlichen Voraussetzungen braucht es für gelingende Sterbebegleitung bei demenzkranken Menschen?
Auf allen drei gesellschaftlichen Ebenen – Makro-, Meso-, und Mikroebene – gibt es in den letzten Jahren Fortentwicklungen, was die gesamtgesellschaftliche Relevanz der Thematik widerspiegelt. Die Tabelle auf der nächsten Seite veranschaulicht dies.
Auf der Mikroebene geht es um die konkrete Situation der Betroffenen und ihrer Angehörigen und um die jeweiligen Bedarfe, für die es fallspezifische Lösungen braucht. Da diese individuellen Lebenssituationen aber keine Einzelfälle sind, wird auf der Mesoebene der Institutionen und Organisationen darauf mit strukturellen Weiterentwicklungen reagiert.
Dienstleistungsangebote werden geschaffen und ausgebaut, Altenpflegeeinrichtungen stellen sich auf die veränderten Bedürfnisse ihrer Kunden ein, professionell Pflegende werden weitergebildet und speziell qualifiziert, Qualitätsrichtlinien werden erstellt und Profile geschärft, Ehrenamtliche werden geschult und in die Versorgungssysteme integriert. Auf der Makroebene wird auf die demographischen Veränderungen mit neuen Gesetzen reagiert, die die ambulante vor der stationären Pflege weiter stärken sollen, Gesetzgeber verhandeln mit Kranken- und Pflegekassen über Rahmenvereinbarungen zur Umsetzung der Gesetze. Eine „Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen“ wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend7 herausgegeben. Und neben all dem treten die Themen Sterben und Demenz stärker ins öffentliche Bewusstsein, was unter anderem mit dem großen Engagement der Hospizbewegung und Demenz-Kampagnen durch verschiedene bundesweit aktive Demenzinitiativen zusammenhängt.
Die Vielschichtigkeit des Themas dürfte deutlich geworden sein. Dieses Buch bezieht sich auf die derzeitige Situation in Deutschland. Es wurden Studien und Metastudien der letzten 3-5 Jahre herangezogen, um die aktuellen Entwicklungen und relevanten Fragestellungen im Bereich „Sterbebegleitung bei Demenzerkrankten“ nachzuvollziehen. Fachzeitschriftenartikel wurden ebenso berücksichtigt wie aktuelle Handbuchartikel, Monographien und Grundlagenliteratur. Das Buchstellt so einen Überblick über Konzepte und aktuelle Entwicklungen dar. Die Perspektive einzelner Betroffener, Angehöriger oder professionell bzw. ehrenamtlich damit befasster Personen findet keine Berücksichtigung. Diese mittels qualitativer Interviews zu rekonstruieren, könnte eine lohnende Fortsetzung sein.
Das Buch ist so aufgebaut, dass die Themen Sterben und Demenz zunächst einzeln erörtert werden. In Kapitel 2 „Sterben“ wird der Umgang mit Tod und Sterben historisch und gesellschaftlich verortet. Sterben wird dann als Lebensphase zwischen Tod und Beginn des Sterbeprozesses eingegrenzt, wobei aufgezeigt wird, dass die genaue Bestimmung nicht eindeutig möglich ist und von der Perspektive abhängt. Hospiz und Palliative Care werden als Konzepte der Sterbebegleitung erläutert und der Begriff „Begleitung“ in seiner Bedeutung für die so genannte „hospizliche Haltung“ ausgeführt. Kapitel 3 befasst sich mit dem Thema „Demenz“, beginnend mit einer Beschreibung des Krankheitsbildes und theoretischer Grundannahmen über demenziell bedingtes Verhalten. Vor diesem Hintergrund werden Ansätze der Betreuung Demenzerkrankter vorgestellt. In Kapitel 4 „Sterbebegleitung bei Demenzerkrankten“ werden die beiden Themen zusammengeführt. Nach einer Übersicht über den Stand der Forschung wird der Sterbeprozess bei Demenzkranken in seinen Besonderheiten gegenüber dem ausschließlich somatisch Erkrankter spezifiziert. Die sich daraus ergebenden Themenbereiche werden im Einzelnen abgehandelt. Kapitel 5 beschreibt die Rahmenbedingungen, unter denen Sterbebegleitung bei Demenzerkrankten stattfindet. Die Situation häuslicher Pflege, Ansätze der Implementierung von Hospizkultur in Altenpflegeeinrichtungen sowie Weiterentwicklungen, die die Versorgung Demenzerkrankter am Lebensende verbessern sollen, werden erörtert. Eine Zusammenfassung mit Ausblick bündelt in Kapitel 6 die Antworten auf die Fragestellung und schließt mit weiterführenden Gedanken das Buch ab.
1 Vgl. Statistisches Bundesamt 2009 .
2 Vgl. Statistisches Bundesamt 2006 .
3 Der leichteren Lesbarkeit halber wurde in dieser Arbeit auf die Nennung beider Geschlechter verzichtet. Geschlechtsspezifische Formulierungen schließen das jeweils andere Geschlecht mit ein.
4 Gronemeyer 2008a, S. 34.
5 Vgl. Kostrzewa 2009, S. 31.
6 Vgl. Kostrzewa 2009, S, 32.
7 Nachfolgend als BMFSFJ abgekürzt.
2 Sterben
Jeder kennt die Begriffe Sterben und Tod. Sterben wird als Verlauf gesehen, an dessen Ende der Tod steht. In diesem Kapitel soll das individuelle Erleben des Sterbens in seinem gesellschaftlichen Kontext verortet und die Lebensphase „Sterben“ hinsichtlich ihres Endes – Eintritt des Todes – und ihres Anfangs eingegrenzt werden.
2.1 Sterben einst und heute
Sterben ist einerseits so individuell wie das Leben, andererseits unterliegt es gesellschaftlichen Bedingtheiten. Der Mensch weiß, dass er sterben muss, und er muss sich dazu in irgendeiner Weise verhalten. Wie Menschen dies individuell und auch kollektiv tun, ist und war sehr unterschiedlich in den verschiedenen Kulturen und Zeiten. Jede Gesellschaft hat ihre eigene Weise des Umgangs mit Tod und Sterben und diese kann als Spiegelbild der jeweiligen Kultur betrachtet werden8.
2.1.1 Gesellschaftliche Bedingtheit des Umgangs mit Sterben und Tod
In früheren Jahrhunderten waren die Menschen wesentlich stärker mit dem Tod konfrontiert als heute. Er umgab sie in ihrem Leben augenscheinlich: die Menschen starben in jüngerem Lebensalter, sie starben oft plötzlich, der Tod war omnipräsent. Ein Viertel der Säuglinge überlebte nicht einmal das erste Lebensjahr9. Wer dann das junge Erwachsenenalter erreichte, konnte dennoch nicht sicher sein, „alt“ zu werden. Pest, Hunger und Krieg bedrohten das Leben ständig. Die Menschen mussten mit der Unsicherheit des eigenen Lebens umgehen und diese bewältigen. Eine Verdrängung des Todes war nicht möglich.10
Über das Sterben in der vormodernen Zeit herrscht heute oft die Vorstellung, es sei damals „besser“ gewesen, weil die Menschen der Tatsache des Sterbens ins Auge sahen. Außerdem lebten sie in der Lebensform des „Ganzen Hauses“ zusammen und die Menschen starben, wo sie gelebt hatten. Für viele heutige Menschen ist es eine Art Idealvorstellung, zu Hause im Kreise der Familie zu sterben. Doch diese Vorstellungen eines Sterbens in Geborgenheit sind unrealistisch, wie Arthur Imhof belegt. Sie romantisieren und idealisieren das Sterben in vormodernen Gesellschaften. Dies wird verständlich, wenn man sich vor Augen führt, dass die Menschen früher am häufigsten an Infektionskrankheiten starben, an Pest, Typhus, Fleckfieber oder Tuberkulose. All diese Krankheiten führten stets dazu, dass unzählige Menschen gleichzeitig erkrankten und viele von ihnen starben.11 Um sich selbst zu schützen, vermied man den Kontakt zu den Erkrankten, so weitdies möglich war. Das Zusammenleben im Ganzen Haus war Überlebenserwägungen geschuldet und wenn die Lebenssicherheit nicht mehr gewährleistet war, gab es keinen Grund die Gemeinschaft aufrecht zu erhalten. So war es auch damals nicht die Ausnahme allein zu sterben, sondern die Regel.12
Hinzu kommt, dass die Kirche die Definitionsmacht über die Sinngebung von Leben und Tod hatte. Das Wichtigste war, gottwohlgefällig zu sterben. In der Sterbestunde entschied sich alles: Entweder man kam ins ewige Fegefeuer, in die Hölle, oder man wurde in den Himmel aufgenommen. Was auch immer man im Leben getan hatte, man konnte sich nicht sicher sein, denn die eigentlichen schweren und gefährlichen Versuchungen hatte man erst auf dem Sterbelager zu erwarten. Die Vorstellung war, dass dann die Mächte des Teufels um die Seele feilschen und ringen. So waren die Menschen darauf angewiesen, sich beizeiten auf diesen Kampf vorzubereiten. Sie taten dies, indem sie ein Büchlein, die „Ars moriendi“, ihr ganzes Leben lang immer wieder betrachteten. Es enthielt Bilder, die jedermann verstehen konnte, Darstellungen der Versuchungen und des Widerstehens, die dem Menschen den Weg durch die Todesstunde wiesen.13 Sterben war also keineswegs einfacher oder angenehmer für die Menschen früherer Zeiten.
Die Unsicherheit, die die Spanne des eigenen Lebens betraf, zog sich durch die Jahrhunderte hindurch bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts.14 Noch 1875 lag die Lebenserwartung für Männer nur bei 35, für Frauen bei 38 Jahren. Im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts ging dann die Kindersterblichkeit zurück und in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts sank durch die Verbesserung der Lebensbedingungen und die medizinischen Fortschritte in der Bekämpfung der Infektionskrankheiten auch die Erwachsenensterblichkeit. Seit dem Ende des 2. Weltkriegs reduzierte sich schließlich auch die Sterblichkeit im höheren Alter.15 So vollzog sich der Wandel von der „unsicheren zur sicheren“ Lebenszeit erst vor wenigen Jahrzehnten.
Das Leben ist sicherer geworden. Wir können heute davon ausgehen, zumindest ein Alter von 70 oder 80 Jahren zu erreichen. Die moderne Medizin hat dem Tod durch Krankheiten einiges entgegenzusetzen. Früher war Sterben oft eine Sache von wenigen Tagen. Heute gibt es Krankheiten, die länger andauern und ganze Lebensabschnitte betreffen können. Zwischen infauster Prognose und Tod dehnt sich oft eine erhebliche Zeitspanne aus. Wir sind im alltäglichen Leben nicht mehr zwangsläufig mit dem Tod konfrontiert, was zur Folge hat, dass die erste Begegnung mit dem Tod heute für viele Menschen der eigene ist. Und schließlich fürchten wir heute nicht mehr Fegefeuer und Höllenqualen.16 Nicht generell zumindest, denn in unserer postmodernen Epoche der Pluralisierung der Lebensformen und der Individualisierung steht jedem frei, seine eigene Vorstellung von Lebensgestaltung und Sinndeutung zu wählen17.
So sind wir heute weitgehend abgeschirmt von sterbenden Menschen und damit vom Tod und der Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit. Doch der demographische Wandel und die damit steigende Zahl der Hochaltrigen, die oft an verschiedenen Krankheiten leiden, führt uns gesamtgesellschaftlich vor Augen, dass wir nicht darum herum kommen, uns mit dem Tod, vor allem aber mit der Lebensspanne davor, dem Sterben, auseinanderzusetzen. Denn die Sterbenden müssen versorgt werden und wo ihre Zahl immer größer wird, steigt der Bedarf an Versorgungsstrukturen.
2.1.2 Sterben in der postmodernen Gesellschaft
Der Umgang mit Tod und Sterben ist ambivalent. Auf eine Art ist das Sterben längst aus der Tabuzone heraus getreten: Durch die Medien werden wir täglich mit dem Tod konfrontiert. In Fernsehen, Internet und Computerspielen sehen schon Kinder Bilder von Sterbenden, Toten, von Mord und Ermordeten, selbst von zu Tode Gefolterten. Über Tod und Sterben werden Bücher geschrieben und Filme gedreht. Die Masse an Literatur in diesem Bereich ist in den vergangenen Jahren fast unermesslich angewachsen. Man spricht darüber, plaudert in Talk-Shows, hört Sendungen im Radio. Und doch haben heute viele Erwachsene noch nie einen Menschen leibhaftig sterben sehen, noch nie einen Toten berührt und viele haben auch in reiferem Alter noch keinen Nahestehenden durch den Tod verloren. Ein Todesfall im persönlichen Umfeld führt oft zu Unsicherheit wie darauf zu reagieren ist, zu Hilflosigkeit im Kontakt mit den Hinterbliebenen und zu Sprachlosigkeit.
„Wir haben auch hier eine doppelläufige Entwicklung. Auf der einen Seite wird das Sterben thematisiert und nicht mehr umschwiegen (…). Auf der anderen Seite wird es oft dort nicht besprochen, wo es ansteht.“18
Reimer Gronemeyer sieht im Umgang mit Tod und Sterben ein Spiegelbild der Gesellschaft19. In unserer Gesellschaft werde dem Tod mit modernen Mitteln der Schrecken entzogen wird: Er wird in die Hände von Experten gegeben. Um Sterbende kümmern sich Intensiv- und Palliativmediziner, Ethikkommissionen, spezialisiertes Pflegepersonal und geschulte Ehrenamtliche.
Der technische Fortschritt ermöglicht es heute, Menschen am Leben zu erhalten, die noch vor wenigen Jahrzehnten an ihrer Krankheit gestorben wären. Der Preis ist hoch. Viele Menschen, die erleben, dass da „nur noch ein Körper“ am Leben erhalten wird, hoffen, selbst nie so zu enden und versuchen, sich mit einer Patientenverfügung dagegen abzusichern.20 Auf der anderen Seite sind die Kosten, die Menschen in ihren letzten Lebenswochen verursachen, gewaltig und steigen exponenziell auf das Lebensende hin an, sodass schon die Befürchtung nahe liegt, Hochaltrige könnten bald zum „sozialverträglichen Frühableben“ aufgefordert werden21. Die Diskussion um die Legalisierung der Aktiven Sterbehilfe kann als Schritt dazu gesehen werden. Die erst seit diesem Jahr (2009) verbindlich geltende Patientenverfügung gerät ebenfalls in Gefahr, hierfür instrumentalisiert zu werden. Die Themen Sterben und Tod stehen so in einem Spannungsfeld zwischen extremen Gegenpolen.
2.1.3 Tod: Das Ende des Sterbeprozesses
Das Sterben findet sein natürliches Ende im Tod. Doch wann genau der Zeitpunkt des Todes eintritt, ist für die Wissenschaft selbst heute noch schwierig zu definieren.22 Am eindeutigsten scheint es, den Todeszeitpunkt anhand körperlicher Parameter zu bestimmen. Die so genannten „sicheren“ Todeszeichen sind nach Grond23 Leichenstarre, Leichenflecken und Verwesungsgeruch, als „unsichere“ Todeszeichen gelten Atemstillstand, Herzstillstand und Blässe. Seit Ende der 1950er Jahre kennt man den so genannten Hirntod, der eine weitere Todesdefinition ins Blickfeld brachte, die unter ethischen Gesichtspunkten sehr kritisch diskutiert wird, da sie eng mit dem Interesse an Organentnahmen verknüpft ist.24 Kriterien für den Hirntod sind Koma, Fehlen der Spontanatmung, Erlöschen der Hirnstammreflexe über 12 Stunden oder Null-Linien-EEG über eine halbe Stunde. Diese Zeichen müssen von zwei Medizinern unabhängig von einander festgestellt werden.25
Doch nicht nur die Medizin definiert den Tod. Die Philosophie tut es auf ihre Weise. Platon und Aristoteles sahen den Tod dann als gegeben, wenn die Seele den Körper verlassen hat. Nach der Lehre des Tibetischen Buddhismus geschieht dies über einen gewissen Zeitraum hinweg, sodass empfohlen wird, den Körper des Verstorbenen „so lang wie möglich ungestört“26 zu lassen.
Auch in der Sterbebegleitung wird der Eintritt des Todes eher als Verlauf denn als Zeitpunkt erlebt. Angehörige und Begleitende nehmen oft wahr, dass sich der Verstorbene in seinem Gesichtsausdruck in den ersten Stunden und Tagen noch verändert. Für viele ist spürbar, wenn er „endgültig“ gegangen ist.
2.1.4 Wann beginnt das Sterben?
Auch bei dieser Frage gibt es unterschiedliche Betrachtungsweisen, je nach dem aus welchem Interesse heraus nach dem Beginn des Sterbeprozesses gefragt wird.
2.1.4.1 Medizinische Definitionen