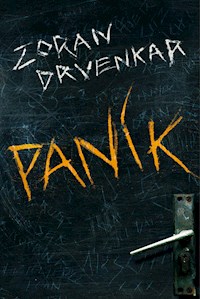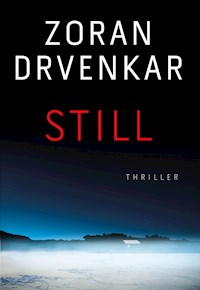
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eder & Bach
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wenn die Seen schweigen, kommt der stille Tod. Ein Mann, der seine Tochter sucht und dabei seine Identität verliert. Ein Mädchen, das seit sechs Jahren reglos aus dem Fenster schaut und darauf wartet, dass ihr jemand den Schlüssel zu ihrer Erinnerung bringt. Vier Männer und eine Mission, die aus Hunger und Disziplin besteht und keine Opfer scheut. Ein Winter in Deutschland, ein See im Wald und Schatten, die sich unter dem Eis bewegen. Der neue, große Thriller des SPIEGEL-Bestseller-Autors Zoran Drvenkar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ZORAN
DRVENKAR
STILL
THRILLER
Eder & Bach
1. Auflage, August 2014
© 2014 Zoran Drvenkar
© 2014 Eder & Bach GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlaggestaltung: wunderlandt.com
Autorenfoto: © Corinna Bernburg
Gesetzt aus der Adobe Garamond
Gestaltung und Satz: Corinna Bernburg
ISBN: 978-3-945386-01-9
www.drvenkar.de
www.ederundbach.de
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
für Mika & für jeden,
der in die Dunkelheit eintaucht,
um sich das Herz der Bestie zu holen
SIE
Sie steigen aus dem Eis wie hungrige Geister, die einen Wirtskörper suchen. Ihre Haut dampft und ihr Haar gefriert innerhalb von Sekunden. Die Genitalien sind geschrumpft, die Brustwarzen hart. Sie lachen, stoßen sich an und stapfen durch den Schnee, als würden sie einem unsichtbaren Pfad folgen. Bevor sie die Hütte betreten, reibt jeder von ihnen über die Einkerbungen, die auf Augenhöhe in den Türrahmen eingeritzt sind. Es ist eines von vielen Ritualen, es soll Glück bringen. Keiner von ihnen vertraut auf das Glück, dennoch tut es gut, dieses Ritual zu haben. Es verbindet sie miteinander wie ein Knoten, der nur einmal alle hundert Jahre gelöst wird.
Als sie die Hütte wieder verlassen, hat sich das Eisloch geschlossen, und nur ihre Fußabdrücke im Schnee erinnern daran, daß sie aus dem See gestiegen sind. Jetzt tragen sie Stiefel und Mäntel, jetzt ist ihnen warm. Sie setzen sich in den Wagen und fahren ohne Licht los. Die Dunkelheit ist angebrochen, und der Mond schaut zwischen den Wolken hervor, als würde er sie im Auge behalten wollen. Erst nachdem sie die Straße erreicht haben, schalten sie die Scheinwerfer ein, und das Licht reißt eine Bresche in die Nacht. Es ist windstill, aber die Stille täuscht, in den nächsten Stunden soll es stürmen. Sie schweigen und schauen in die Dunkelheit, und die Dunkelheit weicht ihren Blicken aus und schaut nicht zurück.
Das Haus unterscheidet sich kaum von den anderen Häusern. Zwei Stockwerke, ein Vorgarten, drei Tannen und eine Schaukel mit einem Schneemann davor. Es liegt in einer schmalen Einbahnstraße im Herzen von Lankwitz. Hier gibt man sich noch der Illusion hin, nicht zu Berlin zu gehören. Die Fahrbahn ist unberührt, und auf dem Bürgersteig sind keine Fußspuren zu sehen.
Sie parken den Wagen und betrachten die Häuserreihe. Das Blinken der Weihnachtsbeleuchtung färbt die Fassaden in einen regelmäßigen Takt, als hätte die Straße ihren ganz eigenen Herzschlag. Der Schneefall ist jetzt dicht. Sie warten und lassen den Motor laufen, sie sitzen reglos im Wagen, und der Rhythmus der blinkenden Lichter wird zu einem Rhythmus der Ruhe.
Ihr Blick kehrt immer wieder zu dem einen Haus zurück.
Eine Stunde vergeht, dann steigen sie aus.
DU
Sie holen dich in der Nacht, drei Tage später lebst du nicht mehr.
So schnell kann das gehen.
Es ist kurz nach sieben und ein Winterabend, wie du ihn dir nur wünschen kannst – seit gestern sind Weihnachtsferien und vor einer Stunde hat es wieder angefangen zu schneien. Der Schneefall liegt über der Stadt wie eine Decke, die sich bei jeder Windböe hebt und senkt und dir zu winken scheint. Es ist Weihnachtsstimmung pur. Am Fensterglas ranken sich die ersten Eisblumen, und über deinem Bett hängt eine Lampe in der Form eines roten Papiersterns. Sie verwandelt dein Zimmer in eine warme, schummrige Höhle, der die Kälte nichts kann.
Wäre da nicht der Fernseher an deinem Bettende, würdest du die ganze Nacht am Fenster stehen und rausschauen. Es ist zwar noch früh, dennoch trägst du schon deinen Schlafanzug und liegst neben deinem kleinen Bruder. Eigentlich hat er nichts in deinem Zimmer verloren und erst recht nichts in deinem Bett. Er sollte bei einem Freund übernachten, aber der Freund ist krank geworden. Also haben dir deine Eltern zwanzig Euro versprochen, damit du dich den Abend über um ihn kümmerst. Und so teilt ihr euch eine Schale Popcorn, und du erträgst sein Gequassel, wie man im Sommer die Mücken erträgt. Du bist müde, denn ihr schaut schon den zweiten Film, aber um keinen Preis würdest du auch nur eine Minute versäumen wollen. Eure Eltern haben euch den Fernseher nach dem Abendbrot hochgetragen und gesagt, sie bräuchten heute Zeit für sich. Es ist ihr Hochzeitstag, und gleich werden sie in die Oper gehen und später in dem kleinen Restaurant essen, in dem sie sich kennengelernt haben.
Du hörst ihre Stimmen aus dem Erdgeschoß – das Lachen deiner Mutter, den Bass deines Vaters, und immer wieder ihr Flüstern, als würden sie ein Geheimnis teilen.
Es geht deiner Familie gut, und das Leben könnte nicht besser sein, wenn du nur nicht so müde wärst. Dein Bruder dagegen ist hellwach. Seine Füße bewegen sich unter der Bettdecke, als wollte er jeden Moment lossprinten. Er stopft sich Popcorn in den Mund und kommentiert den Film mit Sprüchen, die alle mit »Ach, du Kacke« anfangen. Er ist sechs Jahre alt, und du hast es längst aufgegeben, ihn zum Schweigen zu bringen.
Als eure Eltern hochrufen, daß sie jetzt gehen würden, schreckst du zusammen.
Das Innere deines Mundes fühlt sich pelzig an, und dein Kopf ist schwer, einen Moment lang bist du weggenickt. Eure Eltern rufen, daß sie jetzt gehen, daß sie in drei Stunden wieder da sind, und daß ihr spätestens um halb elf im Bett sein sollt. Bevor du ihnen antworten kannst, schnappt die Haustür zu, dann ist kein Laut mehr von unten zu hören. Dein Bruder stellt fest, er würde auf jeden Fall bis Mitternacht und noch später wach bleiben. Du gähnst, von dir aus kann er bis um fünf Uhr früh Polka tanzen, falls er überhaupt weiß, was Polka ist.
– Von mir aus kannst du Polka tanzen, sagst du.
– Ausgerechnet Polka, sagt er.
Deine Augen fallen wie von allein zu.
Das Lachen deines Bruders weckt dich wieder auf.
Du weißt nicht, wieviel Zeit vergangen ist. Auf dem Boden der Schale liegen nur noch ein paar Maiskörner, und die Cola in deinem Glas ist lauwarm. Dein Bruder hat nicht einmal mitbekommen, daß du geschlafen hast. Er zeigt auf den Fernseher und stellt fest, der Film wäre ganz schön albern. Du willst ihm gerade sagen, er solle mal in den Spiegel schauen, dann würde er sehen, was wirklich albern ist, als es dunkel wird im Haus. Stockdunkel und still. Du kannst den Schnee hören, der mit einem Knistern an das Fensterglas geweht wird. Dein kleiner Bruder sitzt so reglos neben dir, daß du nicht weißt, ob er noch im Zimmer ist. Kein Atemzug, nichts. Du lauschst, und nach einer gefühlten Ewigkeit hörst du ihn sagen:
– Was jetzt?
Du wartest, daß der Stern wieder angeht und der Fernseher erwacht, aber nichts geschieht. Nur der gelbliche Schein der Straßenlaterne beleuchtet einen Teil der Zimmerdecke, und die Schatten der Schneeflocken wandern wie träge Insekten durch dieses Licht.
– Gleich wird es wieder hell, flüsterst du, aber es klingt nicht überzeugend.
Dein Bruder drückt sich an dich.
– Mach was, sagt er.
Du versuchst die Lampe neben deinem Bett einzuschalten, sie bleibt aus. Deine Fingerspitzen sind klebrig vom Popcorn. Du wischst die Hand an der Bettdecke sauber, obwohl du weißt, daß deine Mutter deswegen meckern wird. Ihr habt euch in letzter Zeit wegen den winzigsten Kleinigkeiten gestritten. Du bist dreizehn Jahre alt und lebst deine erste Rebellion, es ist ein wunderbares Gefühl der Macht, bewußt Nein zu sagen.
– Lucia?
– Was denn?
– Mach mal was.
Du wünschst dir, deine Eltern wären noch da. Bestimmt würden sie dann mit Kerzen zu euch hochkommen, wie letztes Jahr, als ein heftiger Sturm über Berlin hereinbrach und der Strom für Stunden ausfiel. Dein Bruder hatte alles verschlafen, du aber weißt noch ganz genau, wie es sich angefühlt hat, zwischen den Eltern zu liegen und dem Wind zu lauschen, der zornig an den Fensterläden rüttelte, während dein Vater im Kerzenschein aus einem Buch vorlas und deine Mutter dir über das Haar strich, als wäre der Sturm aus deinem Kopf entflohen und sie müßte nur deine Gedanken besänftigen, dann würde auch das Unwetter sich beruhigen. Das war im Sommer, jetzt ist Winter, und du wünschst dir, deine Eltern wären noch im Haus.
Kaum hast du das gedacht, hörst du Schritte auf der Treppe. Es knarrt, und dein Bruder sagt was, aber du achtest nicht auf ihn, denn du konzentrierst dich auf dieses Knarren.
Einmal, zweimal. Pause.
Ein drittes Mal.
Du weißt, woher das Knarren kommt. Es ist die achte Stufe von unten. Sie ist lose, seitdem eurer Mutter beim Putzen der Staubsauger runtergefallen ist. Euer Vater will die Stufe seit Monaten reparieren, und niemand tritt mehr drauf, weil das Knarren so fies ist, daß selbst dein kleiner Bruder sich das gemerkt hat.
Es knarrt ein viertes Mal.
Wer ist das? denkst du, als die Tür zu deinem Zimmer aufschwingt.
Sechs Jahre später sitzt du auf einem Stuhl und dein Bruder und deine Eltern sind nicht mehr. Ihre Namen, ihre Worte, ihre Gedanken. Die Erinnerung an sie befindet sich in einem verschlossenen Zimmer, von dem niemand weiß, daß es existiert. Deine Erinnerung ruht dort und auch du ruhst. Ohne Bewußtsein, ohne Gedanken. Du kannst dieses Zimmer nicht betreten, denn du bist in dir selbst gefangen. Dein Bewußtsein ist ein zerbombtes Dorf, aus dem alle Bewohner geflohen sind. Alle außer dir. Du sitzt in den Ruinen und bist geduldig. Deine rechte Hand liegt auf deinem rechten Knie, die Handfläche zeigt nach oben und wartet, daß jemand kommt und den Schlüssel hineinlegt, der das Zimmer deiner Erinnerung öffnet.
Und wann immer jemand deine Hand schließt, kommen dir die Tränen.
Und wann immer Schnee fällt, stirbst du ein bißchen mehr. Du bist eine Tote, die atmet. Du bist eine Tote, die wartet. Genau das hast du gesagt, als sie dich fanden.
– Ich bin tot.
– Nein, widersprachen sie dir, Du bist gerettet.
Als du das hörtest, hast du dir gedacht: Nur ein Lebender kann sowas sagen, die Toten wissen es besser. Seitdem sitzt du geduldig am Fenster, Tag für Tag, mit der offenen Hand auf dem Knie und hoffst und wartest, daß jemand den Schlüssel findet und zu dir bringt. Jemand wie ich.
ICH
1
Ich will nichts Falsches sagen. Ich habe mein drittes Bier vor mir stehen und will auf keinen Fall was Falsches sagen. Die Jukebox wiederholt Eye of the Tiger zum achten Mal an diesem Abend, der Dartautomat dudelt seine Melodie, das Licht ist gedimmt. Ich starre auf die Theke. Die Worte in meinem Kopf sind poliert wie Flußkiesel, die vom Wasser glattgerieben wurden. Keine Kanten, keine Ecken. Ich sortiere sie immer wieder neu und suche nach der richtigen Ordnung. Die Worte müssen mir ins Blut übergehen. Ich muß ein Teil des Flusses sein.
Der Mann links von mir murmelt, daß nichts mehr so ist, wie es einmal war, seitdem keiner mehr rauchen darf, wann er will, wo er will, und sind wir denn hier in der DDR oder was? Er wiederholt sich wie einer von diesen mechanischen Papageien, die auf dem Volksfest die Besucher anlocken sollen. Die Leute ignorieren ihn, der Barkeeper wischt über die Theke, ich sehe auf.
Sie sind zu zweit an einem der Tische. Sie sitzen im Halbdunkel und reden, wie Männer gerne reden – mit beiden Händen ums Glas, ohne sich anzusehen, versunken im Bierschaum oder in der Maserung des Tisches und manchmal auch im Raum, als wäre da ein unsichtbarer Zuhörer. Einer der Männer fängt meinen Blick auf, ich nicke ihm zu und hebe mein Glas. Er nickt zurück, läßt sein Glas aber stehen.
Der Anfang ist gemacht.
Ich zahle und gehe.
Zu Hause stelle ich mich unter die Dusche und warte, daß die Kälte weicht. Das Bad ist eine Nebellandschaft, meine Haut steht in Flammen, die Fingerspitzen sind aufgequollen. Nach zehn Minuten gebe ich auf. Die Kälte sitzt so tief in meinen Knochen, daß ich frierend aus der Dusche steige. Nichts hilft.
Die nächsten Stunden verbringe ich im Internet, bis meine Beine unruhig sind und ich saure Übelkeit auf der Zunge schmecken kann. Ich will die Augen nicht verschließen. Ich will sehen, was es zu sehen gibt. Nach sechzehn Downloads kann ich nicht mehr. Es ist keine gute Zeit für mich. Ich balanciere auf einem schmalen Grat entlang, dabei weiß ich es besser. Es gibt Regeln. Wir sollten immer jemanden an unserer Seite haben, der uns vor dem Absturz bewahrt. Immer. Meine Frau fehlt mir. Sie ist bitter, sie ist wütend. Ich kann mich nicht gut erklären. Sie nennt mich krank, sie nennt mich pervers und hat mir mit der Polizei gedroht. Ich konnte sie nur ansehen. Ich bin nicht der, der ich sein wollte. Ich wurde zu dem, der ich bin, weil der Wind sich gedreht hat, weil ein Stern verlöscht ist oder irgendwo in Afrika ein Blatt vom Baum fiel. Ich weiß, es wird nicht ewig so weitergehen. Ich arbeite daran.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!