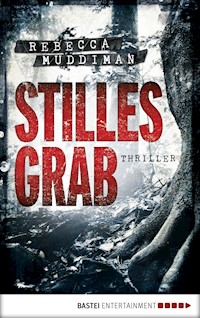
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einem Waldstück werden die sterblichen Überreste eines Mädchens gefunden, und alle Hinweise deuten darauf hin, dass es sich dabei um die Leiche von Emma handelt, die vor elf Jahren spurlos verschwand. DI Michael Gardner, der sich nie verziehen hat, dass er Emma damals nicht finden konnte, wird nun zu den Ermittlungen hinzugezogen. Er und DS Nicola Freeman stoßen auf ein Netz aus Lügen und Halbwahrheiten - und müssen schnell feststellen, dass in diesem Fall nichts so ist, wie es scheint ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Epilog
Danksagung
Über die Autorin
Rebecca Muddiman studierte Film- und Medienwissenschaften und legte einen Master in Creative Writing ab. 2010 gewann sie den englischen Northern Writers’ Award, 2012 den Northern-Crime-Wettbewerb. Ihr Debüt Ruhe sanft, mein Kind sorgte in Großbritannien für große Begeisterung. Nun legt sie mit Stilles Grab ihren zweiten Roman vor. Rebecca Muddiman lebte eine Zeitlang in den Niederlanden auf einem Hausboot, inzwischen wohnt sie mit ihrem Freund und einem Hund in ihrer nordenglischen Heimatstadt – in einem Häuschen namens Murder Cottage …
Rebecca Muddiman
STILLES GRAB
Psychothriller
Aus dem britischen Englisch von Alexandra Kranefeld
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:Copyright © 2015 by Rebecca MuddimanTitel der englischen Originalausgabe: »Gone«Originalverlag: Mulholland Books, Hodder & Stoughton Ltd, London
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Dr. Katja BendelsTitelillustration: © shutterstock /gordan; © shutterstock /andreiuc88Umschlaggestaltung: Massimo PeterE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-2314-6
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
Für Mam und Dad
Prolog
11. Dezember 2010 · Middlesbrough
»Die Leiche wurde heute in einem Waldgebiet in der Nähe von Blyth entdeckt …«
DI Michael Gardner verfolgte die Bilder des ihm einst so vertrauten Ortes mit gemischten Gefühlen. Eigentlich sollte es ihm nichts ausmachen. Es war nicht sein Fall, nicht sein Problem. Jetzt nicht mehr.
»Auch wenn es nach Auskunft der Polizei noch zu früh ist, um die Identität der Frau zweifelsfrei festzustellen, heißt es, bei der Toten seien persönliche Gegenstände der seit elf Jahren vermissten Emma Thorley gefunden worden. Eine zum Zeitpunkt ihres Verschwindens durchgeführte Suchaktion der Polizei war erfolglos geblieben. Ihr Vater hatte die damals Sechzehnjährige im Juli 1999 als vermisst gemeldet.«
Sowie die Nachrichten zum Wetter übergingen, schaltete Gardner den Fernseher aus; es war arschkalt, das brauchte ihm niemand zu sagen. Er lehnte sich zurück und schaute zu, wie der Schnee von seinen Schuhen rutschte und langsam in den Teppich sickerte. An Emma Thorley konnte er sich noch gut erinnern. Nicht an sie selbst, denn er war ihr nie begegnet, aber an ihren Fall. Er erinnerte sich an ihren Vater und die vielen Fotos seiner geliebten Emma, die er Gardner in die Hand gedrückt hatte. Kein einziges dieser Fotos konnte sie wieder nach Hause bringen.
Wären die Umstände damals andere gewesen, hätte er sich vielleicht tiefer in den Fall hineingekniet. Hätte genauer hingeschaut, gründlicher nachgefragt, und dann … Hätte man dann trotzdem heute eine Leiche im Wald gefunden?
*
Louises Hand schloss sich fest um die Fernbedienung, ihr Daumen schwebte über dem Aus-Knopf. Die Nachricht erwischte sie kalt. Obwohl Emma Thorley schon seit elf Jahren spurlos verschwunden war, war es ein Schock, jetzt davon zu hören, so plötzlich. Ihr Lächeln darüber, das perfekte Weihnachtsgeschenk für Adam gefunden zu haben, war wie weggewischt. Stattdessen breitete sich Angst in ihr aus, eine blinde, bodenlose Furcht, die glühend heiß und eiskalt zugleich in ihr aufstieg.
Sie musste etwas tun, irgendetwas, konnte nicht untätig hier herumhocken, doch sie saß wie gelähmt und starrte auf die Bilder jenes Ortes, den sie einmal ihr Zuhause genannt hatte.
Das Geräusch der Haustür holte sie in die Gegenwart zurück. Schnell schaltete sie den Fernseher aus, und als Adam kurz hereinschaute, brachte sie sogar ein Lächeln zustande. Doch noch während sie ihm nachblickte und ihn in der Küche verschwinden sah, wusste sie, dass es vorbei war.
Es war nur eine Frage der Zeit. Früher oder später würde man herausfinden, was sie getan hatte.
Blyth
Lucas Yates steckte sich eine Zigarette an und spürte sein Herz rasen. Emma Thorley. Den Namen hatte er seit Jahren nicht mehr gehört – zumindest nicht von anderen. In seinem Kopf hörte er ihn dauernd. Er träumte von ihr, sogar jetzt noch, nach so langer Zeit.
Er dachte an die Tage, die sie zusammen verbracht hatten, Tage, an denen sie in der Schule hätte sein sollen. Braves Mädchen gerät auf die schiefe Bahn – soll vorkommen, so was. Aber sie war anders. Anders als die anderen kleinen Schlampen, die ihm die Bude einrannten, dauernd was von ihm wollten. Die blonde Tusse in den Nachrichten hatte gesagt, man hätte irgendwas bei der Leiche gefunden. Irgendwas, das die Bullen vermuten ließ, es könnte sich bei der Toten um Emma handeln. Was, hatten sie natürlich nicht gesagt. Klar, das behielten sie für sich.
Den ganzen Morgen hatte er hier rumgehangen und an das letzte Mal gedacht, als er sie gesehen hatte. An seinen rasenden Zorn. Wochenlang hatte er nach ihr gesucht. Und als er sie dann endlich gefunden hatte, konnte er sich kaum noch beherrschen. Das war mehr gewesen als nur Wut. Das war Hass. Und der war ihm geblieben, kochte immer mal wieder hoch.
Jetzt war sie wieder hier, in seinem Kopf. Lucas schlug mit der Faust gegen die Wand, bis der Spinner von nebenan zurückhämmerte.
Er drückte die Zigarette aus und stand auf. Als er ans Fenster trat, konnte er seinen eigenen Atem in der Luft sehen. Unten auf der Straße hasteten ein paar Gestalten vorbei, und er fragte sich, wann es so weit wäre. Wann die Polizei bei ihm klopfen würde. Ihn fragen würde, wann er Emma Thorley zuletzt gesehen hatte, und dann den ganzen alten Scheiß wieder ausgraben. Er wusste, dass es so kommen würde. Er wusste nur nicht, wann. Die Bullen waren nicht gerade die Hellsten, aber irgendeiner von denen würde schon auf ihn kommen. Man musste kein Einstein sein, um hier eins und eins zusammenzuzählen.
Er und Emma, das ging ziemlich lange zurück.
1
13. Dezember 2010
DS Nicola Freeman saß an ihrem Schreibtisch und schaute kurz zur Uhr über der Tür. Die Zeit drängte, und sie hatte nichts Konkretes in der Hand. Wie sie so etwas hasste! Sie waren sich so gut wie sicher, dass es sich bei der Toten um Emma Thorley handelte – soweit sich das anhand der sterblichen Überreste beurteilen ließ, hatte das Mädchen die richtige Größe und das richtige Alter. Aber Freeman brauchte Fakten, wenn sie ein offizielles Statement abgeben und Emmas Vater traurige Gewissheit geben wollte. Am einfachsten wäre natürlich ein DNA-Abgleich, aber Emma Thorley hatte keine lebenden Blutsverwandten. Zumindest waren keine bekannt. Als einziger Familienangehöriger war ihr Vater Ray geblieben, und der hatte Emma adoptiert. Freeman seufzte. Es wäre ja auch zu einfach gewesen.
Als das Telefon klingelte, stürzte sie sich darauf. »Freeman«, sagte sie ungeduldig.
»Hallo, Nicky, hier ist Tom.« Tom Beckett, der Pathologe und vermutlich der umgänglichste Mensch, dem Freeman je begegnet war. Eigentlich konnte sie es nicht ausstehen, Nicky genannt zu werden. Nur ihr kleiner Bruder Darren hatte sie so genannt – und auch das nur, um sie zu ärgern –, aber bei Tom ließ sie es durchgehen. Um ehrlich zu sein, hätte sie Tom fast alles durchgehen lassen. Der Mann verschwendete seine Fähigkeiten an die Toten. Er sollte hier oben arbeiten, mit Menschen aus Fleisch und Blut, die sein Talent zu schätzen wüssten.
»Bitte sag mir, dass du konkrete Ergebnisse hast«, kam sie gleich zur Sache.
»Habe ich, aber sie werden dir nicht gefallen. Miss Thorleys verpeilter Zahnarzt hat soeben bestätigt, dass er die Krankenakte seiner Patientin tatsächlichnichtmehr in seinen Unterlagen findet.«
»Na, super«, sagte Freeman.
»Viel hätten wir damit sowieso nicht anfangen können, nicht bei dem Zustand des Gebisses. Womit wir auch gleich beim nächsten Punkt wären: Unser Opfer wurde gleich zweimal brutal angegangen – einmal davon vermutlich erst nach ihrem Tod.«
»Will sagen?«
»Die schweren Verletzungen im Gesicht lassen vermuten, dass jemand ihr im wahrsten Sinne des Wortes den Schädel eingeschlagen hat – wie es aussieht, mit den bloßen Händen. Da steckte eine unglaubliche Aggression dahinter. Und mit großer Wahrscheinlichkeit ist unser Täter Linkshänder, denn die Verletzungen konzentrieren sich vor allem auf die rechte Gesichtshälfte. An den Zähnen habe ich allerdings Spuren gefunden, die von einem stumpfen, glatten Gegenstand stammen könnten, vermutlich einem Hammer.«
»Jemand hat also versucht, eine Identifizierung des Opfers zu verhindern?«
»Sieht so aus«, meinte Tom. »Nur haben der oder die Täter dabei keine ganze Arbeit geleistet. Einige Zähne lagen lose neben der Leiche in der Erde, als wären sie ihr erst dort, im Wald, ausgeschlagen worden. Da war unser Mörder ein bisschen nachlässig. Oder er wollte schnell wieder weg.«
Freeman seufzte. »Also nichts, womit ich Ray Thorley Gewissheit geben könnte?«
»Tut mir leid, aber ich habe ja kaum Material, das zur Identifikation taugt. Oder … Moment, der gebrochene Arm. Aber eine Überprüfung ihrer Krankenakte hat hier ebenfalls keinen Treffer gebracht, was aber wiederum nichts heißen muss. Wenn sie sich den Bruch eingehandelt hat, als sie gerade mal wieder von zu Hause ausgerissen und untergetaucht war, wurde der vielleicht nie richtig behandelt.«
»Und ihr Vater weiß dann vermutlich auch nichts davon«, schloss Freeman resigniert. »Okay. Danke, Tom.« Sie legte auf und wünschte sich, sie hätte Ray Thorley nicht schon so früh in die Ermittlungen mit einbeziehen müssen. Hätte nicht bei ihm vor der Tür stehen und alte Wunden aufreißen müssen, ohne einen abschließenden Beweis dafür zu haben, dass es sich bei der Toten tatsächlich um seine Tochter handelte. Aber nachdem an die Presse durchgesickert war, dass sich in der Trainingsjacke des Opfers ein Ausweis befunden hatte, war ihr keine andere Wahl geblieben. Wenigstens die Goldkette hatten sie nicht erwähnt. Eine Information, die sie ihnen voraushatte. Denn bereits jetzt ging der Tenor der Berichterstattung dahin, dass die Polizei Emma Thorley und ihren Vater damals im Stich gelassen hatte. Und wenigstens das sollte ihr später niemand vorwerfen können.
Freeman schaute erneut zur Uhr. Ihr knurrte der Magen, und jetzt bereute sie es, ohne Frühstück aus dem Haus gehetzt zu sein, aber um sechs Uhr morgens hatte sie einfach noch nichts hinunterbekommen. Sie griff nach ihrem Handy und suchte die Nummer ihrer Ärztin heraus, ließ den Finger einen Moment über der Wahltaste kreisen, ehe sie das Telefon vor sich auf den Schreibtisch warf und sich wieder den Unterlagen zuwandte, die sie sich zum Fall Emma Thorley herausgesucht hatte. Ihr eigener Kram konnte warten.
Emmas Vater hatte seine Tochter insgesamt drei Mal als vermisst gemeldet. Das erste Mal im Februar 1999, doch der Fall galt als erledigt, als Emma einen Monat später von sich aus nach Hause zurückkehrte. Ein weiteres Mal im April, aber hier wurde die Anzeige schon kurz darauf von ihrem Vater selbst zurückgezogen. Und schließlich im Juli desselben Jahres, als Emma endgültig verschwand. Ray Thorley hatte zu Protokoll gegeben, dass Emmas Probleme nach dem Tod seiner Frau begonnen hätten. Emma war damals fünfzehn, und der Verlust ihrer Mutter war ein schwerer Schlag für sie. Vorher hatte sie nie Schwierigkeiten gemacht. Sie lernte fleißig für die Schule, war zwar keine Einser-Schülerin, aber sie gab sich Mühe. Sie war eher still und zurückhaltend und hatte wohl auch ein paar Freundinnen, mit denen sie sich allerdings nur selten außerhalb der Schule traf. Ihr großer Traum war es, später zu studieren. Darauf hatte Ray lange gespart. Am Ende gab er das gesamte Geld für die Suche nach seiner vermissten Tochter aus, steckte es in Plakate, auf denen »Wer hat dieses Mädchen gesehen?« stand.
Freeman lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Es war schon seltsam, wie die Dinge, wie Menschen sich entwickeln konnten. Wie sich von einer Minute auf die andere alles verändern konnte. Wie Menschen, die man zu kennen glaubte, denen eine gute, vielversprechende Zukunft sicher schien, einem von einem Augenblick auf den anderen entgleiten konnten, wie sie abstürzten oder einfach verschwanden – wenn sie kaum noch wiederzuerkennen waren, wenn aus Menschen plötzlich Monster wurden.
Sie holte tief Luft. Nein, darauf würde sie sich nicht mehr einlassen. Sie wollte nicht mehr an ihn denken. Es tat zu weh. Er hatte seinen Weg gewählt, und sie konnte nichts mehr für ihn tun. Niemand konnte mehr etwas für ihn tun. Er war fort, für sie verloren. Und sie hoffte, dass er endlich seinen Frieden gefunden hatte.
DC Bob McIlroy kam ins Büro getrampelt und grüßte lauthals quer durch den Raum. Der Mann besaß einfach keinen Lautstärkeregler. Ohne auf sein übliches »Morgen, Nana« einzugehen – so nannte er sie wegen ihrer Brille (die aber, wie sie fand, kein bisschen der von Nana Mouskouri ähnelte) –, schaute sie nur kurz auf, als er an ihrem Schreibtisch vorbeiging, sah, wie seine Hemdknöpfe sich über seiner dicken Wampe spannten, und wandte sich leicht angewidert wieder Emma Thorley zu.
Eilig überflog sie die Berichte, bis sie schließlich das Gesuchte fand: den Namen des Detectives, der damals die Ermittlungen geleitet hatte, ein DC Michael Gardner.
»Hey, Bob«, rief sie, und McIlroy drehte sich sichtlich erstaunt um, dass sie mit ihm sprach.
»Was?«, fragte er und zog ein Päckchen Kaugummi aus seiner Tasche. Seit ihm jemand gesagt hatte, sein Atem würde nach verfaulten Eiern stinken, kaute er ständig Kaugummi. Geholfen hatte es nichts.
»Kennen Sie einen Ermittler namens Michael Gardner?« McIlroys Miene verdüsterte sich. »Ich deute das mal als ein Ja«, fuhr sie fort. »Ist wohl ein alter Freund von Ihnen, was?«
McIlroy schnaubte. »Bestimmt nicht. Warum? Wozu wollen Sie das wissen?«
»Weil ich mit ihm sprechen muss«, sagte sie. »Wo finde ich ihn?«
»Der ist nicht mehr da«, kam es von McIlroy.
»Im Ruhestand?«
»Nö, versetzt.«
»Ah. Und wohin?« Meine Güte, alles musste man dem Kerl aus der Nase ziehen!
»Keine Ahnung. Ist mir auch egal.«
»Was hat er Ihnen denn Schlimmes getan? Sich über die kahle Stelle an Ihrem Hinterkopf lustig gemacht?«
Sie sah, wie McIlroys Brust sich hob und senkte – ein sicheres Zeichen dafür, dass es in ihm tobte. Dieser Gardner musste sich ganz schön was geleistet haben, denn so leicht wurde McIlroy nicht wütend; Wut verbrauchte unnötig Energie, die er lieber aufs Essen verwandte.
»Er hat einen Kollegen reingeritten«, sagte er, winkte dann aber ungeduldig ab. »Nein, streichen Sie das. Er hat einen Kollegen umgebracht, so muss man das sagen.« Kopfschüttelnd wandte er sich ab und ging davon.
Freeman schaute ihm ungläubig hinterher. Gardner hatte einen anderen Polizisten umgebracht? Sie sah, wie McIlroy stehen blieb und etwas zu Fry sagte, mit dem er nach Feierabend gern noch einen trinken ging. Fry drehte sich zu Freeman um und brummelte etwas vor sich hin, das zweifelsohne wenig schmeichelhaft war.
Interessant, dachte sie. Was war da bloß mit diesem Michael Gardner passiert?
2
14. Januar 1999
Lucas steckte sich das Geld hinten in die Hosentasche und schaute dem miesen kleinen Penner nach, der mit seinem Stoff abzog. Er hasste diese Kaschemme und die Schwachköpfe, die sich hier rumtrieben. Am liebsten hätte er seine Deals draußen durchgezogen, auf der Straße, aber seinen Kunden schien das abgeranzte Ambiente zu gefallen, Biermief und alles. Zeit für einen kleinen Tapetenwechsel. Er trank sein Glas leer und schubste es den Tresen runter zu Tony, der sofort nachfüllte. Unbegrenzter Nachschub, immerhin. Ein Vorteil, wenn man in einem Pub arbeitete, der einer lahmen Lusche wie Tony gehörte.
Lucas schaute sich um. Es kotzte ihn an, dass hier im Januar immer noch schäbiger Weihnachtsflitter in den Ecken rumhing. Es kotzte ihn an, dass jeden Abend dieselben blöden Arschgesichter aufkreuzten, immer in der Erwartung, dass sich was verändert hätte, dass es mal was Neues gäbe. Gab es aber nicht. Und am meisten kotzte ihn an, dass er immer noch hier, dass er einer von ihnen war.
»Und, was geht, Lucas?«
Er drehte sich um und sah Jenny Taylor auf sich zu wanken. Sie war die dreckigste Schlampe in Blyth und stellte ihm dauernd nach, das alte Miststück.
»Verpiss dich«, sagte er, als sie sich an ihn ranhängte, sich sein Glas schnappte und einen kräftigen Schluck nahm, ehe sie es ihm wieder in die Hand drückte. »Scheiße, Mann«, murmelte er und stieß das Glas angewidert weg. Tony kapierte den Wink und zapfte ihm ein neues.
»Willse mit mir aufs Klo kommen?«, lallte Jenny.
Lucas stieß sie weg, und sie kippte nach hinten auf den klebrigen Boden. Er stieg über sie rüber und ging weiter zum Billardtisch, wo Dicko gerade ordentlich abräumte. Lucas sah, wie dem Typen sein selbstgefälliges Grinsen verging, als ihm klar wurde, dass alles, was er hier gewann, in Lucas’ Tasche wandern würde, nicht in seine.
Irgendwer hatte einen Packen Kippen liegen lassen. Lucas nahm sich eine, zückte sein Feuerzeug und ließ dann beides in seiner Tasche verschwinden. Draußen sah er ein Mädchen über die Straße kommen – den Kopf gesenkt, die Ärmel ihres Pullis über beide Hände gezogen.
Das arme Schwein, das sich gerade von Dicko ausnehmen ließ, bat Lucas höflich, ein Stück zur Seite zu gehen, damit er seinen Stoß ausführen konnte. Lucas ignorierte ihn. Eben war ihm wieder eingefallen, wer das Mädel war. Vor ein paar Tagen war sie mit Tomo hier gewesen. Hatte kein Wort gesagt, einfach nur dagestanden und auf den Boden gestarrt. Sah noch ziemlich jung aus, die Kleine, aber Tomo meinte, sie wäre im selben Jahrgang wie er – Freiwild also. Hatte sich dauernd die blonden Haare hinter die Ohren gestrichen, waren ihr aber immer wieder ins Gesicht gefallen. Wenigstens war sie echt blond, nicht so wie die anderen Schnallen, die er kannte. Er hatte gehofft, sie würde noch länger bleiben, aber sie müsse nach Hause, hatte sie gesagt. Die ganze Nacht hatte er an sie denken müssen. Hatte Tomo sogar gefragt, wo sie wohnte. Und hier war sie wieder. Lucas grinste.
Er stieß die Tür auf und ging nach draußen. Mitten auf dem Gehsteig blieb er stehen und beobachtete sie. Fast wäre sie mit ihm zusammengestoßen, bevor sie merkte, dass da jemand war.
»Tschuldigung«, murmelte sie und versuchte ihm auszuweichen.
»Hey, wir kennen uns doch … Du bist Emma, oder?«
Sie blieb stehen und schaute nervös die Straße rauf und runter, als sollte sie überhaupt nicht hier sein. Schon gar nicht mit ihm.
»Ich hab dich neulich gesehen«, sagte Lucas. »Mit Tomo.«
Emma nickte und starrte wieder auf den Boden.
»Willst du was trinken?«
Sie schüttelte den Kopf. Lucas trat ganz dicht vor sie, und endlich schaute sie ihn an. »Komm schon«, sagte er. »Ist nicht gut, so allein hier draußen. Da treiben sich ziemlich üble Typen rum. Komm, nur kurz was trinken, dann bringe ich dich nach Hause – versprochen.« Er lächelte und sah, wie sie weich wurde. »So ist’s gut«, sagte er.
Sie setzten sich ganz nach hinten. Jedes Mal, wenn jemand in ihre Richtung kam, hielt er sie mit Mörderblicken auf Abstand. Geschlossene Gesellschaft. Als sie mit ihrem dritten Glas halb durch war, hatte sie noch immer nicht viel gesagt, aber gelächelt, immerhin.
»Diesmal gleich zwei Doppelte«, sagte Lucas an der Theke zu Tony, ehe er sich wieder zu ihr umdrehte. »Verdammte Fotze«, murmelte er und marschierte zurück an ihren Tisch. Jenny hatte sich vor Emma aufgebaut, stierte ihr voll ins Gesicht.
»Hassu mich verstanden, Schlampe?«, brüllte Jenny, und Emma nickte. Lucas packte Jenny von hinten und zerrte sie weg, stieß sie gegen den Spielautomaten, dass es krachte. Ihre Haare fielen ihr ins Gesicht – blond, wie Emmas. Aber nicht echt, bloß gebleicht. Voll versifft halt.
»Wenn du noch einmal mit ihr redest, schlag ich dir deine scheißverfickte Fresse ein, klar?«, zischte Lucas ihr ins Gesicht. Dann schob er sie weg und ging wieder zu Emma. »Alles klar?«
Emma nickte, aber er merkte, dass sie gehen wollte. »Tut mir leid. Die hat echt einen an der Klatsche.« Lucas streckte seine Hand nach ihr aus. »Komm«, sagte er. Emma stand auf und nahm seine Hand. Er führte sie nach draußen, vorbei an Jenny, die sie beide fies anstarrte, aber keinen Mucks von sich gab. Doch nicht so blöd, wie sie aussah.
Draußen sah er, wie Emmas Wangen sich in der kalten Luft röteten. Sie stolperte, weil der Alkohol jetzt voll einschlug, und er hielt ihre Hand ganz fest. »Komm, wir gehen zu mir«, sagte er. »Ist näher.«
3
13. Dezember 2010
Lucas stand an der Straßenecke und beobachtete das Haus. Er hatte befürchtet, dass Reporter sich hier herumtreiben könnten, es war aber kein Mensch zu sehen. Vielleicht waren sie auch einfach wieder abgehauen. Konnte man ihnen echt nicht verübeln, bei dieser Kälte. Niemand zu sehen außer einem alten Muttchen, das seinen Hund ausführte, der genauso senil aussah wie sie. Hatte sich nicht viel verändert in den letzten elf Jahren, schon gar nicht zum Besseren. Wer damals kein Geld hatte, hatte jetzt wahrscheinlich noch weniger. Die Gegend war nur noch weiter heruntergekommen. Abgewrackte Rostlauben standen auf Ziegelsteine aufgebockt, und in den Vorgärten türmte sich irgendwelcher alter Schrott. Die Häuser waren das reinste Flickwerk, nichts passte zusammen. Rauputz und Waschbeton, billig und hässlich. Dafür war es ruhig, fast wie ausgestorben. Zu seiner Zeit, als er dauernd hier gewesen war, um ein Auge auf Emma zu haben, hatten sich die kleinen Rotznasen alle noch draußen herumgetrieben. Ihn wegen Stoff angehauen oder gebettelt, dass er ihnen Alk im Eckladen besorgte. Nervig. Jetzt hingen wahrscheinlich alle bloß noch zu Hause rum.
Genau hier an dieser Stelle hatte er gestanden und darauf gewartet, dass sie endlich rauskam. Er wusste, dass sie da war, denn manchmal hatte er sie oben am Fenster gesehen, hatte gesehen, wie sie zu ihm rausschaute und wusste, dass er sie beobachtete. Und zu wissen, dass sie es wusste, hatte ihm ein gutes Gefühl gegeben, ein verdammt gutes Gefühl.
Er hatte lange überlegt, ob es schlau war, sich nach all den Jahren ausgerechnet jetzt hier blicken zu lassen. Aber er musste wissen, ob ihr Vater ihn erkennen würde. Ob er von dem Alten etwas zu befürchten hätte, wenn die Bullen bei ihm aufkreuzten. Begegnet waren sie sich zwar nie, aber so oft wie er hier vor dem Haus herumgestanden hatte, war es durchaus möglich, dass der Alte sich an sein Gesicht erinnerte.
Lucas taxierte das Haus. Alles wie damals. Ob es drinnen auch noch genauso aussah? Ob Emmas Zimmer noch so aussah, wie er es kannte, alles unverändert? Eigentlich war er nur zweimal oben in ihrem Zimmer gewesen – einmal, als ihr Dad nicht zu Hause war, und einmal, als beide nicht da waren. Er war rauf in ihr Zimmer gegangen, hatte sich auf ihr Bett gelegt und getan, was ein Mann im Bett seiner kleinen Teenie-Braut halt so tut. Er hätte wirklich gern ihr Gesicht gesehen, hätte zu gern gewusst, wie sie sich gefühlt hatte, als sie sein kleines Souvenir fand.
Die Frau mit dem Hund schlurfte an ihm vorbei und überquerte die Straße. Endlich. Eigentlich war er heute aus zwei Gründen gekommen: zum einen, weil er wissen wollte, ob Thorley ihn noch erkannte, vor allem aber, weil er ins Haus wollte, ihre Sachen sehen wollte, sie sehen musste.
Er rückte seine Krawatte zurecht und überlegte kurz, ob er sie abnehmen sollte. Emmas Dad würde kaum damit rechnen, dass seine Tochter einen so seriösen Freund gehabt hatte, oder? Sie war ein kleiner Junkie gewesen, eine Ausreißerin. Aber egal, jetzt hatte er schon geklopft. Er wippte mit dem Fuß, während er wartete; schließlich sah er durch das Türglas die verschwommenen Umrisse einer Gestalt durch den düsteren Flur kommen. Lucas atmete tief durch und setzte sein bestes Sonntagsgesicht auf, als die Tür aufging.
Ein alter Mann in einer schäbigen braunen Polyesterhose und beigefarbener Strickjacke stand leicht gebeugt vor ihm. Lucas wusste nicht, was er erwartet hatte, aber das nicht. Keinen rotgesichtigen Rentner, dem noch die Essensreste von letzter Woche auf dem Hemd klebten.
Ray Thorley blickte erwartungsvoll zu ihm auf. Dachte er etwa, Lucas wäre von der Polizei?
»Mr Thorley?«
»Ja. Geht es um Emma? Gibt es Neuigkeiten?«
Lucas lächelte den Alten an und machte einen Schritt auf ihn zu. »Dürfte ich hereinkommen?«
Ray trat beiseite und winkte Lucas ins Haus. »Haben Sie etwas gehört?«, fragte er, als er die Tür hinter ihm schloss.
Lucas ging durch ins Wohnzimmer und warf einen kurzen Blick auf die vielen Fotos seiner kleinen Fickfreundin, die überall herumstanden. »Darf ich mich setzen?«, fragte er, während er genau das tat. Ray blieb stehen und schien darauf zu warten, dass sein Besucher etwas sagte. »Mr Thorley, ich möchte Ihnen mein Beileid aussprechen …«
Worauf der Alte mit einem Geräusch, als würden alle Lebensgeister ihn verlassen, in seinen Sessel sackte. »Dann ist sie es also«, flüsterte er.
Hitze durchströmte Lucas. Die Polizei war sich demnach nicht sicher, ob es sich wirklich um Emma handelte. War das jetzt gut für ihn oder nicht? In den Nachrichten hatten sie noch keine Bestätigung gebracht, aber Lucas hatte angenommen, die Bullen würden Informationen zurückhalten, weil sie sich nicht in die Karten schauen lassen wollten. Aber vielleicht hatten sie echt keinen Schimmer. Vielleicht würden sie doch nicht bei ihm auf der Matte stehen und blöde Fragen stellen.
Lucas schaute Ray Thorley an, der auf irgendeine Antwort zu warten schien. »Ich fürchte, hier liegt ein Missverständnis vor. Emma und ich waren befreundet. Ist lange her. Aber ich war fassungslos, als ich davon hörte.«
Ray zeigte mit zittriger Hand auf Lucas. »Sie sind gar nicht von der Polizei?«
»Nein«, erwiderte Lucas. »Erinnern Sie sich nicht mehr an mich?«
»Tut mir leid, mein Junge, nein.« Ray musterte Lucas’ Gesicht und schüttelte dann den Kopf. »Nein, wirklich nicht.«
Lucas musste sich ein Grinsen verkneifen. »Ich war ein Freund von Emma, aus der Schule.«
»Ah ja«, sagte Ray. »Natürlich.«
Lucas lehnte sich vor. »Noch einmal mein aufrichtiges Beileid, Mr Thorley.« Er stand auf. »Hätten Sie was dagegen, wenn ich kurz Ihre Toilette benutze?«
Ray schüttelte wieder den Kopf und deutete zur Treppe. Lucas nickte, schloss die Wohnzimmertür hinter sich und sprintete nach oben. Sofort fiel sein Blick auf dieses blöde Schild an ihrer Zimmertür.
HIER WOHNT EMMA – ZUTRITT VERBOTEN!
Hing das immer noch da, so ein trashiges Souvenirding aus irgendeinem bekackten Küstenkaff, Whitley Bay oder Scarborough. Damals war es ihm auch gleich aufgefallen; ihr war es peinlich gewesen. Eine Ecke, an der sie versucht hatte, es abzuziehen, wellte sich lose nach oben. Lucas stieß die Tür auf und ging rein. Nichts hatte sich verändert, außer dass es ein bisschen muffig roch, abgestanden. Wie der Karton mit Weihnachtskugeln, wenn man ihn vom Speicher holte. Der Geruch von billigem Deospray war längst verflogen.
Lucas setzte sich aufs Bett. Er musste daran denken, wie er sie berührt hatte. Wie sie vor ihm zurückgewichen war, weil sie Angst hatte, ihr Dad könnte früher nach Hause kommen und sie hören. Von wegen böses Mädchen – sie wär gern eins gewesen, hatte es aber nie richtig durchgezogen.
Sein Blick fiel auf das Brett am Kopfende, noch immer vollgeklebt mit Stickern von den Spice Girls und Take That. Ein paar Aufkleber hatte sie versucht abzuziehen, weil ihr Musikgeschmack sich geändert hatte. Oder weil er sich darüber lustig gemacht hatte. Er sah sie noch vor sich, wie sie dasaß, ans Kopfende gelehnt, und sich fragte, ob es vielleicht ein Fehler gewesen war zu sagen, sie hätte das alles so satt und wollte nur noch weg.
Lucas stand auf und ging zum Fenster. Es hatte wieder angefangen zu regnen, kalter Schneeregen, der über die Straße trieb. Auf dem Fensterbrett stand eine bunte Pappschachtel. Er machte sie auf, kramte in billigem Schmuck und Münzgeld, bis er die Kette mit dem silbernen Anhänger fand, die er ihr geschenkt hatte. Die Kette, die sie nicht hatte tragen wollen. Er schlang sie sich um die Finger, spürte das Metall kalt auf seiner Haut und ließ sie in seiner Hosentasche verschwinden.
Im Wohnzimmer rührte sich etwas, der Alte schien aufzustehen. Schnell klappte Lucas den Deckel zu, schlüpfte aus dem Zimmer und ging wieder nach unten zu Emmas Vater, der nun vor dem Kamin stand und ein Foto in der Hand hielt, das die Familie im Urlaub zeigte. Dass Lucas zurückgekehrt war, schien er gar nicht zu merken.
Lucas räusperte sich. »Tut mir leid, dass ich einfach so hereingeschneit bin«, sagte er, als Ray sich umdrehte. »Ich wollte Sie nicht aufregen.«
Ray schüttelte den Kopf. »All die Jahre … Und dabei habe ich nie geglaubt, dass sie tot sein könnte. Das hätte ich gewusst, dachte ich immer. Ich hätte es gespürt, hier«, sagte er und hob seine zittrige Hand ans Herz. Dann schweifte er wieder ab und schaute auf die Uhr über dem Kamin. Lucas schaute ebenfalls auf die Uhr, die aber entweder völlig falsch ging oder längst stehen geblieben war. Er überlegte, wie lange er sich das Gequatsche anhören sollte, ehe er sich vom Acker machen konnte. »Selbst nachdem er nicht gekommen war, dachte ich, dass sie vielleicht …«
»Er?« Lucas horchte auf. Hatte Emma einen anderen gehabt?
Ray hatte den Faden verloren und runzelte die Stirn.
»Sie meinten eben, nachdem er nicht gekommen war«, half Lucas ihm auf die Sprünge. Oh Mann, bestimmt war der Alte auch schon senil.
Ray nickte langsam und zeigte mit unsicherer Hand auf Lucas. »Ja, ja. Der Mann, der früher schon mal hier war. Er kam her, um mir zu sagen, dass es Emma gut gehe. Er hat ihr geholfen.«
»Wer?«, fragte Lucas.
»Er kam vorbei und sagte, es geht ihr gut und sie kann bald wieder nach Hause kommen. Ein netter junger Mann, sehr freundlich. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen, hat er gemeint. Ich dachte, es wäre so wie beim ersten Mal, aber dann hat er mir einen Brief von ihr gebracht. Wenn ich nur wüsste …« Ray schaute sich um, als überlegte er, wo er den Brief gelassen hatte. »Und dann, beim letzten Mal … Ich habe gewartet und gewartet, aber es kam niemand. Da dachte ich mir schon, dass ihr bestimmt etwas passiert war, etwas Schlimmes. Aber ich habe nichts gespürt, wissen Sie? Ich dachte immer, ich würde es merken, wenn meiner Emma etwas zustößt, aber ich habe nichts gespürt. Ich dachte …«
»Wer war er? Der Mann, der vorbeigekommen ist?«
»Oh, ich …« Ray schüttelte den Kopf und tippte sich mit den Fingern an die Lippen. »Ach, wie hieß der noch gleich? Verflixt aber auch. Daran sollte ich mich wirklich erinnern.« Wieder schüttelte er den Kopf. »Er war von dieser Klinik. Er hat ihr geholfen … bei ihrem Problem.«
Lucas spürte, wie etwas in ihm aufwallte. Er war hier gewesen, hier in ihrem Haus. Wo war er sonst noch gewesen, der Scheißkerl? Was wusste er alles?
Ray schüttelte erneut den Kopf, als könnte er so seine Erinnerungen wachrütteln. Lucas hatte genug, er reichte Ray die Hand. »Noch mal mein Beileid wegen Ihrer Tochter«, sagte er, und Ray dankte ihm. Das Laufen fiel ihm sichtlich schwer, als er seinen Besucher zur Tür brachte. Lucas verabschiedete sich und sah zu, dass er wegkam.
»Ben!«, rief Ray hinter ihm, als er schon fast an der Straße war; Lucas drehte sich um. »Der Mann von der Klinik. Er hieß Ben.«
Aber Lucas wusste längst, von wem die Rede war. Er kannte diesen kleinen Wichser, der sich wie ein übler Geruch an Emma gehängt hatte, der ständig versucht hatte, sie beide auseinanderzubringen. Aber wie viel wusste er tatsächlich?Vielleicht sollte er sich ja mal wieder beim lieben Ben melden.
4
13. Dezember 2010
Gardner kniff ein Auge zu und zielte mit einem kleinen Papierkügelchen auf DC Don Murphy. Zugegeben, man musste kein Scharfschütze sein, um das Ziel zu treffen, Murphy bot reichlich Angriffsfläche. Aber die Regeln galten trotzdem: ein Punkt für den Bauch (kaum zu verfehlen), zwei für die Stirn und drei für den Mund (Volltreffer). Gardner peilte volle Punktzahl an. Er warf und sah das Papiergeschoss quer durchs Büro fliegen, bis es genau in Murphys offenem Mund landete. Murphy hustete und setzte sich mit einem Ruck auf. Gardner riss triumphierend die Arme hoch, auch wenn DC Carl Harrington sofort versuchte, einen Regelverstoß geltend zu machen. PC Dawn Lawton schaute kurz von ihrem Schreibtisch auf, lächelte über Murphy, der gutmütig den erbosten Bären mimte, und vertiefte sich dann erneut in was auch immer sie gerade beschäftigte. Wenigstens eine, die arbeitete. Normalerweise hätte Gardner Murphy einen Rüffel erteilt, ihm gesagt, dass er nicht auf der faulen Haut liegen, sondern arbeiten solle, doch die Wahrheit war, dass es im Augenblick keine Arbeit gab. Zumindest nichts Richtiges, keinen laufenden Fall. Aber aus Angst, irgendetwas heraufzubeschwören, wenn er es laut aussprach, hielt er lieber den Mund.
»Sollte ich echt mal der Personalstelle melden«, murrte Murphy und trollte sich zum Wasserkocher.
»Wenn ich richtig gerechnet habe, führe ich jetzt mit zehn Punkten Vorsprung«, meinte Gardner zu Harrington.
»Neun«, gab der zurück.
»Neun, meinetwegen. Soll mir auch reichen.«
Das Telefon klingelte. Harrington zeigte sich kollegial und nahm ab, schließlich wollte er kein schlechter Verlierer sein. Gardner rätselte derweil, womit Lawton sich so fleißig befasste. Der letzte große Fall, den sie hatten, war eine vermisste Jugendliche, die ihren getrennt lebenden Eltern gesagt hatte, sie würde das Wochenende beim jeweils anderen verbringen, und derweil mit einem ihrer Lehrer durchgebrannt war. Nichts deutete darauf hin, dass sie zu irgendetwas gezwungen worden war, aber heikel war die Angelegenheit dennoch, denn das Mädchen war erst vierzehn. Danach nur noch Routinesachen, die binnen weniger Tage gelöst und erledigt waren. Nichts, in das man sich so richtig verbeißen konnte. Aber nach einem Fall wie dem von Abby Henshaw, der ihn – wenn auch mit Unterbrechungen – gut fünf Jahre beschäftigt hatte, sollte er sich vielleicht einfach freuen, wenn die Dinge sich so leicht klären und aus der Welt schaffen ließen.
Gardner lehnte sich in seinem Stuhl zurück und spürte, wie sein kurzfristiges Stimmungshoch wieder abflaute. Er sollte langsam aufhören, an Abby Henshaw zu denken. Es war Wochen her, dass sie zuletzt miteinander gesprochen hatten, vielleicht sogar Monate. Der Fall war erledigt, er hatte seinen Job gemacht. Es war an der Zeit, gedanklich damit abzuschließen, sich etwas Neuem zuzuwenden. Und genau das versuchte er ja.
In einem Anfall geistiger Umnachtung hatte er sich bei einer Singlebörse im Internet registriert. Stundenlang hatte er an seinem Profil herumgefeilt und war dabei längst nicht so nüchtern gewesen, wie man es vielleicht sein sollte, bevor man so etwas online stellte. Ob es wirklich so eine gute Idee gewesen war, anzugeben, dass er bei der Kripo war? Und kam es womöglich einem Vertragsbruch gleich, bezüglich seiner Hobbys gelogen zu haben? Aber was hieß schon lügen – schließlich besaß er ja ein Mountainbike; er benutzte es nur nie. Das Profilbild war auf jeden Fall ein Fehler gewesen. Er bereute schon jetzt, es eingestellt zu haben – und das, obwohl er darauf zehn Jahre jünger war. Oder vielleicht gerade deshalb. Denn fairerweise musste man sagen, dass das längst überholte Profilbild weniger seiner Eitelkeit geschuldet war als der Tatsache, dass ihn seit zehn Jahren niemand mehr fotografiert hatte und er einfach kein neueres Foto besaß. Nachdem er sein Profil freigeschaltet hatte, bekam er plötzlich Panik, dass jemand, den er kannte, es sehen und sofort wissen würde, was für ein Versager er war. Aber dann versuchte er sich mit dem Gedanken zu beruhigen, dass jeder, der sich auf dieser Seite herumtrieb, ihm in dieser Hinsicht in nichts nachstand.
Und obwohl sich noch kein nennenswerter Erfolg abzeichnete und die einzige in den drei Wochen seit seiner Registrierung an ihn gerichtete Anfrage von einer Frau in mittleren Jahren kam, die als Hobby »Mützenstricken für meine Katzen« angab, war er regelrecht süchtig danach, sein Profil regelmäßig auf neue Nachrichten zu prüfen. Auch jetzt juckte es ihn wieder in den Fingern. Aber wollte er riskieren, dass ihm einer der Kollegen über die Schulter schaute – Carl Harrington womöglich? Der Spott würde ewig an ihm kleben bleiben. Da könnte er sich gleich versetzen lassen.
»He, Champion«, rief Harrington und hielt den Hörer hoch. »Ist für Sie. Eine DS Freeman aus Blyth.«
Einen Moment schien die Zeit stillzustehen. Gardner kam es vor, als würden alle ihn anstarren und auf seine Reaktion warten. Wie konnte ein einziges Wort – das B-Wort – sich nach all den Jahren noch immer anfühlen wie ein Schlag in die Magengrube?
Sein eigenes Telefon klingelte, und Harrington bedeutete ihm, dass er abnehmen sollte. Aber er wollte nicht. Ja, es war kindisch, aber er wollte nicht, und niemand konnte ihn dazu zwingen. Was ging ihn Blyth an? Er wollte mit niemandem von dort reden, wollte sich da nicht wieder mit hineinziehen lassen.
Sein Telefon klingelte unvermindert, und mittlerweile starrten ihn tatsächlich alle an. Seufzend hob er den Hörer ab.
»Gardner.« Detective Sergeant Freeman stellte sich kurz vor, und Gardner erinnerte sich, ihren Namen in den Nachrichten gehört zu haben; er konnte sich natürlich denken, was sie von ihm wollte. Allerdings wusste er nicht, wie er ihr hätte helfen können. Wüsste er irgendetwas Erhellendes zum Fall Emma Thorley beizutragen, hätte er den Fall vermutlich schon vor elf Jahren gelöst.
Nachdem alle Fragen erschöpfend geklärt waren und DS Freeman sich endlich verabschiedete, musste Gardner erst mal tief durchatmen. Harrington schien zu einer zweiten Runde aufgelegt zu sein, aber ihm war plötzlich die Lust vergangen.
Gardner ging auf die Webseite der BBC und las sich den aktuellen Bericht über den Leichenfund in Blyth durch. Noch immer war nicht bestätigt, dass es sich um Emma Thorley handelte, aber Freeman hatte durchblicken lassen, dass alles darauf hindeutete. Das würde heißen, dass sie vermutlich die ganze Zeit dort im Wald gelegen hatte. Wahrscheinlich war sie bereits tot gewesen, während Gardner ihren Vater noch damit zu beruhigen versuchte, dass seine Sorge gewiss unbegründet sei und Emma schon wieder nach Hause käme. Sie würde zurückkehren, wenn sie dazu bereit war, genau wie auch schon die beiden Male zuvor. Aber sie war nie zurückgekehrt.
Er fragte sich, was besser wäre: Dass es sich bei der Toten um Emma Thorley handelte, damit ihr Vater nach all den Jahren endlich mit dem Verlust seiner Tochter abschließen konnte – oder dass sie es nicht wäre und noch immer Hoffnung bestand.
Gardner schloss einen Moment die Augen. Wäre er damals nicht so sehr mit seinen eigenen Problemen beschäftigt gewesen, hätte er dem Fall mehr Aufmerksamkeit geschenkt. So blieb immer das ungute Gefühl, das Mädchen vor elf Jahren im Stich gelassen zu haben.
5
12. Juli 1999
DC Gardner versuchte, sich seine Ungeduld nicht anmerken zu lassen, während Ray Thorley in einer alten Keksdose nach Fotos seiner Tochter suchte.
»Ich müsste hier irgendwo noch ein neueres haben«, sagte Ray und wühlte sich weiter durch Erinnerungen an Ferien im Wohnwagen und Geburtstage, bei denen jeweils die Torte die Hauptrolle zu spielen schien.
Gardner betrachtete das halbe Dutzend Bilder von Emma, die ihr Vater ihm bereits in die Hand gedrückt hatte. Die meisten waren schon ein paar Jahre alt – Emma mit dreizehn, vierzehn. Auffällig war allenfalls, dass sie mehr lächelte, als die meisten Teenager es für gewöhnlich auf Fotos mit ihren Eltern tun. Die Bilder zeigten ein hübsches Mädchen, das für sein Alter allerdings sehr jung wirkte.
»Hier, das ist vom letzten Jahr«, sagte Ray und reichte ihm ein weiteres Bild. Gardner nahm es in die Hand und bemerkte sofort den deutlich gesunkenen Glückspegel. Verständlich: Emma saß am Krankenhausbett ihrer Mutter und hielt deren Hand.
»Gut, vielen Dank«, sagte er und legte die Sammlung auf dem Couchtisch ab. »Mr Thorley, ich würde Ihnen jetzt gern noch ein paar Fragen zu Emmas Freund stellen, Lucas Yates.«
»Er war nicht ihr Freund«, erwiderte Ray ungewöhnlich scharf. »Entschuldigen Sie, aber dieser Junge war nicht ihr Freund. Das stimmt nicht.«
»Okay, dann berichtigen Sie mich bitte, wenn ich etwas falsch verstanden haben sollte. Als Sie Emma das erste Mal als vermisst gemeldet haben – das war im Februar –, war sie bei Lucas Yates untergetaucht. Stimmt das so oder nicht?«
Ray nickte unwillig. »Ja, aber jetzt ist sie nicht bei ihm, falls Sie darauf hinauswollen.«
»Was macht Sie da so sicher?«
»Weil sie sich in letzter Zeit nicht mehr mit ihm getroffen hat. Sie wollte ihn nicht mehr sehen. Er war nicht sehr nett zu ihr.«
»Was meinen Sie mit ›nicht sehr nett‹?«
»Ich weiß es nicht«, erwiderte Ray mit brüchiger Stimme und Tränen in den Augen. »Über solche Dinge hat sie mit mir nicht geredet. So was hat sie immer mit ihrer Mum besprochen. Aber ich kenne meine Emma. Sie ist nicht dumm und hätte sich nicht mehr mit jemandem wie ihm eingelassen.«
Ray Thorley hatte Gardners volles Mitgefühl. Wirklich, der Mann konnte einem nur leidtun. Er hatte vor nicht allzu langer Zeit seine Frau verloren, und wenig später war auch noch seine Tochter auf die schiefe Bahn geraten. Aber sein Kummer ließ ihn die Augen vor den Tatsachen verschließen.
»Mr Thorley, Emma hatte Drogenprobleme, oder nicht?«
»Nicht mehr. Sie hat damit aufgehört.«
»Okay, sehr schön. Allerdings ist es nicht immer ganz leicht, einfach aufzuhören. Vielleicht hatte sie ja wieder angefangen, und Lucas Yates ist uns als Dealer bekannt …«
»Nein!« Ray Thorley schloss die Augen, als wollte er auch Gardner ausblenden. Gardner wartete ein paar Minuten, dann stand er auf. Er wollte ihrem Vater seinen Glauben nicht nehmen, aber Gardner war davon überzeugt, dass man nur Lucas Yates ausfindig zu machen brauchte, um auch Emma Thorley zu finden. Bislang war seine Suche zwar erfolglos gewesen, aber irgendwann würde der Kerl schon wieder auftauchen, würde aus dem Loch hervorkriechen, in dem er sich versteckt hatte.
Emma Thorley brauchte Hilfe – das stand außer Frage. Nur handelte es sich nicht um die Art von Hilfe, an die ihr Vater dachte.
Er wartete noch einen Moment und betrachtete Ray Thorley – ein gebrochener Mann, der die Wahrheit nicht hören wollte und sich allen vernünftigen Argumenten verschloss. Es war sinnlos. Sie hätten noch den ganzen Abend so weitermachen und sich immerzu im Kreis drehen können, ohne auch nur einen einzigen Fortschritt zu erzielen. Gardner würde einfach wie geplant seine Suche nach Yates fortsetzen, aber das hatte Zeit bis morgen. Er war müde und wollte nur noch nach Hause, ein bisschen ausspannen.
Gardner wandte sich zum Gehen. »Ich melde mich«, sagte er und ließ Ray mit seinen alten Fotos und Erinnerungen zurück.
*
Gardner beförderte die Essensreste in den Küchenmüll. Langsam fragte er sich, warum er sich überhaupt noch die Mühe machte, wenn doch sowieso nichts mehr gut genug für sie war – zu salzig, zu fad, zu viel Knoblauch, zu egal was. Sie war mäkelig wie ein Restauranttester. Eigentlich könnten sie sich auch jeden Abend etwas bringen lassen, dann wäre wenigstens nicht er, sondern der Lieferdienst schuld – aber vermutlich war genau das der Punkt. Wahrscheinlich meckerte sie nur aus Prinzip, denn meistens aß sie es dann trotzdem. Heute jedoch hatte sie ihr Essen kaum angerührt. Vielleicht lag es auch gar nicht an ihm oder seinen Kochkünsten, sondern sie wollte einfach abnehmen? Immerhin hatte sie in letzter Zeit einiges an Gewicht verloren und brachte immer mehr Zeit im Fitnessstudio zu.
Er nahm eine Flasche Rotwein und zwei Gläser und ging ins Wohnzimmer, denn wenigstens am Wein fand sie nie etwas auszusetzen. Sonst saß sie um diese Zeit meist in ihre Ecke der Couch gekuschelt, wo sie sich von der Glotze berieseln ließ, doch heute war es still, und sie stand am Fenster, die Arme um sich geschlungen, als sei ihr kalt. Er sah, wie ihr Kiefer sich anspannte, als sie ihn kommen hörte. So viel zu einem ruhigen, friedlichen Feierabend, dachte er resigniert. Irgendetwas wollte sie ihm sagen. Was hatte er jetzt wieder angestellt? Im Geiste ging er seinen Tag noch einmal durch. Was mochte diesmal das Problem sein?
Sie stritten sich nie im eigentlichen Sinne des Wortes, es gab keine lauten Auseinandersetzungen zwischen ihnen, keine Wortgefechte; stattdessen gab es immer mal wieder ein paar spitze Bemerkungen und bedeutungsschwangeres Schweigen.
»Was ist los, Annie?«, fragte er und stellte Flasche und Gläser auf den Tisch, ohne sich die Mühe zu machen, Untersetzer zu holen. Sie sah es, zuckte aber nicht mal mit der Wimper. Das hätte ihn bereits stutzig machen müssen. Aber ehrlich gesagt, war ihm scheißegal, was ihr jetzt schon wieder über die Leber gelaufen war. Seufzend setzte er sich auf die alte, schon reichlich ramponierte Ledercouch. Es war ein langer Tag gewesen, und er wollte einfach nur seine Ruhe.
Sie blieb stehen, wo sie war, und er sah, dass sie mit den Tränen kämpfte. Scheiße, dachte er. Jemand gestorben, auch das noch.
Gardner beugte sich vor, um nach ihrer Hand zu greifen, aber sie entzog sich ihm und wandte sich erneut zum Fenster.
»Annie?«
»Ich treffe mich mit jemandem«, sagte sie so leise, dass es kaum mehr als ein Flüstern war. »Schon seit einiger Zeit.«
Sie traf sich mit jemandem? Was sollte das denn heißen? Musste er darüber Bescheid wissen? Hatte sie das irgendwann einmal erwähnt? »Was meinst du mit ›jemanden treffen‹? Zum Sport? Oder gehst du zu einem Therapeuten? Warum das denn?«
Sie gab einen seltsam erstickten Laut von sich, der halb Schluchzen, halb Lachen war, dann schlug sie sich die Hand vor den Mund und ließ ihren Tränen freien Lauf. Als sie sich zu ihm umdrehte, schaute sie ihn an wie einen Dreijährigen, mit dem man ganz viel Geduld haben musste.
»Nein, Michael«, sagte sie und schüttelte langsam den Kopf. »Ich gehe zu keinem Therapeuten. Ich spreche von einem anderen Mann.«
»Einem anderen Mann«, wiederholte er.
Sie nickte kaum merklich. Und plötzlich wurde ihm alles klar, alles ergab plötzlich einen Sinn und passte zusammen, wie bei einem dieser Steckwürfel für Kinder – allen war es offensichtlich, nur er, der begriffsstutzige Junge, versuchte noch immer, das eckige Klötzchen durch die kreisrunde Öffnung zu bekommen. Aber er wollte es nicht sehen, wollte es sich nicht eingestehen, als würde es dadurch weniger wahr. Doch er spürte es. Sein Körper wusste längst, was sein Verstand nicht begreifen wollte. Er spürte, wie die Erkenntnis sich schockartig in ihm ausbreitete, durch sein Blut rauschte, bis auch die letzte Zelle Bescheid wusste.
»Wer ist es?«
Gardner stand auf und trat zu ihr. Als sie vor ihm zurückwich, fragte er sich für den Bruchteil einer Sekunde, ob sie etwa dachte, er wollte sie schlagen. War es das? Glaubte sie allen Ernstes, er würde so etwas tun? Falls ja, stand es zwischen ihnen noch schlimmer als gedacht.
»Wer?«, fragte er erneut.
»Setz dich wieder. So werde ich nicht mit dir darüber reden.«
»Verdammt noch mal, nein, ich werde mich nicht wieder hinsetzen«, sagte er und spürte einen Kloß im Hals. Nicht weinen, dachte er, nicht jetzt. Er presste die Augen fest zusammen und spürte Übelkeit in sich aufsteigen. »Bitte sag mir einfach, wer es ist.« Annie wandte sich zum Gehen und wollte ohne ein weiteres Wort das Zimmer verlassen; Gardner packte sie beim Ellbogen. »Sag es mir.«
»Stuart Wallace«, stieß sie hervor und riss sich von ihm los. Dann rannte sie die Treppe hinauf.
»Stuart Wallace?«, wiederholte er ungläubig. Er war wie gelähmt. Wollte ihr nachlaufen und konnte es nicht. »Spinnst du?«, schrie er ihr hinterher. »Stuart Wallace?! Wallace ist ein absolutes Arschloch! Ein fettes, fieses Arschloch!«
Oben knallte die Badezimmertür zu, dann war nur noch sein eigener Atem zu hören. Gardner stand reglos und spürte den Boden unter sich schwanken.
Stuart Wallace. Er hatte ihn Annie sogar noch selbst vorgestellt, bei dieser dämlichen Weihnachtsfeier im frisch bezogenen Eigenheim der Wallaces, zu der er überhaupt nicht hatte gehen wollen, sich aus beruflichen Gründen aber gezwungen sah. Annie und er hatten sich noch über die Einrichtung lustig gemacht, diesen protzigen Neureichengeschmack.
Immerhin wusste er, wo Wallace wohnte.
Gardner schnappte sich seine Schlüssel vom Tisch, dann kehrte er noch einmal um, schnappte sich auch die Weinflasche und zerschlug sie an der Wand, an der die Fotos in den auf alt getrimmten Bilderrahmen hingen, die Annie unbedingt hatte haben wollen; den zerbrochenen Flaschenhals schmetterte er an die gegenüberliegende Wand.
»Schatz?«, brüllte er die Treppe hinauf, doch oben blieb es still. »Geh mal ins Wohnzimmer. Da ist ein fetter, fieser Rotweinfleck auf deinem Scheißteppich!« Damit stürmte er aus dem Haus und knallte die Tür hinter sich zu.
6
13. Dezember 2010
Freeman blieb einen Moment im Wagen sitzen und schaute zum Haus hinüber. Wie heruntergekommen es aussah, der kleine Garten, so unaufgeräumt und verwildert. Sie fragte sich, ob das der Tribut von elf Jahren Ungewissheit war. Ob das Verschwinden seiner Tochter Ray Thorley allen Lebenswillen geraubt und ihm den Antrieb genommen hatte, für sich zu sorgen, für sein Haus, seinen Garten. Doch als sie ausstieg, sah sie, dass fast alle Grundstücke in dieser Straße in einem so trostlosen Zustand waren. Den Preis für den schönsten Garten Englands würde hier keiner gewinnen. Freeman strich sich die Krümel ihres hastig verzehrten Schinken-Käse-Brötchens von der Jacke und klopfte an die Tür.
Als Ray Thorley ihr öffnete, schien er etwas verwirrt und sie im ersten Moment nicht zu erkennen. Schon beim letzten Mal hatte Freeman den Eindruck gehabt, dass er vielleicht an einer beginnenden Demenz litt. Es dauerte eine ganze Weile, bis ihm bestimmte Wörter einfielen, und nachdem er ihr etwas zu trinken angeboten hatte, war er fast eine Viertelstunde in der Küche verschwunden und schließlich mit leeren Händen zurückgekehrt. Niemand war gegen gelegentliche Aussetzer gefeit, auch sie selbst nicht, beispielsweise wenn sie einen Bericht schrieb und zum wiederholten Mal etwas nachschlagen musste oder beim Einkaufen dann doch etwas vergaß, obwohl sie es sich extra notiert hatte, aber bei Ray Thorley fühlte sie sich doch sehr an ihren Großvater erinnert. Vielleicht war er ihr ja deshalb auf Anhieb sympathisch gewesen.
Unter nur halb verständlichem Gemurmel, dass es hier ja zugehe wie im Taubenschlag, ließ er sie ins Haus. Die Presse, vermutete Freeman. Reporter waren wirklich eine Pest. Obwohl Emma noch nicht einmal zweifelsfrei identifiziert worden war, setzten sie dem alten Mann bereits zu, immer in der Hoffnung auf eine exklusive Geschichte. Wenn sie den Idioten in die Finger bekam, der den Stand der Ermittlungen an die Presse durchgereicht hatte, würde sie ihn höchstpersönlich zur Schnecke machen.
Während sie zum Wohnzimmer durchging, wickelte sie sich ihren Schal ab und steckte ihn in die Jackentasche. Ray folgte ihr dicht auf den Fersen.
»Haben Sie etwas Neues erfahren, Miss Freeman?«, wollte er wissen.
Normalerweise reagierte sie gereizt, wenn jemand sie Miss nannte. Wer sie so anredete – in aller Regel Männer, die mit Frauen in Machtpositionen ein Problem hatten –, wurde von ihr stets mit einem freundlichen, aber bestimmten »Detective Sergeant Freeman« eines Besseren belehrt. Aber bei Ray machte es ihr seltsamerweise nichts aus. Bei ihm fand sie es auf altmodische Weise charmant.
»Nein, leider noch nicht«, sagte sie. »Die Obduktion hat einen verheilten Bruch des linken Unterarms ergeben. Hatte Emma …«
»Oh nein, sie hat sich nie etwas gebrochen«, sagte Ray und lächelte. »Ich weiß noch, wie sie einmal weinend von der Schule heimkam, und als ich wissen wollte, was denn los war, meinte sie, alle anderen Kinder in ihrer Klasse hätten schon mal einen Gips gehabt, nur sie nicht. Das fand sie furchtbar ungerecht.«
Na gut, dachte Freeman, das musste jetzt nichts heißen. Sie beließ es erst mal dabei. Es war ohnehin ein Wunder, wie ruhig und umgänglich Thorley war, wie wenig Druck er ihr machte. Kein böses Wort, kein einziger Vorwurf, dass sie doch bitte endlich Ergebnisse liefern sollte. Ob er schon immer so freundlich und geduldig, so verständnisvoll gewesen war, oder ob ihn im Laufe der Jahre nur aller Kampfgeist verlassen hatte?
»Mr Thorley, ich versuche, Emmas letzte Tage und Stunden vor ihrem Verschwinden zu rekonstruieren. Können Sie mir etwas über Emmas Freundeskreis sagen? Irgendwelche Leute, mit denen sie vor ihrem Verschwinden besonders häufig zusammen war?«
Ray schüttelte den Kopf. »Oh je, da bin ich überfragt, aber sie war schon immer ein eher schüchternes Mädchen. Schon als Kind hat sie nicht viel mit anderen Kindern gespielt. Doch, in der Schule gab es ein paar Mädchen, mit denen sie befreundet war, aber das war … vorher. Vor ihren Problemen. Danach ist der Kontakt irgendwie abgebrochen. Aber sie war gern allein, es hat ihr nichts ausgemacht, glaube ich.«
Freeman nickte, auch wenn sie ihre Zweifel hatte, dass Emma immer nur allein gewesen war. Zumindest Lucas Yates dürfte ihr zeitweilig Gesellschaft geleistet haben, denn irgendwie musste sie ja an die Drogen gekommen sein. »Und wie sah es mit Jungs aus? Wissen Sie, ob sie einen Freund hatte?«
Sie merkte, wie Rays Miene sich ganz leicht verdüsterte, doch er schüttelte den Kopf. »Über so etwas hat sie nicht mit mir gesprochen.«
Freeman nickte erneut. »Aber meines Wissens gab es doch jemanden, als sie anfing … als Emmas Probleme anfingen, oder?« Ihr war schon aufgefallen, dass Ray es tunlichst vermied, von »Drogen« zu sprechen.
Wieder huschte ein Anflug von Besorgnis über Rays Gesicht. »Ja, das stimmt. Da war dieser Junge … Sie ist zu ihm gegangen, als sie das erste Mal verschwand. Das habe ich nie verstanden. Dieser Junge war nicht gut für sie, er hat ihr nur wehgetan«, sagte er und knetete seine Hände im Schoß. »Als sie zurückkam, stand sie völlig neben sich, wollte mir aber nicht erzählen, was passiert war. Wissen Sie, ich war einfach nur froh, sie wieder bei mir zu haben, und wenn sie nicht darüber reden wollte, mochte ich sie auch nicht drängen.«
»War sie danach noch einmal mit ihm zusammen?«
Ray schüttelte den Kopf. »Nein, nicht meine Emma. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Junge hat nichts getaugt, das brauchte sie mir gar nicht erst zu erzählen, das wusste ich auch so. Eine Zeit lang, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, hat sie sich kaum aus dem Haus getraut. Sie hat ständig aus dem Fenster geschaut – hier und oben in ihrem Zimmer. Das ging den ganzen Tag so: treppauf, treppab, schauen, ob jemand draußen auf der Straße steht. Ich habe sie gefragt, ob sie auf jemanden wartet.« Ray wandte den Blick zum Fenster, dessen Gardinen längst von der Sonne vergilbt waren. »Einmal habe ich ihn draußen herumlungern sehen. Da, gleich gegenüber, auf der anderen Straßenseite. Stand einfach nur da, stundenlang, und hat zum Haus geschaut. Ich wollte die Polizei rufen, aber sie meinte, die würden sowieso nichts unternehmen. Also dachte ich mir, gehe ich selber raus und sage ihm, dass er verschwinden soll, aber das wollte sie auch nicht. Es wäre nicht weiter wichtig, hat sie gesagt, ich sollte ihn einfach nicht beachten. Und als ich später noch mal geschaut habe, war er weg.« Ray stand auf und nahm ein Foto von Emma vom Kaminsims. »Kurz darauf ist sie wieder verschwunden.«
»Das müsste im April gewesen sein. War das, als der Mann von der Klinik bei Ihnen vorbeigekommen ist?« Sie schlug kurz in ihren Notizen nach. »Ben Swales, richtig?« Ray nickte. »Aber als Emma das letzte Mal verschwunden ist, kam er nicht mehr vorbei?«
Ray Thorleys Hände zitterten, als er das Foto zurückstellte. »Nein, er ist nicht noch einmal gekommen.«
»Gab es sonst noch jemanden, mit dem Emma vor ihrem Verschwinden zusammen gewesen sein könnte? Irgendwelche Freunde, Freundinnen?«
Er setzte sich wieder. »Da gab es dieses eine Mädchen, das mit ihr in einer Klasse war. Wie hieß sie noch …?« Er schüttelte den Kopf. »Gleich fällt es mir wieder ein. Sie waren seit der Grundschule befreundet, auch wenn sie in der letzten Zeit nicht mehr so viel miteinander gemacht haben wie früher. Aber vielleicht hat Emma ihr etwas von diesem Jungen erzählt. Wenn, dann ihr.« Er schwieg einen Moment und schüttelte den Kopf, als wollte er seinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. »Diane«, sagt er plötzlich. »So hieß sie. Diane Royle. Bestimmt haben Ihre Kollegen damals auch mit ihr gesprochen.«
»Prima«, sagte Freeman. »Das denke ich auch, aber ich werde es noch mal überprüfen.« Sie zog ihren Schal aus der Tasche und wandte sich zum Gehen. »Und wenn Ihnen sonst noch etwas einfällt, rufen Sie mich bitte an, ja?« Sie war schon fast an der Haustür, als Ray ihr endlich in den Flur folgte.
»Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht weiterhelfen konnte.«
»Aber nein, Sie haben mir sehr geholfen«, sagte sie. »Vielen Dank, Mr Thorley.« Sie öffnete die Tür und zog die Schultern hoch, als ihr der nasskalte Wind entgegenschlug. Wenigstens hatte es aufgehört zu regnen.
»Vielleicht kann Ihnen ja dieser Junge weiterhelfen«, sagte Ray hinter ihr; Freeman blieb jäh stehen und drehte sich um.
»Welcher Junge?«
»Der heute Morgen hier war. Ein Freund von Emma, der mir sein Beileid aussprechen wollte. Sehr netter junger Mann.«
Freeman war plötzlich hellwach. Endlich! Vielleicht konnte besagter Freund ja Licht in die Angelegenheit bringen.
»Wie hieß er?«, fragte sie.
»Wie er hieß?«, wiederholte Ray und runzelte angestrengt die Stirn, sodass Freeman sich ein bisschen für ihre Ungeduld schämte, aber sie wünschte wirklich, der Mann wäre etwas mehr auf Zack. »Oh, ich …« Ray schloss die Augen und schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er mir seinen Namen gesagt hat … Doch, das hat er bestimmt, aber ich weiß es wirklich nicht mehr.«
»Wie sah er denn aus?«
Wieder schloss Ray die Augen, diesmal so lange, dass Freeman schon fürchtete, überhaupt keine Antwort zu bekommen. »Ein sehr netter junger Mann«, begann er schließlich. »Sehr anständig. Gut gekleidet. Dunkelhaarig, wenn ich mich recht entsinne.« Er öffnete die Augen wieder. »Sie müssen schon entschuldigen, Miss Freeman, aber mehr weiß ich wirklich nicht mehr.«
Freeman seufzte, dann lächelte sie Ray an und hoffte, dass er ihren Unmut nicht bemerkte. »Schon in Ordnung«, versicherte sie ihm. »Aber wenn Ihnen der Name wieder einfällt oder wenn der junge Mann noch einmal vorbeikommt, dann rufen Sie mich an, okay?«
Ray nickte, doch wie er da so stand, sah er aus, als würde er die Last der Welt auf seinen Schultern tragen, als hätte er – er ganz allein – seine Tochter im Stich gelassen. Freeman schenkte ihm noch einmal ein aufmunterndes Lächeln und hätte viel darum gegeben, ihm dieses Gefühl der Ohnmacht nehmen zu können, statt es noch zu verstärken. Der Mann tat ihr wirklich leid, aber was sollte sie tun? Sie machte auch nur ihren Job.
7
13. Dezember 2010
Detective Chief Inspector Routledge lehnte sich in seinem Stuhl zurück und gähnte herzhaft. Freeman versuchte, es nicht persönlich zu nehmen, und ging einfach mal davon aus, dass sie ihn nicht langweilte, sondern der DCI gestern lediglich etwas spät ins Bett gekommen war. Das würde auch sein reichlich verkatertes Aussehen erklären. Für manch einen konnten die Weihnachtsfeiern anscheinend gar nicht früh genug beginnen.
»Also«, fuhr sie unbeirrt fort, »habe ich mich mit DI Gardner in Middlesbrough in Verbindung gesetzt …«
»DI?«, fragte Routledge und verzog das Gesicht. Freeman hätte zu gern eingehakt und ihn gefragt, welches Problem hier eigentlich alle mit diesem Gardner hatten, bezweifelte aber, dass Routledge es ihr sagen würde. Wenn er wollte, konnte er die Diskretion in Person sein.
»Allerdings«, setzte sie erneut an, »hätte ich mir das auch sparen können, denn ich habe nichts von ihm erfahren, das nicht auch schon in den Ermittlungsprotokollen gestanden hätte. Im Wesentlichen gab es damals zwei für den Fall relevante Personen: zum einen Ben Swales, ein Sozialarbeiter und Drogenberater, der Emma anscheinend zur Seite stand und als eine Art Vermittler zwischen ihr und ihrem Vater fungiert hat, als Emma das zweite Mal von zu Hause weglief. Gardner hat ihn ausführlich befragt und von der Liste der Verdächtigen gestrichen.«
»Dann würde ich vorschlagen, dass Sie noch einmal selbst mit ihm sprechen«, sagte Routledge; Freeman nickte und dachte sich ihren Teil.
»Der andere ist Lucas Yates«, fuhr sie fort, »Emmas Exfreund, und nach allem, was ich bislang über ihn gelesen habe, ein ganz reizender Zeitgenosse. Gardner hat ihn damals im Zuge der Ermittlungen ebenfalls befragt, aber viel scheint bei diesem Verhör nicht herausgekommen zu sein. So wie ich es verstanden habe, ist Gardner davon ausgegangen, dass die beiden zusammen durchgebrannt sind – auch wenn Ray Thorley das völlig anders sieht.«
»Ach ja? Inwiefern?«





























