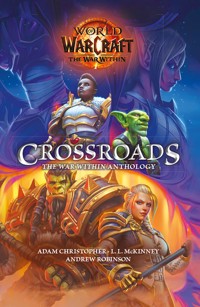Stranger Things: Finsternis - DIE OFFIZIELLE DEUTSCHE AUSGABE – ein NETFLIX-Original E-Book
Adam Christopher
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die offiziellen Stranger-Things-Romane
- Sprache: Deutsch
Exklusiv und nur im Buch: Was geschah, bevor die Serienhandlung einsetzt
Sommer 1977: Es ist bereits der dritte Tote in Folge! In der brüllenden Hitze New Yorks treibt ein brutaler Serienmörder sein Unwesen, doch Detective Jim Hopper und seine Kollegin Delgado finden keinen Hinweis auf den Täter. Als ihnen unter zweifelhaften Umständen der Fall entzogen wird, beschließt Hopper, im Verborgenen weiter zu ermitteln. Schon bald befindet er sich inmitten von New Yorks berüchtigten Streetgangs und riskiert sein eigenes Leben. Aber gerade als er der Lösung des Falls näher zu kommen scheint, wird die Stadt von einem Stromausfall getroffen, der Hopper in tiefere Abgründe eintauchen lässt, als er je für möglich gehalten hat …
Ein Muss für alle Fans. Und für alle, die die Serie noch nicht kennen: Ein extrem spannender Thriller.
Wenn Sie noch tiefer in die mysteriöse Welt von STRANGER THINGS eintauchen wollen, lesen Sie gleich weiter:
>> STRANGER THINGS: Das offizielle Begleitbuch
>> STRANGER THINGS: Suspicious Minds. Das Geheimnis um Elfi
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 597
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
ADAM CHRISTOPHER wurde in Neuseeland geboren und lebt als Schriftsteller in Großbritannien. Sein Debütroman Empire State erhielt u. a. von der Financial Times die Auszeichnung als Buch des Jahres 2012. Ein Jahr später wurde Adam Christopher für den Sir-Julius-Vogel-Award als Bester neuer Künstler nominiert. Als großer Fan der Erfolgsserie STRANGERTHINGS erarbeitete er gemeinsam mit Netflix die Geschichte um Jim Hopper.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Adam Christopher
FINSTERNIS
Die Wahrheit über Jim Hopper – die Vorgeschichte zur Erfolgsserie
Aus dem Englischen von Melike Karamustafa
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel Suspicious Minds bei Del Rey, einem Imprint von Random House, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen
von Penguin Books Limited und werden
hier unter Lizenz benutzt.Copyright © 2019 by Netflix CPX, LLC und NETFLIX CPX International, B.V
This translation published by arrangement with Del Rey, an imprint
of Random House, a division of Penguin Random House LLC
Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 2019 by Penguin Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlag: www.bürosüd.de nach einer Vorlage von Scott Briel
Umschlagmotiv: Rick Davies
Übersetzung: Melike Karamustafa
Redaktion: Susann Harring
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-24252-7V001www.penguin-verlag.de
Für Sandra, immer.Und für Aubrey, weil.
Prolog
26. DEZEMBER 1984
Hoppers Hütte
Hawkins, Indiana
Jim Hopper stand vor dem Spülbecken, die Arme tief im heißen Seifenwasser versenkt, und versuchte, gegen das Lächeln anzukämpfen, das beim Anblick der dicken weißen Flocken vor seinem Küchenfenster an seinen Mundwinkeln zerrte.
Weihnachten war keine gute Zeit. Nicht für ihn. Nicht mehr seit … Nun ja, schon seit langer Zeit nicht mehr. Seit Sara. Er akzeptierte es. In den vergangenen sechs, bald sieben Jahren, die er wieder in Hawkins war, hatte er sich mit den in jeder Adventszeit neu aufkeimenden Gefühlen von Trauer und Verlust abgefunden.
Wobei abgefunden nicht das richtige Wort war. Er hieß die Gefühle willkommen, erlaubte sich, von ihnen überwältigt zu werden. Weil es so leichter war. Angenehmer. Und, merkwürdigerweise, auch sicherer.
Dabei hasste er sich selbst dafür, den Gefühlen nachzugeben und zuzulassen, dass sich der Samen der Verzweiflung jedes Jahr aufs Neue in ihm einnistete, um in den folgenden Wochen zu voller Pracht zu erblühen. Der Hass ließ ihn noch tiefer in der Dunkelheit versinken, und so drehte sich die Spirale immer weiter und weiter, zog ihn tiefer und tiefer.
Doch jetzt nicht mehr.
Nicht in diesem Jahr.
Dieses war das erste Jahr, in dem alles anders war. Sein Leben hatte sich verändert, und erst die Veränderung hatte ihm klargemacht, wie tief er bereits gefallen war. Was aus ihm geworden war.
Und das alles wegen ihr: Jane, seiner Adoptivtochter. Legal und offiziell seine Familie.
Jane Hopper.
Elf.
Elfi.
Hopper spürte, wie sich das Lächeln abermals auf sein Gesicht stahl, und dieses Mal wehrte er sich nicht dagegen.
Natürlich bedeutete Elfis Anwesenheit nicht, dass er die Vergangenheit vergessen würde. Ganz im Gegenteil. Doch er trug jetzt eine neue Verantwortung. Er hatte wieder eine Tochter, die er großziehen würde, und das hieß, dass er weitermachen musste. Das machte seine Vergangenheit nicht ungeschehen, doch er konnte sie endlich in einem sicheren Winkel seines Kopfes ruhen lassen.
Noch immer fielen dicke Schneeflocken vom Himmel. Die Stämme der Bäume, die seine Hütte umstanden, steckten bereits in einer gut einen halben Meter hohen, weichen Schneedecke. In den Radionachrichten am Nachmittag war weder ein heraufziehender Sturm angekündigt worden, noch hatte es anderweitige Wetterwarnungen gegeben. Ein Fehler offenbar. Der Moderator hatte zwar von Schneefall im ganzen Bundesstaat gesprochen. Allerdings fragte Hopper sich inzwischen, ob die weißen Massen stattdessen allein auf den wenigen Morgen Land um die alte Hütte seines Großvaters niedergingen.
Wenn Sie reisen müssen, hatte der Radiomoderator gesagt, dann lassen Sie es ganz einfach. Bleiben Sie im Warmen und trinken Sie Ihren Eierpunsch.
Hopper hatte nichts dagegen. Elfi dagegen …
»Das Wasser ist kalt.«
Aus seinen Gedanken gerissen, blickte Hopper blinzelnd auf. Elfi stand plötzlich neben ihm an der Spüle. Er sah auf sie hinab. Ihre Miene war undurchdringlich. Offensichtlich hatte er das Wasser so lange laufen lassen, dass nun der Boiler leer war. Er zog die Hände aus dem Schaum und blickte auf seine Finger. Sie waren schrumpelig geworden, und der Stapel Geschirr vom Abendessen, zu dem es Reste vom Weihnachtstag gegeben hatte, war nur unmerklich kleiner geworden.
»Alles in Ordnung?«
Hopper richtete den Blick wieder auf Elfi. Mit großen Augen sah sie ihn erwartungsvoll an. Sein Lächeln wurde breiter. Verdammt, er konnte einfach nichts dagegen tun.
»Ja, alles bestens«, sagte er und streckte die Hand aus, um ihr durch die dunklen Locken zu wuscheln, doch beim Anblick seiner seifigen Hand verzog sie das Gesicht zu einer Grimasse und duckte sich weg. Lachend schnappte sich Hopper das Küchenhandtuch, das auf der Anrichte neben dem Spülbecken lag. Während er sich die Hände abtrocknete, deutete er mit dem Kopf in Richtung Wohnzimmer. »Hast du es geschafft, Mike zu erreichen?«
Elfi seufzte.
Vielleicht ein wenig zu theatralisch, dachte Hopper. Andererseits war das alles für sie noch immer neu und, so schien es, häufig eine Herausforderung. Hopper beobachtete, wie sie zur Couch zurückging, um das riesige neue Walkie-Talkie zu holen und ihm das Gerät anschließend so auffordernd entgegenzustrecken, als könnte er ihre Freunde aus dem Äther hervorzaubern.
Ein paar Sekunden lang starrten sie sich an, bevor Elfi ungeduldig mit dem Walkie-Talkie vor seiner Nase herumwedelte.
Hopper warf sich das Küchenhandtuch über die Schulter. »Was soll ich machen? Funktioniert es nicht?« Er nahm das Gerät in die Hand und drehte es um. »Brauchst du schon wieder eine neue Batterie?«
»Niemand da.« Elfi seufzte noch einmal und ließ die Schultern hängen.
»Ach ja, jetzt erinnere ich mich«, sagte Hopper, dem in diesem Moment einfiel, dass Mike, Dustin, Lucas und Will an diesem Tag alle unterwegs waren, um Verwandte zu besuchen; über das Walkie-Talkie würde Elfi heute keinen aus der Gang erreichen.
Elfi nahm ihm das Gerät wieder ab, schaltete es mehrmals ein und aus und fummelte an den Knöpfen für die Frequenzeinstellung herum. Mit jeder Drehung erklang ein abgehacktes Knacken, gefolgt von statischem Rauschen.
»Vorsicht, das war ein sehr großzügiges Geschenk von den Jungs«, ermahnte Hopper sie und wand sich innerlich, als er an das Geschenk dachte, das er Elfi zu Weihnachten gemacht hatte: Hungry HungryHippos. Ein Spiel, für das sie viel zu alt war – eine Erkenntnis, die ihn wie ein Vorschlaghammer getroffen hatte, aber leider erst, als sie gestern das Geschenkpapier heruntergerissen hatte – und das es nicht einmal ansatzweise mit dem Walkie-Talkie aufnehmen konnte, für das ihre Freunde zusammengelegt hatten. Anscheinend war er in Sachen Vaterschaft etwas aus der Übung. Er hatte das Spiel ohne nachzudenken gekauft, einfach nur, weil Sara es geliebt hatte … doch Elfi war nicht Sara.
Glücklicherweise war Elfi viel zu sehr auf das Gerät in ihren Händen konzentriert, um seine Verlegenheit zu bemerken.
Hopper wandte sich wieder der Spüle zu, drehte den Warmwasserhahn auf und vermischte das neue heiße Wasser mit dem erkalteten im Becken. »Du hattest doch gestern einen schönen Tag, oder?« Er warf einen Blick über die Schulter. »Oder?«
Elfi nickte und ging zurück ins Wohnzimmer.
»Eben«, sagte Hopper. »Und morgen sind sie alle wieder zu Hause.« Er drehte den Hahn zu. »Vielleicht erreichst du sie heute Abend schon mit dem Ding.«
Hopper widmete sich wieder dem Abwasch, bis er hörte, wie Elfi zurück in die Küche kam. Als sie neben ihm stehen blieb, warf er ihr einen fragenden Blick zu.
»Hey.« Er nahm einen Teller vom Stapel und versenkte ihn in dem warmen Wasser. »Mir ist klar, dass dir langweilig ist, aber Langeweile ist gut, glaub mir.«
Elfi runzelte die Stirn. »Langeweile ist gut?«
Hopper zögerte einen Moment. Er hoffte, dass er mit seiner improvisierten Elternweisheit nicht völlig danebenlag. »Natürlich. Solange du dich langweilst, bist du nicht in Gefahr. Und außerdem kommen einem bei Langeweile die besten Ideen. Und Ideen sind gut. Man kann nie genug Ideen haben.«
»Ideen sind gut«, wiederholte Elfi. Hopper glaubte beinahe sehen zu können, wie sich die Rädchen in ihrem Kopf drehten.
»Genau. Und Ideen führen zu Fragen. Fragen sind auch gut.« Rasch wandte Hopper sich ab, um sein selbstkritisches Stirnrunzeln zu verbergen. Fragen sind auch gut? Was zur Hölle redete er da? Langsam fragte er sich, ob er zu viel oder zu wenig von dem Eierpunsch getrunken hatte.
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, schlich sich Elfi aus der Küche, und einen Moment später hörte Hopper, dass der Fernseher eingeschaltet wurde.
Als er einen Blick über die Schulter warf, sah er sie regungslos auf dem Sofa sitzen, den Blick auf den Bildschirm geheftet, auf dem die Kanäle in schneller Folge wechselten, obwohl nicht viel mehr zu sehen war als abwechselnd farbenfrohes Flackern und Schneegestöber.
»Das liegt am Wetter. Ich fürchte, der Fernseher wird noch eine ganze Weile nicht funktionieren. Hey, wie wäre es mit einer Partie Hungry Hungry Hippos?«
Als Hopper keine Antwort bekam, warf er erneut einen Blick über die Schulter. Elfi hatte sich halb zu ihm herumgedreht und bedachte ihn mit einem Blick, der alles andere als amüsiert wirkte.
Hopper lachte. »Nur ein Vorschlag. Dann lies doch ein bisschen.«
Nachdem Hopper das restliche Geschirr gespült hatte, zog er den Stöpsel und trocknete sich die Hände ab. Als er zum Küchenfenster sah, spiegelten sich darin das Sofa und der immer noch eingeschaltete Fernseher, doch Elfi war verschwunden.
Gut, dachte er. Gegen das Wetter konnte er nichts ausrichten, aber vielleicht war es gar nicht so übel, in der Hütte festzusitzen. In den letzten Tagen waren sie beide viel unterwegs gewesen. Elfi hatte Zeit mit ihren Freunden verbracht, und er selbst hatte die Gelegenheit genutzt, Joyce zu sehen. Sie schien sich gut zu halten und hatte seine Gegenwart offenbar genossen. Genau wie Jonathan.
Hopper wandte sich vom Fenster ab und ging zu dem Tisch auf der gegenüberliegenden Seite des Küchentresens, auf dem der geöffnete Karton von Hungry Hungry Hippos lag. Während er einen Stuhl unter dem Tisch hervorzog und sich wenig enthusiastisch fragte, ob man das Spiel eventuell auch gegen sich selbst spielen konnte, kam Elfi aus ihrem Zimmer.
Ihr Gesichtsausdruck war so ernst, dass Hopper, eine Hand an der Rückenlehne des Stuhls, mitten in der Bewegung erstarrte.
»Alles okay?«
Ohne den Blick von ihm abzuwenden, legte Elfi den Kopf schräg wie ein Hund, der einem Geräusch lauschte, das zu weit entfernt für das menschliche Gehör war.
»Was ist los?«, fragte Hopper.
»Warum bist du Polizist geworden?«
Hopper blinzelte irritiert, bevor er tief Luft holte. Die Frage traf ihn völlig unvorbereitet.
Worauf will sie hinaus?
»Na ja«, begann er und fuhr sich mit der Hand durch das Haar, »das ist eine interessante Frage …«
»Du hast gesagt, dass Fragen gut sind.«
»Stimmt, das habe ich gesagt … Und sie sind tatsächlich gut.«
»Beantwortest du sie mir dann auch?«
Mit einem leisen Lachen stützte Hopper die Ellbogen auf die Rückenlehne des Stuhls. »Klar. Ich meine, es ist eine gute Frage … Ich bin mir nur nicht sicher, ob es eine einfache Antwort darauf gibt.«
»Ich weiß nicht viel über dich«, sagte Elfi. »Du weißt aber alles über mich.«
Hopper nickte. »Das ist … Ja, du hast recht.« Er drehte den Stuhl herum und setzte sich.
Elfi ließ sich auf dem gegenüberliegenden Platz am Tisch nieder, stützte die Ellbogen auf und beugte sich neugierig vor.
Hopper dachte einen Augenblick über die Frage nach. »Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich wirklich Polizist werden wollte«, antwortete er schließlich. »Es schien mir damals einfach eine gute Idee zu sein.«
»Warum?«
»Na ja …« Hopper richtete sich ein wenig auf und strich sich über das unrasierte Kinn, während er überlegte. »Ich wusste nicht so recht, was ich mit mir anfangen sollte. Ich war gerade zurückgekommen. Aus …« Er hielt erneut inne.
Nein, nicht jetzt. Das ist ein anderes Thema für einen anderen Zeitpunkt.
Hastig wedelte er mit der Hand in der Luft, als wolle er die letzten Worte ungesagt machen. »Ich wollte etwas Sinnvolles machen. Etwas verändern. Leuten helfen, denke ich. Und ich habe über Fähigkeiten und Erfahrungen verfügt, die mir nützlich erschienen. Also bin ich Polizist geworden.«
»Und?«
Hopper runzelte die Stirn. »Und was?«
»Hast du etwas geändert?«
»Na ja …«
»Hast du den Leuten geholfen?«
»Hey, immerhin habe ich dir geholfen, oder etwa nicht?«
Elfi lächelte. »Wo bist du gewesen?«
»Was?«
»Du hast gesagt, dass du zurückgekommen bist. Wo bist du gewesen?«
Hopper schüttelte den Kopf. »Ich bin mir nicht sicher, ob du für diese Geschichte schon bereit bist.« Er hatte auf einmal das Gefühl, schlechter Luft zu bekommen. Sein Adrenalinpegel stieg sprunghaft an und verursachte ihm in Kombination mit dem Restalkohol des Eierpunsches in seinem Blut einen leichten Schwindel.
Nun war es an Elfi, den Kopf zu schütteln. »Fragen sind etwas Gutes«, wiederholte sie.
Natürlich hatte sie recht. Er hatte sie bei sich aufgenommen, ihr geholfen und sie beschützt. Zusammen hatten sie Dinge durchgestanden, die sich andere Menschen nicht mal in ihren wildesten Fantasien hätten ausmalen können, und nun waren sie auch ganz offiziell eine Familie. Und jetzt musste er auf einmal feststellen, dass er für sie genauso ein Mysterium darstellte wie sie für ihn, damals in Joyce’ Haus, nachdem er sie und die Jungs auf dem Schrottplatz gefunden hatte.
Elfi neigte leicht den Kopf und reckte auffordernd das Kinn. Sie erwartete eindeutig eine Antwort.
»Hör zu, Kleine, es gibt Dinge, die du noch nicht bereit bist zu hören, und Dinge, die ich noch nicht bereit bin zu erzählen.«
Elfi zog konzentriert die Augenbrauen zusammen. Gespannt beobachtete Hopper sie, während er sich fragte, wo ihre Gedanken sie hinführen würden.
»Dieser Ort«, fragte sie, »ist das Vietnam?« Sie betonte das letzte Wort so deutlich, als wäre es das erste Mal, dass sie es aussprach.
Hopper hob eine Augenbraue. »Vietnam? Wo hast du das denn her?«
Elfi schüttelte den Kopf. »Hab ich gelesen.«
»Du hast es gelesen?«
»Auf einem der Kartons, die du unter den Holzdielen aufbewahrst.«
»Unter den …« Hopper musste wieder lachen. »Hast du dich auf Erkundungstour begeben?«
Elfi nickte.
»Okay. Na gut, du hast recht. Ich kam aus Vietnam zurück. Das ist ein Land, sehr weit von hier entfernt.«
Gebannt rückte Elfi noch näher an den Tisch heran und beugte sich vor.
Hopper öffnete den Mund, schloss ihn jedoch sofort wieder. »Nein.« Er hielt erneut inne. »Das ist keine gute Idee.«
»Was ist keine gute Idee?«
»Dir von Vietnam zu erzählen.«
»Warum nicht?«
Hopper seufzte. Das war eine gute Frage. Nur fiel ihm keine gute Antwort ein.
Die Wahrheit war – und das überraschte Hopper –, dass er nicht über Vietnam reden wollte, nicht, weil es ein Trauma oder sein persönlicher Dämon war, sondern weil es so weit zurücklag, fast so, als wäre es die Geschichte einer anderen Person. Obwohl er seine Erlebnisse dort nie vergessen würde, war ihm doch bewusst, dass er seine Vergangenheit in einen Teil seines Bewusstseins verdrängt hatte, an den er nur sehr selten rührte. Daher: Ja, Vietnam war ein schwerer Teil seines Lebens, und er war verändert zurückgekehrt – wie die meisten Soldaten –, aber das spielte keine Rolle, jetzt nicht mehr. Dieser Mensch, der damals zurückkam, hatte nicht mehr viel mit ihm zu tun.
Denn er hatte etwas viel Schlimmeres akzeptieren müssen: dass sich sein Leben in zwei Hälften teilte. Vor Sara. Nach Sara.
Nichts anderes zählte. Nicht einmal Vietnam.
Aber wie sollte er Elfi das erklären?
»Weil«, sagte Hopper schließlich mit einem sanften Lächeln, »Vietnam ist lange her. Ich meine, wirklich lange. Und ich bin nicht mehr derselbe wie früher.« Er legte seine Unterarme auf den Tisch und beugte sich vor
»Hör zu, es tut mir leid. Wirklich. Ich verstehe, dass du neugierig bist und mehr über mich wissen möchtest. Schließlich bin ich dein …« Er hielt inne.
Elfi hob fragend die Augenbrauen und reckte das Kinn, während sie darauf wartete, dass er den Satz beendete.
Das Lächeln, das Hopper ihr dieses Mal schenkte, war wieder überzeugender. »Ich bin jetzt dein Dad. Und ja, es gibt viele Dinge, die du nicht über mich weißt. Vietnam eingeschlossen. Aber irgendwann werde ich dir davon erzählen. Wenn du ein wenig älter bist.« Als Elfi die Stirn runzelte, hob Hopper schnell eine Hand, um ihre Erwiderung im Keim zu ersticken. »Du musst mir ganz einfach vertrauen. Eines Tages wirst du bereit dazu sein, genau wie ich. Aber im Moment lassen wir das Thema aus. Okay, Kleine?«
Elfi wirkte enttäuscht, nickte jedoch.
»Gut«, sagte Hopper. »Hör zu, ich weiß, dass du dich langweilst und Fragen hast. Das ist gut. Vielleicht finden wir ein anderes Thema, über das wir uns unterhalten können. Lass mich nur zuerst Kaffee machen.«
Hopper stand auf und ging in die Küche. Die Kaffeemaschine war ein Relikt aus vergangenen Zeiten, das er in einem der Küchenschränke gefunden hatte und das in Anbetracht seines Alters erstaunlich gut in Schuss war.
Während er Wasser in die Maschine füllte, hörte er hinter sich einen dumpfen Schlag.
Elfi stand neben dem roten Tisch und klopfte sich die Hände an der Jeans ab. Vor ihr stand ein großer Pappkarton, der an der Seite mit zwei Wörtern in Großbuchstaben beschriftet war.
NEWYORK
Es war Jahre her, dass Hopper die Kiste gesehen hatte, aber er wusste genau, was sich darin befand. Er trat an den Tisch und zog sie zu sich heran. Dann sah er Elfi an.
»Ich bin mir nicht sicher, ob …«
»Du hast gesagt, dass wir etwas anderes finden müssen«, unterbrach sie ihn und deutete auf den Karton. »Und ich habe etwas gefunden.«
Hopper kannte Elfi gut genug, um ihren Gesichtsausdruck und ihren Tonfall richtig zu deuten. Sie würde nicht nachgeben. Dieses Mal nicht.
Okay. New York. New York. Hopper setzte sich und starrte den Karton an. Immerhin lag New York nicht ganz so weit zurück wie Vietnam. Aber war sie hierfür bereit? War er es?
Als Elfi sich wieder auf dem Stuhl ihm gegenüber niederließ, hob Hopper den Deckel der Kiste an. Darin lagen eine ganze Reihe Hefter und lose Dokumente und ganz oben eine dicke Aktenmappe aus Packpapier, die von zwei roten Gummibändern zusammengehalten wurde.
Oh.
Hopper griff in die Kiste, löste, ohne die Akte herauszunehmen, die Gummibänder und schlug sie auf.
Zuoberst lag eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Das Bild einer Leiche auf einem Bett. Das weiße T-Shirt war so voller Blut, dass es beinahe schwarz aussah.
Abrupt schlug Hopper die Akte zu, bevor er den Deckel zurück auf die Kiste stülpte und sich zurücklehnte. Er sah zu Elfi hinüber.
»Das ist keine gute Idee.«
»New York.«
»Elfi, hör zu …«
In diesem Moment sprang der Deckel von der Kiste, ohne dass jemand von ihnen sie berührt hätte.
Hopper blinzelte überrascht, bevor er wieder seine Tochter ansah. Sie wirkte vollkommen ungerührt, ernst, entschlossen.
Hopper legte für eine Sekunde den Kopf in den Nacken, bevor er sich geschlagen gab. »In Ordnung. Du willst etwas über New York erfahren? Sollst du.« Er zog die Kiste zu sich heran, entnahm ihr dieses Mal jedoch etwas, was unter der Akte lag. Es handelte sich um eine große weiße Karte in einer durchsichtigen Plastiktüte. An die Tüte war ein Zettel angeheftet worden, auf dem Erläuterungen zum Inhalt des Beweismaterials festgehalten waren.
Hopper starrte auf die Karte, die vollkommen nichtssagend wirkte, und drehte sie schließlich herum. Auf der Rückseite befand sich ein einzelnes Symbol, das offensichtlich handschriftlich und mit schwarzer Tinte daraufgezeichnet worden war: ein fünfzackiger Stern.
»Was ist das?«
Elfi war aufgestanden und beugte sich über die Kiste, um hineinsehen zu können. Doch Hopper schob den Karton beiseite und hielt die Karte hoch.
»Nur eine Karte aus einem dummen Spiel«, sagte er schnell und lachte, doch sein Lachen erstarb in der nächsten Sekunde. Er musterte erneut die Karte. »Ein Spiel, in dem du ziemlich gut wärst, denke ich.«
Elfi setzte sich wieder. Als er ihr in die Augen sah, erkannte Hopper ein Funkeln darin. »Ein Spiel?«
»Dazu kommen wir noch.« Hopper legte die Karte vor sich auf den Tisch und stellte anschließend den Karton neben seinem Stuhl auf den Boden. Dann zog er einen Stapel Dokumente daraus hervor. Bei der obersten Seite handelte es sich um ein Empfehlungsschreiben, ausgestellt vom Kriminalhauptkommissar der New Yorker Polizei. Hopper las das Datum am oberen Rand: Mittwoch, 20. Juli 1977. Dann holte er einmal tief Luft und sah Elfi an.
»Bevor ich Chief in Hawkins geworden bin, habe ich für die Polizei in New York gearbeitet. Als Detective für Tötungsdelikte.«
Elfi bewegte die Lippen, um stumm das unbekannte Wort nachzusprechen.
»Tötungsdelikt bedeutet Mord.«
Elfi riss die Augen auf.
Mit einem tiefen Seufzen fragte sich Hopper, ob er soeben die Büchse der Pandora geöffnet hatte.
»Wie dem auch sei, im Sommer siebenundsiebzig ist etwas sehr Merkwürdiges passiert …«
Kapitel eins DIE GEBURTSTAGSFEIER
4. JULI 1977Brooklyn, New York
Der Flur war weiß. Wände, Boden, Decke. Die Kunstwerke. Weiß auf Weiß auf Weiß. Hopper wurde ein wenig schwindelig. Schneeblind mitten in der Stadt, wer hätte das für möglich gehalten.
Ein ganzes Haus, das komplett weiß war, vom Erdgeschoss bis unters Dach. Jedes Zimmer, jedes Stockwerk. Von außen war es ein ganz normales Brooklyn Brownstone, von innen erinnerte es an eine Kunstinstallation. Ängstlich umklammerte Hopper sein Rotweinglas. Allein der Gedanke daran, auch nur einen einzigen Tropfen zu verschütten, versetzte ihn in Panik.
Nur reiche Leute konnten sich erlauben, in einem Haus wie diesem zu leben, überlegte er. Denn man musste schon mindestens eine ganze Armee an Reinigungspersonal beschäftigen, um es dermaßen sauber zu halten. Reiche Leute, die sich für Andy Warhol hielten. Reiche Leute, die mit Andy Warhol befreundet waren – oder zumindest seinen Innenarchitekten kannten.
Und sie hatten Kinder. Zwei. Zwillinge, die in diesem Moment ihre Geburtstagsparty im hinteren Teil des Hauses feierten. In einer riesigen Küche, an die sich ein üppig bepflanzter Garten anschloss, der von hohen Mauern umgeben war. Eine grüne Oase – versteckt zwischen zwei hohen Häuserreihen –, die es irgendwie geschafft hatte, der brütenden Hitze, die den Rest New Yorks in ein Trockengebiet verwandelt hatte, zu widerstehen.
Die Partygeräusche hallten von den Wänden des spartanisch eingerichteten Flurs wider, in den sich Hopper auf der Suche nach Trost mit seinem unglücklich gewählten Drink zurückgezogen hatte. Er hob das Glas und starrte in die dunkelrote Flüssigkeit. Rotwein auf einer Kinderparty. Ja, die Palmers zählten zu dieser Art Leute.
Mit einem Seufzen hob Hopper das Glas an die Lippen und trank einen Schluck. Seine Pläne für den vierten Juli hatten eigentlich anders ausgesehen, doch ihm war klar, dass er sich mit seinem Urteil zurückhalten sollte. Die Kinder – insgesamt dreißig, beinahe Saras gesamte Grundschulklasse – hatten Spaß. Sie wurden von einer ganzen Horde professioneller Entertainer unterhalten, welche die Palmers extra für diesen Anlass engagiert hatten, und von einem Catering-Team, das vermutlich mehr kostete, als Hopper in einem Monat verdiente, gefüttert, getränkt und vor allem gezuckert. Und nicht nur die Kinder bekamen Unterhaltung geboten, auch an die Eltern hatte man gedacht. Irgendwo am Ende des weißen Flurs, hinter einer der vielen weißen Türen, scharten sich in diesem Moment Mütter und Väter – abzüglich Hopper – um irgendeine Show. Eine Magierin, hatte er jemanden sagen hören. Diane hatte versucht, Hopper zu überreden, sie sich ebenfalls anzusehen, sie hatte ihn sogar ein wenig am Ärmel gezupft, aber im Ernst … eine Zauberin?
Nein, es ging ihm gut, hier und jetzt. Allein. Im Flur. Umgeben von unendlichem Weiß.
Gelächter schallte aus der Küche herüber, wurde aber noch übertroffen von dem Applaus, der sich beinahe im selben Augenblick in dem Raum am Ende des Flurs erhob. Hopper sah sich um, unschlüssig, in welche Richtung er sich wenden sollte, bis er sich schließlich mit einem Kopfschütteln ermahnte, kein Partymuffel zu sein, und sich dem Zimmer zuwandte, in dem die anderen Eltern versammelt waren.
Als er die Tür am Ende des Flurs öffnete, erwartete er halb, dahinter einen weißen Raum mit einem weißen Klavier in der Mitte vorzufinden. John Lennon mit den Händen auf den Tasten, Yoko Ono lang ausgestreckt auf dem Deckel. Doch stattdessen handelte es sich um ein Wohnzimmer, eines von mehreren, die er bereits im Haus entdeckt hatte, nur dass dieses ein bisschen weniger karg eingerichtet war als der Rest des Hauses. An den weißen Wänden reihten sich kunstvoll geschnitzte, vermutlich antike Bücherregale in einem warmen Braunton aneinander.
Hopper trat ein, schloss die Tür hinter sich und nickte ein paar Leuten, die in der Nähe standen, höflich zu. Die meisten von ihnen waren Männer, wie Hopper feststellte, während an dem runden Tisch, der den Großteil des Raums einnahm, vor allem Mütter und Tanten Platz genommen hatten, die ihre Aufmerksamkeit auf die Frau richteten, die am Kopf des Tisches, genau gegenüber der Tür, saß. Die junge Frau hatte einen rot gemusterten Schal über ihr Haar gelegt, dessen Enden seitlich an ihrem Gesicht hinabfielen. Vor ihr auf dem Tisch stand tatsächlich eine gottverdammte Kristallkugel.
Hopper versteifte sich und spannte unwillkürlich den Kiefer an, widerstand jedoch dem Drang, einen Blick auf die Uhr zu werfen. Beim Anblick der anderen Männer fühlte er sich unwohl und fehl am Platz. Er schien der Einzige in der Runde zu sein, der die Geburtstagsfeier nicht zum Anlass genommen hatte, um sich schick zu machen. Die meisten anderen Väter trugen Jacketts mit breiten Revers in verschiedenen Braunschattierungen und dazu passende Krawatten.
Ach ja, das gute alte Model-T-Jackett. Wenn möglich, in einem kräftigen Erdton.
Auf einmal fühlte sich Hopper in seinem rot karierten Hemd und der Jeans gar nicht mehr so schlecht. Wenigstens war sein Outfit bequem. Bei den herrschenden Temperaturen war Polyester alles andere als eine weise Entscheidung – wie inzwischen auch einigen der umstehenden Männer klar geworden sein durfte, zumindest ließen das die vielen roten und schweißbedeckten Gesichter vermuten.
Hopper versteckte sein Grinsen hinter seinem Weinglas und trank es in einem Zug leer, bevor er seine Aufmerksamkeit auf die Szene richtete, die sich in der Mitte des Raumes abspielte. Diane saß zwischen den anderen Frauen – von denen die meisten lange Kleider aus fließenden Baumwollstoffen trugen, die sehr viel luftiger wirkten als die Outfits der Männer – am Tisch und sah gebannt die Hellseherin an, die in ihre Kristallkugel starrte und vorgab, die Zukunft zu sehen.
War das etwa Cindy, Toms Mutter?
Hopper hatte den Überblick verloren. Auf einmal verspürte er das unbändige Bedürfnis nach einem zweiten Glas Wein.
Die Hellseherin redete in monotonem Tonfall vor sich hin. Sie war jünger, als Hopper erwartet hatte, auch wenn er sich nicht ganz sicher war, welcher Altersgruppe Wahrsagerinnen normalerweise zuzuordnen waren. Waren die nicht eigentlich älter? Nicht dass es irgendeine Rolle gespielt hätte. Das Ganze war reine Show, nichts weiter.
Hopper versuchte, sich zu entspannen, die Vorführung zu genießen und aufzuhören, sich wie ein Arsch aufzuführen.
Der Applaus, der einige Sekunden später aufbrandete, riss ihn aus seinen Gedanken. Als er aufblickte, stellte er fest, dass die Frauen am Tisch alle einen Platz aufrückten, damit sich die nächste die Zukunft voraussagen lassen konnte.
Es war Diane.
Sie lachte über etwas, was ihre Sitznachbarin sagte, bevor sie einen Blick über die Schulter warf. Als sie Hopper entdeckte, begann sie zu strahlen und winkte ihm zu.
Mit einem verlegenen Lächeln in Richtung der anderen Väter ging Hopper zu Diane hinüber und stellte sich hinter ihren Stuhl. Als sie die Hand ausstreckte und er sie drückte, sah sie zu ihm auf und lächelte.
Er erwiderte ihr Lächeln. »Hey, warum siehst du mich so an? Die gute Madame Mystique hier ist diejenige, die in deine Zukunft sehen kann.«
Die Hellseherin lachte, bevor sie ihren Schal ein Stück nach hinten schob, um Hopper anzusehen. »Die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft – alle Wege und alle Pfade stehen mir offen.« Sie streckte die Hände über der Kristallkugel aus.
Diane grinste, bevor sie tief Luft holte, den Rücken streckte und die Augen schloss. Langsam und konzentriert ließ sie den Atem durch die Nase entweichen. »Okay. Schießen Sie los.«
Die Frauen um den Tisch brachen in laute Anfeuerungsrufe aus, während die Wahrsagerin – ganz offensichtlich bemüht, nicht laut loszulachen – den Kopf von rechts nach links wiegte, bevor sie erneut in ihre Kugel starrte, die Hände daneben flach auf den Tisch gelegt.
Stille senkte sich über den Raum.
Hopper beobachtete, wie die junge Frau die Augen zu schmalen Schlitzen zusammenkniff und konzentriert die Brauen zusammenzog.
Ein leises Murmeln setzte ein, als einige der Männer das Interesse zu verlieren begannen.
Und dann …
»Ich … Oh!« Die Hellseherin zuckte zurück.
Hopper drückte sanft die Schulter seiner Frau, und sie legte ihre Hand auf seine.
Die Wahrsagerin schloss die Augen. Sie hatte das Gesicht zu einer Grimasse verzogen, als würde sie starke Schmerzen empfinden.
Hopper spürte, wie Diane seine Hand fester packte. Er fühlte sich immer unwohler. Das alles war nur Show, doch die Atmosphäre im Raum hatte sich merklich verändert. Die fröhliche Stimmung, die noch vor wenigen Sekunden geherrscht hatte, war Anspannung gewichen.
Hopper räusperte sich.
Langsam öffnete die Wahrsagerin die Augen und neigte den Kopf, um einen weiteren Blick in die Kristallkugel zu werfen. »Ich sehe … Ich sehe …« Dann schüttelte sie den Kopf und kniff die Augen so fest zusammen, als hätte sie nicht vor, sie je wieder zu öffnen. »Da ist … Dunkelheit. Eine Wolke … Nein, eher eine Welle, die sich immer höher auftürmt und bricht … bricht.«
Diane rutschte unruhig auf ihrem Stuhl hin und her und sah zu Hopper auf.
»Licht … Da ist …« Die Hellseherin verzog das Gesicht, als hätte sie in eine Zitrone gebissen. »Da ist … Nein, kein Licht. Es ist … Abwesenheit. Leere. Dunkel, eine Wolke, wie eine Welle, die heranrollt und bricht … bricht …« Sie keuchte auf.
Erschrocken zuckte Diane zusammen, genau wie die Hälfte der anderen Frauen, die um den Tisch saßen.
Hopper schüttelte den Kopf. »Wenn das ein dummer Scherz sein soll …«
Die Hellseherin schüttelte in einem fort den Kopf. »Dunkelheit. Da ist nichts als Dunkelheit. Eine riesige Wolke. Die schwarze Schlange …«
»Ich denke, das reicht«, sagte Hopper.
»Die Dunkelheit kommt. Eine Nacht ohne Ende. Ein Tag ohne Dämmerung. Der Tag der …«
»Ich habe gesagt, es reicht!« Hopper schlug mit der geballten Faust auf den Tisch.
Die Hellseherin riss die Augen auf und schnappte erschrocken nach Luft. Mit überraschtem Gesichtsausdruck sah sie sich blinzelnd um, als wäre sie aus einer tiefen Trance erwacht.
Und dann begannen alle durcheinanderzureden. Die Frauen standen hastig von ihren Plätzen auf, auf einmal peinlich berührt, überhaupt an der ganzen Scharade teilgenommen zu haben, während sich die Männer im Hintergrund weiter ihren Unterhaltungen widmeten.
Als Diane sich ebenfalls erhob, bot Hopper ihr seinen Arm an.
»Alles in Ordnung?«
Diane nickte und rieb sich über die Stirn. »Ja, es geht mir gut.« Sie drehte sich zu ihm um und schenkte ihm ein schwaches Lächeln.
Hopper wandte sich der Hellseherin zu. »Hören Sie, ich habe keine Ahnung, was das alles soll, aber das hier ist eine Geburtstagsparty für Kinder, verdammt noch mal. Wenn Sie Leute erschrecken wollen, sollten Sie sich Ihre Show vielleicht besser für Halloween aufsparen.«
Die Wahrsagerin sah mit ausdrucksloser Miene zu Hopper auf, wirkte aber, als müsste sie sich konzentrieren, um ihm folgen zu können.
Die Menschen um sie herum verließen nach und nach den Raum, und auch Hopper wandte sich zum Gehen.
»Alles okay?«, fragte Diane ihn.
Als Hopper sich nach ihr umsah, stellte er jedoch fest, dass sie nicht mit ihm gesprochen hatte, sondern mit der Wahrsagerin, die mit Zeigefinger und Daumen ihre Schläfen massierte.
»Ja … Ja. Hören Sie, es tut mir leid. Wirklich. Ich bin mir selbst nicht ganz sicher, was da über mich gekommen ist.«
»Also, ich weiß es«, knurrte Hopper, bevor er Diane an der Schulter fasste, um sie hinauszudirigieren. An der Tür drehte er sich noch einmal um. Die Frau, die nun allein am Tisch saß, wirkte plötzlich noch jünger als zuvor. Der rote Schal und die Kristallkugel verliehen ihrem Anblick etwas Lächerliches. »Ich werde Susan und Bill über diese Sache informieren.«
»Lass es einfach gut sein, Jim«, sagte Diane nachdrücklich und schüttelte kaum merklich den Kopf.
Hopper runzelte verärgert die Stirn, atmete laut aus, wandte sich dann jedoch ab und verließ den Raum. Erst als Sara fröhlich auf sie zugehopst kam, spürte er, wie seine Wut augenblicklich nachließ. In der einen Hand trug sie eine weiße Papiertüte mit roten Streifen, mit der anderen umklammerte sie so fest den Henkel einer braunen Pappschachtel, dass ihre Knöchel vor Anstrengung weiß hervortraten.
»Hey, Kleine, was hast du da?«, fragte Hopper, als er in die Knie ging, um seine sechsjährige Tochter hochzuheben.
»Geburtstagskuchen! Und einen Haustier-Stein! Alle Kinder haben einen bekommen. Meiner heißt Molly.«
»Okay«, sagte Hopper gedehnt und musterte skeptisch den kleinen Karton mit den Luftlöchern, den Sara ihm entgegenstreckte. »Glaubst du, Molly möchte auch was von dem Geburtstagskuchen abhaben?«
»So ein Quatsch, Daddy. Molly trinkt doch nur Limonade.«
»Natürlich tut sie das. Wie dumm von mir.«
Mit hochgezogenen Augenbrauen, den Mund zu einem erstaunten O aufgerissen, warf Hopper seiner Frau einen Blick zu. »Super, das bedeutet mehr Kuchen für uns!«
Mit einem Lachen zog ihn Diane am Arm. »Na los, lass uns gehen«, forderte sie ihn auf und folgte den anderen Eltern und Kindern den Flur hinunter in Richtung Haustür.
In der Eingangshalle warteten zwei der Entertainer, die für die Unterhaltung der Kinder zuständig gewesen waren und passend zum Unabhängigkeitstag als Uncle Sam verkleidet waren. Jedem Kind, das sich verabschiedete, drückten sie eine amerikanische Flagge an einem kurzen Stab in die Hand, an dessen Ende eine kleine Papiertüte mit Süßigkeiten befestigt war. Schnell drückte Sara ihrem Dad den Pappkarton mit dem Stein in die Hand und schnappte sich ebenfalls eine.
»Was sagt man, Sara?«, ermahnte ihre Mutter sie.
»Danke, Mr. Clown!«
Zu dritt stiegen sie die Stufen vor dem Haus hinunter, die auf den Bürgersteig führten, während die anderen Gäste in ihre Autos stiegen, die entlang der Straße geparkt waren. Die Hoppers waren zu Fuß gekommen. Sie wohnten nicht weit entfernt.
Kaum dass sie ein paar Meter gegangen waren, spürte Hopper, wie Sara an seiner Hand zog. Er ließ sie los, erleichtert darüber, dass sie offensichtlich noch ein bisschen Energie loswerden wollte, bevor sie in ihr Apartment ein paar Häuserblocks weiter zurückkehren würden.
Diane hakte sich bei ihrem Mann unter und lehnte den Kopf an seine Schulter. »Großartige Party.«
»Ja, großartige Party«, bestätigte Hopper. »Ich hatte die ganze Zeit Angst, Rotweinspritzer auf irgendetwas zu hinterlassen, für das ich nie im Leben aufkommen könnte; und dann haben wir auch noch einen Ausblick auf die kommende Apokalypse von einer Untergangsprophetin erhalten.« Er hob den Pappkarton mit den Luftlöchern an. »Und außerdem haben wir unerwarteten Familienzuwachs bekommen. Wirklich, eine großartige Party. Ich freue mich schon auf die im nächsten Jahr.«
Mit einem Lachen löste sich Diane von ihm, um spielerisch gegen seine Schulter zu boxen. »Ach, komm schon, so schrecklich war es auch wieder nicht. Lisa hat nur …« Auf der Suche nach den richtigen Worten gestikulierte sie mit den Händen in der Luft.
»Lisa?«
»Lisa Sargeson, die Wahrsagerin. Sie ist die Mutter von einem Kind aus Saras Klasse. Die ganze Zauberei ist so eine Art Nebenjob für sie.«
»Hellsehen ist Zauberei?«
»Na ja, das war noch nicht alles. Vorher hat sie uns ein paar richtig gute Entfesselungstricks mit Ketten und Schlössern vorgeführt. Janice McGann hat sich als Freiwillige gemeldet und wurde in Handschellen gelegt. Sie hat beinahe einen Herzinfarkt bekommen, als Lisa behauptet hat, die Schlüssel verlegt zu haben.«
Hopper musste grinsen. »Und was sollte dann dieser ganze Aufstand beim Hellsehen? Reine Übertreibung?«
Diane zuckte mit den Schultern. »Ich denke, sie hat sich ganz einfach ein bisschen reingesteigert.«
Hopper stieß einen leisen Pfiff aus. »Nicht nur ein bisschen …«
»Was für eine Party.«
»Das kannst du laut sagen. Saras ganze Klasse war eingeladen, inklusive aller Eltern. Aber ich bin mir sicher, dass sie noch mehr Angestellte als Gäste hatten. Unterhaltungsprogramm für die Erwachsenen? Erzähl mir bloß nicht, dass Susan und Bill das nicht nur gemacht haben, um zu zeigen, was sie haben.«
»Ich hatte Spaß. Offensichtlich ganz im Gegenteil zu dir.«
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Musst du auch nicht. Ich hab’s dir angesehen.«
»Ich habe dir doch gerade erklärt, dass ich nur Angst hatte, irgendwas dreckig zu machen.«
»Schon klar.«
»Ja, schon klar!«
»James Hopper«, sagte Diane und hakte sich erneut bei ihm unter. »Ich weiß genau, dass du die ganze Zeit über schrecklich angespannt warst. Du musst lernen, die Dinge auch mal ein wenig lockerer zu sehen.«
Hopper öffnete den Mund, schloss ihn jedoch gleich wieder. Dann hob er die Schultern, nur um festzustellen, dass es ihm schwerfiel, sie wieder fallen zu lassen. »Es ist nur so, dass …«
»Nur was?«
»Dieses Haus. Diese Leute. Okay, die Palmers sind ganz nett, aber sie sind … anders als wir. Anders als alle anderen Eltern. Überleg mal, die haben die Party nur deshalb nicht in ihrem Haus in den Hamptons geschmissen, weil sie wissen, dass sich keine der anderen Familien erlauben kann, eine ganze Tankfüllung zu verpulvern, nur um da rauszufahren.«
»Das stimmt nicht.« Diane grinste amüsiert.
»Okay, vielleicht nicht.« Hopper gelang es endlich, seine Schultern zu entspannen. »Aber jetzt mal im Ernst, dieses Haus? Komm schon, so leben doch keine normalen Leute. Und wenn sie tatsächlich so viel Geld haben, warum schicken sie die Zwillinge dann auf eine öffentliche Grundschule?«
»Hey, die Schule ist vollkommen in Ordnung. Andernfalls würde ich nicht dort arbeiten – und schon gar nicht Sara dorthin schicken.«
»Ich weiß, ich weiß«, sagte Hopper, »aber in der Gegend gibt es doch mindestens ein Dutzend schicker Privatschulen, auf die sie ihre Kinder schicken könnten. Ich meine, würdest du Sara nicht auch eher an eine von denen schicken, wenn wir uns das erlauben könnten? Ihre Grundschule ist vielleicht ganz in Ordnung, aber wir sprechen hier schließlich immer noch über das öffentliche Schulsystem von New York.«
»Und wenn ich nicht daran glauben würde, dass es funktioniert, würde ich ganz sicher nicht so viel Herzblut und Schweiß in meinen Job stecken, oder?« Diane sah zu Hopper auf. »Du bist nicht der Einzige in dieser Familie, der versucht, etwas zu verändern, Jim. Ich bin nicht nur deshalb in diese Stadt gezogen, um dich von der Seitenlinie aus anzufeuern. Das solltest du dir ab und zu in Erinnerung rufen.«
Hopper nickte und zog Diane wieder an sich. Natürlich gab es mehr als genug Probleme hier in New York, aber Saras Schule war tatsächlich gut. Ihm war klar, wie glücklich sich Diane schätzen konnte, ausgerechnet dort eine Anstellung gefunden zu haben, wenn man sich den derzeitigen Zustand der Bildungseinrichtungen in der Stadt vergegenwärtigte. Diane hatte ihm von Schulen erzählt, in denen die Lehrer an manchen Tagen erst gar nicht zum Unterricht erschienen und wo Kinder, die nicht einmal zwölf Jahre alt waren, eine Flasche Wein kreisen ließen – ohne dass die Lehrer eingriffen. Weil diese wussten, dass jeglicher Versuch autoritären Auftretens ignoriert, wenn nicht sogar mit Gewalt beantwortet wurde. Dabei handelte es sich natürlich um Extrembeispiele, doch es gab Zeiten, da kam einem die gesamte Stadt wie ein einziges großes Extrembeispiel vor. Willkommen in New York im Jahr 1977: so gut wie pleite und mit öffentlichen Einrichtungen gesegnet, deren Infrastruktur schon seit Langem vor sich hin bröckelte.
Nicht dass Hopper ihren Entschluss herzuziehen jemals bereut hatte. Ganz im Gegenteil. Für ihn war es genau die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt gewesen. Nachdem er aus Vietnam zurückgekehrt war, war ihm das kleine Hawkins in Indiana wie ein Paralleluniversum erschienen. Während er Blut und Schweiß und – wie er sich oftmals sicher gewesen war – einen Teil seines Verstandes an einen endlosen Krieg verschwendet hatte, der aus einem Grund ausgetragen worden war, den bis heute niemand wirklich verstand, hatte sich das amerikanische Kleinstadtleben kein bisschen verändert. Und manchmal fragte sich Hopper, ob es das jemals tun würde oder auch nur konnte.
Nach seiner Rückkehr war er rastlos gewesen und hatte sich mit der Zeit kaum mehr Mühe gegeben, seine innere Unruhe zu verbergen. 1969 war er mit Diane zusammengekommen, und er war dankbar für die Ablenkung gewesen. Ihre Romanze hatte sich schnell entwickelt und war 1971 von der Geburt ihrer Tochter Sara gekrönt worden. Auch das hatte geholfen. Zumindest für eine Weile. Doch Hawkins, Indiana, war noch immer Hawkins, Indiana, gewesen. Das private Glück hatte nicht besonders lange über diese Tatsache hinwegtäuschen können. Hopper hatte etwas … anderes gebraucht. Etwas Größeres.
Eine größere Stadt.
Eine Stadt wie New York City.
Es hatte eine Weile gedauert, bis er Diane zu dem Umzug hatte überreden können, und noch immer verspürte Hopper ab und an einen Anflug von Schuldgefühlen. So gern seine Frau ihn in dem, was er tun musste, auch unterstützte, der Umzug nach New York war für sie in mehr als nur einer Hinsicht ein großer Schritt gewesen. Hawkins war klein und konnte eine beinahe einschläfernde Wirkung entfalten, aber diese Kleinstadt war nun mal ihr Zuhause, samt Familie und Freunden. Es war ein sicherer, bequemer Ort. Und als die Erinnerungen an Vietnam langsam zu verblassen begonnen hatten, war das Leben dort … leicht geworden.
Doch vielleicht war genau dies das Problem gewesen. Sicher, bequem und leicht waren gute Eigenschaften, aber Hopper hatte bald festgestellt, dass es nicht das war, was er sich wirklich wünschte. Zwei Einsätze in Vietnam hatten ihn verändert, und nach seiner Rückkehr hatte er das Gefühl gehabt, von der Vorstadtidylle verschluckt zu werden. Er hatte die Zeichen früh erkannt – genau wie Diane, wofür er ihr zutiefst dankbar war. Er verließ sich auf ihre Unterstützung, ohne die er … Nun, er wusste nicht, wo er heute stünde. Aber er hatte gesehen, wie es anderen ergangen war, die aus dem Krieg zurückgekehrt und zugrunde gegangen waren.
Hopper hatte eine Veränderung gebraucht. Also hatten sie eine herbeigeführt. Sie waren nach New York gezogen. In eine riesige Stadt. In eine Stadt, die mehr als genug Probleme hatte – und Hilfe bitter nötig. Hopper hatte gewusst, dass er es schaffen konnte, egal wie schwer es auch werden würde. Eine Feuertaufe in einer Stadt, die schon damals von manchen als Hölle auf Erden angesehen wurde. Aber das war genau das, was er wollte, vor allem das, was er brauchte.
Im Frühjahr 1972 hatte Diane schließlich zugestimmt. Hoppers Argument, dass sie es jetzt tun sollten, da sie noch jung und in der Lage waren, sich auf etwas Neues einzulassen, war ausschlaggebend gewesen, und sie waren zu dem Schluss gekommen, dass es ihnen allen dreien guttun würde.
Hoppers einwandfreier Lebenslauf war ihm zugutegekommen: An seinen Militärdienst hatten sich dreieinhalb Jahre solide Polizeiarbeit in Hawkins angeschlossen. Das und eine Handvoll Empfehlungsschreiben in Kombination mit den Erfahrungen, die er beim Militär gesammelt hatte, hatten ihm einen Platz in einem Programm der chronisch unterbesetzten New Yorker Polizeibehörde verschafft, in dem Streifenpolizisten mit speziellen Fähigkeiten im Schnelldurchlauf zu dringend benötigten Detectives ausgebildet wurden. Nach wenigen Monaten als Streifenpolizist, in denen er so viel über die Stadt und die Polizeibehörde gelernt hatte wie möglich, hatte Hopper sich mit einer Dienstmarke in der Tasche an seinem eigenen Schreibtisch wiedergefunden. Er hatte hart gearbeitet, jede Menge Überstunden geschoben und war dafür belohnt worden. Als Budgetkürzungen zu einer Entlassungswelle in der Behörde geführt hatten, war er ein weiteres Mal befördert und versetzt worden – dieses Mal ins Morddezernat.
Hopper war niemals in seinem Leben glücklicher gewesen. Sicher, sie besaßen nicht viel – und das war es auch, was ihn bei den Palmers so gestört hatte, der vollkommen überflüssig zur Schau gestellte Wohlstand –, aber sie waren glücklich. Sie wohnten in einem Apartment in einem Viertel Brooklyns, das keinen allzu schlechten Ruf hatte. Diane hatte einen Job an einer Grundschule, die in Ordnung war oder zumindest mittelmäßig, aber sie hätte es auch sehr viel schlechter treffen können. Sara war ein aufgewecktes Kind, das in der neuen Schule – obwohl sie gerade erst in die erste Klasse gekommen war – gut zurechtkam. Natürlich half es, dass Diane in der Nähe war; zwar hielt sie ihr nicht die ganze Zeit über die Hand, aber sie konnte ihre Tochter im Auge behalten. Immerhin war das hier immer noch New York City.
Ein Zerren an seinem Oberschenkel riss Hopper aus seinen Gedanken. Als er an sich hinabsah, erblickte er Sara, die mit aller Kraft an seinem Bein zog. Das Haus, in dem sie wohnten, befand sich nur noch wenige Meter entfernt.
»Komm! Komm, Daddy!«, rief Sara aufgeregt. »Es ist Zeit für Kuchen, Daddy!«
»Genau. Weil unsere junge Dame hier heute ganz besonders dringend noch eine Ladung Zucker braucht.« Lachend hob Hopper seine Tochter hoch und setzte sie sich auf die Hüfte.
Diane ging ein paar Schritte voraus, um die Haustür aufzuschließen. Doch anstatt hineinzugehen, blieb sie vor der Tür stehen, was dazu führte, dass Hopper, der sich ganz auf seine Tochter konzentrierte, in sie hineinlief.
»Was ist?«
Diane sah sich zu ihrem Mann um. »Ist das unser Telefon?«
Hopper lauschte. Diane hatte recht, über ihnen war ein Läuten zu hören, und ziemlich sicher kam es aus ihrem Apartment im ersten Stock.
»Hier.« Hopper übergab Sara an Diane. »Ich laufe schnell hoch, vielleicht schaffe ich es noch ranzugehen. Es könnte wichtig sein.«
Dann rannte er, zwei Stufen auf einmal nehmend, die Treppe hinauf.
»Hallo?«
»Hop, du bist wirklich nicht leicht zu finden«, begrüßte ihn eine tiefe weibliche Stimme mit einem heiseren Unterton, die Hopper nur allzu vertraut war.
»Das will ich hoffen, Delgado. Heute ist Unabhängigkeitstag, und meine einzige Pflicht bestand darin, Sara zu einer Geburtstagsfeier zu begleiten.«
»Ich fürchte, ich muss dich noch zu einer anderen Party bitten.«
Hopper lehnte sich an die Wand neben dem Kühlschrank, an der das Telefon hing, als er spürte, wie sich sein Puls beschleunigte. Wenn ihn Detective Rosario Delgado – seit sechs Wochen seine Partnerin – an seinem freien Tag anrief, dann hatte sie einen verdammt guten Grund dafür. Und Hopper hatte das ungute Gefühl, dass er diesen bereits kannte.
Er hörte, wie Sara und Diane die Wohnung betraten. Kurz darauf kam seine Frau in die kleine Küche und sah ihn fragend an. Hopper nickte knapp.
»Hey, Zentrale an Detective James Hopper, bitte kommen!«
Hopper richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf das Telefongespräch. »Sorry.« Er schwieg einen Moment. »Es ist wieder passiert, oder?«
»Du solltest so schnell wie möglich herkommen.«
Hopper nickte. »Bin schon auf dem Weg. Wie lautet die Adresse?« Er drehte sich um die eigene Achse, um nach Papier und Stift Ausschau zu halten, doch Diane hatte bereits verstanden und hielt ihm einen Block und einen Bleistift hin, die zum Schreiben der Einkaufsliste stets griffbereit auf dem Küchentresen lagen. Er formte ein stummes »Danke« mit den Lippen, bevor er den kleinen Notizblock gegen die Wand neben dem Telefon drückte, um die Informationen, die Delgado ihm durchgab, mitzuschreiben. »Okay, ich hab alles. Bin gleich da.«
»Ich werde den roten Teppich ausrollen«, sagte Delgado trocken, dann war ein Klicken zu hören, und die Verbindung war unterbrochen.
Hopper hängte den Hörer zurück in die Gabel. Als er Dianes Hand auf seiner Schulter spürte, legte er seine darauf und drehte sich zu ihr um.
»Hör zu …«, begann er.
Diane nickte. »Du musst gehen.«
»Ja. Tut mir leid.«
Diane schenkte ihm ein Lächeln. »Du musst dich nicht entschuldigen. Entschuldige dich niemals dafür, dass du deinen Job machst.«
»Ich mache es wieder gut.«
»Und ich werde dich daran erinnern.«
Hopper löste sich von ihr und ging zur Tür. Nachdem er sie geöffnet hatte, drehte er sich noch einmal zu Diane um. »Ich rufe dich später an.«
Dann sah er zu Sara hinüber, die am Küchentisch saß und damit beschäftigt war, die Reste des Geburtstagskuchens zu verputzen. »Hey, lass mir was übrig, Kleine!«, rief Hopper seiner Tochter zu.
Sara sah mit einem Lächeln zu ihm auf. Ihr Gesicht war beinahe vollständig von blauem und rotem Zuckerguss bedeckt.
Diane gab Hopper einen Kuss auf die Wange. »Pass auf dich auf.«
»Wird gemacht«, sagte er, küsste sie auf den Mund und zog die Tür hinter sich zu.
Kapitel zwei DAS DRITTE OPFER
4. JULI 1977
Brooklyn, New York
»Was für eine Sauerei.«
Hopper sah zu dem uniformierten Officer hinüber, nicht sicher, ob dieser den Zustand des Apartments oder das Verbrechen an sich meinte. Wahrscheinlich beides, dachte er, als er sich mit geballten Fäusten vorsichtig einen Weg durch den Flur bahnte. Darauf bedacht, nichts zu berühren und der kleinen Armee aus Beamten, die die ganze Wohnung durchkämmten, bei ihrer Arbeit nicht in die Quere zu kommen.
Während er sich aufmerksam umsah, versuchte er sich jedes Detail so gut wie möglich einzuprägen, so wie er es an jedem Tatort tat. Natürlich würden aus jedem nur erdenklichen Winkel Fotos aufgenommen werden, irgendjemand würde eine Zeichnung anfertigen und jemand anders jeden Zentimeter der Wohnung vermessen und jeden noch so kleinen Gegenstand mit einem gelben Fähnchen markieren. Doch nichts davon konnte den ersten Eindruck ersetzen, den er sich persönlich vom Schauplatz eines Verbrechens machte. Nur so bekam er ein Gefühl für den Ort, die Raumaufteilung, die gesamte Szenerie und das Verhältnis, in dem ein Raum und ein Objekt zu einem jeweils anderen stehen.
Der Polizist hatte recht. Es war tatsächlich eine Sauerei. Im Flur reihten sich Müllsäcke aneinander, von denen seit einiger Zeit keiner mehr bewegt worden zu sein schien. Und als Hopper in die Zimmer sah, die rechts und links vom Gang abgingen, bot sich ihm ein ähnlicher Anblick. Das ganze Apartment glich einer Müllhalde. Allerdings konnte Hopper keinen besonderen Gestank feststellen. Es roch lediglich ein wenig nach abgestandener Luft – wie jedes Apartment, das während einer Hitzewelle lange nicht mehr gelüftet worden war.
Das änderte sich jedoch, je näher er dem Zimmer kam, in dem sich die Leiche befand. Schon bald stieg ihm der charakteristische ranzige Geruch von Tod in die Nase, wie er etwa von einer häufig benutzten Schlachtbank eines Metzgers ausging. Angesichts der Hitze wunderte es Hopper allerdings, dass er nicht sehr viel schlimmer ausfiel.
»Detective Hopper, wie nett, dass Sie vorbeischauen.«
Als Hopper sich umdrehte, entdeckte er seine Partnerin Detective Rosario Delgado, die mit in die Hüften gestemmten Händen im Türrahmen des Zimmers stand, an dem er gerade vorbeigegangen war.
Sie trug eine Jeans mit Schlag, die in der Taille von einem fünfzehn Zentimeter breiten braunen Gürtel zusammengehalten wurde und dazu ein hellblaues Poloshirt, das sie so weit wie möglich aufgeknöpft hatte und das ihre olivfarbene Haut betonte. Ihre goldene Polizeimarke baumelte an einer Kette um ihren Hals und schlug mit jeder Bewegung leicht gegen den untersten Knopf ihres Shirts.
Der Anblick ihrer Marke erinnerte Hopper daran, seine ebenfalls anzustecken. Er zog sie aus der Gesäßtasche seiner Hose und befestigte sie an seinem Gürtel.
Während Delgado ihn von oben bis unten musterte, breitete sich langsam ein Grinsen auf ihrem Gesicht aus. »Nettes Hemd«, bemerkte sie. »Erzähl mir jetzt nicht, dass es eine Kostümparty war und du als Holzfäller gegangen bist.«
Hopper blickte verlegen an sich hinab. Er trug eine Jeans, ein rot kariertes Hemd und Chelsea Boots, die mit dem breiten Absatz an Cowboystiefel erinnerten. »Was soll ich sagen, ich stehe eben auf Karos.«
»Und ich bin mir sicher, dass die Frauen deswegen ganz verrückt nach dir sind.«
Er machte eine vage Geste in ihre Richtung. »Wo wir gerade vom Dresscode sprechen …«
Delgado zuckte mit den Schultern. »Als der Anruf kam, war ich gerade auf dem Weg ins Studio 54.«
»Wirklich?«
»Nein, natürlich nicht, verdammt noch mal. Es ist heiß. Was soll ich sonst machen?« Sie trat auf den Flur und gab Hopper ein Zeichen, ihr zu folgen. »Komm mit.«
Am Ende des Gangs befanden sich zwei weitere Türen, die von zwei uniformierten Beamten bewacht wurden. Delgado trat an einem von ihnen vorbei in das dahinterliegende Zimmer, Hopper folgte ihr.
Er ließ den Blick durch den Raum gleiten. Nicht, weil er sich den Anblick des Horrorszenarios in der Mitte ersparen wollte, sondern um sich zuerst – wie bereits im Flur – jedes Detail genau einzuprägen. Den Schnitt des Zimmers. Die Einrichtung. Die Dimensionen. Die Beziehung, in der die Gegenstände im Raum zueinander standen. Den Schauplatz des Verbrechens.
Sie standen in einem Schlafzimmer. Die braun gestreifte Tapete wirkte weder alt noch sonderlich neu. Es gab ein rechteckiges Fenster mit grün gestreiften Vorhängen, die genug Licht hereinließen. Teppich in einem wilden blau-roten Blumenmuster bedeckte den Boden. An einer Wand stand eine Kommode, deren Holzfarbton nicht zum Braun der Tapeten passte, darauf ein runder Rasierspiegel. Es gab keine Stühle. Die einzige Sitzmöglichkeit bot ein Einzelbett. Es sah so aus, als hätte jemand darin geschlafen und anschließend nur nachlässig die Laken glatt gezogen. Im Gegensatz zum Rest der Wohnung lag in diesem Zimmer relativ wenig Müll herum, wobei die Betonung auf relativ lag.
Erst ganz zum Schluss richtete Hopper seine Aufmerksamkeit auf das eigentliche Objekt des Interesses, das auf dem Bett lag und dessen Anwesenheit die Bruchbude erst zu dem machte, was es war: dem Ort eines Verbrechens.
Die Leiche. Ihr neuestes Opfer.
Delgado deutete auf das Bett. »Alles wie gehabt: Das Opfer ist männlich, Ende dreißig und gut in Form – wenn man davon absieht, dass sich das meiste Blut außerhalb seines Körpers befindet.«
Hopper trat einen Schritt näher, während seine Partnerin blieb, wo sie war, um ihm den Raum zu geben, den er brauchte, um sich alles genau anzusehen.
Das Opfer lag auf dem Rücken. Es trug eine blaue Anzughose und ein weißes Hemd, an dem die Ärmel hochgekrempelt waren. Seine Füße, die in schwarzen Socken und ordentlich polierten schwarzen Schuhen steckten, baumelten seitlich vom Bett hinunter. Sein Kopf lag neben dem Kissen. Der Deckenbezug aus dunkelbrauner Baumwolle hatte, wo er vom Blut durchtränkt worden war, eine beinahe schwarze Färbung angenommen. Die Brust des Mannes glich einem Schlachtfeld. Sein weißes Hemd war aufgerissen worden, und Hopper konnte das vertraute Muster dunkler Streifen auf der Haut erkennen.
Er holte tief Luft. Einen Arm vor die Brust gelegt und den Ellbogen des anderen daraufgestützt, strich er sich nachdenklich mit der Hand übers Kinn, bevor er langsam den Kopf schüttelte. »Genau wie bei den anderen.«
»Genau wie bei den anderen«, bestätigte Delgado. »Fünf Stiche, von denen ausgehend die Haut aufgeschlitzt wurde, um einen …«
»… fünfzackigen Stern zu formen«, ergänzte Hopper. »Einen verdammten fünfzackigen Stern.« Er sah seine Partnerin an. »Alles andere auch wie gehabt?«
Sie nickte. »Ja. Keine Anzeichen gewaltsamen Eindringens. Keine Kampfspuren. Keine Zeugenaussagen von Nachbarn, die irgendwas Verdächtiges gehört oder beobachtet haben.«
Hopper sah sich noch einmal in dem Schlafzimmer um, bevor er zum Fenster hinüberging und vorsichtig durch die halb aufgezogenen Vorhänge hinausspähte. »Wer hat ihn gefunden?«
»Der Hausmeister«, sagte Delgado. »Anscheinend hat sich irgendjemand über den Geruch beschwert. Deswegen ist er in die Wohnung gegangen, um nachzusehen.«
»Bekommen wir seine Aussage?«
»Haben wir schon. Er ist sehr kooperativ.«
Hopper nickte und wandte sich wieder dem Fenster zu. Das Haus lag an einer Straße, wie es sie zu Hunderten in Brooklyn gab. Ein paar Autos waren am Bordstein geparkt. Ein Wagen fuhr mit schnurrendem Motor die Straße entlang. Ein alter Mann in einer weißen Weste und mit einem schwarzen Filzhut auf dem Kopf ging vorbei. In die entgegengesetzte Richtung lief eine junge Frau an ihm vorüber, die ein kleines Mädchen an der Hand hielt. Beide trugen hoch geschlossene Kleider mit Blumendruck, die in einer leichten Brise umher flatterten.
Eine Straße wie jede andere.
Eine Straße wie die, in der Diane und er für sich und ihre Tochter ein Zuhause geschaffen hatten. Ihr Apartment lag ein wenig höher als dieses, aber machte das wirklich einen Unterschied? In jemandes Privatsphäre war eingedrungen worden. Jemand war in seiner eigenen Wohnung getötet worden. In dieser Hinsicht unterschied sich niemand vom anderen. Es spielte keine Rolle, wer man war oder wo man lebte. Er kannte den Mann, der auf dem Bett lag, nicht, doch er hätte ihn kennen können.
Was, wenn es Diane gewesen wäre?
Hopper verdrängte den Gedanken in den hintersten Winkel seines Kopfes. Der Job als Polizist brachte es mit sich, dass einem ständig gesagt wurde, dass man die Dinge nicht zu nah an sich herankommen lassen durfte. In jedem Lehrbuch und bei jedem Training wurde einem eingeschärft, dass man seine Arbeit mit einer gewissen Distanz betrachten musste, da sie einen andernfalls zerreißen würde. Und das stimmte. Hopper wusste das. Aber wenn er seine Arbeit nicht persönlich nehmen sollte, wie verdammt noch mal dann?
Der Trick – die Antwort – war, dass man es kontrollieren musste, bevor es selbst die Kontrolle übernahm.
Er sah auf die Straße hinunter. Draußen drehte sich die Welt weiter wie bisher. Hier drinnen war das eine ganz andere Geschichte.
Mit einem tiefen Atemzug versuchte Hopper, seine Gedanken zu ordnen, um seinen Job zu erledigen.
»Für alle, die nicht mitgeschrieben haben«, meldete sich Delgado irgendwo hinter ihm zu Wort, »das hier ist unser drittes Opfer. Die Tatorte sind die gleichen, und die Art des Tötens ist identisch. Alles ist identisch.«
Hopper schloss die Augen und kniff sich mit Daumen und Zeigefinger in die Nasenwurzel. »Ich muss vermutlich nicht fragen, ob wieder eine zurückgelassen wurde, oder?«
»Nein, musst du nicht.«
Hopper wandte sich um. Delgado hielt bereits die Plastiktüte mit dem Beweisstück in die Höhe. Er starrte einen Moment darauf, bevor er es in die Hand nahm.
In dem Plastikbeutel steckte eine Karte. Sie war rechteckig und etwa doppelt so groß wie eine Spielkarte aus einem normalen Kartendeck. Die eine Seite war weiß.
Noch bevor Hopper die Karte umdrehte, wusste er, was er auf der anderen Seite sehen würde.
Und er wurde nicht enttäuscht.
Die Zeichnung bestand aus drei geschwungenen schwarzen Linien, aufgetragen mit einem dicken Pinsel und schwarzer Tinte, die parallel und mit nur wenig Abstand zueinander von einer kurzen Seite der Karte zur anderen verliefen. Das Symbol war ein anderes als das auf den beiden Karten, die sie an den ersten Tatorten gefunden hatten, doch es stammte eindeutig aus derselben Serie.
»Eine weitere Karte für unsere Sammlung«, bemerkte Delgado, während sie die lockigen schwarzen Haare im Nacken zusammennahm, um ein wenig Luft an die Haut darunter zu lassen. Was in der stickigen Wohnung allerdings ein absolut hoffnungsloses Unterfangen war. »Ich würde vorschlagen, dass wir den Tatort jetzt den Profis überlassen. Die Hitze bringt mich um.«
Hopper nickte und reichte ihr die Karte.
Delgado gab sie an einen Mann von der Spurensicherung weiter, der im Türrahmen stand. Dann verließ sie das Zimmer.
Im Türrahmen blieb Hopper noch einen Moment stehen, um einen weiteren Blick auf die Leiche und den Tatort zu werfen. Er hielt die Luft an.
Drei Opfer. Jedes von ihnen mit fünf Stichen in der Brust, die der Mörder mit tiefen Schnitten zu einem Stern verbunden hatte.
Drei Opfer. Dreimal dasselbe Vorgehen. Es war nicht mehr von der Hand zu weisen: Brooklyn hatte einen Serienmörder, der seine Opfer in einer Art ritueller Handlung ins Jenseits beförderte.
Hopper atmete aus. Dann wandte er sich ab und verließ das Schlafzimmer.
Als ob New York nicht schon genug Probleme hätte.
26. DEZEMBER 1984Hoppers HütteHawkins, Indiana
»Was? Das war das dritte Opfer?«
Hopper starrte in seinen Kaffeebecher. Er war leer. Ein ganzer Becher Kaffee, dabei hatte er gerade erst angefangen. Er durfte sich nicht zu sehr in Details verlieren.
Ihm gegenüber am Tisch saß Elfi und schüttelte mit verwirrtem Gesichtsausdruck den Kopf.
Hopper stand auf, um seinen Kaffeebecher aufzufüllen. »Ja, das war das dritte Opfer. Zu dem Zeitpunkt arbeiteten wir seit fast zwei Monaten an dem Fall. Bei den ersten beiden Morden war bereits ein Muster zu erkennen gewesen, uns war also klar, dass wir in beiden Fällen nach derselben Person fahnden. Das dritte Opfer hat die Sache auf eine ganz andere Ebene gehoben. Ab da wussten wir, dass wir es mit einer Serie zu tun haben.«
Elfi zog konzentriert die Brauen zusammen. »Einer Serie? So wie im Fernsehen?«, fragte sie zögerlich.
Hopper ließ sich wieder auf seinen Stuhl fallen. »Oh … Nein, keine Fernsehserie. Ich meine eine Mordserie. Bei einer Mordserie tötet ein Mörder – der Serienkiller – ganz viele Menschen. Oft nach demselben Muster.«
»So wie Papa?«
Papa?
Dann dämmerte es ihm. Sie meinte Brenner. Doktor Brenner. Das Monster, das dafür verantwortlich war, dass Elfi in einem Labor aufgewachsen war.
Verdammt.
»Nein, das ist etwas anderes. Er war anders. Es ist … ziemlich kompliziert. Hör zu …« Er hielt inne und nahm einen Schluck von seinem Kaffee.