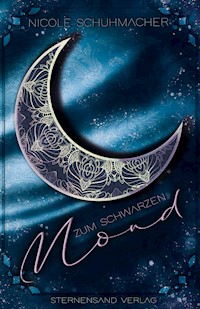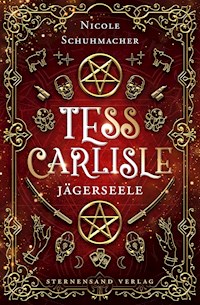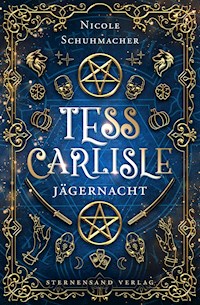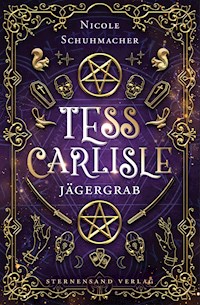11,99 €
11,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Ein fantastisches Epos um Gefühle, Abenteuer und die Macht der Magie
In einer Welt, regiert von Göttern und der Kraft der Magie, ist die junge Rika dazu ausersehen, dem Gott der Sturmkraft zu dienen. Doch Neid und Habgier haben die Magie in Verruf gebracht. Rika findet sich plötzlich inmitten eines Krieges wieder, in dem politische Intrigen und eifersüchtige Götter mit ihrem Schicksal spielen – bis sie beschließt, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Damit beginnt für Rika ein Abenteuer voll stürmischer Gefühle und Gefahren ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 608
3,0 (18 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cerlunes Schöpfung
Automatenlager II, nahe Gres, nördliches Hochthal - Im Jahre 239 nach dem ...
Königlicher Palast, Stadt Hochthal, Nördliches Hochthal - Im Jahre 239 nach ...
Copyright
Cerlunes Schöpfung
Als Vherc der Gründer innehielt, um die Welt zu bewundern, die er erschaffen hatte, strahlte sein metallenes Gesicht vor Freude; vielleicht war es aber auch nur der Glanz der heißen Feuer des Kosmos, die seinen kupfernen Leib umhüllten und sich nun in seinen gläsernen Augen spiegelten.
»Sie ist außerordentlich schön!«, sprach der Gründer zu den Herrschern der übrigen Elemente, die sich um ihn geschart hatten. Sein mildes Angesicht, die metallene Maske ewiger Güte, blickte auf die von Blitzen zerklüfteten Gipfel, auf wogende Wasser und Blüten, die vom Wind über die grüne Ebene zu seinen Füßen getrieben wurden. »Die Welt ist zu schön, um nur uns alleine vorbehalten zu bleiben.«
»Und was gedenkt Vherc der Gründer zu tun?«, fragte Aeledd. Vherc wandte dem jüngsten der Götter sein grimmiges Antlitz zu, die metallene Maske ewigen Zorns, aber den eben erst in die Welt getretenen Herrn der Stürme schreckte die stumme Zurechtweisung nicht.
»Mit wie vielen weiteren Elementen gedenkt der Gründer seine Schöpfung noch zu beschenken?«, fuhr er fort. »Wie viele Herren und Herrinnen kann denn Vhercs schöne Welt verkraften?«
Vherc antwortete nicht.
Er ließ seine Blicke über all die schweifen, die ihn umgaben, über die perfekten Leiber und Gesichter der jungen Göttinnen und Götter, und er fand, dass in der Frage des so leicht erregbaren Herrn der Stürme viel Klugheit lag. Selbst die Perlenaugen der lieblichen Sae blickten nun voller Argwohn auf ihre Brüder und Schwestern, als ob sie fürchtete, mit ihnen um einen Teil von Vhercs schöner Schöpfung wetteifern zu müssen.
Und so fasste Vherc den Entschluss, keine weiteren Herren zu erschaffen. Stattdessen wollte er ein Wesen gestalten, das seine Schöpfung beleben sollte, ohne selbst einen Anteil daran zu begehren.
So schuf er ein Erstes Wesen nach seinem Bilde aus Kupfer, Stahl, Kristall und Feuer.
Von den übrigen Göttern erbat er sich das Geschenk ihrer Elemente für sein Erstes Wesen, damit sie die Schönheit seiner Welt in ihrer Ganzheit würdigen könnten. So erfüllte Cyn das Wesen mit der ruhigen Macht der Erde, verlieh Sae ihm die unbändige Kraft des Wassers, teilte Leodun den ewigen Einfluss der Himmel mit ihm und Aeledd die wilde Stärke der Stürme. Aber die rohen Elementargewalten der jungen Gottheiten zerbrachen fast den festen Leib des Ersten Wesens; so erweckte Vherc sie, die er Cerlune nannte, zum Leben, bevor das göttliche Werk vollendet worden war. Nur so konnte er sie vor der sicheren Zerstörung bewahren.
Als das Erste Wesen Cerlune die gläsernen Augen öffnete, verstand sie nicht, was sie sah: Zu fremd war ihr die Welt, die sie umgab. Zwar waren in ihr die Elemente, die Geschenke der Götter, zu einer wundersamen Gabe verschmolzen - aber Bewusstsein hatte sie noch nicht erlangt.
Wie ein staunendes Kind wanderte Cerlune davon, um Vhercs Schöpfung zu erkunden: Das eigenartige Bündnis von Feuer, Erde, Wasser, Himmel und Sturm erregte ihre Wissbegier, ohne dass sie es wirklich verstand.
Vherc grämte sich über den Misserfolg, hatte er doch ein perfektes Wesen erschaffen wollen. So wandte er den anderen Göttern die Maske ewigen Zornes zu.
»Nur eine Gottheit kann dem Ansturm der Elemente widerstehen«, sprach der Gründer mit seinem grimmigen Antlitz. »Wir müssen nachgiebigere Kreaturen schaffen, deren Leib nicht sogleich zerbricht. Und damit ihr ihnen nicht mit eurem frischen Eifer schadet, werdet ihr mir eure Kräfte leihen. So bringen wir Wesen hervor, die den Kosmos und alles, was in ihm ist, verstehen.«
Feuer pulsierte in Vhercs gläsernen Adern, als er sprach, und die Herrinnen und Herren der Elemente senkten zustimmend ihre Häupter. So lieh denn Cyn dem Gründer die ruhige Macht der Erde, Sae die unbändige Kraft des Wassers, Leodun den ewigen Einfluss der Himmel und Aeledd die wilde Stärke der Stürme. Uns so schuf der Gründer die Menschen und die Tiere.
Als Vhercs Tochter Cerlune nun die Welt auf ihrer Suche nach Einsicht durchstreifte, verwirrt, einsam und ungeliebt, da erblickte sie auch die Menschen und Tiere, die der Gründer gestaltet hatte, und sie bewunderte ihre Zartheit und Schönheit.
Schon erfüllte sie der Wunsch danach, gleich dem Vater Wesen zu erschaffen, und so fragte sie ihn um Rat. Durch die Maske ewiger Güte sprach Vherc zu Cerlune: »Weich und nachgiebig muss ein Wesen sein, mein Kind. Und willst du ihm Macht verleihen, so mäßige sie, sonst werden deine Mühen vergebens sein und dein Werk vernichtet werden.«
So zog sich Cerlune in die Berge zurück, dahin, wo sie zuerst in die Welt getreten war, und setzte sich nieder, um ein Wesen hervorzubringen. Auf den Ratschlag des Gründers hörend gab sie ihrer Schöpfung nur einen geringen Teil ihrer Gabe mit.
Als das Wesen erwachte, erfreute es sich zweier Paare starker Gliedmaßen, krallenbewehrter Pranken und eines scharf bezahnten Mauls, und Cerlune war überaus zufrieden mit sich und ihrem Werk. Tränen der Freude rannen über ihre glatten Wangen. Nachdem sie eine Weile mit dem Wesen gespielt hatte, sprach Cerlune durch ihr mildes Angesicht, die metallene Maske ewiger Güte, zu ihm:
»Wisse, dass du mein ungezähmtes Kind bist. Dein Aussehen, deine Umgangsformen mögen grob sein, aber dein Leib ist fest und dein Glaube unerschütterlich. Von nun an sollst du als Jixur bekannt sein, und du sollst Vhercs Schöpfung achten.«
Und Cerlune wanderte weiter.
Als sie die Wüste erreichte, in der sie auf die ersten Menschen getroffen war, setzte sie sich nieder, um ein weiteres Wesen hervorzubringen. Auf den Ratschlag des Gründers hörend gab sie ihrer Schöpfung nur einen geringen Teil ihrer Gabe mit.
Als das Wesen erwachte, erfreute es sich acht kräftiger Gliedmaßen, grimmiger Gesichtszüge und einer rauen, starken Stimme, und Cerlune war überaus zufrieden mit sich und ihrem Werk. Tränen der Freude rannen über ihre glatten Wangen. Nachdem sie eine Weile mit dem Wesen gespielt hatte, sprach Cerlune mit ihrem milden Angesicht, der metallenen Maske ewiger Güte, zu ihm:
»Wisse, dass du mein grimmiges Kind bist. Du magst grob wirken, doch dein Leib ist stark und dein Verstand scharf. Von nun an sollst du als Verjig bekannt sein, und du sollst Vhercs Schöpfung achten.«
Und wieder wanderte Cerlune weiter.
Als sie die Seen in der Mitte des Landes erreichte, setzte sie sich nieder und brachte erneut ein Wesen hervor. Doch diesmal gab sie ihre Gabe in reichem Maße weiter, denn sie hatte bereits zwei Kreaturen hervorgebracht, die ihr wohlgeraten waren.
Als das Wesen erwachte, erfreute es sich zweier Paare schlanker Arme und eines wohlgestalteten Leibes, und die Elemente kreisten stark in seinem Blute, so dass Cerlune überaus zufrieden mit sich und ihrem Werk war. Tränen der Freude rannen über ihre glatten Wangen. Nachdem sie eine Weile mit dem Wesen gespielt hatte, sprach Cerlune mit ihrem milden Angesicht, der metallenen Maske ewiger Güte, zu ihm:
»Wisse, dass du mein anmutiges Kind bist. Ich erschuf dich nach meinem Bilde, und es gelang mir gut. Von nun an sollst du als Kind der Cerlune bekannt sein, und du sollst Vhercs Schöpfung achten.«
So waren die großen Arten entstanden.
Und Cerlune wanderte weiter.
Aus: »Die Schelmin. Entstehung, Errungenschaftenund Wanderungen« von Nirgunamatra,Jahr 13 nach dem Zerfall des Mittleren Reiches
Automatenlager II, nahe Gres, nördliches Hochthal
Im Jahre 239 nach dem Zerfall des Mittleren Reiches, Erstwinter
Rika Robertstochter!«
Die junge Frau war so sehr in ihre Lektüre vertieft, dass sie die Ankunft ihres Vorgesetzten nicht bemerkt hatte; hastig schlug sie das sperrige, in Leder eingebundene Buch zu und sprang auf. Der durch das Zuklappen erzeugte Luftstoß blies ihre kurzen, gelockten Stirnfransen nach hinten, ihr plötzliches Aufspringen sorgte dafür, dass der Schemel ins Wanken geriet. Rika versuchte noch, nach dem Hocker zu greifen, auf dem sie eben noch gesessen und studiert hatte, aber es war bereits zu spät. Mit lautem Scheppern stürzte der Schemel um, Metall schürfte über glatten Stein. Der Krach hallte unangenehm von den Wänden des von bläulichem Licht erhellten Gewölbes wider.
»Das war laut.«
Im dunklen Gesicht des stämmigen Leutnants zeigte sich keine Regung, als er erst Rika und dann dem umgestürzten Schemel prüfende Blicke zuwarf.
»Weshalb so schreckhaft? Hast du etwas ausgefressen?«
»Ab… aber nein, natürlich nicht, Joseph«, stammelte Rika, deren Gesicht sich schlagartig verfärbte. Sie hob das Buch ein wenig an, damit der Leutnant einen Blick auf den Einband werfen konnte. »Ich habe bloß gelesen.«
Der Leutnant zog die Augenbrauen hoch - zwei finstere Balken über glänzenden, schwarzen Punkten.
»Bloß gelesen, ach so. Ich … verstehe.«
Rikas bernsteinfarbige Augen verengten sich, als ein Gefühl von Ärger in ihr aufstieg.
Darauf, dass sie wie zahlreiche andere Kinder ihrer ländlichen Heimatregion viele Sommer hintereinander in der Obhut der Brüder und Schwestern der Cyn verbracht hatte, war sie stolz: Im Kloster Cornel war Rikas Wissbegierde, ihr Interesse an Altem wie Neuem, geweckt worden. Durch die Schriftkunde hatten sich ihr faszinierend neue Welten erschlossen … und die Vorstellung, in der Nacht heimlich in den riesigen Bücherregalen des Klosters zu stöbern, erfüllte sie noch heute mit einem wohligen Schauer. Umso weniger konnte Rika die merkwürdige Reaktion des Sturmwerker-Leutnants nachvollziehen; eine steile Falte erschien auf ihrer Stirn, als sie die sommersprossige Nase rümpfte.
»Jawohl, es ist eine religiöse Schrift - na und? Hättest du das Lesen nicht erlernt, wärst du kein Sturmwerker geworden, und dann wäre all das hier …«, sie deutete auf den bläulich beleuchteten Kellerraum des unterirdischen Automatenlagers, »… nicht passiert! Außerdem habe ich alles getan, was eine Sturmzwingerin überhaupt nur tun kann: Das Lager selbst, alle Automaten und jeder einzelne Kubus sind aufgeladen und bereit! Ich habe den Ladestand sogar täglich kontrolliert, obwohl mir niemand, auch du nicht, den Befehl dazu erteilt hat - also spricht wohl nichts dagegen, wenn ich eine ruhige Minute dazu nutze, ein Buch zu lesen!«
Der Offizier zuckte mit den Achseln, so dass sich der Stoff des hellen Waffenrocks kräuselte.
»Für Soldaten gibt es immer etwas Sinnvolles zu tun.«
Rika schnaubte aufgebracht. »Joseph …«
… da erst bemerkte sie, dass ein leichtes Lächeln die Lippen ihres Vorgesetzten umspielte.
»Du willst mich bloß reizen!«
»Nichts läge mir ferner.«
In Josephs Tonfall schwangen weder Spott noch Humor mit, als er das sagte, aber sein Lächeln wurde wärmer.
»Deiner Reaktion nach zu schließen, bist du schon genug gereizt. Macht dir der Gedanke an den bevorstehenden Feldzug denn so sehr zu schaffen?« Der Leutnant schüttelte knapp den Kopf. »Du brauchst dich nicht um uns zu sorgen, Rika. Krieg ist nun einmal unser Handwerk, und der Tod gehört eben zum Geschäft.«
Rika wich dem forschenden Blick des Mannes aus, indem sie sich bückte, um den Schemel wieder aufzustellen.
Es war nicht so, dass Joseph im Unrecht war; zwar fürchtete sie den Feldzug und den wohl unausweichlichen Krieg … aber nicht aus den Gründen, die der Sturmwerkerleutnant bei ihr vermuten mochte.
Die Machenschaften der Matriarchin des benachbarten und vom Gebirge umschlossenen Reiches Craiglin hatten den Tod von Rikas Vater und etlicher ihrer Freunde verursacht. Dass die junge Frau die Gelegenheit bekommen hatte, die Matriarchin persönlich zur Rechenschaft zu ziehen, das hatte sie mit einer gewissen Befriedigung erfüllt - auch wenn ihre Vergeltung all die schlimmen Dinge nicht hatte ungeschehen machen können. Und ausgerechnet Aeledd, der zornige Herr der Stürme, hatte ihr dabei geholfen, zu ihrem Recht zu kommen, denn dank seiner Gnade vermochte sie nun die Gewitter zu beherrschen …
Den aufständischen Überresten der Zweiten Armee hatte sie sich aus freien Stücken angeschlossen, und allein durch ihre Fähigkeit war diese neue Sturmwerkerarmee wieder zu einer ernstzunehmenden Streitmacht geworden. Natürlich gefiel es der heranwachsenden jungen Frau, eine solch wichtige Position innezuhaben, und das Wissen, dass so viele Soldaten auf Gedeih oder Verderb auf ihre Fähigkeiten angewiesen waren, erfüllte sie mit Stolz.
Dennoch …
Rika blickte zu Joseph dem Schlosser auf.
»Es tut mir sehr leid, Leutnant. Ich hätte dich nicht so anfahren dürfen. Du hast Recht, ich bin … ich bin gereizt.«
»Entschuldigung angenommen.« Er nickte knapp mit dem Kopf. »Vielleicht bessert sich deine Laune, wenn ich dir sage, dass die Verstärkung aus Craiglin angekommen ist und du gleich Besuch bekommen wirst.«
»Besuch?«
Der Ärger, der Rikas Gedanken eben noch beherrscht hatte, wich Bestürzung. »Besuch? Für mich? Aber … wer sollte mich denn besuchen wollen?«
»Genau, wer will schon freiwillig mit einer Sturmzwingerin zu tun haben?«, spöttelte eine angenehme Baritonstimme aus Richtung des Gewölbeeingangs.
Rika schnellte herum; sie glaubte ihren Augen nicht zu trauen, als sie den großen, vierarmigen Uniformierten sah, der sich durch den - ursprünglich für die kleineren und handfester gebauten Gavenner geschaffenen - Türrahmen duckte.
Das bläuliche Sturmlicht zauberte violette Reflexe in das zerzauste rosarote Haar des Shathatoka, als er sich wieder aufrichtete und den hellen Waffenrock abklopfte. Die aufsteigende Staubwolke bewies, dass die Aktion bitter notwendig gewesen war.
Rika starrte mit offenem Mund zur Tür; die aschgraue Haut, die roten und schwarzen Muster auf seinen Wangen, die ein wenig so aussahen wie das Gebiss eines wilden Tieres … Es gab keinen Zweifel an der Identität des Soldaten.
»Shoran …? Bist das wirklich du?«
»Nun hast du mich ertappt. Eigentlich bin ich die Königin der Thäler«, grinste der Vierarmige, während er sich Joseph und Rika näherte. »Aber ich konnte ja schlecht in meiner wahren Gestalt ins Lager …«
»Halt die Klappe«, befahl Rika.
»… meiner Erzfeinde spazieren und …«
»Halt die Klappe«, rief Rika noch einmal und fiel dem Shathatoka um den Hals. Ohne lange zu fackeln presste sie ihre Lippen auf seinen Mund, was ihn tatsächlich zum Schweigen brachte; behutsam legte er alle vier Arme um das Mädchen, das ihn so fest umklammerte, als müsse sie sich vor einem lebensbedrohlichen Sturz in die Tiefe retten.
»Rika …«
»Klappe«, knurrte sie und schmiegte sich eng an den Shathatoka, dessen schmale Ohren waagerecht nach hinten zeigten.
»Ich freue mich ja auch, dich zu sehen, meine Süße«, brachte er ein wenig atemlos hervor, »aber du tust mir weh.«
Erschrocken löste Rika ihren Klammergriff; hatte sie etwa immer noch das große, scharfkantige Buch in der Hand?
»Oh nein. Vergib mir!«
»Dir immer, meine Süße.« Vorsichtig setzte Shoran die junge Frau, die besorgt beobachtete, wie er sich die schmerzende Schulter rieb und dabei eine Grimasse schnitt, auf dem Boden ab.
»Geht es dir gut?«, fragte sie; im Schloss Glaesdun war Shoran von einem der gewaltigen Leibwächter des Königs niedergestreckt worden. Dass er überlebt hatte, war schon erstaunlich genug gewesen, aber dass er bereits nach so kurzer Zeit wieder auf den Beinen war …
Rika hatte nicht damit gerechnet, Shoran vor Mitte des Jahres wiederzusehen.
»Zumindest der Mund funktioniert noch«, lächelte Shoran. »Aber Scherz beiseite … es geht mir wirklich gut. Sayan hat sein Bestes getan, und hätte der alte Pferdefresser Sarrias seinen hässlichen Kopf durchgesetzt, läge ich noch immer in einem gemütlichen Bett in Schloss Glaesdun. Aber ich hatte so meine eigenen Vorstellungen.«
Rika rief sich die groben Gesichter von Sayan und Sarrias ins Gedächtnis; sie waren vierarmige, vierbeinige Jixur und Mitglieder der Herde, die dank der Hinterlist der Matriarchin ihren Vater getötet hatte. Dass Leutnant Joseph ausgerechnet den brutalen vierbeinigen Räubern gegenüber Gnade gezeigt hatte, die auch viele seiner Kameraden auf dem Gewissen hatten, hatte Rika zunächst weder nachvollziehen noch gutheißen können. Im Nachhinein hatte es sich jedoch als klug erwiesen; die Jixur hatten sich nicht nur beim Sturm auf Schloss Glaesdun nützlich gemacht - ihr Heiler Sayan hatte durch seine rasche Hilfe das Leben des Shathatoka gerettet.
Manchmal fragte sich Rika, ob auch sie jemals dazu imstande sein würde, losgelöst von jeglichem … Gefühl Entscheidungen zu treffen, so wie Leutnant Joseph; gerade Sarrias gegenüber, der als Anführer der Herdenkrieger für den Überfall auf ihr Elternhaus verantwortlich gewesen war, war es ihr anfänglich sehr schwer gefallen, Gleichmut zu zeigen …
»Was ist los? Träumst du schon wieder?«
»Nein«, log Rika.
»Womit hast du eigentlich gerade versucht, mich umzubringen?«
»Mit einem Buch«, gestand sie zerknirscht.
»Die Schelmin. Entstehung, Errungenschaften und Wanderungen«, las Shoran schmunzelnd vor. »Soso. Schlimmeren Schund hast du also nicht finden können? Woher hast du das überhaupt? Das Lager hier«, die rechten Hände des jungen Soldaten beschrieben einen weiten Bogen, »muss viel älter sein als dieses … Werk.«
Milde verwundert sah Rika auf den Buchdeckel, dann legte sie den Kopf schief und blickte zu Shoran auf.
»Es stammt aus der Bibliothek der Grenzlandfestung, und ich hatte durchaus vor, es wieder zurückzubringen. - Was habt ihr bloß alle? Stimmt mit diesem Buch denn etwas nicht? Ich dachte, es sei die religiöse …«
»… Grundlage der hiranyischen Kultur. Stimmt in gewisser Weise ja auch, meine Süße, aber der werte Herr Nirgunamatra hat in seiner Ausgabe einen besonderen Schwerpunkt auf pikante Details gelegt. Kein Wunder, dass du es im Lesesaal einer militärischen Festung entdeckt hast. Hast du schon ausprobiert, ob sich auch alle Seiten umblättern lassen?«
»Ach, hör schon auf«, fauchte Rika. »Wenn du bloß gekommen bist, um mich zu veralbern, kannst du sofort wieder nach Craiglin zurückgehen.«
Shoran spreizte die Ohren, als müsse er sich erst überlegen, ob er das wollte; dann legte er die Finger des oberen Armpaares zusammen und senkte leicht den Kopf.
»Verzeih. Ich bin so froh darüber, wieder hier zu sein, dass ich gar keine Lust habe, es mir schon gleich am ersten Tag mit dir zu verderben. Ich werde versuchen, dich nicht mehr zu veralbern.« Er blickte sie einen Augenblick lang nachdenklich aus großen, steingrauen Augen an, dann zuckten seine Mundwinkel. »Aber wenn du schon unbedingt etwas über Hiranyer oder Shathatoka lernen möchtest, solltest du vielleicht mit grundlegenderen Schriften beginnen - oder doch zumindest die hiranyische Sprache erlernen. Die Übersetzung«, er deutete auf das große Buch, »taugt nicht viel.«
»Also hast du diesen schlimmen Schund gelesen?«
»… wird behauptet«, ergänzte Shoran grinsend seinen vorangegangenen Satz.
Zuerst wollte Rika ihm eine scharfe Erwiderung entgegenschleudern, aber dann überlegte sie es sich anders und rollte bloß mit den bernsteinfarbenen Augen. Sie wusste selbst, dass es keinen Zweck hatte: Der junge Shathatoka konnte so gut wie nie ernst bleiben. Es lag wohl in seiner Natur.
»Seid ihr fertig?«, nutzte Joseph ihre Redepause. Rikas Kopf fuhr herum; sie hatte völlig vergessen, dass sich auch der Leutnant in dem kühlen Kellerraum aufhielt.
»Schön.«Joseph nickte Shoran knapp zu und deutete dann auf die Klumpen feuchter Erde zu seinen Füßen. »Du, Roter, wirst dich zuerst einmal sauber machen, denn ich will, dass dieses Lager schmutzfrei bleibt. Sand in den Innereien unserer Automaten wäre das Letzte, was wir so kurz vor dem Abmarsch gebrauchen könnten. Wenn du damit fertig bist, finde dich in der Automatenhalle ein. Wir müssen unsere Reise nach Hochthal-Stadt besprechen.«
Damit drehte sich der Offizier auf dem Absatz um und eilte zum Durchgang hinaus. Rika sah Shoran fragend an; seine einzige Antwort war ein Achselzucken.
»Halte das mal.«
Ohne eine Reaktion abzuwarten, drückte die junge Frau dem Soldaten das schwere Buch in die Hand und eilte hinter dem Leutnant her.
»Joseph!«, rief sie. »Warte!«
Joseph der Schlosser wartete tatsächlich, bis Rika ihn eingeholt hatte. Eine der in die niedrige Decke eingelassenen Lampen flackerte und ließ bizarre Schatten über die glatten Wände und die kompakte Gestalt des Offiziers tanzen; für Sturmlicht war dies eigentlich ungewöhnlich, aber das Automatenlager, in dem sie sich aufhielten, war alt - sehr alt sogar. Das erklärte auch das eine oder andere defekte Gerät.
Das Mädchen holte tief Luft.
»Joseph, ich meine Leutnant … was ist mit mir? Sollte ich nicht auch an dieser Besprechung teilnehmen?«
»Nein.« Der Leutnant machte Anstalten, weiterzugehen, als Rika ihn am Ärmel seines Waffenrocks festhielt.
»Wieso nicht? Der Feldzug geht uns doch alle an!«
Joseph runzelte die Stirn, so dass sie sich beeilte, »… die gesamte Zweite Armee«, nachzuschicken. »Ich meine natürlich die Sturmwerkerarmee.«
»Ich werde lediglich die Leute einweisen, die nach Hochthal marschieren werden. Zu euch anderen komme ich später.«
»Aber …«
»Kein aber, Rika Robertstochter. Du hast doch nicht etwa erwartet, dass ich dich an die Front schicke?«
Die Enttäuschung stand der Siebzehnjährigen wohl ins Gesicht geschrieben, so dass Joseph ihr beschwichtigend seine kräftige Hand auf die Schulter legte; die Finger kontrastierten scharf mit dem hellen Stoff ihres Waffenrocks.
»Rika, ich kann dich nicht mitnehmen. Du bist die einzige Sturmzwingerin, die wir haben … vielleicht sogar die einzige Sturmzwingerin auf der ganzen Welt. Was soll aus unserer Armee werden, wenn dir etwas zustößt?«
»In Craiglin war ich nicht nur dabei - ich habe euch allen auch noch den Allerwertesten gerettet«, stieß Rika trotzig hervor. »Was wäre aus der Sturmwerkerarmee geworden, wenn ich nicht mitgegangen wäre?«
»Ich will, dass du in diesem Lager bleibst«, entgegnete der Leutnant ruhig. »Vermutlich hätten wir ohne dein beherztes Eingreifen in Schloss Glaesdun alle den Tod gefunden, aber es war zugegebenermaßen eine schlampig geplante Operation. Diesen Fehler noch einmal zu begehen können wir uns nicht erlauben. Hochthal-Stadt ist die Hauptstadt der Thäler, Rika. Du warst selbst schon dort und weißt, mit welchen Gegnern wir es zu tun bekommen werden. Königin Elane ist nicht einfach nur ein machtlüsternes, boshaftes Weib, sie ist auch überaus talentiert darin, ihren Willen durchzusetzen … und es scheint nun mal ihr Wille, das Mittlere Reich in den alten Grenzen wiederauferstehen zu lassen. Zu allem Überfluss kann sie auch noch auf das große militärische Geschick ihres herzoglichen Gemahls zurückgreifen.« Der Gavenner schüttelte knapp den Kopf, als wolle er einen bösen Gedanken vertreiben, dann strich er sich mit der Hand, die eben noch auf Rikas Schulter geruht hatte, über sein stoppelkurzes Haar. »Gegen das, was vor uns liegt, war Craiglin ein Spaziergang.«
»Aber wir haben jetzt doch viel mehr Kriegsautomaten«, wandte Rika mit vor Aufregung bebender Unterlippe ein.
»Und genau deswegen brauche ich dich hier. Du musst dafür sorgen, dass dieses Lager funktioniert. Es ist dasjenige, das der Hauptstadt am nächsten liegt, und falls sich unser Vorhaben länger als geplant hinzieht und wir die Sturmkubi zum Aufladen zurücksenden müssten - wer sollte es tun, wenn nicht du?«
Rika schloss für einen Moment die Augen. Es sah nicht so aus, als würde sich der Leutnant durch Argumente umstimmen lassen. Also wagte sie noch einen letzten, verzweifelten Versuch.
»Dann lass Shoran auch hier. Bitte.«
»Ach herrje.« Josephs Zungenspitze fuhr über den abgesplitterten Schneidezahn. »Gerade wollte ich dir das Angebot machen, dir einen Hund mitzubringen, wenn du mir keine Schwierigkeiten machst - du magst Hunde doch, nicht wahr? Aber wenn es natürlich dieser Busch ist, hinter dem die Staubkatze lauert … Das geht nicht, Rika. Den Roten brauche ich vor Ort. Mit ihm an unserer Seite«, ein Anflug eines Lächelns erhellte das Gesicht des Leutnants, der bemerkt hatte, dass der Shathatoka mit im wahrsten Sinne gespitzten Ohren lauschend im Türrahmen lehnte, »fühle ich mich sehr viel wohler, sonst hätte ich ihn nicht vorzeitig aus Craiglin herbeordert.«
Das Licht der zuckenden Deckenlampe erlosch mit einem Knistern. Irritiert legte der Schlosser den Kopf in den Nacken und fixierte die plötzliche Lücke in der Reihe bläulicher Leuchtkörper.
»Die müssen wir wohl auswechseln. Nicht alles, was das Sturmwerkersiegel trägt, ist zwingend gut.«
Königlicher Palast, Stadt Hochthal, Nördliches Hochthal
Im Jahre 239 nach dem Zerfall des Mittleren Reiches, später Erstwinter
Rhedgar Callanssohn stand so nahe am Fenster des königlichen Schauraumes, dass seine Nase beinahe die kalte, glatte Glasscheibe berührte. Mäßig interessiert verfolgte er die Exerzierübungen der Männer der königlichen Garde, deren rote Waffenröcke von hier oben wie Blutlachen auf dem schmutzigen Weiß des verschneiten Palastvorhofs wirkten. Selbst von Rhedgars Standort aus war zu sehen, dass die feuchte Kälte des Erstwinters den Männern gehörig zu schaffen machte: Zu gequält wirkten die scheinbar gleichmütigen Gesichter, zu verkrampft die Bewegungen, als sie mit ihren Schwertern fuchtelten und so taten, als kämpften sie in Zweiergrüppchen gegeneinander.
Eine reine Schautruppe.
Auf einmal mischte sich ein Anflug von Wehmut in das Gefühl milder Belustigung, das Rhedgar empfand. Das üblicherweise makellose Erscheinungsbild und die distanzierte Art der Gardisten schätzte er genauso wenig wie die oft wiederholte Beteuerung ihres Obersten, sie seien reguläre Soldaten; daher gönnte er den Männern die winterlichen Unannehmlichkeiten durchaus. Insgeheim beneidete er die Rotuniformierten jedoch darum, dass sie sich außerhalb des Palastgeländes aufhalten durften, wann immer ihr Dienstplan es ihnen gestattete. Das konnte sich Rhedgar Callanssohn als persönlicher Leibwächter der Königin nicht erlauben. Seit er in Elane Spindels Diensten stand, verließ er die Umgebung Ihrer Majestät nur dann, wenn sie es ihm auftrug. Das kam selten genug vor; zudem bot die Natur der Aufträge, die die Königin ihm üblicherweise erteilte, kaum jemals Gelegenheit, die kurzen Ausflüge in die ›Freiheit‹ zu genießen. Hätte man ihn heute vor die Wahl gestellt, entweder Ihrer Majestät als Leibwächter zu dienen oder wieder auf den Feldern zu schuften, und nicht als Jüngling …
Er presste die breite Stirn gegen das Fenster, um die unbotmäßigen Gedanken zu vertreiben. Tatsächlich half der Kontakt seiner Haut mit dem kühlen Glas, ihn wieder in die Gegenwart des königlichen Palastes zurückzurufen. Rhedgar trat einen Schritt zurück und schnitt seinem Spiegelbild in der glatten Scheibe eine höhnische Grimasse.
»Ich weiß gar nicht, was du willst, Rhedgar Callanssohn«, meinte er leise. »Es geht dir doch gut.«
»Das ist ganz offensichtlich nicht der Fall«, ließ sich da eine scharfe Stimme vernehmen. »Der Heiler sollte deinen Kopf untersuchen.«
Rhedgar musste sich nicht umwenden, um zu wissen, dass die Königin den Raum betreten hatte; er tat es dennoch, gebot ihm doch das höfische Protokoll, seiner Monarchin möglichst nicht das Hinterteil zuzuwenden.
»Bezieht Ihr Euch auf meine Selbstgespräche, Majestät?«
»Selbstverständlich.« Die Königin zog ihre Brauen hoch, und wie aus Verlegenheit strich sie über den Stoff des schmal geschnittenen, weißen Kleides, das ihre schlanke Figur gut zur Geltung brachte. Allerdings brachte sie nur sehr selten irgendetwas in Verlegenheit, so dass ihre Geste einen anderen Grund haben musste. »Von denen abgesehen gibt es an deinem Kopf schließlich nichts auszusetzen.«
Rhedgar ließ sich zu einem Grinsen hinreißen, denn dies gehörte zu den Dingen, die er sich gegenüber der öffentlich so unzugänglichen Monarchin herausnehmen durfte. Im Grunde genommen konnte sich der Leibwächter im Beisein der Königin vieles erlauben, wofür andere Höflinge mindestens eine Gliedmaße verlieren würden, und Elane Spindel hatte ihm im Laufe der Jahre mehr Staatsgeheimnisse und mehr Persönliches anvertraut als ihren Herzögen, Rittern, Kindern und dem Ehegemahl zusammen.
In Momenten wie diesen hielt Rhedgar sein selbst gewähltes Los für gar nicht so übel. Er senkte den Kopf, so dass ihm ein borstiges Lockenbüschel vor die Augen fiel.
»Ihr beschämt mich, Majestät.«
»Du hast allen Grund, beschämt zu sein«, entgegnete sie und bedachte den kräftig gebauten Leibwächter mit einem kühlen Blick. »Du hast deine Pflichten vernachlässigt.«
Rhedgars braune Augen weiteten sich erstaunt.
»Majestät? Ich fürchte, ich kann Euch nicht ganz folgen.«
»Könntest du jedem meiner Gedankengänge folgen, müsste ich dir vermutlich einen anderen Posten zuweisen, guter Rhedgar.« Die Regung, die sich für einen kurzen Augenblick in den herben Gesichtszügen von Elane Spindel widerspiegelte, hatte leichte Ähnlichkeit mit Humor, aber sie verschwand so schnell, wie sie gekommen war.
»Alvaro ist sehr besorgt. Die Prinzessin ist wiederholt nicht zum Unterricht erschienen. Auch hat sie den Lehrraum einige Male verlassen, ohne wiederzukehren.«
»Und das ist mein Verschulden?«, wunderte sich Rhedgar; er kratzte sich am kahlgeschorenen Hinterkopf. »Wie kommt Ihr darauf, Majestät? Dafür zu sorgen, dass die Prinzessin ihre tägliche Lektion Lernen nicht versäumt, gehört nicht zu meinen Pflichten.«
»Jetzt schon.« Elane erhob sich zu ihrer vollen Größe; für eine Frau war sie hochgewachsen, aber ihr Leibwächter überragte sie noch um ein gutes Stück. »Von jetzt an wirst du die junge Dame hüten wie deinen Augapfel, Rhedgar, denn ich kann und werde ihre Kapriolen nicht mehr länger dulden. Du wirst sie beschützen, und zwar nicht nur vor anderen, sondern auch und gerade vor sich selbst. Du wirst auch dafür sorgen, dass sie sich anständig benimmt.«
»Aber Majestät«, protestierte Rhedgar, der sich ziemlich sicher war, das er kaum der Richtige für diese Aufgabe war - es sei denn, die Königin gestattete ihm, der verzogenen, arroganten Göre ab und an eine Tracht Prügel zu verpassen.
»Kein Aber. Zuallererst einmal wirst du Prinzessin Helfrid suchen, finden und zu Alvaro bringen. Und damit sie nicht noch einmal nach dem Mittagsmahl Reißaus nimmt, wirst du sie in Zukunft von der Tafel bis zu ihrem Hauslehrer eskortieren.«
»Wir Ihr wünscht, Majestät.« Rhedgar runzelte die breite Stirn. »Das wird die junge Dame aber kaum davon abhalten, sich aus dem Unterricht zu entfernen, wenn ihr danach ist.«
»Das stimmt allerdings, guter Rhedgar.« Elanes blaugraue Augen verengten sich, als sie kurz nachdachte. »Dann wirst du von jetzt an eben bei ihr bleiben, bis Alvaro seinen täglichen Unterricht beendet hat.«
»Aber Majestät«, wiederholte Rhedgar erschrocken; nur zu gut konnte er nachempfinden, weswegen die kleine Prinzessin den Unterricht schwänzte. Nicht, dass er eine Abneigung gegen die Aneignung von Wissen hatte: Im Schauraum mit seinen vielen Vitrinen, die alle möglichen Errungenschaften und Trophäen aus der Geschichte der Thäler enthielten, hielt er sich sogar sehr gerne auf. Aber der Gedanke daran, stundenlang stillzusitzen und ein aufmerksames Gesicht machen zu müssen, während der alte Alvaro mit seiner krächzenden Stimme die Namen aller verstorbenen Gebietsfürsten der letzten dreihundert Jahre aufsagte … dieser Gedanke trieb ihm den Angstschweiß auf die Stirn.
»Was sagte ich eben? Kein Aber, Rhedgar! Ein wenig Bildung wird selbst dir nicht schaden. - Los jetzt.« Die Königin wies auf die Tür des Schauraumes. »Du weißt, was zu tun ist.«
Rhedgar senkte respektvoll den Kopf. Über diese Angelegenheit mit Elane Spindel zu diskutieren war vermutlich sinnlos.
»Ich werde Euch nicht enttäuschen, Majestät.«
»Das weiß ich. Und jetzt beginne mit deiner Suche, denn ich muss mich auf das Treffen mit dem Herzog von Seethal vorbereiten. Wir haben wie üblich Wichtiges zu besprechen.«
Mit diesen Worten drehte sich die Königin um und verließ den Schauraum; die Regel mit dem Hinterteil galt natürlich nicht für sie.
Rhedgar stöhnte auf, kaum dass ihre Schritte auf dem Gang verhallt waren.
»Herzlichen Glückwunsch, Rhedgar Callanssohn. Jetzt bist du nicht nur Leibwächter, Stiefelknecht und Fußabstreifer, sondern auch noch Kindermädchen.«
Wo konnte sich eine verzogene kleine Prinzessin schon aufhalten, wenn sie nicht im Unterricht war?
Praktisch überall.
Leise vor sich hin fluchend setzte sich Rhedgar in Richtung der königlichen Schlafgemächer in Bewegung; seine Schritte hallten von den Wänden wider, als er durch die breiten Gänge eilte … doch dann konnte er seinen Lauf gerade noch rechtzeitig abstoppen, als unvermittelt ein Dienstmädchen mit eiligen Schritten aus einem Seitenkorridor kam. Seine schnelle Reaktion verhinderte zwar, dass er mit der jungen Frau zusammenstieß, aber auch sie wich zur Seite aus - und streifte mit der Kante des beladenen Tabletts die Wand. Das Servierbrett schwankte; Rhedgar griff geistesgegenwärtig danach, aber es war bereits zu spät: einige der Kelche kippten.
»Oh nein! Bei allen Fünfen!«
Das Dienstmädchen schrie erschrocken auf, als sich Ströme dunkler Flüssigkeit über ihr rotes Schürzenkleid und auch über die helle Korridorwand ergossen; hastig versuchte sie, die Gefäße wieder aufzustellen, aber der Schaden war bereits angerichtet. Während Tränen der Verzweiflung aus ihren Augen schossen, saugte der Putz die farbigen Streifen und Flecken gierig auf.
»Das tut mir leid.« Der Leibwächter stellte das Tablett auf den Boden, um die Verfärbungen genauer zu begutachten, dann sah er dem Dienstmädchen tief in die großen, tränenfeuchten Augen. »Ich werde dir natürlich dabei helfen, das wieder in Ordnung zu bringen, aber zuvor muss ich etwas für Ihre Majestät die Königin erledigen, das keinen Aufschub duldet.«
»Aber … aber das müsst Ihr doch nicht, Herr Rhedgar«, schluchzte sie, während sie verzweifelt versuchte, die klebrige Brühe von ihrer Schürze zu wischen. »Mir helfen, meine ich. Es war meine Schuld, und wenn Louterne mich bestrafen will, dann - dann …«
»Keine Aufregung, Mädchen, der Hausmeister wird nichts davon erfahren. Wir bekommen das schon wieder hin.« Rhedgar schenkte der verschreckten jungen Frau ein aufmunterndes Lächeln. »Wie heißt du?«
»Renwy.«
»Also, Renwy, du besorgst Lappen und Wasser, und ich tue, was ich tun muss, und danach treffen wir uns wieder hier. Einverstanden?«
»Aber … wenn Louterne nach mir sucht?«
»Soll er doch. Der Palast ist groß.«
Mit dem Handrücken wischte das Dienstmädchen die Tränen aus ihren Augen, dann nickte sie stumm.
»Gut, dann wäre ja alles geklärt. - Bist du in der letzten halben Stunde zufällig Prinzessin Helfrid begegnet?«
Renwy legte den Kopf schief.
»Ist sie denn nicht auf ihrem Zimmer?«
»Heli!«
Erschrocken duckte sich das Mädchen mit den dunklen Zöpfen; dann sah sie den Vierjährigen, der voller Begeisterung auf sie zurannte.
»Heli, wath …«
»Leise, Aspen! Psssst!«
»… wath itht denn?«
»Na ja, ich … ich spiele Verstecken.« Sie zuckte mit den Achseln.
»Oh«, flüsterte der Kleine verständnisvoll, dann sah er triumphierend zu seiner großen Schwester auf. »Ich hab dich aber gefunden. Jetht bin ich mit Verthtecken dran.«
»Aspen …«, begann Heli und hielt inne. Sie suchte krampfhaft nach Worten, mit denen man einem kleinen Kind klarmachen konnte, dass man genau in diesem Moment nicht mit ihm spielen wollte … ohne einen Weinkrampf oder lautes Geschrei zu provozieren, oder sogar beides. Dummerweise fiel ihr genau in diesem Augenblick nichts ein.
»Aspen, hör zu. Wir verstecken uns beide. Du dort, und ich …«
»Dath itht blöd«, maulte der blonde Junge mit den blauen Kulleraugen. »Komm, wir thpielen zuthammen.«
Heli überlegte einen Moment, dann richtete sie sich auf und warf schwungvoll die Zöpfe über die Schultern zurück.
»Na schön, Aspen. Heute ist schließlich ein besonderer Tag. Wenn du versprichst, leise zu sein, nehme ich dich mit.«
»Ich bin leithe«, versprach Aspen, dann ergriff sie seine Hand und zog ihn in Richtung eines schmalen Seitenganges.
»Wir müssen hier entlang gehen, Aspen.«
»Warum?«
»Weil wir nicht entdeckt werden wollen, also können wir den Hauptgang nicht nehmen.«
Sie gefiel sich in der Rolle der Anführerin, auch wenn Aspen der Einzige war, der ihr bereitwillig folgte - meistens jedenfalls. Nun blieb er jedoch ruckartig stehen.
»Heli, thollen wir nicht lieber auth dem Fenthter klettern?«
»Bei dem Wetter?«
Beinahe hätte Heli aufgelacht, aber gerade noch rechtzeitig fiel ihr ein, dass sie ja im Moment um nichts in der Welt entdeckt werden wollte. Vorsichtshalber legte sie also einen Finger auf den Mund - weniger wegen ihres kleinen Bruders denn als Ermahnung an sich selbst.
»Pssst, Aspen«, flüsterte sie. »Jetzt musst du aber wirklich leise sein, sonst wird uns doch noch jemand erwischen.«
»Pthhhht«, nickte auch Aspen. Dann sah er fragend zu Heli auf.
»Wohin gehen wir eigentlich?«
Rhedgar fluchte leise vor sich hin; wo auch immer Helfrid sich gerade befand - auf ihrem Zimmer war die Prinzessin jedenfalls nicht. Das Regal mit den kostbaren Puppen, die die Großmutter ihr von ihren Reisen mitgebracht hatte, war aufgeräumt, und auch ihr Mantel hing ordentlich an dem dafür vorgesehenen vergoldeten Haken nahe der Tür; bei der draußen herrschenden Kälte bedeutete das, dass die Prinzessin sich weder im Schlosspark noch in den Stallungen aufhielt.
Aber wo war sie dann?
Auf der Suche nach einer Antwort blieb Rhedgars Blick an dem Porzellangesicht der Puppe hängen, die ihm am nächsten saß. Es handelte sich um eine bleiche Schönheit in einem nachtblauen Samtgewand; die Ebenmäßigkeit ihrer Züge hatte keinerlei Ähnlichkeit mit der Wirklichkeit, und insgeheim fragte sich der Leibwächter, was Kinder eigentlich zu solch unnatürlichen Spielsachen hinzog.
»Verdammt, wo kann die Prinzessin bloß sein?«
Die Puppe gab ihm keine Antwort.
Nicht, dass Rhedgar damit gerechnet hatte: er mochte zwar Selbstgespräche führen, wenn er sich unbeobachtet glaubte, aber wahnsinnig war er nicht.
Noch nicht.
Nun, es hatte keinen Zweck; wenn er die Kleine finden wollte, musste er den Palast wohl oder übel Stück für Stück durchsuchen. Da er sich nun schon mal in dem Flügel des Gebäudes aufhielt, der die Schlafräume der königlichen Familie und der wichtigsten Hofschranzen beherbergte, konnte er genauso gut hier beginnen …
»Heli, ich muth dir wath thagen.«
»Sei still, Aspen. Wir müssen jetzt ganz vorsichtig sein.«
So leise es ihr möglich war, schlich Heli die marmornen Stufen hinab, die sich um eine breite Säule wanden. Der schwere, bestickte Stoff ihres langen Kleides raschelte und rauschte, aber so gerne die Zwölfjährige den Saum auch angehoben hätte - es wäre nicht möglich gewesen: In einer Hand trug sie die Schuhe, die auf dem harten Boden wesentlich lautere Geräusche verursacht hätten, und in die andere schmiegte sich das rundliche Händchen des kleinen Jungen.
Gerade hatten die Kinder das untere Ende der Treppe erreicht, als Aspen wieder zu quengeln begann.
»Aber Heli, ich muth dir wirklich wath thagen. Wirklich!«
»Aspen, wenn du nicht still bist, hören uns die Soldaten«, flüsterte Heli ärgerlich.
»ABER ICH MUTH MAL!«
Der letzte Satz war ein verzweifeltes Aufheulen, und er hatte exakt die befürchtete Wirkung. Mit einem Krach flog in dem Stockwerk, das sie gerade verlassen hatten, eine Tür auf.
»Verflixt«, zischte Heli. »Jetzt hast du es geschafft!« Mit einem unsanften Ruck zog sie den kleinen Jungen in den Schatten unter der Wendeltreppe und legte die Hand über seinen Mund. Glücklicherweise erkannte Aspen den Ernst der Lage sofort und versuchte gar nicht erst, sich zu wehren.
»Ist da wer?«
Es klang mehr nach Bellen als nach einer Frage; dazu passten die sorgfältig abgemessenen Schritte des Mannes, der langsam die Treppe hinabzusteigen begann - wie ein Hofhund, der einen Hühnerdieb wittert.
Heli sah nach oben. Die großen Füße in den durchnässten Stiefeln, die sie durch die Lücke zwischen den Treppenstufen erkennen konnte, gehörten ebenso wie die raue Stimme zu Gryff, dem Adjutanten von Oberst Alteric - und vor Gryff hatte sich Heli schon immer gefürchtet. Das lag weniger an den großen Füßen des Adjutanten als an seinem durchdringenden Blick und dem wettergegerbten Gesicht. Er wirkte tatsächlich wie ein Hofhund, als er die Treppe hinunterstiefelte und dann vorsichtig in den Gang hinaus trat … Es fehlte bloß noch, dass er die Zähne fletschte und knurrte.
Heli spürte, dass Aspen zu ihr aufsah; beruhigend strich sie ihm mit der Hand über den Kopf, während sie selbst die Luft anhielt.
Heli war sich ziemlich sicher, dass Gryff noch niemals in seinem Leben gelacht hatte, und falls doch … dann lachte er bestimmt nur in Situationen, in denen Heli niemals lachen würde. Zum, Beispiel, wenn er einem Gegner die Arme und Beine ausgerissen hatte …
»Heli …«
Erschrocken presste die Prinzessin ihre Hand fester auf den Mund des Brüderchens.
Cyn hilf, flehte sie insgeheim. Nicht auszudenken, wenn er uns findet!
Natürlich schnellte Gryffs grimmiger Kopf sofort suchend herum. Die Augen des Adjutanten verengten sich, als er in Richtung ihres Verstecks starrte.
Schnell wandte Heli den Kopf ab um zu vermeiden, dass Gryff ihre Augen im Dunkeln glitzern sah - da wurde ihr mit einem Mal sehr, sehr warm. Allerdings nur am Außenrist des linken Fußes, der unter dem Kleidersaum hervorblitzte. Verwundert blickte das Mädchen nach unten und entdeckte die sich ausbreitende Pfütze, die ihren Anfang an den Füßen des kleinen Jungen zu nehmen schien.
Sie konnte Aspen, der verzweifelt zu ihr hochstarrte, nicht einmal böse sein.
Es sah ganz danach aus, als sollte Rhedgar glücklos bleiben. Wo immer er auch anklopfte, wurde ihm nicht geöffnet, und die wenigen Dienstboten in den roten Monturen, die er auf seinem Weg durch die Stockwerke traf, hatten das Mädchen nicht gesehen.
Auch die Befragung des kahlköpfigen Obersten der königlichen Garde war ergebnislos verlaufen; Rhedgar war sich nicht einmal sicher, ob Oberst Alteric - dessen Antipathie gegen den Leibwächter mindestens genauso ausgeprägt war wie umgekehrt - ihn absichtlich über den Aufenthaltsort der Prinzessin im Unklaren ließ oder ob der durchgefroren wirkende Mann sich bloß möglichst schnell der nassen Kleidungsstücke entledigen wollte, die ihm die Kampfübungen im Freien eingebracht hatten. Jedenfalls hatte Alteric Rhedgar gegenüber in knappen Worten mitgeteilt, dass er die Prinzessin weder gesehen hatte noch sie zu suchen beabsichtigte.
Frustriert trabte Rhedgar die polierten Stufen der Treppe hinunter, die zum Erdgeschoss führte. Sosehr er seinen Kopf auch anstrengte - es gab mindesten hundert Orte, an denen sich Prinzessin Helfrid gerade aufhalten konnte, und kein Platz kam ihm wahrscheinlicher vor als der andere. Und damit meinte er nur die Orte abseits von Gärten und Stallungen.
Er schüttelte den Kopf, um den schwachen Stallgeruch zu vertreiben, der ihm plötzlich in die Nase stieg. Was der bloße Gedanken an die auf engem Raum zusammengepferchten Tiere doch auszulösen vermochte!
Nein, die Ställe schlossen an einen anderen Teil des Palastes an; hier wartete Angenehmeres auf ihn, denn am entfernten Ende des langen, gefliesten Ganges, den er nun betrat, lag die Hauptküche.
Rhedgar sah kurz in Richtung eines der schmalen Fenster, die Ausblick auf den Palasthof gewährten. Es würde schon bald dunkel werden; vielleicht sollte er sich einfach zu Gonsette und ihren Gehilfen in die Küche setzen und bei einem Krug kräftigen Bieres und einem Teller Suppe abwarten, bis der königlichen Familie das Abendbrot aufgetischt wurde. Da der Herzog von Seethal heute früh im Palast eingetroffen war, würde die Tafel sicherlich üppiger ausfallen als sonst; Rikart Spindel war für seine Liebe zu gutem Essen bekannt, und gleich dem Herzog ließ auch das verschwundene Mädchen niemals eine Mahlzeit aus freien Stücken aus - zum Essen würde sie gewiss wieder auftauchen.
»Nein, ausgeschlossen. Der Prinzessin könnte schließlich etwas passiert sein.«
Außerdem würde es bedeuten, dass das Dienstmädchen - Renwy? - noch länger auf ihn warten musste, und das wollte er vermeiden. Rhedgars Angebot, ihr zu helfen, war ehrlich gemeint gewesen. Und wenn er weiterhin ehrlich war, hatte er seine Hilfe nicht etwa angeboten, um sie zu beeindrucken: Das scheue junge Ding hatte bloß so hilflos und verzweifelt dreingeschaut, dass er sie um nichts in der Welt in ihrem Jammer hätte allein lassen können.
Der Leibwächter schüttelte energisch den Kopf, um sich seine Aufgabe in Erinnerung zu rufen. Dann bewegte er sich gemessenen Schrittes zu der Doppeltür hin, die die zu seiner Linken gelegenen Gemächer abschloss.
Er hob die Faust, um an das schwere Holz zu klopfen - und zögerte.
In dieser Zimmerflucht lebte trotz der räumlichen Nähe zur Küche nicht etwa das Gesinde: Das war in einem anderen Gebäudeteil untergebracht worden, nachdem sich die erste hiranyische Geisel ausgerechnet diese Räumlichkeiten ausgewählt hatte. Aber so waren sie eben, die Hiranyer: seltsam.
Die gegenwärtige Geisel, die werte Dame Yazinthi, war erst vor wenigen Wochen mitsamt ihrem Hausstand in die ehemaligen Gesindestuben eingezogen, und obwohl Rhedgar die Mittel hatte, sie an einer Flucht aus dem Palast zu hindern, traute er der jungen Hiranyerin nicht über den Weg. Das hatte nicht unbedingt mit der Persönlichkeit der werten Dame zu tun: Die seltsame Mischung aus Arroganz, Genussfreude und Unredlichkeit, die sie bei den seltenen Zusammentreffen mit Rhedgar zur Schau gestellt hatte, hatte bisher noch jeden Hiranyer ausgezeichnet, der ihm begegnet war … und das waren einige gewesen.
Herzog Susirrash von Hiranya hatte Königin Elane nach den Vereinigungskriegen als Zeichen seines guten Willens ein Familienmitglied überlassen. Als Zeichen von Elane Spindels gutem Willen wiederum wurde die Geisel, die dem regierenden Adelshaus von Hiranya angehören musste, alle vier Jahre ausgetauscht, und Rhedgar hatte sie alle erdulden müssen.
Nein, der Soldat misstraute der gegenwärtigen Geisel einfach nur deshalb, weil von ihm verlangt wurde, alle Personen zu beargwöhnen, die sich häufig in der Nähe seiner Herrin aufhielten.
Das war schließlich seine wichtigste Aufgabe.
Er wollte gerade noch einmal klopfen, als der rechte Türflügel aufschwang und einer der beiden Diener erschien, die zum Hausrat der werten Dame Yazinthi gehörten. Der vierarmige Hiranyer in der schmucklosen schwarzen Livree, dessen wasserblaues Haar zu einer kunstvollen Frisur geflochten war, musterte Rhedgar mit einem herablassenden Blick. Dann rümpfte der Mann die Nase; die Linie, die sein weißes Gesicht auf Höhe der Ohren in zwei Flächen teilte, kräuselte sich.
»Tritt ein. Die werte Dame wünscht es so.« »Es gibt keinen Grund, so verwundert zu schauen, Herr Leibwächter«, lachte eine leise Frauenstimme aus der Tiefe des Raumes. »Dein lautes Schnaufen hat dich verraten. Als du nicht gewichen bist, glaubte Rashuka schon, du wolltest durch die Schlüssellöcher spähen.«
»Nicht doch, werte Dame«, wehrte Rhedgar ab. »Weshalb sollte ich …«
Er verstummte schlagartig.
Die werte Dame Yazinthi räkelte sich auf dem dunklen Eisenholztisch, auf dem üblicherweise Mahlzeiten serviert wurden. Das hübsche Gesicht, das orangefarbene Kreise auf den Wangen höchst vorteilhaft betonten, stützte sie auf zwei ihrer Arme; die anderen beiden baumelten ebenso wie ihr sorgfältig in Wellen gelegtes schwarzes Haar an den Seiten des Tisches herab. Eines ihre Handgelenke zierte ein schwerer Metallreif, das Zeichen ihres Geiselstatus. Davon abgesehen trug sie - nichts.
Der zweite Bedienstete der Dame - ein Mann mit violettem Zopf, dessen graue Haut sehr dunkel war, funkelte Rhedgar finster an, bevor er damit fortfuhr, Yazinthis blanken Rücken mit einer durchscheinenden Flüssigkeit einzureiben.
»Oh … verzeiht. Hätte ich gewusst, in welchem … Zustand Ihr Euch befindet, hätte ich natürlich nicht gestört.«
Demonstrativ wandte Rhedgar den Kopf ab, aber das schien die werte Dame noch mehr zu belustigen.
»Da gibt es nichts zu verzeihen, Herr Leibwächter«, gurrte sie. »Schließlich war ich mir meines … Zustands wohl bewusst, als ich dich hereinbat.«
Es bereitet ihr Vergnügen, mich zu beschämen.
Nicht, dass Rhedgar sich aus dem Anblick einer unbekleideten Frau nichts gemacht hätte, im Gegenteil … er war dem schönen Geschlecht durchaus gewogen, wobei ihn die Art, der eine Frau angehörte, wenig interessierte. Aber in seiner Position wusste er sehr wohl zwischen persönlichen und offiziellen Anlässen zu unterscheiden, und was immer diese Situation hier sein mochte - eine persönliche war sie jedenfalls nicht.
»Nun? Was kann ich für deine Herrin tun?«, wollte Yazinthi wissen und verschränkte die Finger mit den scharfen Nägeln unter dem Kinn.
»Ich bin auf der Suche nach Prinzessin Helfrid. Sie ist nicht zum Hausunterricht erschienen.«
Rhedgars Augen waren zwar auf die cremeweißen Brokatvorhänge gerichtet, die diesen und den nächsten Raum voneinander trennten, aber es war ihm auch wichtig, zumindest den Diener neben der Tür zusätzlich im Blick zu behalten. Der Mann überragte selbst ihn um mindestens einen Kopf, und seine Bewegungen ließen Rhedgar darauf schließen, dass er entweder ein ausgebildeter Akrobat war - oder ein ausgebildeter Kampfkünstler.
Yazinthi gluckste, als amüsiere sie diese Nachricht. »Und da schickt deine Herrin dich, um das Mädchen zu suchen? Über wie wenig … Feingefühl sie doch verfügt. Oder sollte ich mich da täuschen, und sie wollte dich bloß auf die Probe stellen?«
Furchen gruben sich in Rhedgars breite Stirn.
»Wie meint Ihr das, werte Dame?«
»Es ist doch offensichtlich, wo die Prinzessin steckt«, erläuterte Yazinthi, die Stimme triefend von wohlwollender Herablassung. »Seine Hoheit der Herzog von Seethal ist schließlich im Hause. Wie oft sieht das Mädchen ihren Vater eigentlich - einmal im Jahr? Zweimal?«
»Bisweilen sogar dreimal im Jahr, werte Dame.«
Natürlich.
Rhedgar schloss kurz die Augen, während er insgeheim über seine eigene Kurzsichtigkeit fluchte. Dann wandte er den Kopf, um der Hiranyerin knapp zuzunicken.
»Ich danke Euch. Ihr habt meiner Herrin einen großen Dienst erwiesen.«
»Selbstverständlich. Wenn deine Herrin Hilfe benötigt, darf sie dich jederzeit gerne wieder zu mir senden, Herr Leibwächter«, freute sich die Dame Yazinthi, dann schnellte ihr Kopf mit einem sehr undamenhaften Fauchen herum. »Was tust du da, Trottel?«
Der Diener hielt mit regungsloser Miene inne. Für einen winzigen Augenblick schienen sich seine von violett-goldenen Strahlen umkränzten Augen zu verengen; dann nahm er die Massage vorsichtig wieder auf.
»Ja, so ist es besser. Viel besser.« Yazinthis Kopf sank wieder auf ihre Hände herab, und sie blickte Rhedgar lange und konzentriert ins Gesicht. Dann lächelte sie süß.
»Deine Anwesenheit bereitet mir Vergnügen, denn trotz deiner Stummelohren bist du ein interessanter Mann.«
Normalerweise hatte der Leibwächter seine Gesichtszüge sehr gut im Griff, aber in diesem Fall konnte er nicht verhindern, dass er seine dichten Augenbrauen in Richtung des Haaransatzes hochzog. Aus den Augenwinkeln meinte er zu sehen, wie der Diener an der Tür spöttisch das Gesicht verzog.
Yazinthi klimperte mit den langen Wimpern.
»Mein Kompliment bereitet dir Unbehagen?«, schmunzelte sie. »Wie interessant. ›Scham‹ ist ein Wort, für den es in unserem Wortschatz keinen Begriff gibt, und ich frage mich immer wieder … Aber dies ist kaum die richtige Umgebung. Nun geh und bring deine Prinzessin zurück.«
»Eure Königlichen Hoheiten.«
Zwischen Rhedgar Callanssohns energischem Klopfen und dem Aufreißen der Tür war kaum ein Lidschlag vergangen; entsprechend verblüfft sahen ihm die beiden Männer entgegen, die sich in dem prunkvoll eingerichteten Raum gegenübersaßen. Der jüngere der beiden, ein gut aussehender, schlanker Mann mit schulterlangem Haar, schob eilig den Ledersessel nach hinten und sprang auf, das Gesicht schuldbewusst. Als er jedoch registrierte, dass es sich bei dem Neuankömmling bloß um den Leibwächter der Königin handelte, atmete er erleichtert auf und setzte sich wieder hin; die Mischung aus Enttäuschung und Erleichterung, die dabei seine ebenmäßigen Züge verzerrte, wirkte seltsam.
»Rhedgar«, meinte er vorwurfsvoll. »Du hast mich erschreckt!«
»Das tut mir aber leid, Hoheit. - Hoheit«, nickte der Soldat auch dem älteren Mann zu, dessen Kleidung sich um einiges prächtiger ausnahm als die des jungen Herzogs von Hochthal. Dafür übertraf auch seine Leibesfülle die von Herzog Enrik um ein Vielfaches; ein unbedarfter Beobachter hätte sich vielleicht sogar gewundert, wie Rikart Spindel, seines Zeichens Herzog von Seethal, militärischer Oberbefehlshaber der Thäler und Gemahl der Königin, überhaupt in dem Ledersessel Platz gefunden hatte.
Auf seinem Schoß schaukelte Herzog Rikart einen kleinen, blonden Knaben, dessen Hintern statt in Hosen in ein weiches Handtuch eingeschlagen war. Der Junge, der wohl drei oder vier Jahre alt sein mochte, war des Herzogs jüngster Sohn, Aspen. Sowohl Aspen als auch Herzog Rikart wirkten dabei sehr zufrieden, und Rhedgar gewann den Eindruck, dass nichts in der Welt den Gemahl der Königin in diesem Augenblick dazu bewegen könnte, sich von seiner Sitzgelegenheit zu erheben.
»Ich freue mich, Euch zu sehen, Hoheit.«
Rhedgar neigte den Kopf vor dem Helden der Vereinigungskriege, der dieser Tage nicht mehr allzu viel Ähnlichkeit mit der riesenhaften Statue aufwies, die ihm zu Ehren nach dem Krieg vor den Stadtmauern errichtet worden war. Weder das gemeißelte Kinn noch die athletische Figur des Standbildes
Originalausgabe 07/2010 Redaktion: Babette Kraus
Copyright © 2010 by Nicole Schuhmacher
Copyright © 2010 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
eISBN : 978-3-641-04688-0
www.heyne-magische-bestseller.de
Leseprobe
www.randomhouse.de