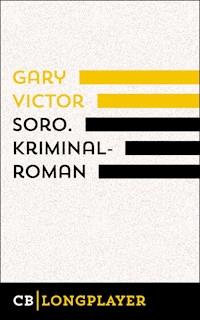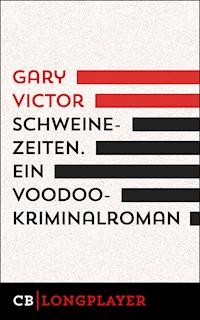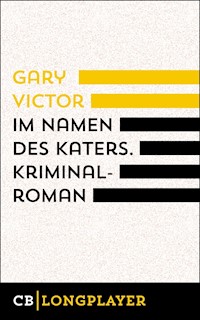8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Gary Victor gehört zu den wichtigsten Autoren von Kriminalliteratur.« Thomas Wörtche, Leichenberg Inspektor Dieuswalwe Azémar hat keine Wahl: Will er nicht aus dem Polizeidienst entlassen werden, muss er sich der Entziehungskur unterziehen, die sein neuer Vorgesetzter ihm verordnet hat. Sie wird zu einem Gang durch die Hölle. Ausgerechnet in diesem geschwächten Zustand wird er in ein Komplott hineingezogen, das sein Leben und das seiner Tochter bedroht. Die Spuren führen zum UN-Militärkontingent in Haiti. Was steckt hinter dem angeblichen Selbstmord eines Generals? Warum wurde der Sohn einer einflussreichen Unternehmerfamilie entführt? Welche Rolle spielt der Bandenchef mit dem seltsamen Namen Raskolnikow bei alldem? Als der Inspektor begreift, wie alles zusammenhängt, ist er ein weiteres Mal auf seine Beretta und seine Reflexe angewiesen … »Haiti ist nur reich an Not und Elend. Selbst damit wird es noch ausgebeutet. Gary Victor führt das vor in finster leuchtenden Krimis.« Elmar Krekeler, Die Welt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über das Buch
Inspektor Dieuswalwe Azémar hat keine Wahl: Will er nicht aus dem Polizeidienst entlassen werden, muss er sich der Entziehungskur unterziehen, die sein neuer Vorgesetzter ihm verordnet hat. Sie wird zu einem Gang durch die Hölle. Ausgerechnet in diesem geschwächten Zustand wird er in ein Komplott hineingezogen, das sein Leben und das seiner Tochter bedroht.
Die Spuren führen zum UN-Militärkontingent in Haiti. Was steckt hinter dem angeblichen Selbstmord eines Generals? Warum wurde der Sohn einer einflussreichen Unternehmerfamilie entführt? Welche Rolle spielt der Bandenchef mit dem seltsamen Namen Raskolnikow bei alldem?
Als der Inspektor begreift, wie alles zusammenhängt, ist er ein weiteres Mal auf seine Beretta und seine Reflexe angewiesen …
»Harter Stoff, grandios gemacht. Gary Victor gehört zu den wichtigsten Autoren von Kriminalliteratur und damit zu den wichtigsten Schriftstellern auf diesem Planeten.« Thomas Wörtche
Über den Autor
Gary Victor
Suff und Sühne
Roman
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2017
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Das französische Original erschien 2013 unter dem Titel »Cures et châtiments«, © Éditions Mémoire d’Encrier, Montreal 2013
Deutsche Printausgabe: litradukt, Literatureditionen Manuela Zeilinger-Trier, Trier 2017
Aus dem Französischen von Peter Trier
Umschlaggestaltung: Magdalena Gadaj
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: März 2017
ISBN 9783959880763
Für Raychnaida Thelot, die darauf bestanden hat, Inspektor Dieuswalwe Azémar eine Entziehungskur zu verordnen.
Begriffe, die mit einem Stern gekennzeichnet sind, werden im Anmerkungsteil erklärt.
I
Die riesige, schwarze Tarantel kam langsam von der Decke herunter. Die Zeit hatte sich ins Unendliche verlängert. Das Netz der Spinne schwang in den vier Ecken des Zimmers wie die Saite einer verstimmten Geige. Irrer Hass leuchtete aus ihren sämtlichen Augen. Er, Inspektor Dieuswalwe Azémar, lag bewegungsunfähig auf einem Bett. Nackt. Schon wieder auf einem Bett! Schon wieder nackt! Er erinnerte sich an das Motel, in dem er abgestiegen war, als das Erdbeben einen Teil der Stadt zerstört hatte. Er hatte mit einer Frau geschlafen, und die Decke des Zimmers war eingestürzt. Seine jetzige Lage war schlimmer: Es lag kein Frauenkörper als Schutz auf ihm. Verschreckt behielt er die Klauen im Auge, an denen Gifttropfen glitzerten. Er biss die Zähne zusammen, um der Kälte in seinen Gelenken zu widerstehen, und langte dorthin, wo sein Revolver hätte liegen müssen. Der Smith & Wesson war jedoch von der Generalinspektion eingezogen worden. Er würde seine Waffe nach der Entziehungskur zurückerhalten, wenn der verantwortliche Arzt eine positive Stellungnahme abgab. Hatte er sich bei Madame Baptiste, seiner soro*-Lieferantin und vertrauten Freundin, seine andere Waffe, die Beretta, wiedergeholt? Er erinnerte sich nicht. Es war ihm unmöglich, den Kopf nach rechts oder links zu drehen, um sich zu vergewissern. Sein Körper wog eine Tonne. Nur der rechte Arm war noch ein bisschen beweglich. Die Tarantel war nun ganz nah. Der Inspektor versammelte seine Kräfte, um seine Hand zu bewegen. Er tastete vergeblich nach der Waffe. Die scharfen, behaarten Klauen der Spinne drohten einige Zentimeter von seiner Brust entfernt. Sie holte aus, um ihm den Oberkörper zu durchbohren. Ein Schluchzen krampfte Dieuswalwe Azémars Körper zusammen. Seine Lippen schmeckten seinen salzigen Schweiß. Die Spinne schlug mit ihren Klauen nach ihm. Sein Lager kippte ins Leere. Die Dolche der Spinne ließen Funken hinter sich, während sie durch die Luft fuhren. Der Inspektor war auf seinem Bett vorerst außer Reichweite, er pendelte über einem Abgrund, aus dem, wie er seltsamerweise sehen konnte, glühende Feuer leuchteten. Sein Peiniger kicherte: »Wenn du glaubst, dass du davonkommen kannst, Mann, dann täuschst du dich.« Der Kopf der Spinne hatte sich verwandelt: Über ihm schwebte das heitere Gesicht Marasas, des Magiers, den er eines Morgens in einer Hütte im hintersten Winkel des Ortes namens »Die Stinkenden Quellen« erschossen hatte. Die halbmenschliche Spinne änderte ihre Taktik. In den Händen, die sie zwischen den Spinnenbeinen hatte, hielt sie einen Stock, der sorgfältig zu einer Schlange geschnitzt war, und versuchte damit, den Inspektor in den Abgrund zu schieben. Bei jedem Stoß mit dem Stock wurde er näher an den Rand gedrückt. Er tastete weiter nach der Pistole, die so viele Delinquenten ins Land ohne Hut* befördert hatte, verurteilt nur von ihm, Inspektor Dieuswalwe Azémar, selbsternannter oberster Richter in einem Land, in dem zu viele korrupte Richter in Diensten schurkischer Mächte standen, die jedes Gewissen kaufen konnten. »Du verschwendest deine Zeit«, jubelte sein Mörder. Nur noch ein Stoß mit dem Stock, und der Abgrund würde ihn verschlingen. Wie konnte sich das Bett so schwerelos über der Schlucht halten? Man hatte ihn gewarnt. Diese brutale Kur konnte zu schweren Sinnesstörungen führen. »Das Leben in diesem Land ist eine Halluzination im Endstadium«, sagte er sich. »Dennoch muss man bis zum letzten Atemzug kämpfen und sich nicht damit aufhalten, die Wirklichkeit zu hinterfragen.« Die Tarantel wurde von unbändiger Freude erfasst. Sie drückte mit dem Stock ein letztes Mal gegen den Körper des Inspektors. Der wehrte sich verzweifelt und klammerte sich an sein Bett, während seine Hand immer noch nach der Pistole tastete. Entnervt von seinem Widerstand, versuchte die Spinne, das Bett anzuheben, um ihr Opfer in den Abgrund rutschen zu lassen. Im letzten Moment fand er die Waffe. Die Teillähmung seines Arms verschwand. Er feuerte. Marasas Gesicht zerbrach wie eine Maske aus Gips. Der Inspektor schoss das Magazin leer, das Dauerfeuer hörte sich an wie Donnergrollen. Die Szenerie wechselte. Er schwebte über nackten Bergen, ein Papierdrachen, der dem Atem einer Gespensterarmee ausgeliefert war. Es waren Flibustier, sie standen in Reihen auf den Decks mehrerer Schiffe, die in Kiellinie parallel zur Küste fuhren. Er verlor an Höhe, stürzte auf eine klaffende Krateröffnung zu. Eine monströse Vagina erfasste ihn mit ihren feuchten Lippen. Jemand rüttelte ihn kräftig: »Herr Inspektor … Herr Inspektor … Wachen Sie auf.« Er versuchte zurückzukehren, aus seinem Gefängnis hinauszufliegen, über den Stacheldraht zu springen. Wohlwollende Hände schüttelten ihn: »Herr Inspektor … Es ist Zeit für Ihre Medikamente.« In einem klebrigen Nebel erkannte er vor sich ein Gesicht. Es war nicht das von Marasa. Er musste einige Sekunden in seinem Gedächtnis kramen, bis er das Gesicht der Frau, die sich mit besorgtem Ausdruck zu ihm hinbeugte, mit einem Namen belegen konnte. Sie reichte ihm ein Glas Wasser und zwei Tabletten. »Ich will sie nicht«, schluchzte er, »ich leide zu sehr. Ich kann nicht mehr.« Sie küsste ihn auf seine brennende Stirn. »Es muss sein. Es ist für Ihre Tochter Mireya. Wenn Sie nicht arbeiten, was soll dann aus ihr werden?« Er erkannte die Stimme von Madame Excès, die sich seit einigen Jahren um Mireya kümmerte, wenn er nicht da war. Er schluckte die Pillen mit etwas Wasser. Madame Excès legte ihn unendlich sanft wieder ab. »Sie haben Fieber, Herr Inspektor. Das ist normal, sagt der Arzt. Da sehen Sie, was für Unheil der soro anrichtet. Das ist ein Teufelsgetränk. Wenn Sie geheilt sind, fangen Sie mir nicht wieder an, ich werde Sie überwachen.« Seine Kehle brannte. Seine Luftröhre war mit Glut gefüllt. Das Wasser, das er getrunken hatte, war möglicherweise vergiftet. Es gab so viele Leute, die etwas gegen ihn hatten, denn er beharrte darauf, ein echter Bulle zu bleiben mit seiner elenden Wohnung, seinen abgetretenen Schuhen und seinem Nissan, der sich mit einem Vierteljahrhundert auf dem Buckel mühsam am Leben hielt. Der Durst nach der Bitterkeit des soro schnitt ihm durchs Fleisch. Einen Kick! Mehrere Kicks! Er kauerte sich zusammen, umschloss seinen skelettmageren Körper mit den Armen und stellte fest, dass er nackt war. Einen Schluck. Nur einen kleinen Schluck soro. Einen Tropfen! Einen einzigen. Ein Molekül. Ein Atom. »Sie müssen widerstehen. Sie tun’s für Mireya. Sie hat nur Sie.« Er hätte sich die Stimme von Madame Excès aus dem Kopf reißen mögen. Die Tarantel kam erneut aus der Zimmerdecke hervor und schoss, von dämonischer Energie getrieben, ihr Netz entlang. Ihre Klauen bewegten sich vor und zurück wie die Fäuste eines Boxchampions. Er suchte frenetisch nach seiner Beretta. Immer schneller kam die Spinne von der Decke herunter. Sein Körper wog erneut eine Tonne. Er war wieder gelähmt, konnte nur den rechten Arm schlecht und recht gebrauchen. Sein Feind war fast auf ihm. Immer noch keine Waffe. Würde er erneut in den Boden, in den glühenden Schlund stürzen? Würde er die Zeit haben, die Pistole wiederzufinden. Eine Klaue durchbohrte seinen Brustkorb. Es gelang ihm trotz allem zu schreien, um seinen Wunsch nach Leben herauszubrüllen, seinen Wunsch, allen zum Trotz zu existieren. Die Spinne riss ihm ein blutendes Organ aus dem Körper. Der Inspektor verlor das Bewusstsein.
*
Als er aufwachte, war er nah am Ersticken, seine Lungen platzten schier. Er zog gierig die Luft ein. Bei jedem Atemzug krampfte ihm der Schmerz die Brust zusammen. Kurzer Atem, brennende Kehle, ein bitterer, klebriger Schleim im Mund, verschwommener Blick. Er erkannte die elende Wohnung, in der er seit Jahren lebte. Seine Bücher standen nicht mehr durcheinander in dem von den Termiten halb aufgefressenen Regal, sondern lagen zusammen mit Kleidungsstücken, Arzneimittelflaschen, Geschirr und einem fast völlig zerschlissenen Paar Schuhe verstreut auf dem Teppichboden. Die Luft war verpestet von eingetrocknetem Erbrochenen. Bei allem guten Willen war Madame Excès machtlos gegen die Unordnung und den Schmutz in diesem Zimmer gewesen. In seinen Entzugskrisen wurde der Inspektor zum Tobsüchtigen. Es gelang ihm, aufzustehen und auf wackeligen Beinen zu der Anrichte zu gehen, die an das alte Bücherregal stieß. Die Digitaluhr zeigte Mittwoch, 17 Uhr 15 an. Er hatte das Zeitgefühl verloren. Eine große, haarige Ratte, die an einer eingetrockneten Pfütze aus Erbrochenem leckte, kümmerte sich kaum um die Bewegungen dieses Gespenstes. Das Radio lief, es wurden die Abendnachrichten gesendet. Aus einer rebellischen Hartnäckigkeit heraus trotzte Dieuswalwe Azémar den Verheerungen seiner Kur und blieb einige Sekunden stehen, um den Worten des Journalisten zuzuhören. Dieser sprach von der Entführung des jungen Johnny Harras vor drei Tagen. Der Vater, Jacques Harras, ein bekannter Industrieller, hatte sich politisch in den Kämpfen engagiert, die den Diktator ins Exil gezwungen hatten. Die Familie Harras gehörte zu den großen Familien, die die Wirtschaft des Landes kontrollierten. Die Kidnapper hatten Polizeifahrzeuge und -uniformen benutzt. Sie hatten sich noch nicht gemeldet. Man fürchtete um das Leben des jungen Harras. Die Polizei hatte keine Spur. Ein seit mehreren Monaten gesuchter Bandenchef, bekannt unter dem Namen Raskolnikow, wurde verdächtigt, hinter der Entführung zu stecken.
Dieuswalwe Azémar blieb reglos stehen. Er sah seinen Freund, den jungen Dichter und Journalisten Pierre Quartier, wieder vor sich. Eines Abends auf der Place Jérémie im Viertel Bas-Peu de Choses hatte er mit ihm stundenlang über einen Roman von Dostojewski diskutiert, sich mit ihm über die Begriffe des Guten und des Bösen gestritten, Begriffe, die in dieser Gesellschaft reichlich lächerlich geworden waren. Er rief sich das Foto einer verstümmelten Leiche ins Gedächtnis zurück, der von Pierre Quartier, den seine Entführer zuerst gefoltert, dann ermordet hatten. Er, der damals in einer Isolationszelle der Generalinspektion gesessen hatte, hatte darauf bestanden, das Dokument in die Hand zu bekommen. Er hörte die zornig donnernde Stimme des jungen Mannes: »Meine Tragik ist, dass es mir unmöglich ist, zur Tat zu schreiten, die Grenze zwischen Gut und Böse auszulöschen, um meine Freiheit zu erobern. Ich will, dass meine Freiheit als scharfes Schwert auf der Kehle dieser verrotteten Gesellschaft liegt. Aber mein Wille ist leider in der kollektiven Moral befangen. Dieuswalwe Azémar, mein Freund, ich sehne mich nach dem Leiden, nach einer Zeit in der Hölle, um dann verwandelt wiederzukehren.« Der Inspektor hatte den plötzlichen Wutausbruch des jungen Mannes nicht verstanden. Pierre Quartier war immer ruhig, übermäßig feinfühlig und liebevoll. Manche fanden, dass er dadurch weibisch wirkte. In seinen Gesten, seinen Blicken, seinem Gang lag eine gewisse Anmut, die auch die Schönheit und Sinnlichkeit seiner Gedichte prägte. Pierre Quartier besang das Leben, sah das Wesentliche hinter den fratzenhaften Masken des Alltags. Wahrscheinlich gefiel es dem Inspektor deshalb in Pierre Quartiers Gesellschaft. Der junge Mann war ein Brunnen, zu dem er immer behutsam, ohne Eile ging, um sich an den sprudelnden Versen zu erfreuen, einem magischen Wasser, das alle Verschmutzungen abwaschen konnte. Aber Pierre Quartier veränderte sich. Die schwindelerregend schnelle Verschlechterung der politischen und sozialen Lage quälte ihn. Die Anhänger der Machthaber hatten es gewagt, auf dem größten Platz des Landes einen abgeschlagenen Kopf zur Schau zu stellen, um die Opposition einzuschüchtern. Man sah Pierre Quartier gegen das herrschende Regime demonstrieren. Es war eigentlich nicht seine Art, sich so zu engagieren. Er sagte, seine Quelle sei versiegt. Das Schreiben fiel ihm schwer. Seine fast feminine Anmut schwand dahin; die derbe, schleimige Materie der Welt lagerte sich auf ihm ab. Der entstellte Alltag drückte dem Körper, dem ganzen Wesen des Dichters seinen Stempel auf.
Über fünf Jahre nach diesen Ereignissen verstand er den Sinn von Pierre Quartiers Worten. Machte ihn der Alkoholentzug, der ihn in unvermutete Zonen seines Bewusstseins abdriften ließ, hellsichtiger? Ein brennender Scheiterhaufen setzte ihn in Flammen. Für einen Augenblick zerstreute sich sein Bewusstsein in den Zeit-Raum-Fragmenten. Er sehnte die Klauen der Tarantel herbei, damit sie den Faden dieses versteinerten Lebens zerschnitten, der ihn noch in dieser Welt hielt.
Er verwahrte ständig eine volle Flasche soro gut versteckt hinter einem Möbelstück. Dort standen auch noch weitere, fast leere Flaschen, in denen vielleicht noch ein paar Tropfen waren, nur um den Schmerz durch diese Wahrheit, die sich ihm jetzt aufdrängte, und dieses widerliche, grässliche Bedürfnis zu trinken, zu mildern. »Geh wieder ins Bett, Dieuswalwe«, flüsterte ihm eine Stimme zu. »Die Pillen liegen auf dem Nachttisch. Sie sollen dir helfen. Diesmal darfst du nicht rückfällig werden, wie bei deiner ersten Kur. Vergiss deinen Freund Pierre Quartier. Bleib auf Kurs, damit du deinen Posten behältst. Tu’s für deine Tochter Mireya. Tu’s, um Kommissar Dulourd, deinen Vorgesetzten, zu ärgern. Er wollte dieses Martyrium für dich. Er hat sich bestimmt gedacht, dass du ohne soro durchdrehst. Dass du noch schlimmer saufen wirst als zuvor. Kommissar Dulourd will dich fertig machen, vergiss das nicht!« Sein Durst brachte die Stimme zum Schweigen. Er fuhr mit der Hand hinter dem Möbel an der Wand entlang. Keine Flasche. Schockiert, bestürzt, gemartert warf er einen Blick in den Spalt. Nichts! Dabei wusste er allein, wo sie waren.
»Madame Excès!«, brüllte er mit Schaum vor dem Mund, die Maske eines verletzten Tieres vor dem Gesicht. »Ich reiß dir die Eingeweide raus! Ich jag dir eine Kugel in den Kopf!« Seit seiner Kur hatte sie unbeschränkten Zugang zu seinem Schlafzimmer. Sie hatte also sämtliche Winkel der Wohnung durchstöbert und dem soro überall nachgespürt, wo er versteckt sein konnte. »Ich schlag dir den Kopf an den Wänden ein!«, heulte er. Vor seinen Augen zog ein schwarzer Schleier vorbei. Er stützte sich gegen den Schaukelstuhl. Im Moment war er nicht in der Lage, bis zum Bett zu gehen. Er hörte ein Lachen hinter sich. Sister Marie-José, die Leiterin des Waisenhauses, das mit Kinderorganen Handel trieb, beobachtete ihn mit spöttisch verzerrtem Gesicht. »Wir schlachten Mireya aus. Was glaubst du, wie viel die Teile uns einbringen werden? Du hast dich getäuscht, als du geglaubt hast, du hättest uns besiegt, du Versager!« Besessen von einer brennenden Wut richtete er sich auf. Er hob den Schaukelstuhl an, um damit auf die Nonne loszugehen, und fiel, mitgerissen von seinem Schwung, der Länge nach auf den Teppichboden, sein Gesicht landete in einer eingetrockneten Pfütze aus Erbrochenen. Ein Schluchzen zerbrach ihn. Ihm wurde sein Niedergang, seine Ausgestoßenheit aus dieser Welt bewusst, in der er nur unter großen Schwierigkeiten überlebte. Durch seine Verzweiflung tönte immer wieder die elektrische Türklingel.
*
Es klingelte unablässig. Der Arzt hätte ihn nicht vor den Sinnesstörungen in den kritischen Momenten seiner Kur warnen dürfen. Er dachte an die Glocken von La Brésilienne*. Sie hatten ihren Klang verloren. War diese elektrische Türglocke mit ihrem schrillen Klang real? In seinem Zustand des erzwungenen Entzugs war alles möglich! Die Klingel an seiner Wohnungstür funktionierte seit Wochen nicht. Sollte sie repariert worden sein, dann hätte niemand sie so lange gedrückt gehalten. Es sei denn, der Mechanismus hatte sich verklemmt, nachdem man ihn betätigt hatte. Der helle, durchdringende Klang stellte seine bereits angegriffenen Nerven auf eine harte Probe. Langsam aber sicher wurde er immer gellender. Bald würde sein Kopf explodieren, seine Hirnmasse durchs Zimmer spritzen. Er entschloss sich zu öffnen, um den Störenfried auf die Fresse zu hauen und anschließend die Klingel abzustellen. Mit den Händen auf den Ohren, um der Marter standzuhalten, schickte er sich an zur Tür zu gehen. Da ihm einfiel, dass er nackt war, musste er die schmerzhafte Aggression der Klingel noch so lange ertragen, bis er eine Hose, ein altes Paar Schuhe und ein Hemd so schnell angezogen hatte, wie es seine ungelenken Bewegungen zuließen. Er gelangte glücklich zur Tür und drehte mühsam den Knauf. Die Angeln quietschten unangenehm. Das hineindringende Licht griff seine Augen an, als stächen ihm Milliarden winziger Nadeln in die Augäpfel.
»Inspektor Dieuswalwe Azémar?«
Eine Frauenstimme! Seine vordringliche Sorge war jedoch diese furchtbare Klingel. Er schlug mehrmals mit der Faust darauf, bis sie verstummte, und blinzelte, um den Schmerz durch die Nadeln in seinen Augen zu lindern. Die Stimme fiel ihm wieder ein, er drehte sich zu der Stelle um, von der sie kam. Eine junge Frau betrachtete ihn aufmerksam. Eine Mulattin. Braun. Die Haare fielen frei auf ihre Schultern. Ein Gesicht mit perfekten, fehlerfrei gezeichneten Zügen. Eine lebende Liane, aus deren Schlingen es kein Entrinnen gab. Eine wiederhergestellte Eva hier, vor ihm. Nichts Bedrohliches. Sie konnte die Tarantel und die anderen Biester, die ihn quälten, vergessen machen! Es war der erste angenehme Moment seit Beginn seiner Kur. Die Frau war einen Kopf größer als er. Mireya, die Frau, mit der er in einem kleinen Bergdorf im Südosten des Landes eine leidenschaftliche Liebe erlebt hatte, als er dort im Fall der verstummten Glocken ermittelte, konnte sich mit seiner Besucherin nicht messen.
»Sind Sie Inspektor Dieuswalwe Azémar?«, vergewisserte sie sich.
Sie sprach französisch mit starkem Akzent. Eine Brasilianerin, vermutete Azémar. Der Tonfall war ihm aus der Zeit vertraut, als er mit brasilianischen Polizisten zusammengearbeitet hatte. Das war zu Beginn des Mandats der Mission der Vereinten Nationen in Haiti nach der Abreise des ehemaligen Priesters und Diktators gewesen. Dessen Anhänger behaupteten, man habe ihn entführt. Mit all dem Geld, das er in seiner Zeit im Nationalpalast angehäuft hat, hätte er das Lösegeld leicht bezahlen können, kicherte der Inspektor innerlich. Er mochte Brasilien. Nicht seine Fußballmannschaft und auch nicht seine Soldaten, die den Großteil des UN-Kontingents in Haiti stellten, aber seine Musik, die verschlingende Sinnlichkeit seiner Rhythmen.
»Es ist wichtig, dass Sie es sind«, sagte sie. »Ich will einen Irrtum ausschließen.«
»Ich bin Inspektor Dieuswalwe Azémar«, brachte er hervor. Durch den klebrigen Schleim in seinem Mund konnte er nur mit Mühe artikulieren.
»Amanda Racelba. Ich bin Ihretwegen in Haiti.«
»Meinetwegen!«, wunderte sich der Inspektor.
Er schüttelte kräftig den Kopf. Sie war weiter da. Sie war jedenfalls keines von den Biestern, die sich seine Kur zunutze gemacht hatten, um in sein Leben einzudringen. Es war eine Atempause. Die Tarantel würde wiederkommen und mit ihr all die Leute, die der Inspektor ins Schattenreich befördert hatte. Die Phantome bedrängten, folterten ihn. Er war wehrlos, und sie nutzten es aus.
»Darf ich reinkommen?«, beharrte die Brasilianerin.
Der jungen Frau war anzuhören, dass das eine reine Höflichkeitsfrage war. Sie war entschlossen einzutreten, und nichts würde sie daran hindern. Inspektor Dieuswalwe Azémar war noch in der erschreckenden Machtlosigkeit des delirierenden Alkoholikers befangen, dem man sein Getränk entzogen hat. Eine so hinreißende Frau durfte diesen Ort, an dem sich das menschliche Elend so deutlich offenbarte, nicht betreten. Er trank nicht mehr, aber es ging weiterhin ein Alkoholgeruch von ihm aus. Sein Körper und die Orte, an denen er verkehrte, waren davon vollständig gesättigt. Da war vor allem der unerträgliche Gestank des Erbrochenen, mit dem Madame Excès trotz reichlicher Verwendung parfümierter Reinigungsmittel nicht fertig wurde. Man konnte den Teppichboden nur noch herausreißen und verbrennen. Madame Excès hatte es für klüger gehalten, die vollständige Heilung des Inspektors abzuwarten, bevor sie zu dieser Extremlösung griff. Sie ging in ihrer Rolle als Beschützerin Mireyas voll auf. Damit Mireya leben konnte, musste ihr Adoptivvater Dieuswalwe Azémar die Prüfung der Kur bestehen: »Wenn Sie kein Polizeiinspektor mehr sind, dann hält der Wohnungsbesitzer Ihnen all die unbezahlten Monatsmieten unter die Nase. Alle, die Angst vor Ihnen hatten, all diejenigen, die Sie unter dem Schirm Ihrer Autorität in Schach gehalten haben, werden sich an Ihnen rächen. Niemand gibt dann noch viel auf Sie, und Ihre Tochter muss es ausbaden.«
Ohne eine Antwort des Inspektors abzuwarten, überschritt die Frau die Schwelle. Sie zeigte Wirkung. Vor allem der Geruch und der Anblick dieses Drecks! Man brauchte einen soliden Grund, nicht kehrtzumachen und vor Blicken geschützt an der nächsten Straßenecke zu kotzen.
»Ich bin krank, sehr krank«, rechtfertigte sich der Inspektor, der sich zu Tode schämte. »Ich habe nicht mit Besuch gerechnet.« Die Scham war ebenso schmerzhaft wie die scharfen und tödlichen Klauen der Tarantel. Die junge Frau öffnete ihre Handtasche, um ein Taschentuch zu nehmen. Sie schnäuzte sich. Der Inspektor durchschaute sie. Das Parfum, mit dem das Taschentuch getränkt war – Vetiver –, milderte den Gestank des Zimmers.
»Ich will sicher sein, dass Sie es sind«, sagte das Mädchen. »Ich habe nicht viel Zeit.«
»Ich bin Inspektor Dieuswalwe Azémar«, wiederholte der Polizist.
»Wenn ich den Informationen glauben darf, die ich über Sie einholen konnte, dann liegt Ihnen die Gerechtigkeit am Herzen.« Eine plötzlich kalte, fast unpersönliche Stimme, in der kaum hörbar Zorn mitschwang. Der Inspektor, dem klar war, dass er erbärmlich wirkte, wusste nicht, wie er sich verhalten sollte. Er wandte den Blick ab. Rang die Hände. Schüttelte unablässig seine Beine aus wie ein Athlet, der sich vor dem Wettkampf aufwärmt.
Sein Atem war kurz und heiser. Er schwitzte trotz der Kühle des kleinen Zimmers.
»Ich bin krank, Madame. Ich bin mitten in einer Entziehungskur. Wenn ich Ihnen helfen soll, dann klopfen Sie an die falsche Tür.«
Er trat zornig gegen die Fläschchen auf dem Fußboden.
»Der Arzt hat eindeutig gesagt, dass die Medikamente mir helfen würden, meine Abhängigkeit zu überwinden, ohne viel zu leiden. Vielleicht will man mich einfach erledigen. Zu anderen Zeiten könnte ich Ihnen nützlich sein. Dieuswalwe mit zwei W versetzt Berge. Jetzt bringt ihn eine Erdscholle ins Wanken.«
»Schauen Sie mir in die Augen«, befahl die junge Frau.
Der Befehl ließ ihn reglos erstarren. Er wich dem Blick der Brasilianerin nicht aus. Er schämte sich seines Schielens jetzt weniger. Wenn er seine Brille immer noch trug, dann nicht mehr, um diese Besonderheit seiner Augen zu verbergen, sondern um die Gewalt und die Erbärmlichkeit des Schauspiels zu lindern, das sich dem Blick überall bot. Sie musterte ihn ungeniert und unverwandt, ohne sich in die Falle locken zu lassen. Nur Mireya, der Frau, die er einst geliebt hatte, war das ebenfalls gelungen. Sonst wurden die Leute immer von der falschen Richtung seines Blicks in die Irre geführt.
»Sie haben schöne Pupillen, Inspektor.«
Gesagt mit entwaffnender, fast mit Händen zu greifender Schlichtheit. Das Herz des Inspektors vollführte einen raschen Galopp. Er schlug die Augen nieder. Seine Hände waren eiskalt, seine Fingerspitzen verkrampft. Eine tellurische Sinnlichkeit ging von ihr aus. Sie war so stark, dass sie die solideste männliche Festung zerstören konnte. Wenn sie ein Trugbild war, dann war sie das hartnäckigste von allen. Sie trat näher an ihn heran. Ihre Lippen streiften sich beinahe. Er hielt den Atem an. Vielleicht würde das ausreichen, um seinen Geruch, den Geruch eines eingefleischten Alkoholikers, zu mildern. Einen Sekundenbruchteil lang geschah etwas Undefinierbares zwischen ihnen. Eine Anziehung. Ein Tumult. Ein Tornado. Sie wich zurück. Die Verwirrung, die einen Moment ihren Blick verschleiert hatte, wich einer fast schon unbarmherzigen Härte.
»Das wird nicht genügen, Inspektor.«
»Warum, nicht genügen?«, fragte er und kam sich ein wenig dumm vor, diese Frage zu stellen, mit der er eine Leere, ein Schweigen, einen Raum, eröffnet von einem hartnäckigen Unverständnis, auszufüllen suchte.
»Ich bin Amanda Racelba, die Tochter von General Ramos Racelba.«
Sie lauerte auf eine Reaktion seinerseits. Sie konnte die Spinne oder auch die Schlange von dem Stock sein. Er nahm vage etwas Gefährliches an ihr wahr. In ihren Pupillen war ein beängstigendes Flackern zu sehen. »Mit allen Frauen muss man vorsichtig umgehen«, versuchte er sich zu beruhigen.
»General Ramos Racelba«, wiederholte sie. »Erinnern Sie sich.« In den letzten Worten lag eine Drohung. Er kramte in seinem Alkoholikergedächtnis. In einem dichten Nebel erwischte er den Faden einer Erinnerung. General Racelba war Kommandant des militärischen Anteils der UN-Mission in Haiti gewesen. Er war in seinem Hotelzimmer tot aufgefunden worden, eine Kugel in der linken Schläfe. Die Ermittlungen waren zu dem Schluss gekommen, dass es sich um einen Selbstmord handelte. Es hatte hartnäckige Gerüchte gegeben. Manche Viertel der Hauptstadt waren damals der blinden Gewalt von Banden ausgeliefert, die dem ehemaligen Präsidenten nahestanden, und aus übereinstimmenden Quellen war zu hören, dass der General und der zivile Chef der Vereinten Nationen sich aufgrund schwerer politischer Meinungsverschiedenheiten spinnefeind waren. Ramos Racelba wollte durchgreifen, der Allmacht der Banden ein Ende bereiten. Sein Gegenüber wollte sich der politischen Richtung bedienen, die die Banden kontrollierte, um seinen Kandidaten an die Macht zu bringen. Laut diesem Funktionär, dem der UN-Apparat in Haiti unterstand, war dies das einzige Mittel, das Land zu befrieden. Dieuswalwe Azémar hatte damals Ärger mit der Generalinspektion gehabt. Sein Freund Pierre Quartier, der Dichter und Journalist, war gekidnappt worden. Er hatte einen Einsatz zu seiner Befreiung geplant. Kommissar Solon, sein Vorgesetzter im Präsidium, hatte ihn nicht abgesegnet, aber versprochen wegzuschauen. Der Einsatz hatte ein schlimmes Ende genommen. Vier Polizisten waren bei dem Feuergefecht mit den Banditen gestorben. In einem Punkt war Dieuswalwe Azémar sich sicher: Er war verraten worden. Ein nur dreihundert Meter weiter weg stationiertes UN-Kontingent aus brasilianischen Soldaten hatte trotz der Hilferufe nicht eingegriffen. Dieuswalwe Azémar war dafür getadelt worden, dass er die Operation ohne Erlaubnis und, schlimmer noch, im Zustand der Trunkenheit durchgeführt hatte. Die Generalinspektion war in ihrem Bericht zu einem eindeutigen Schluss gekommen. Kommissar Solon, der den Machthabern immer nahe gestanden hatte, hatte durch sein Eingreifen verhindert, dass Azémar aus der Polizei ausgestoßen wurde. Er hatte jedoch eine Entziehungskur unternehmen müssen, die erfolglos blieb. Einige Wochen später war er erneut in den grünen Tiefen des soro versunken.
»Ich kann nichts für Sie tun, Madame Racelba. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich krank bin, ich sage es Ihnen nochmal. Wie soll ich wissen, ob Sie echt sind? Ich habe vor meiner Kur eine umfangreiche Dokumentation gelesen. Ich bin auf alles gefasst.«
»Mein Vater hat keinen Selbstmord begangen«, sagte sie mit kalter, unpersönlicher Stimme.