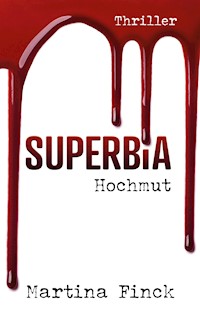
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Todsünden
- Sprache: Deutsch
Dr. Martin Hub ist genervt: von seiner Ehe, seiner Tätigkeit als Hausarzt, seinem Leben. Als er eines Abends auf dem Heimweg eine brutal zugerichtete Frau findet, leistet er nur widerwillig erste Hilfe. Nach einiger Zeit muss er feststellen, er ist tiefer in diesen Fall verstrickt, als ihm lieb ist. Doch als er das erkennt, ist es bereits zu spät...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Inhalt:
Dr. Martin Hub ist genervt: von seiner Ehe, seiner Tätigkeit als Hausarzt, seinem Leben. Als er eines Abends auf dem Heimweg eine brutal zugerichtete Frau findet, leistet er nur widerwillig erste Hilfe. Nach einiger Zeit muss er feststellen, er ist tiefer in diesen Fall verstrickt, als ihm lieb ist. Doch als er das erkennt, ist es bereits zu spät...
Über die Autorin:
Martina Finck, Jahrgang 1984, geboren und aufgewachsen im nördlichen Brandenburg, lebt seit vielen Jahren mit ihrer Familie auf einem landwirtschaftlichen Hof in ihrer Wahlheimat dem Hunsrück. Die gelernte Laborantin arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei einem bekannten Biotechnologiekonzern.
Selbst eine leidenschaftliche Krimi- und Thrillerleserin begann sie schon früh erste Geschichten zu schreiben. Superbia ist ihr erster veröffentlichter Thriller.
Für meine Omas, statt Mini-Playback-Show.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Epilog
Prolog
Es ist nicht so, dass man morgens aufsteht und weiß, dass dieser Tag alles verändern wird. So läuft das nur in Filmen. Ich bin kein Bauchmensch, der alles ‚irgendwie im Gefühl‘ hat. Ich glaube nicht an Schicksal und Vorhersehung. Und wenn ich alles rückblickend betrachte, kann ich keinen genauen Punkt benennen, an dem alles anfing. Ich glaube, es gibt nicht den einen Auslöser, der einen zum Mörder werden lässt, es ist schlichtweg der Lauf der Dinge.
Ich bin Arzt. Dass ich irgendwann jemanden töte, war mir lang klar. Einen, der es trotz Behandlung dann doch nicht schafft, den wir aufgeben müssen. Ein Fehler bei einem Medikament. Eine falsche Diagnose. So etwas vielleicht.
Damit habe ich immer gelebt. Schließlich habe ich zu viele auch gerettet, als dass ich mir um den einen auf der anderen Seite der Waagschale Gedanken mache. Um dieses Töten geht es mir nicht.
Nein, was ich meine, ist der Auslöser, der dich wirklich zum Mörder werden lässt. Der Grund, warum du aktiv und mit Vorsatz einen anderen Menschen tötest. Ich glaube nicht, dass es ihn gibt.
In meinem Fall war es eine lange Ereigniskette, und jeder andere wird sagen, dass ich mit jeder einzelnen Aktion die Möglichkeit hatte, alles abzuwenden. Das mag sein. Vielleicht fehlt mir der nötige Weitblick, vielleicht bin ich einfach zu arrogant, um einen Fehler einzugestehen.
Vielleicht habe ich einfach recht.
Ich glaube nämlich, alles richtig gemacht zu haben.
Egal wie oft ich über die Dinge nachgrübele, was zugegeben ausgesprochen selten ist, ich komme zu dem Schluss, dass ich alles jederzeit genauso wieder tun würde. Dieser Gedanke verschafft mir eine unvorstellbare innere Ruhe.
Und ja, ich bin ein Mörder. Aber damit habe ich absolut kein Problem.
Kapitel 1
Mittwoch, 21.06.2017
Ich war wie stets in Eile. Sämtliche Patientenbesuche hatten sich verzögert. Wie eigentlich immer.
Ich entschloss mich, die Abkürzung über einen asphaltierten, landwirtschaftlichen Wirtschaftsweg zu fahren. Es war inzwischen fast 22 Uhr, ich würde also sicher keine Polizeikontrolle befürchten müssen und sparte so eine Viertelstunde Fahrtzeit. Der Weg war halbwegs gut ausgebaut, die Anzahl der Schlaglöcher hielt sich in Grenzen. Er schlängelte sich durch ein langgezogenes Tal, war gesäumt von Wiesen, Feldern und Schwarz- und Weißdornhecken. Im Hellen sicher ein schöner Spazierweg.
Ich drehte das Radio lauter und trommelte mit den Fingern den Rhythmus zu Bryan Adams summer of 69 auf dem Lenkrad mit. Zwar war ein Großteil des Abends bereits ruiniert, dennoch konnte er mit einem guten Rotwein im Wintergarten einen schönen Ausklang finden. Es begann zu nieseln, Gewitter waren gemeldet. Man konnte den Regen förmlich riechen. Das steigerte meine Vorfreude auf zu Hause. Ich liebte es, wenn der Regen auf das Glasdach prasselte, während ich im Trockenen saß.
Meine Frau Christine war die ganze Woche bei der Besprechung eines neuen Projektes in Frankfurt. Es blieben also noch zwei Tage für ruhige Fernsehabende mit den Füßen auf dem Couchtisch oder einem Whisky im Garten.
Es dämmerte inzwischen, die Lichter der Stadt tanzten schon am Horizont wie ein Zielbanner, als ich einen Schatten am rechten Fahrbahnrand bemerkte.
Ich stutzte.
Zuerst vermutete ich einen Wildwechsel zwischen all den Wiesen und Hecken und drosselte die Geschwindigkeit. Und traute meinen Augen kaum, denn hinter einem Gebüsch kam kein Reh oder Hirsch, sondern ein Mensch hervor, der Statur nach eine Frau. Klein, zierlich, zombiegleich. Sie taumelte ein paar Meter weiter und fiel plötzlich ins Gras wie ein geschossenes Tier.
Ich fuhr im Schritttempo weiter. Starrte auf die Stelle, an der die Gestalt gefallen war. Was zur Hölle war das gewesen? Hatte ich das wirklich gesehen, oder fing ich vor Müdigkeit an zu fantasieren?
Ich zögerte.
Anhalten? Gas geben?
Las man doch immer von irgendwelchen Trickbetrügern, die alles versuchten, einen aus dem Auto zu locken, auszurauben oder schlimmer noch. Schließlich war allein mein Volvo schon genug wert. Aber wer konnte denn ahnen, dass um diese Zeit überhaupt jemand hier entlangfuhr? Ein Betrüger schien mir doch recht unwahrscheinlich. Kurz überlegte ich, ob mich jemand gesehen hatte und mich, falls ich einfach weiter fuhr, wegen unterlassener Hilfeleistung anzeigen würde. Man wusste ja nie. Ich hielt an, schaltete den Motor aus und blickte in die Dämmerung. Als erwartete ich, dass gleich noch eine oder einer hinterhergeschwankt kam.
Aber nichts passierte. Ich ließ das Fenster herunter. Irgendwo trällerte fröhlich ein abendlicher Vogel durch das leise Rauschen des Windes, dass das Gewitter ankündigte. Der Geruch nach Regen wurde intensiver.
Ich hatte keine Lust, bei Nieselregen über die Wiesen zu stapfen und mir meine Kleider zu ruinieren. Unschlüssig blickte ich mich weiter um, wog meine Möglichkeiten ab.
Ich hasste Tage wie diesen. Die Runde der Hausbesuche hatte sich gezogen wie Kaugummi. Wenn es nach mir ginge, würde ich gar keine Hausbesuche bestreiten und nur die Sprechstunde in meiner Praxis anbieten. Am liebsten nur vormittags oder nur an vier Tagen in der Woche.
Ich mochte anderer Leute Häuser nicht. Dort war es in der Regel unaufgeräumt oder unsauber oder beides. Die Betten waren zugestellt, sodass man sich über Krimskrams, Unmengen Teppiche, vorbei an Nachtschränken und Beistelltischen einen Weg bahnen musste. Manche Patienten hatten noch nicht einmal den Anstand, den Fernseher während des Arztbesuches auszustellen.
Vor etwas mehr als einem Jahr hatte ich die Hausarztpraxis, mitsamt seiner Patienten, von meinem Vorgänger übernommen. Ich hoffte, es würde mir gelingen, in den nächsten Jahren die Hausbesuche auf ein Minimum reduzieren. Ich lauschte. Kein Hinweis auf das, was ich gesehen hatte. Mein Blick streifte über die Wiesen, während der Himmel dunkler und der Nieselregen dichter wurde. Steig aus, sieh nach, ob da jemand deine Hilfe braucht, sagte ich mir. Doch ich saß regungslos im Auto, mitten in der ländlichen Einöde, die Hände noch immer auf dem Lenkrad, die Gedanken zerrissen.
Für meine Frau Christine war ich in dieses verdammte Kaff irgendwo in der Provinz zurückgegangen. Doch in den letzten Wochen zweifelte ich immer öfter die Sinnhaftigkeit dieser Entscheidung an. Vielleicht würde ein gemeinsamer freier Nachmittag unserer Ehe wirklich guttun – oder aber wir würden uns so wahnsinnig auf die Nerven gehen, dass wir uns endgültig trennten. Ein Grund mehr, die leidigen Hausbesuche zu minimieren.
Ein leises Grollen drang durch das halboffene Wagenfenster. Lag da draußen ein Verletzter? Ein Junkie? Doch nur ein Tier? Ich blickte zuerst nach vorn, dann in den Rückspiegel, doch alles war schwarz.
Nach dem letzten Patienten den ich besuchte, einem achtzigjährigen Schmied mit Darmkrebs, bei dem es dem Ende zuging, war ich zum Essen mit einem ehemaligen Kollegen verabredet gewesen, welches sich durch seinen verspäteten Start nur noch weiter in den Abend geschoben hatte. Es war schon fast sieben, als ich endlich zum Restaurant aufbrach. Ich wollte eigentlich viel lieber nach Hause, vielleicht noch ein wenig lesen und dann früh schlafen gehen.
Doch Sebastian war vom Hundertsten zum Tausendsten gekommen, und ich überlegte ernsthaft, ob es nötig war, sich weiterhin diese Hintertür an die Uniklinik offen zulassen. Ich pflegte seit meiner Kündigung dort noch immer den Kontakt zu einigen Kollegen und der Klinik allgemein, ließ mich bei Fortbildungen blicken. Es war immer gut, ein gewisses Netzwerk aufgebaut zu haben. Beim vorigen Essen jedoch, erachtete ich den Preis für ein solches Netzwerk als wahnsinnig hoch.
Sebastian erzählte mehrfach, wie er seine Freundin und angehende Ehefrau mit dem Kerl aus dem Reisebüro im Bett erwischt hatte. Er hatte sich im Dienstplan geirrt und doch keine vierundzwanzig Stunden Bereitschaftsdienst gehabt, als er sie mit Pizza und Blumen in der Hand, überraschen wollte.
Ich hatte zum wiederholten Mal bei dieser Geschichte genickt und ihm unbeholfen auf die Schulter geklopft. Mit solchem gefühlsduseligen Zeug konnte ich einfach nichts anfangen. Ich kannte Sebastians Freundin nicht, und da ich es selbst nie so streng mit der Treue gehalten hatte, war ich bei dem Thema nicht sonderlich empfindlich.
Der Vogel trällerte nur noch hin und wieder vor sich hin, der Wind nahm einen Teil seiner Melodie verzerrt mit sich.
War ich wirklich so kalt, so gefühllos? Vielleicht ja, denn sonst wäre ich sicher längst durch die nasser werdenden Wiesen zu dem Menschen oder was immer es war, gegangen. Hätte geholfen. Meine Pflicht als Arzt erfüllt. Stattdessen dachte ich an meine Karriere und das Essen.
Wären die Cannelloni nicht so unglaublich lecker gewesen, ich hätte den heutigen Abend nicht erst jetzt verflucht. Sebastian hatte sich langsam einen Schwips angetrunken, während ich an meinem Glas Cola herumgespielt hatte. Am liebsten hätte ich mir auch ein Glas guten Wein bestellt, um das Drama zu ertragen, aber ich musste noch fahren. Um jetzt hier im Regen zu sitzen und zu zögern.
Da hatte Sebastian gesessen. Ein Kerl wie ein Schrank, worum ich ihn mit meinen einmeterfünfundsiebzig durchaus beneidete, und war in Selbstmitleid versunken. Ein trauriges Bild.
Ich hatte ihm gegen halb zehn ein Taxi bestellt und ihn mühselig hineinbugsiert. Damit hatte ich meine Fürsorgepflicht erfüllt, fand ich. Der türkische Kellner hatte mir irgendwelche italienischen Floskeln hinterhergerufen, als ich das Restaurant verließ. Vermutlich sollte das zum Italienfeeling gehören. Ich hatte ihm wortlos einen Gruß zugenickt.
Kaum dass ich endlich im Auto gesessen hatte, musste ich zuerst einmal tief durchatmen, bevor ich den Schlüssel ins Zündschloss steckte. Dieses Gejammer über Gefühle war einfach nichts für mich. Sich derart gehen zu lassen, in aller Öffentlichkeit, würde mir ganz sicher nicht passieren. Wie immer hatte ich das Gaspedal durchgedrückt.
Und nun saß ich hier im Auto, unschlüssig, mitten im Nirgendwo und blickte in die Dunkelheit, die mittlerweile fast alle Baumsilhouetten verschlungen hatte, und wartete auf ein Geräusch, eine Bewegung.
Mit einem lauten „Ach Scheiße!“, schlug ich jetzt die Hände aufs Armaturenbrett, ehe ich den Rückwärtsgang einlegte. Die Vernunft hatte gesiegt.
Ich fuhr im Schritttempo einige Meter zurück bis an die Stelle, an der ich das Etwas vermutete, parkte meinen SUV, soweit es ging, an der Seite der schmalen Straße und griff nach der Taschenlampe in der Mittelkonsole.
Dieser Tag war wirklich verflucht.
Nur schnell nachsehen und dann nichts wie nach Hause! Ich stieg aus, schlug die Fahrertür zu und schaute mich um, schaltete die Taschenlampe ein und leuchtete in die Richtung, in die die Gestalt getaumelt war. Ich stapfte teils durch Grasbüschel, die mir fast bis an die Knie reichten. Es schien, als habe sich das Etwas, was auch immer es war, die einzige ungemähte Wiese des Weges ausgesucht. Ich sollte später unbedingt meinen Körper nach Zecken absuchen, dachte ich.
Mit der Taschenlampe leuchtete ich vor mich hin. Von links nach rechts und zurück. Eine winzig schmale Schneise aus herunter gedrücktem Gras schlängelte sich vor mir her. Ich folgte der Spur mit dem Lichtschein.
Als ich sie entdeckte, zog sich mir unweigerlich der Magen leicht zusammen.
Scheiße!
Ich hatte mich also nicht getäuscht. Einige Meter vor mir im Gras lag eine spärlich bekleidete Frau auf dem Bauch. Ihre langen roten Haare waren völlig zerzaust, sie trug ein viel zu großes T-Shirt, welches vermutlich einmal beige gewesen, jetzt aber übersät war mit Grasflecken und Dreck und Blut. Um sie herum war das Gras niedergedrückt, es erinnerte mich an die Schneeengel, die wir als Kinder im Hof in den Schnee gewedelt hatten. Die bleiche, nasse Haut glänzte im Schein meiner Taschenlampe. Die nackten weißen Beine strampelten unkoordiniert. Sie bemerkte den Lichtstrahl meiner Taschenlampe in ihrem zur Seite gedrehten Gesicht und versuchte, vorwärts zu robben, es gelang ihr scheinbar nicht, aufzustehen.
Dahin war also mein gemütlicher Abendausklang, samt Rotwein im heimischen Wintergarten.
Ich hatte nie viel darauf gegeben, wenn andere von ihrem ‚Bauchgefühl’ sprachen, ich legte mehr Wert auf Tatsachen und Fakten, aber jetzt schrie es nach mir. In meinem Nacken kribbelte es, ich spürte, wie die Härchen sich dort aufstellten und fürchtete, dass das nicht nur ein Luftzug war.
Zögern.
Noch könnte ich einfach zurück in meinen Wagen steigen, mich hatte ja bisher niemand gesehen.
Rotwein. Musik. Wintergarten.
Planlos stand ich auf dieser Wiese zwischen Gräsern und Blumen, ich spürte die Feuchtigkeit an meinen Beinen, atmete kurz durch und entschied mich letztlich dagegen, einfach heimzufahren.
Ich ging näher auf die Frau zu, das Gras raschelte unter meinen Füßen, ich vermutete die Dame stark alkoholisiert oder unter Drogen, was meine Laune noch weiter verschlechterte. Dieser Tag war wie verhext. Es wurde wirklich Zeit, nach Hause zu kommen, ins Bett zu gehen und einen neu zu beginnen. Hoffentlich würde die Rothaarige nicht noch aggressiv werden oder mich vollkotzen.
Ich seufzte, versuchte, die Schultern zu straffen, und spulte das übliche Prozedere ab, das einem schon in jedem Erste-Hilfe-Führerschein-Pflichtkurs eingetrichtert wird und rief:
„Hallo! Kann ich Ihnen helfen? Was ist passiert?“ Doch je dichter ich an sie herankam, umso größer wurden ihre Bemühungen sich wegzubewegen, wobei sie jetzt noch ein Stöhnen von sich gab. Vielleicht war sie zu high zum Antworten.
Bei ihr angekommen, kniete ich mich neben sie und berührte sie an der Schulter, sie fühlte sich kalt und klamm an. Erst jetzt bemerkte ich, wie regungslos die Arme neben ihrem Körper lagen, während sie versuchte, sich mit den Beinen vorwärts zu drücken. Das war vermutlich der Grund, warum sie nicht aufstehen konnte, irgendetwas stimmte mit den Armen nicht. Dennoch fragte ich noch einmal:
„Was ist passiert? Sind Sie verletzt? Haben Sie Schmerzen? Ich bin Dr. Martin Hub, ich bin Arzt. Können Sie mich verstehen?“
Ich bekam keine verständliche Antwort. Stattdessen schien sie ihre Bemühungen, von mir wegzukommen, zu intensivieren. Hinter ihr bildete sich eine schmierige Spur aus niedergedrücktem Gras.
Ich versuchte, sie festzuhalten und auf den Rücken zu drehen, sie wehrte sich, und auch ihr Stöhnen wurde zu einem, wenn auch leisen, Wimmern. Ich glaubte mehrfach ein „Nein“ von ihr zu hören, war mir aber nicht sicher, vielleicht sprach sie gar kein Deutsch. Oder konnte nur lallen.
Inzwischen klebten meine blonden Haare strähnig auf meiner Haut, mein Hemd begann es ihnen nachzutun. Ich fragte mich, was ich hier eigentlich tat. Ich sollte nicht hier sein. Sie wollte ganz offensichtlich weg von mir. Warum auch immer. Es war frustrierend.
Ich versuchte es erneut: „Ich will Ihnen nur helfen! Ich werde Sie jetzt vorsichtig umdrehen, dann kann ich Sie untersuchen. Ich bin Arzt. Okay?“
Ihr Wimmern wurde lauter, doch so, wie sie vor mir lag, konnte ich definitiv nichts für sie tun. Es kostete mich einige Kraft, obwohl sie so schmächtig war, die Frau auf den Rücken zu drehen, da sie immer heftiger strampelte. Sie drehte den Kopf zur Seite. Genervt bemerkte ich, dass ich mir dabei mein Hemd auch noch völlig verdreckt hatte. Wer weiß, ob die Reinigung das wieder hinbekam.
Ich leuchtete der Frau mit der Taschenlampe ins Gesicht – und erschrak. Fast tat es mir leid, sie auf einen Drogenjunkie reduziert zu haben.
Ich sah lediglich ihre rechte Gesichtshälfte, die war voller Blut, blau und aufgequollen. Sie hatte einen Cut über dem Auge und an der Lippe, ihr rechtes Auge war fast komplett zugeschwollen und über den Wangenknochen zog sich ein ausgeprägter Bluterguss bis an den Haaransatz, wo in einer offenen Wunde das Blut bereits begann einzutrocknen. Ein kurzer Hitzeschauer lief meinen Rücken hoch und wieder herunter.
„Ich hole meinen Koffer aus dem Auto, ich bin Arzt, ich werde Ihnen helfen.“ Meine Stimme klang nicht mehr so fest, wie ich es von mir gewohnt war, und auch von meiner Aussage selbst war ich nicht wirklich überzeugt. Ich zitterte, mein Herz raste dank eines intensiven Adrenalinschubs. Zwar hatte ich im Rahmen meines Studiums auch ein Praktikum in der Unfallchirurgie geleistet, sogar in der Traumaambulanz, aber ich war noch nie als Ersthelfer zu einem Unfall gekommen. Ich war noch nie allein in so einer Situation gewesen. Ich war noch nie außerhalb eines Krankenhauses zu einem Einsatz gerufen worden. Ich war noch nie nur mit meinem Arztkoffer und dem Erste-Hilfe-Kasten meines Autos ausgerüstet.
Sie versuchte, noch etwas zu sagen, wobei ihr schaumiges Blut aus dem Mund quoll und ich sie nicht verstehen konnte. Also auch noch eine Lungenverletzung. Na prima!
Auf dem Weg zurück zu meinem Auto zog ich rennend mein Handy aus der Tasche und setzte einen Notruf ab, was sich schwierig gestaltete, da der Empfang schlecht war und ich auch nicht genau beschreiben konnte, wo ich mich hier eigentlich befand. Was denn passiert sei? Das fragte ich mich auch. Vermutlich ein Unfall mit einer Schwerverletzten. Keine weiteren Verletzten. Ich erklärte etwas ungehalten die Verletzungen, die ich gesehen hatte. Mir versprach die sanfte Stimme am anderen Ende sehr einfühlsam, schnell Hilfe zu schicken. Gut in Deeskalation geschult. So fühlte man sich also an diesem Ende der Leitung, dachte ich noch. Hektisch riss ich die Beifahrertür auf und griff nach meinem Arztkoffer – warum hatte ich den denn nicht gleich mitgenommen – in diesem Moment kam mir ein Geistesblitz. Ich rannte doch noch zur Fahrerseite, stieg ins Auto und wendete, es so gut es eben ging, halb schräg auf der Fahrbahn, schaltete das Abblendlicht ein und versuchte, die Scheinwerfer durch die Nacht in Richtung der Frau zu positionieren.
Bis ich erneut bei ihr war, hatte sie sich einen weiteren Meter nach vorn geschoben, sodass sie am Rand des Lichtkegels lag. Ich kniete mich neben sie und griff ihr wieder an die Schulter. Ihre Lippen bewegten sich, ich beugte mich zu ihr hinab, doch diesmal konnte ich hören wie sie ein ängstliches „Nein! Bitte nicht!“, flüsterte.
„Ich bin Arzt! Ich werde Ihnen helfen, sie brauchen keine Angst zu haben!“
Sie strampelte noch heftiger, und jetzt konnte ich immer wieder ein fast flehendes „Nein!“, aus ihrem blutigen Mund hören.
Ich zog mir ein Paar Handschuhe an und begann, sie von oben nach unten abzutasten, um eventuelle Frakturen oder sonstige Verletzungen zu entdecken. Als ich mich abstützte, um mich über sie zu beugen, griff ich in etwas Warmes, Klebriges. Selbst durch den Handschuh konnte ich es fühlen. Im ersten Moment beachtete ich das nicht weiter. Ich tastete ihre Schultern ab, und ihr dreckiges Shirt verfärbte sich braunrot. Erst jetzt begriff ich, dass ich in eine Blutlache gegriffen hatte. Warum war mir das nicht vorhin schon aufgefallen? Ein dilettantischer Anfängerfehler tadelte ich mich selbst. Ich hätte sie gleich untersuchen sollen, dann hätte ich schon beim Notruf eine bessere Aussage über ihre Verletzungen treffen können.
Auf der Suche nach der Blutung schob ich ihr T-Shirt nach oben und sah zahlreiche Hämatome in allen Blau- und Lilatönen auf ihrem zierlichen Körper, selbst in dem spärlichen Lichtschein des Autos. Bis auf das verdreckte Shirt war sie vollkommen nackt, sie trug nicht einmal Unterwäsche. Ihre Schultern waren so dick, dass man glaubte, die Haut würde jeden Moment reißen. Sicher luxiert. Bis auf zahlreiche kleinere Wunden in Höhe der Rippen linksseitig konnte ich auf ihrem Oberkörper keine größere Blutung ausmachen.
Ihr Anblick schockierte mich, ich fragte mich, was sie wohl für einen Unfall gehabt hatte.
Wie lang war sie schon hier herumgetaumelt, bis ich sie gefunden hatte? War es eher doch kein Unfall gewesen?
Was machte sie in dieser gottverlassenen Ecke, so spät am Abend, halbnackt?
Dies war die einzige Straße, in der Umgebung gab es sonst nur zerfahrene Waldwege. In der Nähe war ein altes Hotel, das aber schon seit Jahren geschlossen war. Danach kam ein kleines Dorf, doch das war von hier aus fast noch zwei Kilometer entfernt, und so weit konnte sie in diesem Zustand ganz sicher nicht gelaufen sein. In die andere Richtung kam nur die kleine Hunsrücker Provinzstadt. Wollte sie dort hin?
„Ist hier noch jemand? Hatten Sie einen Unfall? Ist hier sonst noch jemand?“
Sie antwortete nicht.
Ich starrte auf die Frau vor mir, während sich die Blutlache ihren Weg durch das Gras bahnte wie eine Flasche ausgelaufenes Öl. Da ich noch immer nicht erkennen konnte, wo das Blut herkam, klemmte ich mir die Taschenlampe zwischen die Zähne und tastete so den Körper der jungen Frau ab. Dabei sah ich ausgeprägte, fast schwarze Ringe mit blutigen Rissen an ihren Fuß- und Handgelenken und an ihrem Hals im Licht der Taschenlampe schimmern, ein krasser Kontrast zu ihrer sonst bleichen Haut.
Der Gedanke ließ mir ein zweites Mal das Adrenalin in die Adern schießen: Sie hatte keinen Unfall gehabt! Sie war gefesselt gewesen! Gefesselt und gewürgt. Jemand hatte sie absichtlich so zugerichtet. Was war dem armen Ding nur passiert? Und wo war ich hier hineingeraten?
Als würde es mir helfen, blickte ich mich noch einmal um. Es war niemand zu sehen, keinerlei verdächtige Geräusche zu hören. Nur das entfernte Grollen des nahenden Gewitters, das Rauschen meines eigenen Pulses und das Rascheln des Gebüschs im Wind zeugten von Leben um mich. Auch der Vogel hatte Ruhe gegeben. Noch immer die Taschenlampe im Mund schwenkte ich zu einer Weißdornhecke auf der anderen Seite der Straße, doch ich konnte niemanden entdecken. Der Nieselregen wurde stärker, dennoch war es noch immer ungewöhnlich warm. Ein Regenschauer würde endlich die Abkühlung bringen, auf die alle seit Wochen warteten.
Müsste nicht langsam der Rettungswagen kommen?
Wieder konzentrierte ich mich darauf, die Ursache der Blutung zu finden. Die Frau stöhnte erneut ein leises „Bitte nicht!“, aber sie wurde stiller und ihre Bewegungen waren zu einem leichten Zucken geworden. Ich musste mich beeilen, bevor sie mir hier verblutete. Ich drehte ihr Becken zu mir, um ihren Rücken zu untersuchen, da lief ihr ein Schwall Blut über die Beine.
Die Ursache hatte ich gefunden: Sie blutete vaginal. Stark. Lebensbedrohlich.
Zitternd zog ich mir frische Handschuhe an und riss mehrere Verbandsrollen auf. Ich probierte, die Blutung zu stoppen, indem ich ihr die Verbände wie Tamponaden einführte. Ihre Genitalien waren so zerfleddert, dass ich nur erahnen konnte, was ich da tat. Ich konnte ihr innerlich alles zerreißen, oder aber durch den Druck die Blutung stoppen. Sie schrie auf, was nicht mehr menschlich klang. Sie wand sich und versuchte, nach mir zu treten.
Wo nahm sie nur diese Kraft her? Was tat ich hier eigentlich? Ein weiterer Schwall Blut quoll schaumig aus ihrem Mund. Ich kam mir vor wie ein Vergewaltiger.
„Sch... Alles gut! Ich versuche nur, Ihnen zu helfen!“
Endlich war in der Ferne ein Martinshorn zu hören, doch ich konnte nicht erkennen, woher es kam oder wie weit es tatsächlich entfernt war.
Ihr Zucken hatte aufgehört, sie war völlig still geworden. „Scheiße, nein!“, hörte ich mich fluchen, fühlte ihren Puls, der nur noch schwach zu spüren war. Sie lebte noch! Ich versuchte, sie bei Bewusstsein halten, doch jegliche Spannung war aus ihrem Körper gewichen.
Schwer zu sagen, ob sie noch etwas bemerkte.
„Bleiben Sie wach! Gleich kommt der Notarzt! Alles wird gut!“ Dieses Mal glaubte ich meinen eigenen Worten nicht.
„Nein.“ Es war nur noch ein Hauchen, ihre Augenlider flatterten.
Jetzt war ich es, der schrie: „Nein, nein, nein!“ Ich hatte mir nicht meinen Abend und mein Hemd und die Hose ruiniert, damit sie mir hier unter den Fingern wegstarb! Was war das nur für eine verdammte Scheiße?!
Ich puhlte eine Braunüle aus meiner Tasche, desinfizierte ihre Hand und versuchte, ihr einen Zugang zu legen. Das Zittern meiner Hände erschwerte meine Bemühungen. Ihre Venen waren kaum zu ertasten und es gelang mir erst beim dritten Versuch, eine zu treffen.
„Bleib wach, verdammt!“ Ich flehte schon fast, beugte mich dann über sie und schrie sie an. Am liebsten hätte ich sie geschüttelt, an ihren luxierten Schultern gepackt und geschüttelt, bis sie die Augen öffnete.
Das Martinshorn war nicht mehr zu hören, einen Moment lang glaubte ich zu träumen. Einen dieser Träume, der in Zeitlupe abläuft. In welchem man, egal wie laut man schreit, sich selbst nicht hören kann. Man fühlt nicht, dass man nass ist. Oder Müde. Nur die Verzweiflung, die sich mit der Gewissheit verbündet, dass man verloren hat.
Ich schloss die Augen, um sie nicht weiter ansehen zu müssen. Mein Kopf war leer.
Als ich die Augen wieder öffnete, lag sie völlig regungslos vor mir. Der Puls war kaum noch fühlbar. Wenn dieser verdammte RTW nicht augenblicklich auftauchen würde, würde sie sterben. Ich drehte die Frau in die stabile Seitenlage. Ihr Kopf fiel zur Seite und ich blickte auf die andere, die linke Seite ihres Gesichts. Sie war unverletzt.
Es traf mich wie ein Schlag, durchzuckte meinen Körper wie kleine Blitze. Mein Magen rebellierte.
In dem Moment hielt der Rettungswagen neben meinem Volvo, ich stand auf, schwankte und übergab mich im einsetzenden warmen Juniregen ins Gras.
Ich kannte sie.
Kapitel 2
In der folgenden Nacht.
Es war nach Mitternacht, ich saß mit einem Whiskey in der einen und einer Zigarette in der anderen Hand im Wintergarten meiner Stadtvilla.
Ich hatte seit meinem Studium nicht mehr geraucht und es fühlte sich weniger beruhigend an, als ich es mir erhofft hatte. Der Rauch brannte in meiner Lunge. Erstaunlich, wie man in Stresssituationen in alte Muster verfällt. Auch der Whisky verströmte nicht die gewohnte Wärme auf dem Weg durch meinen Körper. Meine Hände konnten nicht aufhören zu zittern, und ich musste das Glas neben mir auf einem Beistelltischchen abstellen, sonst hätte ich vermutlich den größten Teil des Inhalts einfach verschüttet.
Fühlte sich so ein Schock an? Laut dem, was ich noch aus meinem Studium wusste ja. Ich hatte ihr Schreien im Ohr, sah sie noch immer vor mir, wie sie sich wehrte. Sie hatte Angst vor mir gehabt.
So etwas hatte ich noch nie. Selbst in all den Jahren am Krankenhaus, in denen ich durchaus noch schwierigere Fälle betreut hatte, konnte ich sofort abschalten, sobald ich meinen Kittel abstreifte. Ich war nicht der Typ, der noch zu Hause über die Behandlung seiner Patienten nachgrübelte. Oder der länger blieb, um noch irgendwem das Händchen zu halten. Ich blieb immer sachlich, konstruktiv und auf Abstand. Ich wollte nicht von meinen Patienten bis in die Träume verfolgt werden, nicht noch abends im Wintergarten an sie denken müssen.
Das eine war mein Beruf, das andere mein Leben. Ich wollte beides, nur nicht gemeinsam.
Hauptsächlich war ich nur Arzt geworden wegen des Ansehens. Prestige. Und natürlich, weil ich es konnte. Mir war das Lernen nie schwergefallen. Wo andere stundenlang für Klausuren büffelten, merkte ich mir den Lerninhalt oft schon im Unterricht.
Meine Eltern hatten mich allerdings zur Strebsamkeit erzogen. Fleiß, Ausdauer, Leistung. Wer etwas erreichen will, muss sich reinhängen. Also lernte ich nachmittags zusätzlich, las die Bücher aus unserem Haus, schaute Dokumentationen in den dritten TV-Programmen. Mein Fleiß zahlte sich aus: Ich hatte mein Abitur mit der Eins vor dem Komma bestanden, mir stand alles offen. Doch ich war auf das Medizinstudium fixiert.
Schon als Kind war mir aufgefallen, wie die Menschen meinen Vater behandelten. Wie einen Gott. Eigentlich hatte ich nie erlebt, dass jemand respektvoller behandelt wurde als mein Vater Dr. Konrad Hub, seinesgleichen Allgemeinmediziner. Das wollte ich auch. Gut bezahlt wurde man auch in anderen Jobs, aber derartigen Respekt gab es nur als Arzt. Menschen vertrauen dir, wenn du einen weißen Kittel anhast. Du trägst die Verantwortung für deren Leben.
Eine gewichtige Aufgabe. So stellte ich mir das vor.
Ein wirklicher Menschenfreund war ich jedoch nie geworden. Vielleicht war gerade deswegen das Studium für mich kein Problem gewesen. Ich liebte medizinische Herausforderungen, nur um mich auf Trab zu halten, als eine Art Wettbewerb mit meinen Kommilitonen, weniger der Patienten wegen.
Nach dem Studium in Berlin hatte ich an der Uniklinik in Homburg gearbeitet. Vom Assistenzarzt bis zum Oberarzt. Habe Knochenmark- und Stammzelltransplantationen durchgeführt und Patienten vor dem Tod durch Leukämie gerettet. Leidenschaftlich, eben dieser Herausforderungen wegen. Aber diese Leidenschaft war auf dem Weg zum internistischen Allgemeinmediziner in einem Provinzkaff verloren gegangen.
Ich war inzwischen einfach Arzt, genau wie jemand Anderes Fliesenleger oder Finanzbuchhalter war. Es war mein Job. Selbst das hohe Ansehen war in dieser Berufsgruppe dank Google und Co. nicht mehr so hoch wie noch vor dreißig Jahren, als ich zu meinem Vater aufgeschaut hatte.
Eigentlich gab es heutzutage überhaupt keinen Beruf mit einem derart hochgeschätzten Status mehr. Damit hatte ich mich mittlerweile abgefunden.
Nun saß ich in einem meiner Loungesessel, hörte dem Regen zu und spielte das Was-wäre-wenn-Spiel. Hundert Gedanken schossen mir durch den Kopf. Was wäre, wenn ich pünktlich mit meinen Hausbesuchen fertig gewesen wäre. Wenn ich Sebastian abgesagt hätte? Was wäre, wenn schon jemand vor mir an der Unfallstelle gewesen wäre? Wenn ich nicht die Abkürzung gefahren wäre? Oder einfach nicht angehalten hätte? Es würde sicher keinen Unterschied machen, denn ich ging sowieso davon aus, dass sie diese massive Blutung kaum überleben würde.
Dieser scheiß RTW hatte ewig gebraucht.
Zu lang.
Ich sah sie vor mir. Die Frau mit den roten Haaren, die Kinder an der Hand.
Michaela.
Der Whisky in meinem Glas leuchtete bernsteinfarben im Licht der Designerstehlampe, die Christine irgendwann als ‚Schnäppchen‘ erstanden hatte. Ich griff zittrig nach dem Glas. Dieses Haus, unser Haus, fühlte sich zu groß für mich an. Allein der Wintergarten, der sich über die gesamte Rückseite des Hauses zog, war größer als manche Wohnung, in der ich heute gewesen war.
Der Wintergarten war mein Lieblingsplatz im Haus. Vor allem jetzt, im Regen. Das Wasser prasselte auf das Glasdach, schlug gegen die Seitenscheiben. Ich hatte die Beleuchtung im Garten eingeschaltet. Sanftes, indirektes Licht aus den Ecken. Der Blick in den kleinen, langgezogenen Garten, in der Mitte der riesige Ahorn, hatte etwas Beruhigendes. Er wurde von einer Seite von einer fast zwei Meter hohen Backsteinmauer, von der anderen Seite von einer Thujahecke gesäumt. Mittig schlängelte sich der Rasen, an den Seiten zogen sich langgestreckte Beete, das Grundstück war leicht ansteigend bis in den hinteren Teil. Von der dortigen Sitzecke und dem Whirlpool hatte man einen tollen Blick auf das Haus. Auch das war Christines Werk. Sie hatte alles akribisch geplant und von einer Gartenbaufirma umsetzen lassen. Ich selbst kannte noch nicht eine der Pflanzen in den Beeten mit Namen.
Normalerweise liebte ich diese Strohwitwer-Abende, in denen ich mir bei gedämpftem Licht mit einem guten Wein oder Whisky in der Hand, einen Film ansah.
Heute jedoch, wo Christine in Frankfurt war, kam ich mir einsam vor. Zum ersten Mal stellte ich fest, dass ich gern mit jemandem über die Ereignisse des Tages gesprochen hätte. Nur gab es da niemanden, der in Frage kam. Keiner meiner oberflächlichen Freunde würde mitten in der Nacht ans Telefon gehen, geschweige denn vorbeikommen, da war ich mir sicher. Ich hatte zu niemandem ein besonders enges Verhältnis, ging nicht in Kneipen und gehörte keinem Verein an. Wir hatten noch nicht einmal Haustiere. Das Haus hatte mich leer und dunkel in Empfang genommen.
Und so saß ich allein da, vor mich hinstarrend und ging im Kopf alles noch einmal durch. Schon wieder. Und dann noch einmal und noch einmal.
Warum hatte ich Michaela nicht gleich untersucht und die Blutung entdeckt? Ich war völlig dilettantisch und kopflos vorgegangen. Ich verstand einfach nicht, wie mir so etwas hatte passieren können. Dieses Gefühl war neu für mich. Bisher hatte ich mich selten derart selbst analysiert, und wenn, war ich mit dem Ergebnis durchaus zufrieden gewesen.
Und dann wieder ihr Bild. Verquollen, blutig, blau. Was war ihr nur zugestoßen? Wie war sie dorthin gekommen? Hätte ich sie nicht mit eigenen Augen hinter der Hecke hervortaumeln gesehen, ich hätte nicht geglaubt, dass diese Frau noch in der Lage gewesen war zu laufen.
Nachdem der Krankenwagen eingetroffen war, hatte ein geschäftiges Treiben begonnen. Die Sanitäter legten Infusionen und holten die regungslose Rothaarige aus dem Regen in den RTW. Der Notarzt war gleichzeitig angekommen, und da der Platz im Krankenwagen begrenzt war, stand ich am Fußende der Trage wie ein Komparse. Ich kannte das Prozedere, und trotzdem kam es mir vor, als würde ein Film vor mir ablaufen und ich konnte nichts Produktives beitragen.
Das Blaulicht blinkte scheinbar in Zeitlupe. Es dauerte gefühlte Ewigkeiten, bis endlich auch der Rettungshubschrauber gewaltig dröhnend in einiger Entfernung auf der nassen Straße landete und die Verletzte in die Uniklinik gebracht werden konnte. Die Polizei war mittlerweile auch vor Ort, doch durch den Regen waren keinerlei Spuren mehr zu entdecken. Selbst die Blutlache, in der sie gelegen hatte, war fast vollständig weggewaschen worden. Ich beantwortete die ersten Fragen der Beamten, doch ich hatte nicht das Gefühl, etwas Sinnvolles zu der Aufklärung der Situation beitragen zu können. Der Film vor mir lief einfach weiter. Den Regen spürte ich kaum, doch die Lichter der vielen Fahrzeuge blendeten mich. Ich kann mich kaum an irgendwelche Details erinnern. Mein Kopf fühlte sich an wie in Watte gepackt.
Ein blau blinkendes Rauschen.
Ich hatte dem Blinklicht des Hubschraubers nachgesehen, dessen Rotoren den reinsten Wirbelsturm verursachten, bis er in den trüben Regenwolken verschwand. Jemand hatte mir angeboten, mich nach Hause zu fahren. Scheinbar sah ich so fertig aus, wie ich mich fühlte. Ich lehnte mit einem stillen Kopfschütteln ab. Nachdem ich dann selbst losgefahren war, bereute ich bereits, das Angebot nicht angenommen zu haben. Ich fuhr wie auf Autopilot, konnte mich nicht an den Heimweg erinnern.
Zu Hause hatte ich mich unter die Dusche gestellt, doch auch das heiße Wasser konnte nichts an meinem Zustand ändern. Normalerweise entspannte mich eine warme Dusche, egal ob nach dem Sport oder einem anstrengenden Tag, davon merkte ich heute Nacht nichts. Fast glaubte ich, jeder meiner Muskelfasern wäre noch immer in Alarmbereitschaft. Adrenalin pur. Als müsse ich gleich vor einem Säbelzahntiger fliehen können.
Das Blut war von meinen Händen verschwunden, doch ihr Bild nicht aus meinem Kopf. Meine Kleider waren voll Blut und Dreck, ich warf sie direkt in die Mülltonne, als könne ich damit die Erinnerung vernichten.
Ich war froh gewesen, noch von dem teuren Whisky der letzten Grillparty im Haus zu haben, und hatte mir reichlich eingegossen.
Und nun saß ich hier. Das volle Glas in der Hand. Unfähig, mich zu bewegen. Gequält in einer Endlosschleife meiner Erinnerung. Ich ertappte mich bei dem Gedanken, dass ich gerne wüsste, wie es ihr jetzt ging. Vielleicht lebte sie doch noch?! Ich versuchte, das Bild der geschundenen Frau durch das der strahlenden, ausdrucksstarken Frau, die ich einmal kennengelernt hatte, zu ersetzen. Das Bild vor meinem Auge schwankte.
Sie war meine Patientin gewesen, seit ich diese Praxis vor einem Jahr übernommen hatte. Noch vor einer Woche war sie mit ihren beiden Kindern bei mir gewesen. Die Kinder hatten Fieber, nichts Dramatisches. Wir hatten nie viel miteinander gesprochen, schon gar nichts Privates, aber ich wusste, dass sie verheiratet war, einen kleinen Jungen und ein kleines Mädchen hatte. Ihr Mann bewirtschaftete einen landwirtschaftlichen Hof im Nachbarort. Ganz in der Nähe der Stelle, an der ich sie gefunden hatte. War sie von zuhause gekommen?
Ich hatte stets ihr taffes Auftreten bewundert, auch wenn sie in der letzten Woche viel nervöser gewirkt hatte als sonst. Wenn ich sie in der Stadt traf, nickte sie nur kurz und ging ihrer Wege. Daran könnte sich so mancher Patient ein Beispiel nehmen. Sie war distanziert, lächelte aber stets und wirkte nie gestresst.
Eigentlich aber kannte ich sie schon viel länger. Wir hatten vor über zehn Jahren gemeinsam an der Uniklinik gearbeitet. Sie war eine der besten Laborantinnen, die ich kannte. Absolut besonders.
Wir trafen uns in der Mensa oder auch bei hausinternen Weiterbildungen. Manchmal telefonierten wir wegen irgendwelcher Befunde oder wir schauten uns Blutbilder, Knochenmarkpräparate oder sonstige Auswertungen gemeinsam an.
Das Markante an ihr? Es war ihr Auftreten, als habe sie eine Art Aura, mit der sie sämtliche Blicke auf sich zog. Selbstbewusst, nicht arrogant. Stark, nicht protzig. Elegant, nicht aufgetakelt. Es war, als bliebe die Zeit einen winzigen Augenblick stehen, sobald sie einen Raum betrat.
Und sie besaß ein unglaubliches Fachwissen. Alle Studenten versuchten stets, mit ihr die hämatologische Analytik zu bearbeiten. Obwohl sie damals noch so jung gewesen war, hatte sie bereits die stellvertretende Laborleitung inne. Sie hatte nicht nur dieses umfangreiche Wissen, sie konnte ebenso gut erklären. Sie war eine Koryphäe im Lesen von Blutbildern, und selbst so mancher Oberarzt holte ihren Rat ein, wenn es um auffällige Befunde ging.
Während meiner Zeit in der Hämatologie-Onkologie arbeiteten wir häufig im Rahmen von Stammzelltransplantationen zusammen. Sie war die zuständige Laborantin gewesen, wenn Knochenmark im OP entnommen wurde, um es direkt weiterzuverarbeiten. Wir waren ein paarmal gemeinsam im OP gewesen. Ich hatte es immer bewundert, wie dieses kleine, zarte Persönchen mit flinken Fingern souverän einen Arbeitsschritt nach dem nächsten abarbeitete. Spritzen mit Anti-Koagulanz spülen, aufgezogenes Knochenmark abmessen, über die Filtrationseinheit vorfiltrieren, abwiegen, spülen. Es hatte geschienen, als würde ihr nie ein Fehler unterlaufen.
Das Leder des Loungesessels quietschte leise, als ich jetzt meine Position änderte und die Beine ausstreckte. Ich wollte einen weiteren, kräftigen Schluck aus dem Whiskyglas nehmen und stellte fest, dass ich es bereits geleert hatte. Die Vernunft überwog und ich stellte den Single Malt in die kleine Bar im Wohnzimmer zurück. Die große Wanduhr zeigte bereits halb drei. Ich stieg die große, geschwungene Holztreppe ins obere Stockwerk hinauf und merkte, wie schwer meine Beine waren. Die Treppe knarrte bei jeder zweiten Stufe, das einzige Geräusch im Haus. Ich schlich über die Galerie zum Schlafzimmer und ließ mich, noch immer im Trainingsanzug, auf das Bett fallen. Regungslos. Zumindest körperlich. Die verdammte Gedankenspirale wollte noch immer nicht aufhören, sich zu drehen. Ich starrte an die Zimmerdecke, die im Schein der indirekten Beleuchtung warmweiß war.
Manchmal sah ich sie nach der Arbeit im Stadtbad ihre Bahnen schwimmen. Wenn das Wetter zu schlecht war, ging ich schwimmen, anstatt meine Runden mit dem Fahrrad zu drehen. Ich beobachtete sie dann stets aus dem Augenwinkel, und je länger ich sie beobachtete, desto mehr faszinierte sie mich. Ihr athletischer Körper glitt durch das Wasser, ich glaubte, sie gehöre nirgends anders hin. Sie schwamm Bahn um Bahn in den verschiedensten Schwimmstilen, stieg dann aus dem Wasser und ging hinaus, ohne sich einmal umzusehen. Ich weiß nicht, ob sie jemals gemerkt hat, dass ich dort war. Wenn ich ihr so zusah, hatte ich das Gefühl, das es nichts gab, was sie nicht unglaublich gut machte.
Sie umging private Gespräche geschickt, hielt sich von jeglichem Klatsch und Tratsch fern. Lediglich an Fachgesprächen beteiligte sie sich angeregt und mit unglaublichem Interesse.
Irgendwann war sie einfach verschwunden. Sie habe gekündigt, hieß es. Die Gerüchteküche brodelte, niemand wusste Genaueres.
Als ich vor einem Jahr zurück in meine Heimatstadt, ein Kaff mit nur ein paar tausend Einwohnern, einhundert Kilometer von der nächsten Großstadt entfernt, gezogen war und die Hausarztpraxis übernommen hatte, hatte sie plötzlich als meine Patientin vor mir gesessen.
Ich schloss die Augen und sah sie vor mir: Michaela Fuhr. Ihre langen, roten Haare fallen ihr locker über die Schulter, eine Strähne fällt ihr ins Gesicht. Sommersprossen tanzen bei jedem Lächeln auf ihrer Nase. Ja, sie lächelt. Ein Lächeln, bei dem deine Knie weich werden. Strahlend blaue Augen leuchten wie zwei kleine Bergseen. Sie ist so schön. Sie greift nach meiner Hand, zieht mich hinter sich her. Ich folge ihr ganz selbstverständlich.
Kapitel 3
Donnerstag, 22.06.2017
Sie lächelt mich an, greift nach meiner Hand. Sie ist so schön in ihrem weißen Kleid. Mein Herz schlägt bis zum Hals, mein Körper vibriert vor Erregung. Sie zieht mich hinter sich her, beginnt zu rennen, ihre Haare wehen im Wind. Es gibt kein wohin. Wir laufen einfach. Sie dreht sich immer wieder zu mir um. „Komm!“, flüstert sie und ich folge ihr weiter.
Als sie stehen bleibt, fahre ich mit den Händen über ihre seidige Haut. Sie fühlt sich so unglaublich zart an. Dann lässt sie sich ins Gras fallen und ich lege mich neben sie. Mit einer Hand streiche ich über ihren Oberschenkel, mit der anderen Hand wische ich ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Darunter zum Vorschein kommt ein blaues, blutiges, aufgequollenes Gesicht. Völlig entstellt. Sie blickt auf meine Hand. „Was hast du getan?“, flüstert sie. Erst jetzt fällt mir auf, dass auch meine Hand und mein Unterarm blutverschmiert sind. Ihr Kleid färbt sich braungrün und dunkelrot. Voller Flecken aus Gras und Blut, die immer größer werden. Als habe jemand Kirschsaft über sie geschüttet, der sich in den Stoff saugt. Ich schwitze aus allen Poren.
„Nichts!“, höre ich mich von irgendwoher sagen, „ich habe nichts getan!“
Sie beginnt zu schreien und zu treten. „Was hast du getan?“, schreit sie, „was hast du mir angetan?“
Ich will aufspringen und wegrennen, mein ganzer Körper zittert, aber sie hält mich am Handgelenk fest. „Du bringst mich um!“, schreit sie mich noch lauter an, blickt mir mit blutunterlaufenen Augen ins Gesicht. „Warum bringst du mich um?“ Ich versuche, mich aus ihrem Griff zu befreien, aber ich kann mich keinen Zentimeter bewegen, spüre wie sich ihre Fingernägel tief in mein Fleisch graben.
„Ich habe nichts getan!“, sage ich nun nur noch ganz leise.
Aus ihrem Mund quillt das Blut. Sie zuckt. „Warum bringst du mich um?“ Ihr ganzer Körper wird blau. Blut läuft aus ihrer Nase. „Das hättest du nicht tun dürfen!“, weint die Fratze.
Es war mir selten so leichtgefallen, morgens aufzustehen. Auch wenn ich einen Moment gebraucht hatte, um zu registrieren, dass ich schweißgebadet in meinem Bett lag. Der Albtraum saß mir in den Gliedern, schon wieder musste ich unter die Dusche. Und schon wieder brachte auch jetzt das Wasser nicht die erhoffte Besserung. Ich trocknete mich ab und betrachtete mich im Spiegel. Prinzipiell war ich mit dem zufrieden, was mich aus dem Spiegel anblickte. Hellblaue Augen, Dreitagebart, Grübchen am Kinn, schmale Nase, weiche Gesichtsformen, volle Lippen, gebräunter und trainierter Körper. Ich starrte an diesem Morgen das Spiegelbild an, als sei es ein Fremder, der mich da ansah, straffte die Schultern, atmete tief durch. Ich stieg in Chinos und ein kurzärmeliges Hemd, gelte meine blonden Haare zu der üblichen Strubbel-Surfer-Frisur, die zwar lässig wirkte, aber nur durch jahrelange Übung zur Perfektion gebracht wurde. Ein Hauch des Parfüms von Dior, das Christine so liebte, und ich war fertig im Bad.
Christine! Sollte ich sie anrufen und von letzter Nacht erzählen? Vielleicht möglichst beiläufig, entschied ich. Es war bereits Donnerstag. Morgen Abend würde sie zurück sein. Würde ich sie jetzt anrufen und ihr von der Sache erzählen, würde ich der Geschichte zu viel Gewicht beimessen. Christine war zurzeit etwas zart besaitet. Ich wollte sie nicht aufregen. Nein, wir mussten live und in aller Ruhe darüber reden.
Mir fielen die blutigen Kleider in unserer Mülltonne ein. Ich sollte sie in eine Tüte packen, damit Christine bei ihrem Anblick nicht einen Herzaussetzer bekam.
Meinen ersten Kaffee des Tages trank ich wie gewöhnlich an der Theke der Kochinsel unserer Küche. Wie der Rest des Hauses war auch die Küche aufwändig saniert worden. In das originale Holzparkett waren rund um die Kücheninsel Zementfliesen eingelassen worden. Die helle Holzküche mit den klaren Formen passte perfekt zu den riesigen halbrunden, und fein gearbeiteten Jugendstilfenstern. Für mich hätte ein Raum mit Kühlschrank, Weinkühler und Kaffeemaschine vollkommen ausgereicht. Christine aber kochte regelmäßig und liebte ihre Küche mit all dem Schnickschnack an Geräten und Ausstattungen.
Der eingebaute Bosch-Kaffeevollautomat brummte vor sich hin und füllte meinen To-Go-Becher mit Kaffee, um mir später auf dem Weg zur Praxis eine weitere Koffeindosis zuführen zu können.
Dank meiner Frau, die in dem Hunsrücker Provinzkaff ihr eigenes Architekturbüro betrieb, wohnten wir überhaupt nur in dem durchrenovierten, viel zu großen Haus im Jugendstil mitten in der Stadt. Christine hatte das Haus schon in der Studienzeit von ihrer Oma geerbt und schon damals erste Pläne für den Umbau geschmiedet. Sie nannte es gern ihre Villa, was durchaus nicht übertrieben war, wenngleich es natürlich nicht mit den Jugendstilvillen in Idar-Oberstein mithalten konnte. Das Haus hatte mehr Räume und Platz, als wir jemals benötigen würden.
Der großzügige Eingangsbereich trumpfte noch mit dem originalen Terrazzoboden auf, die reich verzierte, schwungvolle Treppe führte in den ersten Stock. Das Erdgeschoss war weitestgehend entkernt worden, sodass eine offene Küche in Ess- und Wohnbereich überging. Alles war hauptsächlich in Weiß gehalten und mit modernen Möbeln eingerichtet, selbst der alte offene Kamin war modern und neu verkleidet worden. Lediglich einige Elemente, wie der Wintergarten, der den Wohnbereich von der Terrasse und schließlich vom kleinen schlauchförmigen Garten trennte, erinnerte noch an den originalen Stil des Hauses.
Beim ersten Kaffee, der gleichzeitig mein Frühstück darstellte, blätterte ich unentschlossen in der Tageszeitung, wohl wissend, dass noch kein Artikel über die Geschehnisse der letzten Nacht darin sein konnte. Und doch suchte ich danach, oder besser gesagt, nach irgendetwas, dass meine Frage beantwortete.
Was war Michaela passiert?
Aber ich fand nichts. Keine Suchmeldung, keinen Aufruf zu Hinweisen aus der Bevölkerung. Nichts.
Hatte sie noch niemand vermisst? War sie gerade erst verschwunden?
Selbst auf meinem Fußweg in die Praxis grübelte ich und war viel früher als normal in der Praxis. Ich kochte mir einen weiteren Kaffee, fuhr die Computer hoch, sogar die Blumen goss ich und trank anschließend den x-ten Kaffee dieses Morgens. Schon nach dem ersten Schluck Kaffee in meinem Sprechzimmer wusste ich wieder, warum ich auch für die Praxis einen teuren Vollautomaten angeschafft hatte. Meine Arzthelferinnen begrüßten mich, als sie pünktlich um kurz vor acht Uhr kamen, mit großen Augen. Wie oft ich im letzten Jahr, vor ihnen in der Praxis war, konnte man an einer Hand abzählen. Ich bin eigentlich kein Morgenmensch.
Ich unterschrieb schon vorbereitete Überweisungen, Rezepte und Atteste, bevor ich mich in meinem Untersuchungszimmer hinter meinen großen eingebauten Schreibtisch setzte. Im Computer öffnete ich die Patientendatenbank.
Michaela Fuhr. Der Nachname schien einer der häufigsten in der Region zu sein, oder die Familie war ungewöhnlich groß, auf meiner Liste erschienen bestimmt zwanzig Fuhrs. Nur eine aber hieß Michaela.
Mit einem Doppelklick auf ihren Namen ploppten mehrere Fenster auf und ich überflog deren Inhalt, den ich eigentlich schon kannte. Denn nachdem sie vor einem Jahr in meiner Praxis aufgetaucht war, hatte ich genau dasselbe schon einmal getan.
Seit sie Patientin in der Praxis war, beschränkten sich ihre Besuche auf das Übliche: Erkältungen, einmal auch Rückenprobleme. Alles nichts Besonderes. Sie war selten in der Praxis. Über sie waren die beiden Kinder Paul und Martha, fünf und drei Jahre alt, versichert. Sie selbst war 36 Jahre alt.
Es gab kaum Informationen über sie, keine Blutwerte, Überweisungen oder Rezepte, lediglich ein Eintrag zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Es handelte sich um einen Hinweis von Dr. Elisabeth König, einer Psychologin und Psychotherapeutin, der vor acht Jahren verfasst worden war. Ein richtiger Bericht selbst war nicht abgespeichert, lediglich die Information, dass die Behandlung in der Praxis abgeschlossen war. Dieser Hinweis war mir vor einem Jahr ganz sicher nicht aufgefallen.
Vor ungefähr zehn Jahren hatte Michaela noch mit mir an der Uniklinik gearbeitet, der Grund für die Psychotherapie lag also vermutlich in der Zeit danach. Oder sie hatte ihre Probleme hervorragend vor uns Kollegen verborgen. Es konnte alles sein. Von Angstattacken über Depressionen. Vielleicht war das der Grund für ihre Kündigung gewesen?
Ich schaute auch nach den Arztbesuchen der Kinder, aber hier gab es ebenso wenig Einträge. Keine besonderen oder chronischen Erkrankungen. Der Vorname ihres Mannes fiel mir nicht ein, und bei der Häufigkeit des Nachnamens würde ich ihn wohl kaum in meiner Datenbank finden.
Ich wusste nicht, welche Informationen ich erwartet hatte, dennoch war ich enttäuscht. Irgendwie hatte ich gehofft, etwas zu finden, was Licht ins Dunkel bringen würde. Auch wenn ich keine Ahnung hatte, was das hätte sein sollen. Hinweise auf häusliche Gewalt? Möglicherweise. Ich hatte sie fast ausschließlich zusammen mit ihrem Mann in der Stadt gesehen. Ein Schrank von einem Kerl. Groß, breite Schultern, riesige Hände. Ich schluckte beim Gedanken an ihn.
Wer sonst sollte ihr so etwas angetan haben? Einen Unfall konnte man durch die Fessel- und Würgemale sicher ausschließen. Außerdem hatte ich einmal gelesen, dass die meisten Verbrechen im privaten Umfeld passierten.
Oder sollte es etwas mit besagter Psychotherapie zu tun haben? Vielleicht sollte ich mich mit Dr. Angelika König in Verbindung setzen, doch was würde ich für einen Grund angeben? Neugier? Ich könnte die alte, noch nicht elektronische abgelegte Patientenakte ansehen, dort könnte ein weiterer, vollständiger Bericht der Psychologin enthalten sein. Nach kurzer Überlegung entschied ich mich für die zweite, die weniger auffällige Variante.
Ich nahm das Mobilteil des Telefons und rief am Empfang an.
„Sarah, können Sie mir bitte die alte Akte von Michaela Fuhr aus dem Archiv raussuchen? Ich finde nicht alle Daten in der digitalisierten Version.“
„Ja natürlich, Dr. Hub. Jetzt sofort?“
„Wenn sie jemand im Laufe des Tages suchen könnte, wäre das okay. Jetzt sofort wäre natürlich super.“
Im benachbarten Wartezimmer hörte ich die ersten Stimmen von Patienten. Ich straffte die Schultern, bevor ich den ersten Patienten aufrief, den mir mein Computer anzeigte.
Die Zeit schien kaum zu vergehen. Ein Patient nach dem anderen kam und ging. Doch auch der Stapel eingegangener Post verlangte zwischendurch noch meine Aufmerksamkeit. Rechnungen, auszufüllende Formulare, Abrechnungen, medizinischer Dienst. Dann wieder die nächsten Patienten. Verdammte Bürokratie.
Es war bereits kurz nach zwölf und ich hatte noch nicht alle Patienten des Vormittags gesehen. Katharina, eine andere Sprechstundenhilfe, erschien in der Tür.
„Dr. Hub, da sind zwei von der Polizei. Die wollen Sie sprechen. Soll ich sie gleich reinlassen oder sollen sie warten?“
„Oh. Nein, sie können natürlich direkt kommen.“
Hatte sich bis jetzt der fehlende Schlaf der letzten Nacht bemerkbar gemacht, war meine Müdigkeit plötzlich wie weggeblasen. Die Arbeit hatte für ein wenig Ablenkung gesorgt, doch jetzt schossen mir die Bilder und vor allem die Geräusche der letzten Nacht ungebeten in den Kopf und breiteten sich wie ein Fieber aus. Ob ich sie jemals vergessen oder zumindest verdrängen könnte?
Und schon wieder fragte ich mich, ob Michaela Fuhr noch lebte.
Eine kräftige, fast schon dicke Blondine, die ich auf Mitte fünfzig schätzte, gefolgt von einem jungenhaft wirkenden, schlaksigen Mann in Uniform betraten den Raum. Sie stellten sich als Kriminaloberkommissarin Christine Weinberger und Jochen Irgendwas, der keinen Dienstgrad angab, vor und wedelten mit Dienstausweisen.
Ich bot ihnen die zwei Stühle gegenüber meines Schreibtisches an und sie kamen ohne Umschweife zur Sache.
„Dr. Hub, es geht um den Vorfall letzte Nacht. Gibt es etwas, das Ihnen vielleicht noch eingefallen ist?“ Die Blondine hatte das Reden übernommen.
Ich überlegte. Ein Vorfall also.
„Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Sie ist eine Patientin von mir, daher fällt einiges, was ich vielleicht sagen könnte, unter die Schweigepflicht“, tat ich wichtig. „Ich kann eigentlich nur wiederholen, was ich Ihren Kollegen bereits heute Nacht gesagt habe.“
Sie lächelte mild, was ihrem Gesicht etwas Künstliches gab, und beugte sich in Richtung meines Schreibtisches. So als wolle sie mir möglichst kumpelhaft ein Geheimnis verraten. Sie war mir von Anfang an unsympathisch.
„Würde es Ihnen etwas ausmachen, das für uns zu tun? Wir möchten nichts übersehen“, sagte sie, und ich erwartete fast, sie würde mir zuzwinkern.
Der junge Polizist machte sich eifrig Notizen.
Ich holte tief Luft und demonstrierte so meine Gereiztheit. Am liebsten hätte ich beide wieder weggeschickt, sie stahlen mir die Zeit, und im Wartezimmer saßen immer noch drei Patienten. Doch ich hoffte, Informationen zu bekommen. Wie ein neugieriger Journalist. Sensationsgeil? Besorgt? Ich glaubte mich irgendwo dazwischen.
„Als ich gestern Abend die Straße entlang fuhr …“
„Um welche Uhrzeit etwa?“, unterbrach mich der eifrige Schlaksige.
„Ich schätze so kurz vor zehn.“ Ich wartete, bis er mitgeschrieben hatte und mich erwartungsvoll anblickte. „Ich sah einen Schatten hinter dem Gebüsch entlanglaufen, der dann im Gras verschwand. Als ich nachsah, fand ich sie dort liegen.“
„Verstehe ich das richtig? Sie war noch bei Bewusstsein und ist noch gelaufen?“ Die Blondine runzelte die Stirn. Es machte sie nicht hübscher.
„Hab ich doch gesagt“, sagte ich und stellte mich darauf ein, dass es länger dauern würde, wenn sie jedes Wort noch einmal bestätigt haben wollten.
„Können Sie sagen, von wo sie kam?“
„Keine Ahnung“
„Ist Ihnen in der Umgebung etwas aufgefallen? War noch jemand dort? Irgendwelche besonderen Geräusche? Irgendwas Ungewöhnliches? Es könnte wirklich alles wichtig sein.“
„Nein“, antwortete ich, „das hätte ich schon letzte Nacht den Kollegen erzählt.“
„Ja natürlich.“ Die Blondine lächelte, doch ihre Augen blieben kühl. „Wir wollen nur nichts übersehen, nicht wahr? Da sie ja noch bei Bewusstsein war, als Sie ankamen. Hat sie mit Ihnen gesprochen? Hat sie Ihnen erzählt, was passiert ist?“
„Nein. Ich habe sie mehrfach angesprochen. Sie sagte etwas wie ‚Nein‘ oder ‚Bitte nicht‘. Aber nichts sonst.“ Ich blickte beide fragend an. Der Dicken spannte die helle Bluse viel zu eng über Brust und Bauch. „Was ist denn passiert?“
Sie lächelte verschwörerisch. „Darüber können wir Ihnen leider keine Auskunft geben, Dr. Hub.“ Sie machte eine bedeutungsvolle Pause und der Schlaksige schrieb weiter. „
Was können sie als Arzt zu ihren Verletzungen sagen?“, fuhr sie dann fort.
Ich überlegte, was ich sagen sollte. Dies war vermutlich nicht der Platz für meine Spekulationen. Außerdem würde ganz sicher ein Rechtsmediziner die Ursache der Verletzungen erklären können. Ich beschränkte mich also auf rein objektive Beobachtungen. „Sie hatte eine Schädelverletzung, vermutlich eine Verletzung im Bereich der Lunge, massive innere Blutungen und zahlreiche Hämatome.“
„Können Sie sagen, ob die Hämatome alle frisch waren? Oder waren auch ältere Verletzungen dabei?“
„Soweit ich das einschätzen kann, waren alle neu. Ich bin aber kein Rechtsmediziner. Wissen Sie, wie es ihr geht? Lebt sie noch? Die Blutungen waren sehr stark.“
„Soweit wir wissen, lebt sie noch. Mehr kann ich dazu aber nicht sagen“, trällerte sie, als würde sie die Lottozahlen verkünden.
„Sie gaben an, sie zu kennen und sie sagten, Frau Fuhr ist Ihre Patientin. Sind Ihnen früher schon Verletzungen aufgefallen? Ungewöhnliche blaue Flecke? Stürze oder so etwas? Ungewöhnliches Verhalten? Andere Besonderheiten?“
Netter Versuch, dachte ich und sagte: „Frau Weinberger, Sie wissen genauso gut wie ich, dass ich unter ärztlicher Schweigepflicht stehe!“
Ungerührt fuhr sie fort: „Was können Sie uns sonst noch über Frau Fuhr sagen? Gibt es etwas, das wir wissen sollten?“
Ich konnte diese Frau absolut nicht leiden. Mir fehlte bei ihrem Gegrinse ein Gespür für die Ernsthaftigkeit der Lage. Vielleicht wird man so nach einigen Jahren bei der Kripo. So wie Ärzte auch irgendwann abstumpfen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, ihr vertrauen zu können, und sie wirkte nicht derart kompetent, als dass ich sie in meine Gedankenspiele einbeziehen wollte. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass diese beiden Gestalten vor mir in der Lage waren, die Puzzleteile zusammenzusetzen.
„Weiter gibt es nichts“, antwortete ich knapp. „Ich kannte sie nicht weiter. Wir haben zwar vor vielen Jahren an der Uniklinik in einer Abteilung gearbeitet, aber auch da hatten wir nicht sehr viele Berührungspunkte. Alles, was ich Ihnen erzählen könnte, sind Patientendaten, und da bin ich wie schon gesagt an die Schweigepflicht gebunden.“ Ich erhob mich und lief demonstrativ in Richtung Tür. „Würden sie mich jetzt bitte entschuldigen, es warten noch einige Patienten. Ich melde mich, sobald mir etwas einfällt, das für Sie hilfreich sein könnte.“ Ich öffnete die Tür.
Weinberger erhob sich und blieb vor mir stehen. „Die gemeinsame Arbeit an der Uniklinik, wann genau war die?“
„Ich bin nicht ganz sicher, ich denke das war von Beginn meiner Facharztausbildung dort, also vor zwölf Jahren, bis etwa vor zehn Jahren. Da hatte Frau Fuhr meines Wissens gekündigt.“
Weinberger gab mir ihre Karte, nickte und verließ mein Zimmer. Ich blickte den beiden nach. Sie stiefelte selbstsicher den Gang entlang, während ihr Kollege, dessen Vornamen ich direkt auch vergessen hatte, hinter ihr her wackelte. Ein komisches Duo. Fast wartete ich darauf, dass jemand „Cut“ rufen und ich mich im aktuellen Tatort-Dreh wiederfinden würde.





























