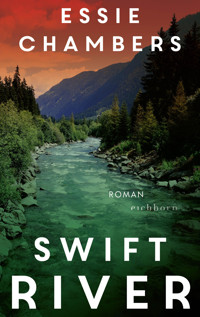
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein generationsübergreifendes Familienepos voller Liebe
Sommer 1987: Die 16-jährige Diamond fühlt sich als Außenseiterin. Ständig wird sie wegen ihres Gewichts gehänselt, zudem ist sie die einzige Schwarze weit und breit und hat mit diversen alltäglichen Rassismen zu kämpfen. Erst recht, seit ihr Vater spurlos verschwunden ist, ein Ereignis, das Anlass ist für allerlei Tratsch im Ort - und Diamond nachhaltig beschäftigt. Doch dann erhält sie Post von einer Unbekannten, und erfährt endlich mehr - über ihren Vater und die eigenen Wurzeln.
Ein berührender, Jahrzehnte umspannender Roman über den Wunsch nach Zugehörigkeit und die komplizierte Beziehung zwischen Vätern und Töchtern. Mit Essie Chambers lernen wir eine beeindruckende neue Autorin kennen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
CoverTitelImpressumWidmungZitatProlog12345678910111213141516171819202122232425Anmerkungen der AutorinDanksagungROMAN
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Eichborn Verlag
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»Swift River«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2024 by Essie Chambers
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2025 by Bastei Lübbe AG,
Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Textstudio Eva Wagner
Umschlaggestaltung: Barbara Thoben, Köln
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-6458-2
eichborn.de
luebbe.de
Für Christine
jemand in mir erinnert sichaus »far memory« von Lucille Clifton
Prolog
Man stelle sich Pops Turnschuhe vor: Abgetragen und verdreckt von der Gartenarbeit stehen sie ordentlich abgestellt am Flussufer, dort, wo das Gras in den Sand übergeht. Es ist die breiteste und tiefste Stelle des Swift River in einem dschungelartigen Waldstück, das einem das Gefühl gibt, allein in der Wildnis zu sein, obwohl man der Landstraße auf der anderen Flussseite so nah ist, dass man das Verkehrsrauschen hören kann. An heißen Sommerabenden waren wir oft mit der ganzen Familie dort – es war der einzige Ort, an dem wir unbehelligt schwimmen gehen konnten, ohne dass die Leute unsere Körper beäugten, die schwarz, weiß und braun waren. Ma schwamm sogar manchmal nackt, und ihr blasser Körper glitt wie eine Lichtspur durch das dunkle Wasser. Pop war Nichtschwimmer. Er stand im hüfttiefen Wasser, hob mich hoch in die Luft und schleuderte mich in den Fluss wie eine Kanonenkugel. Wieder und wieder paddelte ich zu ihm zurück. Sein stolzes, fluoreszierend weißes Lächeln war das Leuchtfeuer, auf das ich zuhielt.
Es ist der erste Juli. Die Strömung ist heute besonders stark, das Wasser aufgewühlt – aufgepeitscht vom Sommerregen, wie Grandma Sylvia zu sagen pflegt. Pop verlässt an diesem Morgen das Haus schon früh, lange bevor Ma und ich aufstehen. Er vergisst, mir Frühstück zu machen. Lässt den Wagen in der Einfahrt stehen. Als Ma nach unten kommt, betrachtet sie stirnrunzelnd die Tür, als würde ihr etwas auf der anderen Seite Kopfzerbrechen bereiten. Sie geht zum Fenster und schaut mit besorgtem Blick in die Ferne. Ich beschließe, meine Cornflakes nicht mit Zucker zu bestreuen, obwohl niemand hinschaut. Zu den Fragen, die ich nicht stellen mag, fallen mir Antworten ein: Es ist nicht genug Benzin für Pop und Ma im Tank – sie muss zur Arbeit, und er muss sich erst eine suchen. Wahrscheinlich ist er zu Fuß losgezogen.
Zwei Tage später tauchen seine Schuhe auf. Darin: seine Brieftasche und sein Haustürschlüssel. Pop selbst ist verschwunden.
Während der gesamten nächsten Woche durchkämmen Männer in Booten mit langen Haken und Netzen den Fluss. Sie sehen aus wie die Fischer, die wir vor zwei Jahren im Sommer in Cape Cod gesehen haben, nur dass sie mit ihren Netzen einen Menschen – meinen Menschen – aus dem Wasser fischen sollen. Die Männer ziehen ein Dreirad, eine Matratze und einen toten Hirsch aus dem Fluss, dessen Geweih im Schlamm festgesteckt hat. Aber keinen Pop.
Dann wird die Suche außerhalb des Flusses, in immer größerer Entfernung zu den Turnschuhen, fortgesetzt – im tiefsten Teil des Waldes, in den verlassenen Fabrikgebäuden flussauf- und abwärts, in Jagdhütten und Werkzeugschuppen, unter Veranden und in unserem Haus, im feuchten, schmutzigen Keller, den Pop eines Tages zu einem Fernsehraum umbauen wollte. Dann verlagert sie sich erneut aufs Wasser, bis sie irgendwann im Sande verläuft. Bald ist auch der Sommer vorbei.
Als der Herbst beginnt, komme ich in die vierte Klasse – das Leben springt abrupt in die gewohnten Bahnen zurück, als hätte ich keinen Vater, der vermisst wird, und keine Mutter, die Angst hat, mich aus dem Haus zu lassen, aber auch vergisst, mir etwas zu essen zu machen. In der Schule lesen wir Die Abenteuer des Huckleberry Finn. Ich bin die Größte und Klügste in meiner Klasse. Ich bin auch die einzige Schwarze Person in meiner Schule, und jetzt, wo Pop nicht mehr da ist, die einzige Schwarze Person in der ganzen Stadt. Die anderen Kinder nennen meinen Vater »Nigger Jim«, denn: Er ist Schwarz, er ist in einem Fluss verschwunden, und er trägt keine Schuhe. Mrs. Durkin lässt die Kinder nachsitzen, drückt mich an ihre Brust, fährt mir mit ihren langen Fingernägeln durch die verknoteten Locken und sagt: Kinder können sehr grausam sein, aber wenn du sie ignorierst, lassen sie dich irgendwann in Ruhe. Ich weine mich bei ihr aus, weil sie so nett ist, aber auch, weil sie so was von unrecht hat – ich wünschte, ich wüsste das nicht mit solcher Gewissheit. Pop bleibt verschwunden.
Das Wort Verschwunden hängt weiter im Raum, und nach einiger Zeit (einem Sommer, einem Herbst und noch einem Sommer) gibt es allen die Erlaubnis, die Lücken in der Geschichte mit Gemeinheiten und Unsinn zu füllen.
Wie zum Beispiel: Pop wurde von einem rassistischen Serienkiller ermordet und skalpiert, der seinen Afro als Mopp benutzt. Oder er wurde beim Schwimmen von einem Wasser-Sasquatch ins Meer hinausgezogen, oder er hat seinen Tod nur vorgetäuscht und hat irgendwo mit gestohlenem Geld und einer anderen weißen Frau ein neues Leben angefangen.
Jahre vergehen, und die Geschichte ändert sich ein letztes Mal. Diesmal sind Ma und ich die Bösen. Wir fahren per Anhalter von Ort zu Ort, verführen Männer, rauben sie aus und springen aus fahrenden Wagen. Nachts streifen wir am Flussufer herum, auf der Suche nach etwas Geheimnisvollem, das mein Vater vor seinem Verschwinden vergraben hat. Wenn die Glühwürmchen so groß sind, dass sie fast wie Minilaternen aussehen, und ein verirrter Lichtstrahl auf einen vorbeikommenden Wagen fällt, behaupten sie, es wären wir – Diamond und Ma –, die dort wieder ihr Unwesen treiben und im Licht von Taschenlampen nach Schätzen graben.
Ich erfahre erst von diesem haarsträubenden Unsinn, nachdem ich die Stadt längst verlassen habe.
Zurück zu uns dreien. Bevor ich zum Flussmonster werde, bevor die Kinder mit angehaltenem Atem an unserem Haus vorbeischleichen, bevor ich meinen Namen verliere, bin ich ein kleines, braunhäutiges Mädchen auf dem Rücksitz eines VW-Käfers und schaue zu, wie der Straßenbelag an den durchgerosteten Löchern im Wagenboden vorbeirast, als würde ich fernsehen. Ma und Pop sitzen vorne. »Lass das«, sagt Ma, ohne sich umzudrehen, als ich probeweise Sachen in die Löcher werfe: einen glatten Stein aus dem Fluss, einen Penny, ein kaputtes Happy-Meal-Spielzeug, die alle klappernd gegen die Unterseite des Wagens prallen. Wir unternehmen eine unserer sonntäglichen Zwei-Tage-nach-Zahltag-voller-Tank-Spazierfahrten, die für unsere Familie ein Luxus sind. Ich hebe den Kopf und sehe die Landschaft an uns vorbeifliegen: Farmerstände, private Flohmärkte, Brennholzstapel, grob zusammengezimmerte Kaninchenställe und dümmlich glotzende, an Bäumen angebundene Hunde, die sich fast strangulieren, als sie versuchen, nach unseren Reifen zu schnappen.
»Was, wenn wir einfach immer weiterfahren und nie mehr zurückkommen?«, fragt uns Pop.
»Und was ist mit meinem Spielzeug?«, wende ich nach kurzer Überlegung ein.
»Ach, komm schon. Wir können dir jederzeit neues kaufen«, sagt er und zwinkert mir im Rückspiegel zu.
»Wir können doch meine Mutter nicht allein in der Stadt zurücklassen«, sagt Ma, die nicht in unseren Witz eingeweiht ist.
»Wir können dir auch jederzeit eine neue Mutter kaufen«, sagt Pop.
Ich kann Mas Gesicht nicht sehen, aber als Pop die Hand nach ihrer Wange ausstreckt, wehrt sie sie ab.
»Da Diamond und ihre Spielsachen den ganzen Rücksitz für sich beanspruchen, müssen wir Sylvia wohl aufs Dach schnallen«, sagt er. Ich stelle mir vor, wie Grandmas beige bestrumpfte Beine mit den dicken Knöcheln, die aus ihren glitzernden Tanzschuhen quellen, neben meinem Fenster baumeln. Ma ist bemüht, nicht zu lachen, aber ihr Glucksen lässt ihren ganzen Körper beben.
Die Zeit steht still. Alles, was ich je brauchen werde, befindet sich in diesem Wagen – bis auf Grandma Sylvia. Ich versuche den Verlust abzuschätzen und beschließe, mich mit dem zu begnügen, was da ist: Ma, die die Füße aus dem Fenster hält und deren Lachen klingt wie das Wiehern eines Esels. Pop, der irgendein Lied schief vor sich hin summt und Ma vorsichtig mit seiner großen Hand den Nacken streichelt, als hätte er Angst, sie kaputtzumachen.
Die Zeit krümmt sich. Wir haben nie in dieser Stadt gewohnt, sind nur auf der Durchreise. Da, wo wir herkommen, sind alle Menschen freundlich und haben dunkle Haut wie ich.
Simon and Garfunkel singen im Radio »The Only Living Boy in New York«. Ich bin das einzige lebende Mädchen im Swift River Valley.
Eine Mücke, die irgendwie ins Wageninnere gelangt ist, sticht mir ein Muster in die Beine. Ich bohre die Fingernägel in die Stiche, bis winzige, blutige Kreuze entstehen, und freue mich schon auf die Krusten, die sich darauf bilden werden, weil man daran herumknibbeln kann.
»Und, sollen wir weiterfahren, Zuckerschote?«, fragt Pop und dreht sich zu mir um. Ma die Meckerziege haben wir aus dem Gespräch ausgeklammert.
»Ja! Ja! Ja!«, schreie ich und trete gegen die Trennwand zwischen den Vordersitzen. »Fahr weiter!«
Die Zeit läuft rückwärts. Es gibt noch kein »Wir drei«. Schwarze leben in dieser Stadt, nennen sie ihre Heimat. Sie arbeiten als Fabrikarbeiter, Schuster, Tischler und Bedienstete. Es gibt eine Kirche für Schwarze und eine Schule für Schwarze, die Fabrikglocke unterteilt ihre Tage. Sie bevölkern die Straßen von The Quarters, rufen sich »Morgen!« und »’n Abend!« zu. In den Hinterhöfen flattert Wäsche auf der Leine wie Flaggen, die ein Schwarzes Land markieren.
Dann, eines Nachts, verschwinden sie einfach. Das waren meine Leute.
Dies ist kein Krimi und auch keine Legende. Es ist eine Geschichte über das Fortgehen.
Und sie nimmt ihren Anfang mit meinem Körper. Er ist eine Karte der Welt.
1
1987
Im Sommer nach meinem sechzehnten Geburtstag bin ich so dick, dass ich mein Rad nicht mehr fahren kann. Deshalb sorge ich dafür, dass es geklaut wird.
»Hast du einen neuen Freund?«, ruft Ma, die Klugscheißerin, mit bellendem Raucherhusten-Lachen aus dem Wohnzimmerfenster, als sie sieht, wie ich mit einem Eimer und einem Putzlappen auf dem Boden vor dem Haus liege und mich über mein Fahrrad beuge.
»Willst du das Ding etwa bespringen?«, fragt sie. Ich ignoriere sie, und sie lässt mich in Ruhe und raucht weiter ihre Newport – ein gesichtsloser Schemen hinter dem schmutzigen Fliegengitter. Das ganze Haus sieht aus, als würde es rauchen.
Es ist heiß, und das Fahrrad glüht praktisch, weil es den ganzen Vormittag im Garten herumgelegen hat. Ich beuge mich in dieser Position über das Fahrrad, weil es die einzige ist, in der ich an alle Teile herankomme. Mit einem Lappen wische ich den Straßenschmutz ab, bis die knallrote Farbe des Rahmens zum ersten Mal seit Jahren wieder zum Vorschein kommt. Sie scheint den übrigen Schrott um uns herum zu verhöhnen: skelettierte Gartenstühle, ein kaputter Schieberasenmäher, das Wrack von Pops Wagen in der Einfahrt.
»Steckst du fest?«, ruft Ma und sieht zu, wie ich mich mühsam aufrapple. Mit ihren dummen Witzen stellt sie meine Bereitschaft, ihr zu vergeben, auf eine harte Probe. Vor einer Stunde hat sie mir gestanden, dass sie schon wieder gefeuert wurde, diesmal, weil sie ihrem Chef in der Düngemittelhandlung die Meinung gegeigt hat, als der sich geweigert hat, für einen weiteren Krankheitstag zu bezahlen. Jetzt müssen wir von dem Gehaltsscheck leben, den ich vom Tee Pee Motel bekomme, wo sie früher auch gearbeitet hat, als ich noch klein war. Ich erinnere sie ständig daran, dass wir uns zwischen Strom und Heizung entscheiden müssen, wenn der Winter kommt, aber sie meint, ich soll mir keine Sorgen machen, Erwachsene würden Pläne schmieden, von denen ihre Kinder nicht einmal etwas ahnten. »Ich habe meine Mittel und Wege«, singt sie, in ihrer Kuhle auf der Couch sitzend.
Ma ist die Ausnahme in der langen Reihe von Vorfahren, die ihr Leben lang nur einen Job hatten. Ich bin die Ausnahme in ihrer rein irischen Familie: die erste Schwarze, das Ende der Weißen.
»Hast du was an den Ohren?« Sie lässt nicht locker. Ich beschließe, zwei Tage lang nicht mit ihr zu sprechen.
Während ich auf alle viere komme, huscht ein laserartiger Lichtstrahl über meine Hand und das Gras vor mir. Als ich mich umdrehe, entdecke ich unsere Nachbarin und ihre Freundinnen – dumme Neuntklässlerinnen –, die in knallbunten Badeanzügen im Vorgarten liegen und lachend versuchen, mich mit den Bräunungsreflektoren zu blenden, die sie sich unter das Kinn halten. Sie sind nicht allzu weit entfernt, nur zwei Häuser, aber ihre Gesichter sind vor glänzendem Babyöl und blitzenden Zahnspangen kaum zu erkennen. Ich stelle mir vor, dass ich, wenn ich wollte, zu ihnen rüberspazieren und mein schmutziges Putzwasser über ihre schäbigen Badetücher und blassen, fettglänzenden Körper schütten könnte. Die eine oder andere Ohrfeige verteilen könnte. Aber ich bin nicht wie Pop. Ich kann nicht gegen alles und jeden ankämpfen.
»Danke für unsere gemeinsame Zeit.« Ich berühre den Reifen meines Fahrrads. »Ich hab dich wieder hübsch gemacht. Du bist jetzt frei.«
Später am Nachmittag lehne ich das Rad sanft, wie eine Opfergabe, an einen Laternenpfahl vor dem CVS Health. Ma hat mich in die Drogerie geschickt, um ihren Monatsvorrat an verschreibungspflichtigen Medikamenten abzuholen, was ungefähr fünf Minuten dauert, aber ich treibe mich eine ganze Stunde lang im hinteren Teil des Zeitschriftengangs herum und lese das National Gardening Magazine und Seventeen, bis die Kassiererin mich ermahnt, entweder etwas zu kaufen oder in die Bibliothek zu gehen. Als ich draußen die leere Stelle am Laternenpfahl entdecke, bin ich bestürzt – aber nicht wegen des Fahrrads, sondern wegen des Fahrradkorbs. Ich habe vergessen, die Bänder zu entfernen, die Grandma Sylvia zwischen die Stäbe geflochten hatte – leuchtend rote, blaue und weiße Streifen, die umso lauter im Wind schnurrten, je schneller ich fuhr. Es sind dieselben, die sie mir ins Haar geflochten hat, als ich noch klein war und mir wünschte, meine krausen Locken wären ebenso fedrig wie die der anderen Mädchen. Es macht mich immer noch fertig, dass Ma die Nähutensilien von Grandma weggeworfen hat, als sie gestorben ist. Ma mag kein sentimentales Chaos. Sie sammelt leere Colaflaschen (»die machen sich gut als Vase«), alte Fernsehzeitschriften und einen Müllsack voller Hautlotionen in Reisegröße, die sie im Tee Pee mitgehen lassen hat, als sie dort noch als Zimmermädchen gearbeitet hat. Aber die Habseligkeiten ihrer eigenen Mutter wirft sie weg.
In diesem Moment überkommt mich eine solche Sehnsucht nach Grandma Sylvias Garn, Reißverschlüssen, Knöpfen und Stoffresten, die nach Jergens-Lotion gerochen haben, dass mich ein Gefühl von Schwindel und Schwere erfasst und ich mit meinem ganzen Gewicht – 130 Kilo, als ich mich zuletzt gewogen habe – auf den Gehweg knalle. Kurz überlege ich, auf der menschenleeren Straße Diebstahl! zu rufen, aber dann fällt mir wieder ein, wie es sich angefühlt hat, wenn meine Beine bei jeder Umdrehung der Pedale gegen den Bauch drückten, sodass meine Lunge zusammengepresst wurde und ich kaum noch atmen konnte. Meine drei Bauchspeckrollen sind zu einer solide Einheit verschmolzen. Ich bin unbeweglich geworden. Meine Beine sind wie massive Phantome, die mich durch die Gegend tragen. Ich habe Blutergüsse und schmerzhafte blaue Flecken am ganzen Körper, die von meinen wöchentlichen Stürzen herrühren und mich ständig daran erinnern, dass das Rad mich nicht mehr tragen mag. Wir brauchen einander nicht mehr.
Macht’s gut, Grandmas Bänder.
Von der Drogerie aus – die in einem neuen, hässlichen Ziegelbau am südlichen Ende der Main Street untergebracht ist – sind es zwei Meilen bis zu mir nach Hause. Es steht etwas abseits von der langen Reihe traditioneller Geschäftsfassaden, die noch folgen, mit ihren dicken, trüben Scheiben und kitschigen Schildern, gemalt von irgendjemandes Cousine, deren Hobby Kalligraphie ist. Die Papierfabrik, in der Pop früher gearbeitet hat, befindet sich ganz in der Nähe. Ma und ich wohnen oben im Norden, in einem der gleichförmig aussehenden Häuser, die früher den franko-kanadischen Fabrikarbeitern gehörten. Die Weißen nennen sie »The Quarters«, aber ganz früher haben dort Schwarze gelebt, die die Textilfabrik geführt haben. Sie haben das Viertel »Little Delta« getauft, weil es dreieckig ist und jemanden an seine alte Heimat in den Südstaaten in einem Flussdelta erinnert hat. Alle, bis auf meine Großtante Clara, haben die Stadt verlassen. Und weil sie noch vor meiner Geburt gestorben ist, hatte ich nicht mal Gelegenheit, sie kennenzulernen. Pop hat erzählt, dass sie Hebamme war. Hin und wieder sagt jemand: Deine Grandma hat meinen Dad auf die Welt gebracht! Und ich frage mich dann, warum sie uns nicht anders behandeln, besser behandeln.
Ich rufe Ma nicht an, damit sie mich von der Drogerie abholt. Sie kann nicht Auto fahren, und Taxis sind zu teuer – wir nutzen sie nur im Notfall oder am Zahltag. Wir sind die einzigen in der Stadt, die zu Fuß irgendwo hingehen. Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel außer den Schulbussen, und die einzigen vernünftigen Gehwege schlängeln sich durch die Meile mit den klobigen Wohnblöcken, die das Stadtzentrum bilden. Manchmal sieht man Homeless Richard, der an der Highway-Auffahrt imaginäre Steine gegen das Auffahrtsschild kickt, als würde er die Grenzen eines Kraftfelds austesten. Seit Beginn der Hirschplage, die wir »Hirsch-o-kalypse« nennen, kann man auch gelegentlich ein paar von den Tieren an einer Straßenecke herumlungern sehen wie gelangweilte Teenager. Ansonsten sind nur wir dort unterwegs, marschieren nacheinander dem Verkehr auf der linken Straßenseite entgegen, wenn es uns nichts ausmacht zu laufen, oder vorgebeugt auf der rechten Seite, wenn wir per Anhalter fahren wollen.
Auf dem Fahrrad scheint der Teil der Stadt zwischen der Main Street und zu Hause nur aus vorbeirauschenden Orten zu bestehen, an denen man schnell vorbeifährt, ohne anzuhalten, sodass all die schlimmen Erinnerungen, die damit verbunden sind, im Luftzug auf meinem Gesicht und dem Hämmern in meiner Brust verschwimmen. Aber jetzt, zu Fuß, geraten sie schrecklich-scharf in den Fokus: Hier ist der Barbershop, in dem man sich geweigert hat, Pops Afro zu stutzen; dort das muffig riechende Kaufhaus, wo sie schale Saltwater-Taffy-Bonbons und Garfield-Figuren verkaufen; und hier das Diner, wo Ma und ich früher am Sonntagabend üppige Abendessen genossen, bis man mich beschuldigte, Trinkgelder von den Tischen geklaut zu haben.
Wenn ich zu Fuß unterwegs bin, starren die Leute mich so entgeistert an, als würde ich lichterloh in Flammen stehen. Sie verdrehen sich in ihren Autos die Hälse um fast hundertachtzig Grad. Verkäufer in Schaufenstern halten bei der Arbeit inne und schauen mich mit ausdrucksloser Miene an, als wäre ich nicht die Mitschülerin ihrer Tochter oder die Kollegin ihrer Freundin, als würden sie mich nicht schon mein ganzes Leben lang kennen. Wenn ich kurz vergesse, was für ein Spektakel ich bin, drehe ich mich um, um zu schauen, wen sie so anstarren. Pop ist früher manchmal abrupt stehengeblieben und hat wortlos zurückgestarrt, bis sie sich irgendwann abgewandt haben. Meist aber hat er sie ignoriert, zumindest bis zu den letzten schlimmen Monaten. Heute ruft Ma den Leuten manchmal Dinge zu wie: Was ist, bist du etwa neidisch?, und schwingt ihren dürren Arsch in ihre Richtung.
Auf halbem Weg nach Hause bleibe ich beim einzigen Münztelefon in der Main Street stehen. Darin gibt es eine Bank, und die Tür lässt sich schließen, wofür ich dankbar bin, denn mir tut alles weh. Füße, Knie, meine geschwollenen Wurstfinger – der Schmerz pulsiert in mir wie ein Morsecode: Ruh dich aus, bis du wieder fit bist. Es kommt in letzter Zeit häufig vor, dass der Schmerz, der an irgendeinem meiner Körperteile zerrt, mir eine Nachricht direkt ins Hirn schickt. Nicht wie ein höheres Selbst oder Gott, der zu mir spricht. Nur eine klare, feste Stimme, die ich bin, aber irgendwie auch nicht. So ist mir auch die Eingebung gekommen: Wenn ich für mein Rad zu dick bin, dann lerne ich halt Autofahren. Ma habe ich noch nichts davon erzählt. Die Vorstellung ist wie eine Pfütze, die einen Fluss aufnehmen soll.
Ich blättere im Telefonbuch und wünschte, es gäbe jemanden, den ich anrufen und bitten kann, mich abzuholen. Wir haben wenige Freunde – eher Leute, die uns den einen oder anderen Gefallen tun. Aber ich habe auch eine Art Freundin: Fat Betty. Allerdings kenne ich ihre Telefonnummer nicht, weil wir uns immer nur über Bücher und Büchereikram unterhalten. Betty ist schon erwachsen und unsere Stadtbibliothekarin. Sie hat früher 180 Kilo gewogen, bis sie sich vor einem Jahr im Diet Center angemeldet hat. Jetzt ist nur noch die Hälfte ihres früheren Ichs übrig, aber die Leute nennen sie immer noch Fat Betty. Ich bezweifle, dass ihr neuer Körper ihr in dieser Stadt je einen neuen Namen einbringen wird, denn alles, was mit einem geschieht, wird hier zu einem Fleck, der zwar verblasst, aber nie ganz verschwindet.
Betty unterstützt mich immer – steckt fröhliche, handgeschriebene Lesezeichen mit Bücherei-Slogans in die Bücher, die ich mir ausleihe. Als sie immer dünner wurde und ich immer dicker, hat sie angefangen, mir ihre alten Sachen – hübsche von Lane Bryant, die wir uns nie leisten könnten – vor unsere Tür zu legen, anfangs anonym, dann mit einer ihrer freundlichen Nachrichten versehen. Selbstbewusstsein kleidet dich am besten! Dann folgten gesunde Snacks und Bücher, von denen sie glaubt, sie könnten mir gefallen, wie Sophies Entscheidung oder Die Farbe Lila. Sie ist wie eine weise Frau aus der Zukunft, die gekommen ist, um mir Dinge mitzuteilen, die ich wissen muss, und Dinge zu bringen, die ich brauche, um mich hier rauszukämpfen. Mit »hier« meine ich diese Stadt und meinen Körper.
Zum Spaß suche ich unsere Telefonnummer aus dem Telefonbuch. Sie ist immer noch unter NEWBERRY, Robert gelistet. Direkt daneben hat jemand NIGER gekritzelt. Ich nehme einen Stift aus der Tasche und schreibe dazu: der drittlängste Fluss in Afrika!
Selbst nachdem ich ein paar Minuten dort gesessen habe, kriege ich immer noch kaum Luft, und mir kommen keine weiteren hilfreichen Gedanken. Nur der Zweifel kreist endlos in meinem Kopf: Hätte ich mein Fahrrad besser behalten sollen?
»Och, das ist ja doof, Zuckerschote«, sagt Ma, als ich ihr von dem Diebstahl berichte.
Sie steht in BH und abgeschnittener Jogginghose mit einem Schnürsenkel als Gürtel vor dem Herd und kocht Abendessen, und ihr ständig zerzaustes Haar steht wirr in alle Richtungen ab. Was auch immer sie da kocht, verströmt einen verwirrenden Geruch – süß und fischig zugleich, als hätte sie das wenige, was noch an Lebensmitteln im Haus war, einfach in einen Topf geworfen. Sie ist nicht die schlechteste Köchin, aber wenn sie etwas anderes kocht als einfache Gerichte – wie Sloppy Joes, Fischstäbchen oder Thunfischauflauf –, kann niemand vorhersagen, was am Ende auf dem Teller landet. Dass sie experimentiert, bedeutet, dass sie sich wegen irgendwas schuldig fühlt.
»Komm her, probier das mal.« Sie deutet mit dem klebrigen Löffel auf den Küchentisch. »Deine Mutter ist eine Koch-Zauberkünstlerin.«
»Mehr hast du dazu nicht zu sagen?«, frage ich. Ich stehe in der offenen Tür, und das Herz schlägt mir immer noch bis zum Hals. Ich habe ganz vergessen, dass ich nicht mehr mit ihr sprechen wollte. Sie kriegt nicht mit, dass ich aus dem letzten Loch pfeife. Fragt nicht, wie lange ich für den Heimweg gebraucht habe (zwei Stunden).
»Deine übergewichtige Freundin hat dir anscheinend wieder was vorbeigebracht.« Ma deutet auf ein Päckchen neben der Haustür, das an mich adressiert ist.
»Pop wäre losgezogen, hätte das Rad gefunden und dem Dieb eine reingehauen«, sage ich.
Ich erwähne Pop nicht oft, aber ich will, dass sie mir endlich zuhört, und das habe ich geschafft. Ich sehe, wie Ma in sich zusammensinkt, als wäre ihr der Stecker gezogen worden. Sie schwankt leicht. Das geht mir nah: ihr runder Rücken, der auf dem besten Weg ist, sich zum gleichen Skoliosebuckel zu entwickeln wie der, den Grandma Sylvia in ihren letzten Jahren hatte, bis ihre Wirbelsäule fast rechtwinklig verkrümmt war.
»Steh gerade, Ma«, sage ich, jetzt sanfter.
»Leute zu verprügeln, hat noch nie jemandem geholfen«, sagt sie, strafft die Schultern, schaut aber immer noch nicht vom Herd auf. »Es hat immer alles nur noch schlimmer gemacht.«
Ich schüttle die Tüte mit den Pillen wie eine Rassel, und endlich fährt sie herum.
»Ich hab dir deine Tic Tacs besorgt«, sage ich.
Wir nennen Mas Schmerzmedikamente Tic Tacs. Sie hat mir den Scherz eingeimpft, hat ihn so oft wiederholt, dass ich gar nicht anders kann, als ihn ebenfalls zu benutzen. Wir reden nie über ihre Schmerzen, die von einem Unfall herrühren, über den wir ebenfalls nicht sprechen.
»Das mit dem Rad tut mir leid«, sagt sie.
»Und dem Korb«, sage ich.
Sie nickt.
Ich stelle die Pillendöschen in einer Reihe aufs Fensterbrett hinter der Spüle, wo früher Grandma Sylvias Chia-Pets gestanden haben. Der Igel war meine Lieblingsfigur. Ma hat mal einen Anfall gekriegt, als Grandma ein Chia-Männchen mit breiter Nase, riesigen Lippen und einem grünen Afro nach Hause gebracht hat. Sie hat es aus dem Fenster geworfen, hat gesagt, es sei rassistisch, und Grandma sei ebenfalls rassistisch, wie könne sie sich noch im Spiegel anschauen, wo sie doch eine schwarze Enkelin habe. Mir tat Grandma leid. Sie sah verwirrt aus, als könnte sie die beiden Dinge nicht miteinander vereinbaren. »Hab ich was falsch gemacht?«, flüsterte sie mir später in meinem Zimmer zu, als sie mir einen Gutenachtkuss gab. »Ja und nein«, erwiderte ich, weil mir das die richtige Antwort zu sein schien.
Wir setzen uns und essen, was sich als Dosenfleisch mit Sauce und gekochten Kartoffeln herausstellt. Normalerweise habe ich für den Fall, dass es so was zum Abendessen gibt, Snacks aus dem Automaten im Tee Pee Motel im ganzen Haus versteckt, aber mein Vorrat ist aufgebraucht. Um das Essen runterzuspülen, trinke ich eine Mischung aus Milchpulver und Pepsi, wie Laverne aus Laverne&Shirley. Ich habe mir immer eine beste Freundin wie sie gewünscht.
»Ich besorg dir einen dieser Einkaufstrolleys«, sagt Ma. »Dann schmücke ich ihn, wie deinen Korb.«
Ich weiß, Ma hat nicht das Geld, um einen Trolley oder sonst was Neues zu kaufen. Es soll angeblich immer eines Tages Geld reinkommen, aber in diesem Sommer könnte es tatsächlich so weit sein. Es ist jetzt fast sieben Jahre her, seit Pop verschwunden ist, und Ma sagt, wir können ihn endlich offiziell für tot erklären lassen und seine Lebensversicherung kassieren. Meine Erbschaft, wie sie es nennt. Das geistert in jeder Hoffnungen-für-die-Zukunft-Unterhaltung herum, die wir je geführt haben – es richtet uns auf, führt uns aber gleichzeitig nirgendwo hin. »Nächstes Jahr gehört das Haus wieder uns!« – »Wir lassen dein Knie in Ordnung bringen und kaufen Wasserbetten und Fernsehsessel!« – »Bald können wir uns zehn davon leisten!«, sagt sie über alles, was wir uns anschaffen wollen. Jedes Mal, wenn Ma an dem Schild mit der Aufschrift »Bankeigenes Haus – Zu verkaufen« vorbeikommt, das seit sechs Monaten in unserem von Unkraut übersäten Vorgarten steht, verpasst sie ihm einen Tritt. Sie träumt davon, dass sie dem Typen von der Bank eines Tages einen Haufen Geld auf den Schreibtisch wirft und ihm sagt, dass er sie mal kann. Anscheinend glaubt sie, dass das Haus bis in alle Ewigkeit zum Verkauf stehen wird, statt der Tatsache ins Auge zu sehen, dass wir jederzeit auf der Straße landen könnten.
In letzter Zeit habe ich mir auch gelegentlich erlaubt, an das Geld zu denken, zügle meine Hoffnungen aber, wenn sie zu sehr überhandnehmen. Zu meinem siebzehnten Geburtstag wünsche ich mir: eine Geburtstagsparty mit Schokotorte und Freunden, neue Anziehsachen, die noch nach Geschäft riechen, und Schuhe, die mir passen. Ich träume davon, dass ich einen Atari oder Caldor kaufe, obwohl ich keine Videospiele mag – nur damit Besucher damit spielen können. Dass ich Kleingeld in einem Glas sammeln kann, als würde ich es nicht noch am selben Tag, in derselben Woche brauchen. Dass ich diese Stadt und Ma verlasse. Aber der Gedanke ist zu schmerzhaft, und so ersticke ich ihn im Keim.
Wir gehen ins Wohnzimmer, damit der Fernseher unser Gehirn übernimmt. Ma will Ein Grieche erobert Chicago sehen, aber ich setze mich durch, und wir schauen eine Wiederholung von Good Times an, denn darin geht es um Schwarze – das bringt sie immer zum Schweigen. Wir schlürfen geschmolzenes Cool Whip und lachen über diese Welt, die wir gar nicht kennen. Mir fällt auf, dass Ma in ihrem Leben mehr Schwarze getroffen hat als ich, was ganz schön unfair ist. Ich stehe auf und hole mir eine Schachtel mit glasierten Donuts, die ich in das Cool Whip tauche.
Unsere rostigen, wackeligen Metallserviertische stehen auf einem blauen Flauschteppich, der den gesamten Boden einnimmt, also essen wir von den Knien. Grandma Sylvia hat Ma den Teppich aussuchen lassen, als sie noch klein war. Ma fand, dass er aussah wie blaues Gras. Das Gefühl, mich darauf herumzuwälzen, habe ich schon immer gemocht, mag es heute noch. Ma hat auch die dazu passende Tapete ausgesucht, die mit verschlungenen grünen Ranken und riesigen blauen Blumen auf einem gelben Hintergrund bedruckt ist, auch wenn mittlerweile alles zu Grau in Grau verblasst ist. Grandma hat uns das Haus geschenkt, als ich noch klein war, weil sie in ein Seniorenwohnheim gezogen ist. Im Laufe der Jahre hat Ma versucht, all ihre kitschigen Schneekugeln und uralten Porzellanfigürchen zu entsorgen, aber die fünfzig Jahre alten, Staub hustenden Möbel, die durchgebogene Decke, die quietschenden Betten und der karierte Linoleumboden in der Küche sind noch dieselben. Selbst das Holzschild, das Grandpa Joe gemalt hat, hängt noch über der Eingangstür, ein fröhliches grünes, vierblättriges Kleeblatt, das alle im Haus einer längst verschwundenen Familie willkommen heißt: The O’Briens, Luck of the Irish! Als würden wir Housesitter für Geister spielen. Oder an einem Ort leben, den wir noch nicht verdienen.
Nur mein Zimmer fühlt sich so an, als würde es wirklich mir gehören.
Ich entfliehe der Fernsehzeit mit einem Stapel Ritz-Cracker-und-Schmelzkäsedip-Sandwiches, die ich vorsichtig auf einer Hand balanciere, schiebe Bettys Paket mit dem Fuß in mein Zimmer und schließe die Tür. Als ich mich aufs Bett werfe, stoße ich mit dem Kopf gegen die hohle Holzverkleidung und höre Ma im Wohnzimmer »Was ist passiert?« rufen. Das macht sie jedes Mal. Die Holzverkleidung verleiht dem Zimmer das Aussehen einer Schiffskabine aus einem Film. Oder das eines riesigen Schwarzen Bretts. Ich habe es in eine Mischung aus beidem verwandelt.
Es ist gerade genug Platz für ein Einzelbett, eine Kommode und einen winzigen Schreibtisch, zwischen denen jeweils nur ein paar Schritte liegen. Auf einer Seite des Bettes habe ich Bilder von Bullaugen aufgehängt, die ich aus einem Buch namens Cabin Class Rivals: A Picture History herausgerissen habe. Wenn man nicht zu genau hinschaut, sehen sie fast echt aus. Der Rest der Wand ist mit Bildern von Orten zugekleistert, die ich eines Tages besuchen will: die ägyptischen Pyramiden, das englische Stonehenge, den Redwoods Forest, den Botanischen Garten in New York. »Wozu willst du all diese Pflanzen und Bäume sehen? Wir haben hier doch selbst genug!«, sagt Ma.
Sie drängt mir ständig Sachen auf, von denen sie hofft, dass ich sie an meine Wand hänge, wie zum Beispiel Seiten, die sie aus einem Stapel Reitzeitschriften herausgerissen hat, den Mrs. Konkol entsorgt hat. Sie zeigen sich aufbäumende Pferde, über die Ma geschrieben hat: Die werden wir eines Tages reiten! Alte Fotos von uns, wie wir steif vor unserem damals noch hübschen Haus stehen, und Werbung für Diamantringe aus einer Schmuckwarenbroschüre, auf die Ma gekritzelt hat: Die können dir nicht das Wasser reichen!
Auf dem Nachttisch steht mein Kassettenrekorder. Seit ich letztes Jahr den Chor verlassen habe, mache ich etwas Seltsames: Ich nehme meinen Gesang auf, spiele ihn ab und singe mit mir selbst im Duett. Ma sagt, ich hätte eine perfekte Singstimme, aber das muss sie ja – sie ist schließlich meine Mutter. Der Chorleiter hat es zwar ebenfalls gesagt, aber die Chorkinder haben manchmal »Muh« gerufen, wenn ich gesungen habe.
Während ich mir den Stapel Cracker-Sandwiches auf die Brust lege, fällt mir auf, dass die schwarzen Punkte an der Decke die Wand hinuntergekrochen sind und sich bis zu einem alten Star-Wars-Poster ausgebreitet haben. Ich habe mir früher immer vorgestellt, die Punkte wären ferne Planeten und die Wasserflecken Wolken am Nachthimmel. Jetzt sehe ich Schimmel und eine Decke, die aufgrund des undichten Dachstuhls verrottet. Als das hier noch Mas Zimmer war, war die Decke blau gestrichen, und an den Wänden hingen Poster von Teeny-Idolen aus kitschigen Fernsehsendungen, in denen es immer genug Geschwister gab, um eine Band oder ein Baseballteam zu gründen.
Mein Magen fühlt sich gefährlich voll an.
Ich streiche über meinen Bauch – die Haut ist gespannt und heiß, als würde darunter ein Essensvulkan brodeln. Weiße Dehnungsstreifen, die aussehen wie Blitze, verlaufen über meine Körpermitte. Mir tut der Bauch weh, und ich frage mich, was passiert, wenn ich eines Tages zu weit gehe. Ich warte darauf, dass sich meine Verdauung beruhigt.
Ich hole mein Fahrschulhandbuch aus dem Versteck unter der Matratze und lese das Kapitel »Sicherheit geht vor«. Ich habe schon »Fahrerlaubnisklassen« und »Beschränkungen« durchgearbeitet und habe vor, alle Gesetze auswendig zu können, bevor ich nächste Woche mit dem Unterricht anfange. Die theoretische Prüfung habe ich schon bestanden und dafür Mas Unterschrift auf dem Anmeldeformular gefälscht, wie jedes Mal, wenn ich eine elterliche Erlaubnis brauche. Ich versuche mich auf Bremslichter und Fahrtrichtungsanzeiger zu konzentrieren, als ich einen mannshohen Schemen am Fenster vorbeihuschen sehe. Dass Leute vor dem Haus herumschnüffeln, ist nichts Ungewöhnliches, besonders seit das »Zu verkaufen«-Schild im Vorgarten steht. Aber normalerweise stehen sie ganz offen da, schauen in die Fenster hinein und prüfen die verrotteten Holzschindeln, als wäre das Haus unbewohnt. Ma schreit sie manchmal an: Wenn Sie das Haus hier kaufen, kaufen Sie uns gleich mit! Jetzt gerade macht mich die Vorstellung, dass jemand da draußen rumlungert, so wütend, dass ich mich aufrapple und zur Tür raus bin, noch ehe ich an meinen fast platzenden Bauch denken kann. Mas Schnaufen und Schnarchen verrät mir, dass sie auf der Couch eingeschlafen ist. Ein Geräusch, das mich normalerweise nervt, jetzt aber etwas Beruhigendes hat, wie ein Seil, das mich ans Haus bindet, sodass ich nicht zu weit in die Nacht hinausgezogen werden kann.
Ein paar Schritte vor der Tür entfernt bleibe ich auf dem Pfad stehen, der den Vorgarten in zwei Teile unterteilt, und lausche, ob ich die Schritte eines fliehenden Eindringlings höre – knackende Zweige, ein nicht zu unterdrückendes Niesen, das Kichern eines Kindes, das nach einem dummen Streich davonläuft, von dem mir vielleicht später eine Nachbarin erzählt, die Mitleid mit uns hat.
Ich schaue zum früher roten, jetzt eher bräunlichen VW-Käfer meines Vaters hinüber, der ganz hinten in der Einfahrt geparkt ist, in der Nähe des Waldrands hinter unserem Haus. Wir nannten ihn Ladybug. Halb erwarte ich, dass die Autotür offensteht, oder irgendein anderes Anzeichen dafür, dass vor Kurzem jemand hier gewesen ist. Ich halte es zwar nicht für wahrscheinlich, erhoffe mir aber immer etwas anderes.
»Wer ist da?«, frage ich.
Am liebsten würde ich nach Dad rufen. Solche versponnenen Einfälle sind mein ständiger Begleiter, besonders wenn die Hitze und die sommerlichen Gerüche mir das Gefühl geben, dass irgendetwas fehlt oder dass gleich etwas passieren wird. Ich weiß nicht mal, was ich glaube, wer antworten wird – ein toter oder ein lebendiger, verschwundener Mann. Das habe ich Ma ein paarmal gesagt, wenn ich fies drauf war und wollte, dass sie genauso durcheinander ist wie ich. Sie haben seine Leiche nie gefunden, Ma. Gerätst du da nicht auch manchmal ins Grübeln? Sie ist nicht der Typ fürs Grübeln.
Ich schwitze so stark, dass sich die Schweißtropfen, die mir den Rücken hinunterlaufen, anfühlen wie kleine Finger. Mein Shirt ist klatschnass. Manchmal, wenn ich besonders eklig aussehe, stelle ich mir vor, was Dad denken würde, wenn er mich sehen könnte. Wahrscheinlich würde er mich nicht mal erkennen.
»Hallo, ist da wer?«
Die einzige Antwort ist ein langgezogenes Schnarchen im Haus, als würde Ma mich auslachen, weil ich hier draußen im Dunkeln stehe und irgendeinen Idioten zu erwischen versuche, der wahrscheinlich längst über alle Berge ist.
»Wer auch immer Sie sind, lassen Sie uns in Ruhe«, sage ich in die Dunkelheit hinein.
Zurück in meinem Zimmer trete ich fast auf eine herausgerissene Zeitschriftenseite, die Ma mir unter der Tür durchgeschoben haben muss. Es ist eine Anzeige für Nature Valley Müsliriegel. Darauf legen zwei Freundinnen bei einem ländlichen Radausflug am baumgesäumten Straßenrand eine Pause ein, um sich etwas Leckeres zu gönnen. Sie sehen sich auf eine wissende Art an, als wären Müsliriegel das Geheimnis ihres ländlichen Glücks. Ich habe diese staubtrockenen Möchtegern-Kekse auch schon gegessen, aber ländliches Glück hat sich danach nicht eingestellt. Wenn das meine Freundin wäre, würden wir beide die Riegel ausspucken, bis wir mit Krümeln übersät wären, und dann über die Dummheit lachen, zu glauben, dass Pseudo-Süßkram uns nach der langen Fahrt zufriedenstellen könnte. Die Räder sind allerdings echte Hingucker. Eins ist metallblau, das andere silberfarben – makellos sauber, ohne ein Anzeichen dafür, dass sie je gefahren wurden. Die Mädchen haben ihre dünnen Beine beiläufig darübergelegt. Unter dem Bild steht, sorgfältig mit Kuli geschrieben, fast, als würde es zur Anzeige gehören:
Das könnten wir sein. Dauert nicht mehr lang. Wir kaufen mindestens zehn davon. In Liebe, Ma.
Ich hänge die Radfahrerinnen über meinen Schreibtisch und schwöre mir, morgen nicht mit ihr zu reden.
Dann stelle ich Bettys Paket auf mein Bett. Mir fällt auf, dass es, anders als die anderen, mit der Post verschickt und nicht einfach vorbeigebracht wurden und dass kein Absender angegeben ist. Darin finde ich alles Mögliche – Schallplatten, einen Quilt, ein Mini-Sweatshirt. Und einen Umschlag, auf dem steht:
Für Diamond, von Auntie Lena.
2
15. Juni 1987
Liebe Diamond,
zunächst einmal möchte ich mich dafür entschuldigen, falls ich zu aufdringlich bin. Ich weiß, deine Mutter hält nicht allzu viel von meiner Familie, und ich habe keine Ahnung, was für Vorstellungen du über mich im Kopf hast. Du kannst sicher ein gutes Leben führen, ohne dass sich unsere Wege je kreuzen, aber dein Daddy hat immer gesagt, er wünscht sich, dass ich mich mehr um dich kümmere, um sicherzustellen, dass es dir gutgeht. Also, hier bin ich, deine Auntie Lena.
Es muss seltsam für dich sein, den Namen einer Fremden zu sehen, die sich deine Tante, deine Verwandte nennt. Eigentlich bin ich, wie du wahrscheinlich weißt, deine Großcousine – die Cousine deines Vaters. Meine Mama – sie wurde »Sweetie« genannt – und sein Daddy waren Geschwister. Unsere Leute nennen ältere Verwandte und Freunde der Familie respektvoll »Auntie« und »Uncle«. Ich habe mindestens hundert davon, und das allein in Woodville. Kann nicht mal zum Briefkasten gehen, ohne einem davon über den Weg zu laufen. Was dich angeht, bin ich das, was man eine Auntie-Cousine nennen könnte.
Um dir ein bisschen was von mir zu erzählen: Ich bin gelernte Krankenschwester und lebe eigentlich in Atlanta, bin aber vorübergehend wieder in Woodville, um Newberry Fine Fabrics zu führen, unser Familienunternehmen, das von meinem Großonkel Henry Newberry (deinem Urgroßonkel) und seinen Brüdern gegründet wurde, als sie 1915 aus Swift River nach Woodville zurückgekehrt sind. Wir haben mit einer Textilfabrik angefangen, aber sie ist aus allen möglichen komplizierten Gründen pleitegegangen und wurde an weiße Leute verkauft. Ich weiß, es wirkt wie ein Rückschritt, nach einer Fabrik ein Textiliengeschäft in Woodville in Georgia zu eröffnen, aber in unseren besten Zeiten hatten wir drei über den Staat verteilte Filialen. Unsere Frauen waren die besten Schneiderinnen in Georgia. Sie haben Kleidung für Bürgermeister, Debütantinnen und für alle Backupsängerinnen von James Brown genäht, ob du es glaubst oder nicht. Jetzt gibt es nur noch den Laden in Woodville. Ich hoffe, eines Tages kannst du uns besuchen kommen und alles mit eigenen Augen sehen. Wir können dir ein Outfit nähen, oder ein Paar von diesen Stulpen, die ihr jungen Leute heute tragt.
Im Paket findest du noch ein paar Geschenke an dich – die Lena-Horne-Album-Sammlung meiner Mutter, einen Quilt, den sie für deinen Daddy genäht hat, und einen Pullover, den er als Baby getragen hat. Wenn ich ehrlich bin, ist das einer der Hauptgründe, warum ich mich jetzt bei dir melde. Mama ist vor einem Jahr von uns gegangen, aber ich komme erst jetzt dazu, ihren Nachlass durchzugehen. Davor habe ich es nicht übers Herz gebracht. Alles riecht nach ihr, alles trägt ihre Handschrift. Sie hat ein paar Dinge beiseitegelegt, die dein Vater bekommen sollte, in der Hoffnung, dass sie ihn eines Tages wiedersieht. Du weißt sicher, dass sie ihn die ersten sieben Jahre seines Lebens aufgezogen hat, als wäre er ihr eigenes Kind. Das war, bevor sein Daddy ihn mit nach Swift River genommen hat, damit er bei unserer Tante Clara lebt. Es hat Mama das Herz gebrochen, als er sie verlassen musste. Sie hat seinem Vater nie verziehen, dass er ihr Robbie weggenommen hat, und das, um ausgerechnet nach Swift River zu gehen. Diese Stadt zu hassen ist in unserer Familie, wie die Augenfarbe seines Großvaters zu erben – es ist Teil der Newberry-DNA, steckt in jeder Zelle. Tut mir leid, dass ich so über deine Heimatstadt spreche, aber es ist die Wahrheit. Kennst du die Geschichte, was unseren Leuten damals dort passiert ist? Die Stadt hat deinen Daddy erstickt, hat ihm das letzte bisschen Licht geraubt. Ich war wütend auf Tante Clara, weil sie Robbie aufgenommen hat. Bis ich herausgefunden habe, dass auch sie zurückgelassen wurde. Ich schicke dir ein paar ihrer Briefe, wenn es dich interessiert. Sie waren alle im gottverdammten Haus versteckt! Tante Clara hat meiner Mutter, ihrer kleinen Schwester Sweetie, Briefe geschrieben. Der Erste kam ein Jahr nach dem Aufbruch. So nennen sie die Nacht, in der alle Schwarzen Swift River verlassen haben.
Tante Clara hat, nachdem sie ihre Eltern verloren hat, ihre Geschwister großgezogen. Es ist unvorstellbar, wie es für sie gewesen sein muss, sie gehen zu sehen. Als ich ihre Briefe las, habe ich angefangen, sie zu mögen. Ich glaube, es wird dir ebenso gehen.
Ich will dich mit all diesen Dingen nicht überfordern, also schreib mir, ob du damit einverstanden bist. Ich habe mit dem Quilt angefangen, weil die Winter in Neuengland sehr kalt sein sollen, wie ich höre. Ich hoffe, du antwortest mir. Erzähl mir etwas von dir. Was bringt dich zum Lächeln? Wie ist es, heute in Swift River zu leben? Und selbst über deine Mutter möchte ich mehr erfahren. Schick mir ein Foto von dir, wenn du eins hast. Ich hoffe, du hattest bisher ein schönes Leben, Diamond. Und ich hoffe, dich eines Tages persönlich kennenzulernen.
Alles Liebe
Auntie Lena
3
1987
Morgenlicht fällt durch die verbogenen Lamellen der Küchenjalousie, schneidet die gegenüberliegende Wand in gekrümmte Streifen. Ich zähle sie, während ich darauf warte, dass Ma mit Duschen fertig ist.
Lenas Brief liegt vor mir, und ich schaue mir das einzige existierende Foto von Mas und Pops Hochzeit an. Ma hat mir gefühlt tausend Mal erzählt, dass sie davon geträumt hat, im Swift River Country Club zu heiraten und danach eine große Party in einem geschmückten, prachtvollen Empfangssaal zu feiern, in dem überall Tische mit weißen Tischdecken stehen. Reihen von mit Folien bedeckten Tabletts an den Wänden, dampfende Köttbullar, Würstchen im Speckmantel und Ziti al Forno. Es sollte Krabbencocktails geben, Hummer auf Eis und eine Band, die Songs von den Rolling Stones oder den Beatles spielt – nur Stücke, zu denen man tanzen konnte.
Doch Pop wollte lieber unter einem Baum heiraten. Da sie sowieso kein Geld hatten, hat er gewonnen. Er hat für eine Trauerweide plädiert, denn die mochte er am liebsten. Es gab eine im Norden der Stadt, hinter dem Top Dollar, umgeben vom grünsten Moos, das man je gesehen hat. Anscheinend hat Pops Tante Clara ihm von diesem Ort erzählt und gesagt, er wäre was Besonderes. Ma war einverstanden, obwohl die Zweige und Blätter des Baums sie an nasse Haare erinnerten. Sie haben sich zuerst ihre Heiratserlaubnis geholt. Beide waren achtzehn.
Es goss an dem Tag in Strömen. Ma sagte, Regen bringe Glück. Für mich klingt das eher wie etwas, was man sagt, wenn man das gottverdammte Pech hat, dass es bei der eigenen Hochzeit schüttet wie aus Eimern.
Das Foto sieht auch so aus, als wäre es nassgeregnet worden. Irgendein unvorsichtiger Trottel muss Cola oder Ähnliches darauf verschüttet haben, denn es ist ganz steif, und die Seiten sind nach oben gebogen wie die von Kartoffelchips. Der Hintergrund ist größtenteils zu einem fleckigen Stahlblau verschmolzen. Der Vordergrund, in dem Ma und Pop mit Grandma Sylvia und Tante Clara vor dem Baum stehen, ist immer noch gestochen scharf – eine Menscheninsel inmitten eines Cartoonmeers. Alle sind klatschnass. Da Pops Vater ein Jahr zuvor gestorben war, war das die ganze Familie. Es ist das einzige Foto von Tante Clara, das ich je zu Gesicht bekommen habe.
Ma trägt darauf ein langes weißes Kleid mit Spitzenärmeln. Grandma Sylvia hat es für sie genäht, obwohl sie mit der Hochzeit nicht einverstanden war. Das Kleid ist regennass – durchsichtig und zu sexy, als hätte sie nur ein Nachthemd an. Ihre fluffigen Lockenwickler-Locken sind ruiniert, kleben ihr in schlaffen Wellen im Gesicht. Pop trägt einen schlotternden Anzug, der ihm ebenfalls am Körper klebt. In seinem Afro steckt eine Blume. Er blödelt herum. Sie haben einander den Arm um die Hüfte gelegt und die Stirnen aneinandergeschmiegt. Ihrer beider Gesichtsausdruck lässt mich an ein Seufzen denken – vor Erleichterung, Enttäuschung, Glück. Tante Clara und Grandma Sylvia flankieren sie mit verwirrter Miene, die Augen zusammengekniffen, die Hände über die Köpfe gehalten wie nutzlose Regenschirme. Sie alle sehen aus, als würden sie versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.
Es ist mir nie in den Sinn gekommen, Ma zu fragen: Wo sind all die anderen? Die Freunde und Freundinnen? Die Brautjungfern in den hässlichen Kleidern? Irgendetwas an dem Foto löst ein Gefühl von Unwohlsein, von Peinlichkeit in mir aus, sodass ich den Blick abwenden muss. Sie sehen zusammen so allein aus. Der Anfang von so viel gemeinsamem Alleinsein.
Als ich an diesem Morgen das Foto betrachte, fällt mir wieder ein, dass noch jemand aus Pops Verwandtschaft zur Hochzeit kommen sollte. Den ganzen weiten Weg aus Georgia. Der Tag hatte sonnig und heiter begonnen. Ma sagt, die Sonnenstrahlen, die durch die Zweige fielen, hätten wie Star-Wars-Lichtschwerter ausgesehen. Sie warteten und warteten auf Pops Verwandte. Warteten, bis Wolken aufzogen und der Himmel sich dunkelgrau färbte. Durch die Warterei bekamen sie sich in die Wolle, und es fing an zu schütten. Tante Clara beklagte sich darüber, dass ihre Sonntagsschuhe ruiniert waren. Pop schrie Grandma Sylvia an, weil sie gesagt hatte: Solche Dinge passieren eben, wenn man zu jung heiratet. Gott hat immer das letzte Wort. Ma brach in Tränen aus.
Und gerade als es anfing zu donnern, nahm Pop Ma auf den Arm, trug sie in den Wald, schickte den Geistlichen nach Hause, und sagte den alten Damen, sie sollten im Wagen warten. Als Ma und Pop eine halbe Stunde später zurückkamen, hatte der Regen nachgelassen. Pop trug Ma immer noch auf Händen. Sie lächelten und klebten aneinander wie die Kletten. Sagten, sie seien jetzt verheiratet. Ma wollte mir den Teil der Geschichte, in dem sie sich irgendwie selbst verheirateten, nicht erzählen, sie meinte, das wäre zu intim, zu privat. Ich weiß, sie stand total darauf, dass Pop sie hochgehoben hat. Sie fand es toll, dass Pop sie immer wie eine feine Dame behandelt hat (obwohl wir beide wissen, dass sie weder das eine noch das andere ist). Sie hat mir erzählt, was als Nächstes kam – Pop hat die brummigen älteren Damen aus dem Wagen geholt und sie nacheinander über Pfützen und Matsch zum Baum getragen. Ein zufällig vorbeikommender Jogger hat das Foto gemacht. Die Verwandte aus dem Süden ist nicht mehr aufgetaucht. In der Nacht regnete es immer wieder mit Unterbrechungen.
Lena.
Jetzt fällt es mir wieder ein, als hätte jemand die Tür zu meinem Gedächtnis eingetreten. Es war Auntie Lena, die nicht gekommen ist. Lena, die dafür verantwortlich war, dass Mas Locken ruiniert waren und dass Pop an seinem Hochzeitstag laut wurde. Lena, die am Regen schuld war.
Was, wenn sie gekommen wäre? Hätte ein Hochzeitsfoto mit Locken, Lächeln und einer Person mehr an ihrer Seite einen Unterschied gemacht? Den entscheidenden Unterschied?
Wie wäre mein Leben verlaufen, wenn sie ein Teil davon gewesen wäre?
Wenn ich versuche, mir ihr Gesicht vorzustellen, fällt mir Thelma aus Good Times ein. Ich wäre zwar sauer auf Ma, wenn sie dasselbe tun würde, aber ich gehe alle möglichen Schwarzen TV-Stars durch, um mir ein Bild von ihr zu machen. Ich entscheide mich für Weezy Jefferson, weil sie etwas Beruhigendes hat. Doch dann wende ich mich in Gedanken sofort gegen Weezy, belagere sie wie eine Horde aufgebrachter Dorfbewohner. Wieso bist du bei der Hochzeit nicht aufgekreuzt? Weißt du, was wirklich mit meinem Vater geschehen ist? Was für ein Problem hast du mit meiner Mom? Wo bist du die ganzen Jahre gewesen? Warum hast du uns nicht geholfen?
Ich verbanne sie in jenen Winkel meines Kopfes, wo sich all die Leute drängen, die mich im Stich gelassen haben und um eine neue Chance kämpfen. Das Hochzeitsfoto verschwindet, zusammen mit den anderen Sachen, wieder in der Schachtel.
»Wenn kein heißes Wasser mehr übrig ist, komme ich nicht mit«, rufe ich in Richtung Badezimmer.
Ich meine es nicht so. Ma würde den heutigen Tag ohne mich nicht durchstehen. Wir treffen uns mit einem ehemaligen Klassenkameraden von ihr, Jerry, der Anwalt geworden ist. Ma sagt, er wird ihr helfen, an die Sterbeurkunde für Pop und danach an sein Versicherungsgeld kommen. Wir lassen Pop offiziell für tot erklären.
Es ist Donnerstag, mein neuer freier Tag, den ich durch einen Tausch mit Dana Lambert bekommen habe. Ich musste auch ihre blöden Frühschichten übernehmen, damit ich nachmittags Zeit für Fahrstunden habe. Morgen fange ich an, habe Ma aber immer noch nichts davon erzählt.
»Du bist dran, Sonnenschein«, sagt Ma und lugt um die Ecke. »Wasch dir schön den Hintern!« Sie schlägt mit dem Handtuch auf den Küchentisch, an dem ich sitze. Es verströmt einen modrigen Geruch. Wie Tutenchamun schreitet sie, nur mit Unterwäsche und einem Handtuchturban bekleidet, in der Küche auf und ab, im Stil von »Walk Like an Egyptian«, mit wippendem Kopf und rechtwinklig abgeknickten Armen, und ihre nassen Füße platschen über den schmutzigen Boden. Jetzt kriege ich das Lied nicht mehr aus dem Kopf.
»Du machst das ganz falsch«, sage ich. Schwer zu glauben, dass sie mal Tanzlehrerin war.
»Gefällt dir nicht, wie ich abhotte?« Sie wedelt mit den gespreizten Händen und versucht sich an einem lahmen High-Kick. Ihre entblößten Hängebrüste scheinen auf die locker auf der Hüfte sitzende Unterhose verweisen zu wollen, deren schlaffer Elastikstoff ihr am Körper schlottert. Verblasste Menstruationsflecken bedecken die Vorder- und Rückseite ihres Schritts wie alte Wunden, und ich muss aus Gründen, die ich nicht erklären kann, zweimal hinsehen.
»Zu viel. Lass gut sein«, sage ich und lege den Kopf auf den Tisch.
»Darf deine Ma an einem Tag wie diesem nicht glücklich sein?«
Es stimmt, dass dieser Tag der Anstoß für ein neues Leben sein könnte. Aber es kommt mir komisch vor, den siebten Jahrestag von Pops Verschwinden mit Tänzchen zu feiern. Normalerweise ignorieren wir ihn, tappen wie umnebelt in der Gegend herum und vermeiden es, uns anzusehen. Ma starrt vielleicht zwanzig Minuten lang in einen Schrank. Ich pralle gegen Wände, stoße mir an irgendwelchen Möbeln den Zeh und breche in Tränen aus. Manchmal verschwindet Ma und kommt erst am nächsten Morgen mit einem Dutzend Dunkin’ Donuts oder einer Familienpackung Butterfinger nach Hause. Dann ist es vorbei. Zurückspulen, und noch mal von vorn, jedes Jahr.
Aber dieses Jahr macht Ma das komplette Gegenteil. Sie schiebt eine alte Karteikarte unter meiner Tür durch – eine Lernkarte mit französischen Vokabeln, die sie von meinem Schreibtisch geklaut hat. Sie hat Où est la bibliotheque? durchgestrichen und darüber geschrieben: Du bist herzlich eingeladen, das Leben zu feiern! Heute Vormittag wollen wir zu Goodwill, um gebrauchte Kleider zu kaufen. Heute Abend will sie zu dem Ort am Fluss gehen, wo Pops Turnschuhe gefunden wurden, und eine Kerze anzünden. Ein paar nette Worte sagen. »Ich werde garantiert keine Rede halten«, erkläre ich ihr. Danach will sie schwimmen gehen.
Ich muss immer an die Turnschuhe denken, nicht an die echten, die immer noch ganz hinten in Mas Schrank stehen, sondern an das Bild aus der Zeitung. Es sind die Zeitungs-Turnschuhe, die mich verfolgen. Es sind ganz normale alte Pro-Keds aus The Shoe Barn, aber sie sehen aus wie einsame, traumatisierte Zeugen. Sie sollten nur Pop und uns gehören. Sie sind ein privates Geheimnis, das aller Welt enthüllt wurde.
Pops Brieftasche steckte unter der Zunge eines Turnschuhs. Darin befanden sich zwei Dollar, sein Führerschein, ein Umschlag mit Löwenmäulchensamen für den Garten, eine Einkaufsliste von Ma und eines meiner Schulbilder. Als die Cops uns seine Sachen schließlich aushändigten, aß ich die Samen auf, verleibte mir alle schwarzen Körnchen aus dem Umschlag ein, weil die neunjährige Diamond hoffte, dadurch die Kraft einer echten Löwin zu gewinnen, wie ein Feuer, das sich in ihrem Bauch ausbreitet.
Die Strömung war in jenem Sommer sehr stark, stellenweise sogar zu stark zum Schwimmen. Ein paar Leute behaupteten, sie hätten einen Körper im aufgewühlten Wasser vorbeitreiben sehen. Ma sagt, Pop wurde wahrscheinlich von einem Dampfschiff mitgerissen, das aufs Meer hinausfuhr. Er konnte nicht schwimmen. Hat es nie gelernt. Das war das Letzte, was sie sagte, bevor sie sich in den Vorgarten warf und einen Tag und eine Nacht ins Gras weinte.
Die betretenen Nachbarn, die uns Rice Krispies Treats und Aufläufe vorbeibrachten, flüsterten: »Niemand hat es verdient, so zu sterben. Das ist alles so seltsam.«
Aber für das Gericht war er auch Jahre später noch nicht tot genug. Sie erklärten ihn für »vermisst«. Es war eine jener verwirrenden Situationen, in denen die Leute uns dumm kamen und von denen Ma völlig überfordert war und es nicht auf die Reihe bekam. Das zu regeln, ist, als wolle man im Schlamm schwimmen, wie sie immer sagt.
Wir waren wütend, wussten aber nicht, wohin mit unserem Zorn, und so übten wir uns in Geduld, um später Rache zu nehmen. Wir erstellten Listen von Leuten, die es noch bereuen würden, sich mit uns angelegt zu haben. Listen von Dingen, die wir ihnen antun würden. Dann zerknüllten wir sie und vertrauten stattdessen auf Karma, Gottes Bumerang für Arschlöcher. Wir zündeten eine Karma-Kerze an und beteten mit geschlossenen Augen dafür, dass sie ihre Funktion erfüllte.





























