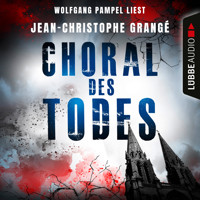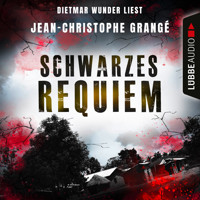9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Elsass während der Weinernte: In einer Kapelle wird unter den Trümmern eines Freskos die Leiche eines Mannes entdeckt. Das Gebetshaus liegt unweit des Wohnorts einer religiösen Gemeinschaft, deren Bewohner ein Leben wie vor 300 Jahren führen und sich durch den Weinbau finanzieren. Kommissar Pierre Niémans ahnt schon bald, dass der mysteriöse Todesfall nicht das einzige finstere Geheimnis der Täufergemeinde ist. Um mehr zu erfahren, beschließt er, seine Assistentin Ivana undercover als Erntehelferin einzuschleusen. Als ein weiterer Mord geschieht, gerät auch Ivana in große Gefahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Das Elsass während der Weinernte: In einer Kapelle wird unter den Trümmern eines Freskos die Leiche eines Mannes entdeckt. Das Gebetshaus liegt unweit des Wohnorts einer religiösen Gemeinschaft, deren Bewohner ein Leben wie vor 300 Jahren führen und sich durch den Weinbau finanzieren. Kommissar Pierre Niémans ahnt schon bald, dass der mysteriöse Todesfall nicht das einzige finstere Geheimnis der Täufergemeinde ist. Um mehr zu erfahren, beschließt er, seine Assistentin Ivanka undercover als Erntehelferin einzuschleusen. Als ein weiterer Mord geschieht, gerät auch Ivanka in große Gefahr …
Über den Autor
Jean-Christophe Grangé, 1961 in Paris geboren, war als freier Journalist für verschiedene internationale Zeitungen (Paris Match, Gala, Sunday Times, Observer, El Pais, Spiegel, Stern) tätig. Für seine Reportagen reiste er zu den Eskimos, den Pygmäen und begleitete wochenlang die Tuareg. »Der Flug der Störche« war sein erster Roman und zugleich sein Debüt als französischer Topautor im Genre des Thrillers. Jean-Christophe Grangés Markenzeichen ist Gänsehaut pur. Frankreichs Superstar ist inzwischen weltweit bekannt für unerträgliche Spannung, außergewöhnliche Stoffe und exotische Schauplätze. Viele seiner Thriller wurden verfilmt. In Deutschland bereits erschienen sind seine Romane »Der Flug der Störche«, »Die purpurnen Flüsse«, »Der steinerne Kreis«, »Das Imperium der Wölfe«, »Das schwarze Blut« und »Das Herz der Hölle.«
JEAN-CHRISTOPHE
GRANGÉ
TAG DERASCHE
Thriller
Übersetzung aus dem Französischen vonUlrike Werner
LÜBBE
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Titel der französischen Originalausgabe:
»Le jour des cendres«
Für die Originalausgabe:
Copyright © Éditions Albin Michel, 2020
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dr. Ulrike Brandt-Schwarze, Bonn
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
Umschlagmotiv: Umschlagmotiv: © MAX SAYPLAY/shutterstock;
© Evannovostro/shutterstock; © lukaszimilena/Shutterstock
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-2085-4
www.luebbe.de
www.lesejury.de
I
Der Weinberg
1
Sie kannte die Grundregeln.
Immer die traditionelle Tracht und Haube tragen. Niemals synthetische Materialien berühren. Auf Mobiltelefone, Computer und alle anderen elektrischen Geräte verzichten. Auf Uhren und Schmuck desgleichen. Keine Lebensmittel verzehren, die nicht direkt vom Gutshof stammen. Nie den Körperschatten eines anderen mit dem eigenen Schatten bedecken …
Als Saisonarbeiterin war sie nicht verpflichtet, diese Grundsätze zu befolgen. Sie hatte lediglich bei der Weinlese die vorgeschriebene Kleidung zu tragen. Um achtzehn Uhr wurden sie und die anderen in eine Unterkunft am nördlichen Ende der Domäne gebracht, wo sie zum normalen Leben zurückkehren durften, das von Gesandten als »weltlich« abqualifiziert wurde. Später brachten unauffällige Transporter mit abgedunkelten Scheiben Wasser und Essen, als wären sie Aussätzige.
»Ivana, kommst du jetzt, oder was?«
Sie folgte Marcel auf den Lkw. Um halb acht morgens: Abmarsch der Truppen. Es war kalt, es war dunkel, und die von den Gesandten benutzten Fahrzeuge sahen düster aus – es waren große Pritschenwagen, die jede Abfahrt wie eine Deportation wirken ließen.
Ivana rückte ihre Haube zurecht und setzte sich neben Marcel auf die offene Ladefläche. Seit ihrer Ankunft vor zwei Tagen hatte sie nur mit einigen wenigen Saisonarbeitern sprechen können, und Marcel war trotz seines finsteren Aussehens der netteste.
»Willst du dir eine drehen?«
Er reichte ihr ein Päckchen Tabak und eine winzige Schachtel Blättchen. Wortlos begann Ivana, sich trotz des holprigen Weges eine Fluppe zu drehen, die diesen Namen auch verdiente.
In Sachen Kleidung schummelte sie ein wenig. Unter ihrem schwarzen Kleid trug sie Thermokleidung aus Heattech von Uniqlo – solche Tricks wurden toleriert, und vermutlich hatten auch die Gesandten selbst unter ihrer Uniform Trikots und Strumpfhosen aus eigener Herstellung an. Im November klettern die Temperaturen im Elsass nicht über 10 Grad.
Ivana zündete sich ihre Zigarette an und betrachtete die Landschaft. Rebenreihen, so weit das Auge reichte. Ein bisschen erinnerte der Anblick sie an Dreadlocks. Bevor sie sich auf diese Schinderei einließ, hatte sie sich die Topografie des Ortes genau eingeprägt. Der größte Teil der Ansiedlung, »Domäne« genannt, bestand aus Weinbergen. Im Zentrum befand sich die »Diözese« mit den Bauernhöfen und den Versorgungsgebäuden der Gesandten. Das gesamte Gelände war streng privat. Fremde durften es nicht betreten.
Einzige Ausnahme von dieser Regel war die Zeit der Weinlese, wenn die Täufer – das war der andere Name der Gesandten – keine andere Wahl hatten, als für zwei Wochen Saisonarbeiter einzustellen, damit die Trauben pünktlich und von Hand gepflückt werden konnten. Willkommen, Ivana …
Sie schloss die Augen und ließ sich von dem Ruckeln einlullen. Im Moment fühlte sie sich recht gut. Das Frühstück bei der Gemeinschaft war wirklich lecker – es gab einfache Bioprodukte, wie sie sie mochte –, und die eisige elsässische Luft tätschelte ihr mit einer Art fröhlicher Zärtlichkeit die Wangen.
Raff dich auf, altes Mädchen. Du bist nicht zum Träumen hier. Sie öffnete die Augen und stieß Marcel, der neben ihr döste, mit dem Ellbogen an.
»Hast du von dem Toten gehört?«
»Welcher Tote?«, fragte Marcel und schien sich an die brennende Zigarette zwischen seinen Fingern zu erinnern.
Der Saisonarbeiter sah aus wie ein Ex-Häftling. Um die dreißig, blasser Teint, schlechte Zähne, längliches Gesicht. Diese Visage, zu ausgemergelt, um ehrlich zu wirken, zeigte den durchtriebenen Blick eines Gauners, der davon träumt, es sich in der Sonne gut gehen zu lassen, tatsächlich aber die meiste Zeit im Knast verbringt.
»Ich hab gehört, dass in einer Kapelle eine Leiche gefunden wurde …«
»In Saint-Ambroise, ja …«
Er rauchte mit kleinen Zügen, als ob er Atem sparen wollte. Die Hälfte seines Gesichts wurde von dem vorgeschriebenen Hut verdeckt, einer Art Panama aus Stroh, der zu ihm passte wie eine Inkamütze zu Pablo Escobar.
»Was war denn da los?«, fragte Ivana.
»Wieso willst du das wissen? Bist du etwa ’n Bulle?«
Sie zwang sich zu lachen. »Nein, mal ehrlich …«, hakte sie nach.
»Vor ’ner Woche ist das Gewölbe der alten Kapelle neben der Domäne eingestürzt«, sagte Marcel schließlich. Da lag einer drunter. Ein wichtiger Typ aus der Gemeinde.«
»Der Chef?«
»Gibt keinen Chef hier, aber Samuel war der Bischof. Hat den Gottesdienst geleitet.«
»Sonst hat er nichts geleitet?«
»Ich will dir mal was sagen, Kleine. Du stellst zu viele Fragen.«
Der Lkw bog auf einen Feldweg ab, und sie wurden in eine Staubwolke getaucht. Die Rebreihen um sie herum erinnerten Ivana an die Kreuze des amerikanischen Friedhofs in Suresnes. Als Zögling der Kinderfürsorge hatte sie als kleines Mädchen mehrere Jahre in dieser Gegend verbracht.
»Die Kapelle wird renoviert«, fuhr Marcel plötzlich fort und sprach lauter, um das Rattern zu übertönen. »Ich glaub, dass das Gerüst nachgegeben hat, und dann ist alles zusammengekracht, und Samuel ist von den Trümmern erschlagen worden.«
»War das ein Unfall?«
Marcel blieb keine Zeit für eine Antwort: Die Lastwagen hielten an. Einer nach dem anderen stiegen die Arbeiter schweigend ab. Ivana hatte nicht genau nachgezählt, aber insgesamt waren sie wohl ungefähr sechzig Saisonarbeiter. Zusammen mit den Gesandten zählten sie gut hundert Leute, die sich den ganzen Tag vor den Rebstöcken den Rücken verbogen.
Marcel war sicherlich keine wertvolle Informationsquelle, aber sie sah ihn als Resonanzboden. Über ihn konnte sie zumindest erfahren, was die Saisonarbeiter über das Drama zu sagen hatten. Das war immerhin ein Anfang.
Natürlich hatte sich Ivana über die Akte schlaugemacht. Die Gendarmen in Colmar wussten auch nicht viel. Im Moment gingen sie von einem Unfall aus, warteten aber auf die Einschätzung der Bausachverständigen. Sie hatten Mitglieder der Glaubensgemeinschaft befragt – vergeblich. Die Gesandten bedienten sich eines absonderlichen Jargons, der sowohl besänftigend als auch einfühlsam klang.
Aus diesem Grund hatte Philippe Schnitzler, der Staatsanwalt von Colmar, Pierre Niémans und Ivana Bogdanovic zu Hilfe gerufen. Die beiden Polizisten waren die einzigen Mitglieder der OCCS, der Zentralstelle gegen Gewaltverbrechen, und Spezialisten für bizarre Morde und seltsame Motive. Bei ihrem Einsatz hatten sie nur beratende Funktion. Niémans und Ivana hatten beschlossen, die Arbeit aufzuteilen: sie im Innern der Siedlung, er außerhalb.
Die Gesandten und Saisonarbeiter stellten sich mit Blick auf die Reben auf, um dem Morgengebet zu lauschen. Die Männer trugen schwarze Anzüge, weiße Hemden, Strohhüte und grobes Schuhwerk, die Frauen ein Kleid aus dickem Stoff, eine graue Schürze und eine weiße Haube aus Baumwollbatist. Von Weitem sahen die Gesandten wie amerikanische Amische aus. Aus der Nähe ebenfalls.
Ivana kratzte sich am Kopf – die Haube war unbequem und lästig – und betrachtete wieder die Landschaft, die sich in der Morgendämmerung immer deutlicher abzeichnete: Die Ebenen und Wälder des Elsass jenseits der Weinberge hatten sie angenehm überrascht. Zwei Monate zuvor waren Niémans und sie dank eines düsteren Zufalls in ihrem Job ein paar Kilometer weiter entfernt tätig gewesen, auf der anderen Seite des Rheins im Schwarzwald. Deshalb hatte Ivana die gleichen dunklen Fichtenwälder und stahlgrauen Seen erwartet, die einem das Blut in den Adern gefrieren ließen.
Aber das hier war das Gegenteil. Das Landschaftsbild war französisch geprägt, sanft und freundlich. Jetzt im Herbst zeigten sich die Bäume rot, kupferfarben oder schon kahl, aber das Gras auf den Weiden – die Gesandten hatten auch Pferde und Vieh – hielt sich wacker, war noch grün, üppig und saftig.
Vor allem die Reben boten einen Anblick entfesselter Schönheit. Ihre leuchtend gelben Blätter schienen wie aus Licht zugeschnitten, und die hellen Trauben leuchteten wie goldene Tupfen. Es schien, als ob ihre bereits runzlige Schale Schwierigkeiten hätte, den süßen Saft zu halten.
Plötzlich begann ein bärtiger Mann ihnen gegenüber zu sprechen und wandte sich an Gott, an die Erde und an die demütigen Diener, die anwesenden Saisonarbeiter.
2
Danken wir Gott für die Erde und den Himmel,
Für die Sonne und den Regen
Und für die Abfolge der Jahreszeiten …«
Ivana sprach zwar Deutsch, aber die Gesandten benutzten einen Dialekt aus dem 16. Jahrhundert, der nichts mit der Sprache der Berliner Clubszene zu tun hatte.
Hilfsbereit wie immer hatte man den Saisonarbeitern eine Übersetzung der Gebete, die den Arbeitstag unterbrachen, zur Verfügung gestellt. Das Büchlein gab auch an, wann bestimmte Verse im Chor wiederholt werden mussten – und zwar auf Französisch. Aber das sollte keinesfalls Indoktrination sein. Wirklich nicht. Die Gesandten wünschten nur, dass alle diese eine Wahrheit verstanden: Die Frucht ihrer Arbeit war in erster Linie und vor allem anderen ein Geschenk Gottes, und die Erntenden sollten sich höchstens als Vermittler zwischen Himmel und Erde sehen.
Alle stimmten in den Refrain ein:
»In dir, Herr, liegt unsere Hoffnung!«
Der Vorbeter wechselte jeden Morgen. In der Gemeinschaft gab es keine Hierarchie. Die Gesandten erlaubten sogar, dass im Notfall ein Saisonarbeiter das Vorbeten übernahm.
»Danken wir Gott für die Hoffnung, die in uns wohnt
Wenn wir säen und pflanzen
Und auf die Ernte warten.«
Das Publikum antwortete erneut:
»In dir, Herr, liegt unsere Hoffnung!«
Ivana spielte ihre Rolle mit großer Bescheidenheit, während sie aus den Augenwinkeln die Gläubigen beobachtete, die sich rechts abseits hielten.
Mehr noch als ihre Tracht war es das Aussehen der Gesandten, das ihre Zugehörigkeit zur Gruppe kennzeichnete. Sie hatten alle das gleiche Gesicht, zumindest beinahe. Hostienweißer Teint und zarte Gesichtszüge bei den Frauen, runde Gesichter und Kinnbart bei den fast durchgängig rothaarigen Männern.
Sie schienen einem anderen Jahrhundert zu entstammen, aus der Zeit der Pioniere des Westens, der Pilger des Ostens, derer, die mit einer Bibel in der einen und einer Spitzhacke in der anderen Hand Ozeane, Wüsten, Berge überquert hatten.
»Bitten wir Gott, unsere Arbeit zu segnen
Auf den Feldern, in den Weinbergen, Obstgärten und Gärten
Damit deren Produkte unsere Kräfte erneuern
Um ihm zu dienen.«
Ivana murmelte:
»In dir, Herr, liegt unsere Hoffnung!«
Über ihnen nahm der Tag Schwung auf. Bald würde der Himmel in durchscheinendem Blau leuchten, und das Licht würde sich zwischen den Rebzeilen ausbreiten. Mit ihrer hellen Haut musste Ivana den ganzen Tag hindurch immer wieder Sunblocker auftragen. Nicht gerade traditionsgemäß, aber effektiv.
Sie merkte, dass sie ein oder zwei Verse verpasst hatte. Keine große Sache. In Gesellschaft der Gesandten empfand sie eine Art Trunkenheit, die keiner Worte bedurfte. Der Glaube dieser Leute faszinierte sie. Eine tiefe, unerschütterliche Überzeugung, die sie in einem gemeinsamen Schicksal einte … Sie stellte sich vor, dass alle in ihren Handflächen die gleiche Lebenslinie hatten.
Bei ihrer Ankunft hatte sie eine durchgeknallte Sekte erwartet, die von Gehirnwäsche und himmlischem Betrug lebte. Stattdessen entdeckte sie eine stille, unerschütterliche und anderen gegenüber absolut gleichgültige Inbrunst.
Ivana glaubte nicht an Gott. Und doch hätte sie Grund genug gehabt, an eine höhere Macht zu glauben, die sie allen Schwierigkeiten zum Trotz beschützte, nachdem sie den Schlägen ihres Vaters mit dem Wagenheber, serbischen Bombardements, Überdosen in Kellern und einer Verurteilung wegen vorsätzlicher Tötung – danke, Niémans! – entkommen war.
Bisher allerdings hatte sie sich damit begnügt, zu überleben, ohne über das Warum und Wie nachzudenken.
»Bitten wir Gott, die Bemühungen all jener zu segnen,
Die versuchen,
Die Güter der Erde zu verteilen …«
Ja, sie war ein bisschen neidisch auf die heiteren Gesichter dieser Menschen, ihre nach innen gerichteten Augen und ihren bescheidenen Glauben. Gerne hätte auch sie so gelebt: ohne den geringsten Zweifel und ohne die kleinste Abweichung. Sie hätte gerne tief in ihrem Inneren dieses selige Gefühl empfunden, einer Wahrheit anzugehören und Vorbild und Gewissen zugleich zu sein …
»In dir, Herr, liegt unsere Hoffnung!«
Es war Mord, dachte sie plötzlich. Samuel Wending wurde in der Kapelle getötet, und ich werde es beweisen. Sie hatte das beschlossen, ohne das geringste Indiz oder auch nur einen Anhaltspunkt zu haben, aber sie wiederholte es in Gedanken hart und wütend immer wieder.
»Hallo, pennst du, oder was?«, fragte Marcel. »Mach schon, Kleine.«
Ivana rückte ihre Haube zurecht, strich ihr Kleid glatt und griff nach der aus Weide geflochtenen Kiepe.
In Wirklichkeit war sie eben doch nur eine verpeilte Polizistin, die jeder Art von Rührung gegenüber nur eine Abwehr kannte – sich von der Überlegenheit des Bösen auf Erden zu überzeugen.
»Es war Mord«, murmelte sie vor sich hin. »Ohne jeden Zweifel.«
3
Ihr Vorstellungsgespräch hatte in einer Scheune stattgefunden. Ivana hatte den Gesandten von Anfang an reinen Wein eingeschenkt: null Erfahrung und nicht das geringste Wissen über Reben.
Getreu ihrem Ruf von Geduld und Großzügigkeit hatten sie sie, ohne zu zögern, eingestellt. Obwohl sie keine Ahnung habe, scheine sie entschlossen, ihr Bestes zu geben, und die Weinlese würde nur noch wenige Tage dauern.
Sie bekam eine kurze Einweisung. Auf der Domäne wurden die Trauben spät geerntet, weil man auf die Überreife der Beeren wartete, die auch als »Edelfäule« bezeichnet wurde. Na toll! Diese sterbenden Weintrauben, zur richtigen Zeit gelesen, ergaben einen wahren Nektar, eine kraftvolle Gewürztraminer-Beerenauslese.
Ivana trank zwar keinen Wein, aber sie glaubte den Leuten aufs Wort. Sie hatten ihr gezeigt, wie man die Trauben erntet, indem man den Stiel abschneidet. Schnipp. Schnapp. Kinderleicht – bis auf die Tatsache, dass die zu erntenden Früchte sorgfältig ausgewählt werden mussten. Am wichtigsten war die Farbe. Die Trauben, die sie seit zwei Tagen schnitt, sahen aus wie kleine, runzelige Rosinen, von denen die dunkelsten die besten waren.
Schnell hatte Ivana in dieses Spiel in Gesellschaft von schwarz gekleideten, im Nebel verschwommenen oder vom kalten Sonnenlicht angestrahlten Männern und Frauen hineingefunden. Kniend oder gebückt wiederholte sich immer wieder die gleiche Bewegung, umhüllt vom Geruch von Weintrauben, der so durchdringend war wie der von Ölfarbe.
Als sie am ersten Abend zu Bett gegangen war, hatte sie schon gefürchtet, nie wieder aufstehen zu können. Das Problem war die Haltung, die sie einnehmen musste: tief gebückt auf Höhe der Blätter, mit schmerzenden Knien und immer wieder herunterfallender Haube.
Aber schon am zweiten Tag hatte sie sich daran gewöhnt. Die frische Luft und das strahlende Licht hatten ihr geholfen, ihren Muskelkater zu überwinden, und das Weinlaub hatte ihr zugeflüstert, Geduld zu haben. Sie war gekommen, um Informationen zu sammeln. Bis es so weit war, konnte sie durchaus ein paar Trauben lesen …
Von Zeit zu Zeit blickte sie auf und sah die Täufer, die ein Stück entfernt herbsteten. Sie vermieden nach Möglichkeit den Kontakt mit den Saisonarbeitern, und wenn sie mit ihnen sprachen, dann mit einer affektierten Süße, einer hochmütigen Zerstreutheit. Auch wenn sie sich bescheiden gaben, spürte Ivana bei ihnen eine diskrete Anmaßung, ein Gefühl von Überlegenheit. Die anderen, all die anderen, die »Weltlichen«, waren für sie nur ein geistiger Irrtum und eine Beleidigung Gottes.
»Durch wen wird der Verstorbene ersetzt?«, nahm Ivana das unterbrochene Gespräch wieder auf.
»Wie meinst du das?«
»Du hast doch gesagt, er sei der Chef gewesen. Dann müsste jemand anders seinen Platz einnehmen.«
Marcel hielt in seiner Bewegung inne: Ein Knie auf dem Boden, das andere Bein angewinkelt, das Handgelenk darauf gestützt, hielt er seine Rebschere wie eine Waffe in Sicherheitsposition.
»Ich hab nicht gesagt, dass Samuel der Boss war. Im Gegenteil: Ich hab dir gesagt, dass es in der Gemeinde keinen gibt.«
Zwischen den Blättern wählte Ivana eine Traube aus, schnitt sie ab und warf sie in ihre Kiepe. »Hab ich wohl falsch verstanden.«
»Bestimmt. Und außerdem habe ich dir schon mal gesagt, dass du zu viele Fragen stellst.«
Ivana spürte, dass es allmählich Zeit für einen Gegenangriff war.
»Weil du keine stellst, vielleicht? Findest du die Atmosphäre hier etwa normal? Die Trachten? Die Regeln? Die Gebete? Die Tatsache, dass wir wie Aussätzige in einer Ecke der Domäne geparkt werden?«
Marcel zuckte mit den Schultern und fummelte mit seiner Schere herum. Vom Angriff wechselte er zur Verteidigung.
»Ich maloche hier jetzt seit fünf Jahren. Die späte Ernte ist ’n echter Glücksfall. Gute Gelegenheit, vor dem Winter noch ’n bisschen Kohle zu machen.«
»Und ihre Art zu leben macht dich nicht stutzig?«
Behutsam legte er eine Weintraube in seine Kiepe.
»Ich schneid die Trauben, hol mir den Zaster ab, und das war’s.«
Ivana schaute an ihrem Kleid hinunter. »Aber trotzdem, diese Klamotten …«
»Ist wegen dem Anstand. Kann’s ihnen nicht verdenken. Erntehelfer arbeiten sonst oft halb nackt.«
»Sogar im November?«
»Du bist echt ’ne Nervensäge.«
Er gab diese Feststellung von sich, ohne mit der Wimper zu zucken, im Tonfall eines Kerls, der zwar weiß, dass es solche Mädchen gibt, dem es aber egal ist, weil er sich ohnehin nie mit ihnen abgeben würde.
»Also kein Chef?«
»Kein Chef.«
»Und wer ist für die Produktion zuständig?«
»Ein Typ namens Jakob.«
»Der von gestern Morgen?«
Ein kleiner, pummeliger Mann war gekommen, um sie über den Stand der Dinge zu informieren. Sie lagen zwar noch ganz gut in der Zeit, was aber kein Grund zum Trödeln sein durfte: Es blieben nur noch drei Tage, um das große Werk zu vollenden!
»Exakt. Er überwacht die Weinherstellung von der Ernte bis zur Abfüllung in Fässer für die weitere Reifung.«
Ivana fragte nicht weiter, machte sich aber ihre eigenen Gedanken. Der kleine Mann mit der süßlichen Stimme und dem verkniffenen Lächeln hätte durchaus das Zeug zu einem hinterhältigen Diktator gehabt.
Ein Rivale von Samuel?
Ein potenzieller Verdächtiger?
In dem Zaun um das Lager der Saisonarbeiter hatte sie ein Schlupfloch entdeckt. In der kommenden Nacht würde sie einen Blick in die Kapelle werfen.
4
Nachdem Ivana abgereist war, hatte sich Pierre Niémans an seinem Pariser Schreibtisch ganz allein über den Papierkram und die vorliegenden Akten hergemacht. Er hasste diese Arbeit. Dabei fühlte er sich wie eine Etappensau, während die anderen draußen in den Kampf ziehen durften.
Jetzt, am Nachmittag des 14. November, einem Mittwoch, saß er im TGV. Eine echte Tortur. Stinkende Sitze, mottengesichtige Passagiere und ungepflegte Schaffner, die sich an die Sitze lehnten, als wollten sie einen anmachen wie in einem Club.
Einer von ihnen fragte soeben nach seiner Fahrkarte. Niémans reichte sie ihm, ohne ihn anzusehen, und verkroch sich anschließend tief in seinem Sitz – ein Einzelplatz, das einzig Positive an der ganzen Sache.
Es war vor allem das Ziel, das ihm Unbehagen verursachte: das Elsass. Er verstand es nicht wirklich. Das neu geschaffene Einsatzteam war eigentlich dazu gedacht gewesen, kreuz und quer in Frankreich zu ermitteln, aber gleich die beiden ersten Fälle hatten sie an denselben Punkt gebracht – zumindest beinahe. Nach dem Schwarzwald mit seinen Fichten war es jetzt das Florival-Tal mit seinen Weinbergen.
Großer Gott! Nur wenige Kilometer vom Haus seiner Großeltern entfernt!
Das war schon kein Pech mehr, das war eher ein Fluch.
Schuld an der Misere war Philippe Schnitzler, der Staatsanwalt von Colmar und zufällig ein Jugendfreund. Oder besser: Niémans und Schnitzler hatten eine gewisse Anzahl von Jahren die Schinderei auf der gleichen Schulbank ertragen. Der Kontakt zueinander war längst abgerissen, und beide hatten sich in eine andere Richtung orientiert.
Aber bei diesem verdächtigen Todesfall in einer Kapelle hatte sich Schnitzler plötzlich an seinen alten Kumpel erinnert. Unfall? Sabotage? Mord? Da fragen wir doch mal den guten alten Niémans nach seiner Meinung …
Durch das Fenster warf er einen Blick auf die Landschaft und dachte an Ivana, die sich freiwillig für die Weinlese gemeldet hatte. Er glaubte nicht wirklich an diese Infiltration in letzter Minute. Die Saisonarbeiter waren abseits untergebracht, und es gab kaum eine Chance, dass seine Partnerin den Gesandten die Würmer aus der Nase ziehen konnte – selbst innerhalb der Domäne. Und vor allem nicht drei Tage vor dem Ende der Weinlese.
In Ermangelung einer besseren Alternative vergrub er sich erneut in seine Akten. Zwischen den Zeilen las er, dass die Gemeinschaft im Tal einen ganz besonderen Status hatte. Ihr Wein war der berühmteste in der Gegend und trug indirekt zum Lebensunterhalt ziemlich vieler Einheimischer bei.
Die Gesandten waren daher mit größtmöglicher Delikatesse befragt worden. Trotzdem hatten sie eine Autopsie abgelehnt und zudem jeden Zutritt auf ihr Land verboten. Zwar lag die Kapelle außerhalb des Anwesens, aber die Gendarmen durften nicht auf dem Privatgelände der Gemeinschaft herumschnüffeln. Immerhin hatte Schnitzler es geschafft, die Autopsie zu erzwingen, aber das war auch schon alles.
Samuels Tod lag fünf Tage zurück, doch die Akte der Gendarmerie war so dünn wie die Speisekarte eines Schnellimbisses. Die Staatsanwaltschaft hatte daher die Verfolgungsfrist verlängert, natürlich nicht ohne Hintergedanken: Damit bekam Niémans den Freibrief, die kleine Welt ordentlich durchzurütteln, ohne dass ein Richter dagegen vorgehen konnte.
Eher unterschwellig ahnte der Polizist noch einen weiteren Grund. Vielleicht hatte Schnitzler ihn zu Hilfe gerufen, weil er innerhalb dieser Domäne etwas Unsauberes witterte. Samuels Tod war eine Gelegenheit, Licht in diese anachronistische Welt zu bringen, und zwar durch Niémans und seine legendäre Sensibilität.
Eine unverständliche Durchsage informierte sie über die bevorstehende Ankunft im Bahnhof von Colmar. Niémans schauderte beim Akzent des Bahnbeamten. Willkommen zu Hause.
Er griff nach seinem Koffer und zwang sich zu ein wenig gutem Willen. Als ob er innerlich seine Kräfte sammelte. Er würde sich zusammenreißen müssen, um diesen zweiten Aufenthalt in einem nur allzu gut bekannten Landstrich durchzuhalten …
»Scheiße.«
Der Fluch entschlüpfte ihm auf dem Trittbrett des Waggons, als er den Gendarmerieoffizier entdeckte, der auf dem Bahnsteig auf ihn wartete. Capitaine Stéphane Desnos war, was der Name nicht sofort vermuten ließ, eine Frau.
Und noch dazu ziemlich attraktiv.
5
Schon lange kursierten Gerüchte über Niémans’ Beziehungen zu Frauen. Entweder ertrug er sie gar nicht, oder er liebte sie zu sehr. Man hielt ihn für einen Frauenfeind. Oder im Gegenteil für jemanden, der sich zu schnell verliebte. Beides stimmte, beides war falsch. Es kam einfach nur auf die Momente an.
Eine Regel hingegen war unumstößlich: Er vermied es, mit Frauen zu arbeiten. Ihre Anwesenheit störte ihn, weil er dafür zu sensibel war. Für eine Ermittlung braucht man einen freien und kühlen Kopf. Das Gehirn eines Polizisten ist wie eine Bibliothek. Temperatur und Luftfeuchtigkeit müssen ständig überwacht werden.
»Commandant Pierre Niémans?«
Er nickte kurz. Ohne lange zu diskutieren, griff die Gendarmin nach seinem Rollkoffer, als wollte sie die Gleichberechtigung unterstreichen, die während ihrer Zusammenarbeit herrschen würde.
Mehrfach wiederholte sie ihren eigenen Namen und machte sich auf den Weg. Niémans folgte ihr in einem gewissen Abstand und betrachtete sie. Um die dreißig, kurvig, ja geradezu sinnlich. Der Polizist konzentrierte sich auf ihr Dienstkoppel, das bestückt war wie ein Baumarktregal – Cordura-Holster, Pistole, Teleskopschlagstock, Handschuhe, Handschellen, Ersatzmagazin …
Unter dieser gewalttätigen Ausstattung sprachen ihre runden Pobacken eine ganz andere Sprache. Niémans fluchte leise vor sich hin. Die Kälte des Bluthundes und die Bibliothek in seinem Kopf konnte er vergessen.
Sie erreichten den Parkplatz, wo ein nagelneuer Mégane auf sie wartete. Auf den Türen stand GENDARMERIE – UNSER ENGAGEMENT, IHRE SICHERHEIT. Blöde Idee, dieser Aufdruck. Nicht gerade schlau, mit einem solchen Slogan herumzufahren, vor allem wenn man an einen Tatort mit einer schon kalten Leiche gerufen wird.
Stéphane Desnos packte Niémans Koffer in den Kofferraum. Noch schlimmer als erwartet. Ihr wohlproportionierter Körper war muskulös, aber sie bewegte sich mit einer Anmut, die sie sofort begehrenswert machte. Sie hatte eine volle, schwere, sehr anziehende Brust und ein eher alltägliches, aber gleichmäßiges und unschuldiges Gesicht. Eine echte Granate.
Zum Thema sexuelle Anziehung hatte Niémans eine recht einfache Theorie, die aber für ihn sehr gut funktionierte. Das Verlangen verstärkte sich wie jede natürliche Energie, je schwieriger der Zugang wurde. Eine Lehrerin war heiß, weil sie Autorität und Moral repräsentierte. Eine Uniform war erregend, weil sie der Lüsternheit im Wege stand. Selbst eine Brille konnte einen dazu bringen, die Wände hochzugehen … Diese gut bewaffnete Gendarmin, deren Brüste ihren halb geöffneten Blouson zu sprengen drohten, war dafür ein – wie sollte man es ausdrücken? – Paradebeispiel.
»Hören Sie mir überhaupt zu?«
Niémans schüttelte seine Grübeleien ab.
»Natürlich. Was haben Sie gesagt?«
»Ich habe Ihnen erklärt, wo Brason liegt.«
»Ich kenne mich hier aus.«
Desnos warf ihm einen misstrauischen Blick zu. Sie ballte die Hände um ihr Koppel und schien seine begehrlichen Gedanken zu erraten.
»Wollen Sie fahren?«, fragte sie, denn sie hatte zweifellos begriffen, dass sie es hier mit einem eingefleischten Macho zu tun hatte.
»Schon gut. Fahren Sie.«
»Und wohin? Aufs Revier?«
»Nein. Zur Kapelle.«
»Jetzt sofort?«
Er nickte und stieg auf der Beifahrerseite ein.
»Mir wurde gesagt, dass Sie zu zweit sind«, fuhr sie fort und setzte sich ans Steuer.
»Nun, ich bin aber allein.«
Ehe sie losfuhr, verrenkte sich Desnos auf dem Sitz, um ihren Blouson auszuziehen. Niémans erspähte im Blusenausschnitt zunächst einen weißen BH-Träger und dann ein halbes Körbchen. Der Anblick bohrte sich wie ein Messer in seinen Unterleib.
Zur Ablenkung ließ er sich auf einen kurzen Kampf mit seinem Sicherheitsgurt ein.
Als Desnos schließlich den Motor startete – und die Temperatur im Fahrgastraum sank –, wurde Niémans plötzlich klar, dass ausgerechnet er als eingefleischter Frauenfeind nie eine bessere Partnerin gefunden hatte als eine Frau: Ivana Bogdanovic, seine derzeitige Assistentin, seine kleine Slawin, sein Eichhörnchen …
Dieser Gedanke erwärmte sein Herz. »Berichten Sie mir von den Ermittlungen«, sagte er mit kontrollierter Stimme. »Erzählen Sie mir, wie weit Sie sind.«
6
Leider gibt es nichts Neues. Die Gesandten rücken nicht mit der Sprache raus, die Untersuchungen am Unglücksort haben nichts ergeben, und wir warten immer noch auf die Experten.«
Um das Gespräch in Gang zu halten, begann Desnos mit einem ausführlichen Bericht über die Religionsgemeinschaft.
Im 16. Jahrhundert flüchteten die in der Schweiz und in Deutschland verfolgten Täufer ins Elsass. Von den unterschiedlichen Gruppierungen, den Mennoniten, den Hutterern und den Amischen, blieben schließlich nur die Gesandten in der Region, weil sie der Meinung waren, dass Gott ihnen ein vollkommenes Geschenk anvertraut hatte – dieses Land, das einen einzigartigen Wein hervorbringt.
Ein ansässiger Landesherr, den ihr Glaube berührt hatte, machte ihnen im 17. Jahrhundert offiziell die mehr als 300 Hektar umfassenden Grundstücke zum Geschenk. Seit dieser Zeit lebten sie an diesem Ort. Eine einfache, in Schwarz-Weiß gekleidete Gemeinschaft, die niemandem Rechenschaft schuldig war und mit der Genauigkeit eines Uhrwerks ihren Gewürztraminer produzierte.
Sie fuhren nun in Richtung des Florival-Tals, durch das der Fluss Lauch fließt. Niémans hatte bereits auf einer Karte nachgeschaut: Die Ländereien der Gesandten befanden sich etwa zehn Kilometer östlich von Brason, am Fuß des Grand Ballon, der höchsten Erhebung der Vogesen.
Es war schönes Wetter, das konnte Niémans nicht leugnen, und doch er hatte an diesem sonnendurchfluteten Spätnachmittag kein gutes Gefühl.
»Erzählen Sie mir von dem Mord«, unterbrach er Desnos plötzlich.
»Du liebe Zeit, nichts deutet darauf hin, dass es sich um einen Mord handelt!«
»Ich habe gelesen, dass die Stützen, die das Gewölbe hielten, plötzlich nachgegeben haben. Im Bericht ist die Rede von Sabotage.«
»Im Moment gibt es noch keine Gewissheit.«
»Und wann erfahren wir es?«
»Das steht in den Sternen. Wir haben Experten angefordert …«
Eine typisch französische Ermittlung. Fast eine Woche nach dem Vorfall wartete man noch immer, als ginge es nach einem Wasserrohrbruch um einen Klempner.
Inzwischen kannte sich Niémans wieder aus: Sie hatten die Hänge rund um Guebwiller passiert, auf denen einige der ganz großen Weine der Region reiften. Wie oft war er hier mit dem Fahrrad entlanggefahren … Damals sprach man nur hinter vorgehaltener Hand von den Gesandten, wie von einem geheimnisvollen Volk mit seltsamen Sitten.
Plötzlich tauchten Zäune und immer wieder Schilder mit der Aufschrift PRIVATGELÄNDE auf.
»Das ist die Domäne«, erklärte Desnos.
»Nicht gerade einladend.«
»Die Gesandten belästigen niemanden und wollen im Gegenzug nicht gestört werden.«
Der Polizist erkannte eine gewisse Aggressivität in ihrer Antwort und begriff, auf wessen Seite sie stand.
»Warum haben sie die Autopsie eigentlich abgelehnt?«
»Weil es gegen ihre Prinzipien verstößt. Es geht um den Schutz der körperlichen Unversehrtheit der Menschen. Sie verweigern auch Bluttransfusionen.«
»In der Akte finden sich nur wenige Verhörprotokolle. Haben Sie keine Nachbarschaftsbefragungen gemacht?«
»Welche Nachbarschaft? Die Kapelle liegt unmittelbar neben dem Anwesen der Gesandten, und jeder, den wir befragt haben, hat sich entweder geweigert, mit uns zu sprechen, oder ausweichend geantwortet. Außerdem konnten sie die Protokolle nicht unterschreiben.«
»Warum?«
»›Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein; was darüber ist, das ist vom Übel‹, sagt Jesus im Matthäusevangelium. Diese Textstelle verbietet ihnen, einen Eid zu leisten.«
Entweder hatte Desnos intensiv über die Frage nachgedacht, oder sie stand den Gesandten sehr nahe.
»Erzählen Sie mir von Samuel. Ich habe gelesen, dass er der Bischof der Gemeinschaft war.«
»Er hat die Gottesdienste geleitet, mehr nicht.«
»Er war nicht ihr Guru?«
»Der einzige Guru, den die Täufer kennen, ist Christus.«
Desnos spielte ihre Rolle als Botschafterin geradezu perfekt. Während der ganzen Zeit fuhren sie an Weinbergen entlang, immer mit Stacheldraht eingezäunt und immer gekennzeichnet mit Schildern PRIVATGELÄNDE.
»Wie erlebt die Gemeinschaft den Tod von Samuel Ihrer Meinung nach?«
»Mit Resignation. Sie gehören nicht zu den Menschen, die jammern. Im Moment ist es für sie das Wichtigste, die Weinlese rechtzeitig zu beenden.«
Niémans – ein weiteres Polizistenklischee – verknüpfte den Gedanken an die Traubenlese direkt mit edelsten Weinen und einer Menge Geld – einem Vermögen, das die Gesandten über die Jahrhunderte angehäuft hatten.
»Ich nehme an, sie stehen auch über materiellen Dingen?«
»Absolut. Kein Gemeindemitglied hat Privatbesitz. Der Weinbetrieb wird von einer Genossenschaft geführt, und die Einnahmen gehen an eine Stiftung.«
»Was ist mit Sex?«
Die Gendarmin war empört. »Was sind das für Fragen?«
»Seien Sie nicht kindisch. Hat es nie Probleme dieser Art auf der Domäne gegeben? Kindesmissbrauch? Vergewaltigungsvorwürfe?«
»Nein.«
Sie antwortete mit leiser Stimme, in einem Ton, der eine gewisse Enttäuschung ausdrückte. Als würde sie flüstern: »Wenn das der berühmte Polizist aus Paris sein soll …«
Niémans beließ es dabei. Keine Machtansprüche, keine Geldangelegenheiten – und Fragen der Moral wurden von vornherein ausgeschlossen: Was ein Motiv anging, war das eine magere Ausbeute.
»Warum ist Samuel an diesem Abend zur Kapelle gegangen?«
»Er hat die Renovierungsarbeiten überwacht. Er war jeden Tag da.«
»Wer hat die Leiche entdeckt?«
»Glaubensbrüder. In der Nacht. Sie waren besorgt, weil er nicht mehr in die Kellerei zurückgekehrt war. Während der Lese wird da Tag und Nacht gearbeitet.«
»Gab es in der Kapelle etwas zu stehlen?«
»Nein.«
»Die Kirche befindet sich nicht auf dem Gebiet der Domäne und ist katholisch. Warum finanzieren sie die Renovierung?«
»Anfang des 20. Jahrhunderts haben sie die Kirche gekauft. Für sie ist es ein symbolischer Ort. Im Laufe der Jahrhunderte haben sie bei Verfolgungen dort oft Zuflucht gefunden.«
Das würde Niémans überprüfen.
»Den Obduktionsbericht habe ich nicht erhalten.«
»Er wurde uns gerade erst zugeschickt.«
Bei diesen Worten reckte sie einen Arm zwischen den Sitzen hindurch nach hinten und durchwühlte ihre Aktentasche auf der Rückbank. Erneut durfte Niémans einen Blick auf ein Stückchen BH erhaschen, makellos wie die frische Windel eines Babys.
Sofort vergrub er sich in der Akte. Die nächste Enttäuschung. Noch nie hatte er einen derart dürftigen forensischen Bericht gelesen. Dabei wies der Tote zahlreiche Verletzungen auf. Samuels Rückgrat war gebrochen und der Bauch aufgerissen. Die Rippen hatten die Lunge perforiert, das Brustbein war in den Herzmuskel gedrückt worden, Dünn- und Dickdarm quollen zwischen den Bauchmuskeln hindurch, und Milz und Bauchspeicheldrüse waren geplatzt.
Das Dokument enthielt keine weiteren Details. Weder eine toxikologische Analyse noch Kommentare zu den Verletzungen.
»Wer hat diesen Wisch verbrochen?«, fragte Niémans.
»Patrick Zimmermann.«
»Offenbar schreibt er solche Berichte nicht gerade häufig.«
»Bestimmt nicht, er ist nämlich Kinderarzt. Zwar ist er auch ausgebildeter Rechtsmediziner, hat aber nie praktiziert.«
»Was ist denn das für ein Mist?«
»Die Gesandten haben der Autopsie nur unter der Bedingung zugestimmt, dass Samuels Leiche in der Nähe bleibt.«
»In der Nähe?«
»Dr. Zimmermann arbeitet in einer Klinik in Brason. Dort hat er die Leiche obduziert. Die Gesandten kennen ihn. Von Zeit zu Zeit konsultieren sie ihn wegen ihrer Kinder. Sie haben Vertrauen zu ihm.«
Das alles erschien Niémans völlig absurd, aber vermutlich hatte Schnitzler sein Einverständnis gegeben, um die Sache voranzubringen und Diskussionen zu vermeiden.
Er beschloss, konkreter zu werden.
»Würden Sie sagen, dass wir es mit einer Sekte zu tun haben?«
»Diese Frage habe ich schon erwartet«, murmelte Desnos sarkastisch.
»Beantworten Sie meine Frage.«
»Ganz sicher nicht. Diese Glaubensgemeinschaft besteht seit mehr als fünf Jahrhunderten.«
»Mit Zeit hat das nichts zu tun.«
»Ich meine, wir müssen sie einfach als eine Randerscheinung des Christentums sehen. Zumindest ist das die Meinung der Sektenbeauftragten der Regierung.«
Der Ausschuss zur Überwachung und Bekämpfung gefährlicher sektiererischer Entwicklungen in Frankreich hat ein Auge auf Gruppen mit religiösen oder abergläubischen Tendenzen, und es handelt sich um Leute, die ihren Job verstehen.
»Wenn man die Kriterien anlegt, die für eine Sekte normalerweise charakteristisch sind«, fuhr Desnos fort, »erfüllen die Gesandten keines davon.«
»Zum Beispiel?«
»Eine Sekte hat immer einen Anführer. Die Gesandten nicht. Auch Geld und Macht sind bei ihnen kein Thema. Sie leben abgeschieden, sind friedfertig und gehen ihrer Arbeit nach.«
»Missionieren sie?«
»Ganz und gar nicht. Sie heiraten nur innerhalb der Gemeinschaft, stellen ihren Wein her und befolgen ihre Regeln fernab von der Welt der Weltlichen.«
Der Begriff sprach für sich: Die Täufer standen für Tiefe und Wahrheit, alle anderen für Oberflächlichkeit und Verirrung.
»So kann man in Frankreich im Jahr 2020 aber nicht leben«, antwortete Niémans. »Unser Land ist ein Rechtsstaat, in dem niemand über dem Gesetz steht.«
Desnos lächelte – offenbar hatte sie auch diese Bemerkung erwartet:
»Sie haben recht. Oberflächlich gesehen beugen sie sich den französischen Regeln. Sie tragen offizielle Nachnamen, sie stellen Lohnabrechnungen aus, und sie zahlen ihre Steuern. Tatsächlich aber spielt sich alles in den Büros der Genossenschaft ab. Nichts überschreitet je die Grenzen der Diözese. Sie haben einen Schatzmeister, der das alles verwaltet.«
»Wissen Sie, wie er heißt?«
»Jakob.«
Niémans wollte gerade eine weitere Frage stellen, als er zwischen Rebstöcken etwas bemerkte, das ihn irritierte.
»Fahren Sie bitte langsamer.«
»Was?«
»Langsam, hab ich gesagt!«
7
Da arbeiteten sie im Licht der Dämmerung. Etwa hundert Männer und Frauen beugten sich über die Reben. Fast wie ein Ballett. Alle trugen schwarze Kleidung, nur hier und da schimmerten ein paar weiße Akzente – Strohhüte und Hemden bei den Männern, Hauben und Krägen bei den Frauen. Im Abendlicht leuchtete diese Zweifarbigkeit auf ganz besondere Weise – das Schwarz glitzerte, das Weiß hatte die Zartheit von Schneekristallen.
Auf der linken Seite hoben sich die Saisonarbeiter trotz identischer Kleidung deutlich von ihren Nachbarn ab. Die meisten waren noch jung und unterschieden sich durch eine große Vielfalt an Hauttönungen, Statur und Gesichtsausdrücken. Auch Tattoos, die große Geißel des 21. Jahrhunderts, waren zu sehen.
Niémans’ Blick wanderte zu den Gesandten. Das Bild war schön wie ein Traum und gleichzeitig präzise wie die Ziernaht einer Nähmaschine. Unwillkürlich musste er an ein Gemälde denken, das er im Musée d’Orsay gesehen hatte: Une Soirée von Jean Béraud. Ein Empfang im späten 19. Jahrhundert, bei dem die Gäste Fräcke und Abendkleider trugen.
Warum kam ihm ausgerechnet dieses Bild in den Sinn, also genau das, was die Gesandten ablehnten?
Doch plötzlich verstand er. Diese so friedliche und choreografierte Szene beschwor den Geist des Werkes herauf. Den Geist eines stillen Festes, einer diskreten, rituellen Zeremonie, einer zurückhaltenden Freude …
Niémans hatte einige Fotos von den Gesandten gesehen, aber die Realität verstärkte noch, was die Bilder nur angedeutet hatten: Die Welt dieser Menschen war anders, als bestünde sie aus einem anderen Material, das von einem anderen Geist belebt wurde. Die Blätter, die Triebe, die Erde – alles wirkte hier frischer und lebendiger. Die Stoffe waren dicker und rauer. Selbst Bärte und Haare hatten eine Textur, die aus einer anderen Zeit zu stammen schien.
Plötzlich hielt er den Atem an.
Gerade hatte er Ivana bemerkt, die zwischen den Reben kniete. Sie befand sich auf der Seite der Saisonarbeiter, aber mit ihrer hellen Haut und ihrem rötlichen Haar hätte sie sich leicht unter die Gesandten mischen können.
Normalerweise kombinierte die Polizistin Blusen, Jeans und Stiefel zu einem eher wilden Look, und wenn sie einmal versuchte, das zu ändern, wirkte es, als hätte sie sich verkleidet. Das Täufer-Outfit jedoch passte zu ihr. Das sehr schlichte, feierliche Gewand offenbarte ihre Reinheit und ihre Zartheit.
Niémans ertappte sich dabei, in ihr eine bekehrte Sünderin zu sehen, wie gewisse Erleuchtete mit schwieriger Vergangenheit, die durch eine Begegnung mit Gott wundersam geläutert werden. Ivana hatte getötet. Sie hatte sich bis zum Anschlag mit Drogen zugedröhnt. Sie hatte ihr Kind im Stich gelassen. Aber sie war eine Maria Magdalena, die nur auf die Chance wartete, gerettet zu werden.
Mit einem Mal bekam er es mit der Angst zu tun. Vielleicht war diese Folklore aus einer anderen Zeit doch nur eine Lüge, eine Fassade, die mörderische Absichten oder vergrabene Geheimnisse verbarg … Wenn Ivana etwas zustieße, würde er sich das nie verzeihen.
Er fröstelte, und seine Stimmung wurde wieder düster. Ihm war, als ob alle seine Neuronen ausschließlich mit negativen Wellen geladen wären. »Geben Sie Gas«, knurrte er. »Wir wollen hier schließlich nicht übernachten.«
8
Die Saisonarbeiter verließen den Weinberg als Erste und stiegen auf die Lastwagen. Die Gesandten nahmen als Nachhut die letzten Fahrzeuge.
Bei der Abfahrt versteckte sich Ivana zwischen den Reben und wartete. Zum Abschluss ritten einige Aufseher noch einmal durch das Gelände, aber weil es bereits dunkel wurde, konnte sich die junge Frau problemlos unter dem Laub verbergen. Sie sah zu, wie ihre Kameraden die Lkws enterten, und musste wieder einmal an eine Deportation denken.
Als die Motoren ansprangen, näherte sie sich. Bald standen nur noch die Transporter für die Gesandten bereit. Ivana sprang in den Scheinwerferstrahl und tat, als ordnete sie ihr Kleid – als wäre sie nur kurz pinkeln gegangen.
»Wartet auf mich!«
Das letzte Fahrzeug hielt an. Sie rannte los und kletterte hinein. Alle rückten zur Seite. Körperkontakt mit »Weltlichen« war ihnen untersagt. Vielleicht nahm man sie als nicht organisches Material wahr, ähnlich wie Plastik oder Kevlar.
Der Lkw nahm Fahrt auf, aber alle Augen blieben auf Ivana gerichtet, die sich auf eine der Bänke setzte. Sie entschuldigte sich unsicher ins Dunkel und presste ihre Beine zusammen wie ein schüchternes kleines Mädchen.
»Mach dir nichts draus«, flüsterte eine Stimme.
Ivana entdeckte ein Gesicht, das ihr zulächelte. Die Frau war höchstens zwanzig Jahre alt und erfüllte die Kriterien der Gemeinschaft perfekt: rotbraunes Haar, helle Wimpern, blasse, wachsame Augen. Ihr rundes Gesicht betonte ihre Jugendlichkeit noch mehr.
Ivanas Atem beruhigte sich. Mit den Händen umschloss sie ihre Knie. Fast sofort überkam sie eine bleierne Müdigkeit. Der Muskelkater in ihren Oberschenkeln, die Schmerzen in den Fingern, die verkrampften Schultern …
»Geht es einigermaßen? Hältst du durch?«, erkundigte sich ihre Nachbarin, die Ivanas Erschöpfung zu ahnen schien.
»Mit tut alles weh«, antwortete Ivana, »ich weiß nicht mal mehr, wo meine Arme oder Beine sind.«
»Das geht bald vorbei, du wirst schon sehen. Dieses Mal bleibt dir allerdings keine Zeit, dich daran zu gewöhnen.«
»Schade.«
Ivana war von ihrer eigenen Antwort überrascht, denn in diesem Moment meinte sie es wirklich.
»Hast du Feuer?«, fragte die junge Frau. Zwischen ihren Lippen klemmte eine Zigarette.
Ivana hatte immer ein Zippo-Feuerzeug in der Tasche, das man ihr gelassen hatte, weil es komplett mechanisch funktionierte. Sie brachte die Flamme so nah wie möglich an das Gesicht der jungen Gesandten.
Im Schein der Flamme erkannte sie deren Züge deutlicher. Zusammengewachsene Augenbrauen, als ob sie wegen eines geheimnisvollen Ärgers oder aus übermäßigem Stolz die Stirn runzeln würde, eine kleine Nase und ein sinnlicher Mund mit hübschen Konturen. Ihre Schönheit war südländisch, aber ihr kastanienbraunes Haar und ihr Porzellanteint wiesen eher nach Norden. Eine Mischung aus Mittelmeer und Ostsee.
»Wie heißt du?«
»Ivana.«
Warum hätte sie schummeln sollen? Als sie ankam, hatte sie ihren richtigen Namen angegeben. Sie wusste, dass die Gesandten diese Informationen nur der Form halber abfragten, denn sie hielten die französische Verwaltung und die sozialen Netzwerke für sinnlose Hobbys der Weltlichen.
»Und du?«
»Rachel.«
Die junge Frau hatte eine klare Stimme, die nach Lachen klang. Sie erinnerte Ivana an einen kleinen Bach, der keck zwischen Steinen und Moos durch einen Wald sprudelte.
»Darf ich mir auch eine drehen?«
Ivana hatte bemerkt, dass Rachels Zigarette selbst gedreht war. Die Gesandte kramte in ihrer Schürzentasche und zog Tabak und Blättchen hervor, die ohne Namen oder Verpackung in einer kleinen Leinwandhülle steckten.
»Was ist das für ein Tabak?«
»Elsässischer. Wir bauen ihn hier selbst an.«
»Ach wirklich?«
Rachel lächelte. Es sah aus wie ein Pinselstrich auf einem leeren Blatt Papier.
»Wir leben hier sozusagen autark.«
Ivana drehte sich in wenigen Sekunden eine Fluppe – der Tabak war blond und seidig: Er passte zu Rachel. Sie zündete sie an, genoss still und ließ sich den Wind um die Nase wehen.
Es war ein besonderer Moment: Die kühle Abendbrise tat ihr gut, aber vor allem beglückwünschte sie sich zu dieser Situation. Sie befand sich mitten unter den Gesandten, und diese ziemlich aufgeschlossene junge Frau verschlang sie mit den Augen. Gerade hatte sie einen Riesenschritt vorwärts gemacht.
»Mich wundert, dass sie dich für die paar Tage noch genommen haben«, bemerkte Rachel.
»Die Leute, mit denen ich geredet habe, waren echt nett. Ich hab ihnen meine Lage erklärt.«
»Welche Lage?«
Ivana nahm einen tiefen Zug, ehe sie anfing zu lügen. »Kein Job, keine Wohnung, keine Knete.«
Rachel schüttelte mitleidig ihre Locken, dann richtete sie sich auf und reckte sich, als wollte sie ihren runden Kopf mit der Haube ins Gleichgewicht bringen. Sie griff nach Ivanas linker Hand, der Hand ohne Zigarette. Die Polizistin erbebte – Rachel hatte soeben das Gesetz der Berührung gebrochen.
»Mit solchen Fingern kannst du nicht viel Erfahrung haben, oder?«
»Gar keine!«, gestand Ivana. »Umso cooler, dass sie mich trotzdem eingestellt haben.«
»Eben eine gute Tat!«
»Ihr habt offenbar keine Angst vor hoffnungslosen Fällen.«
Sie lachten beide, und Ivana machte eine neue Entdeckung: Wenn Rachel lachte, erweckte sie den Eindruck, ein Geheimnis zu verraten. Ihr Gesicht schien davonzufliegen und verlor jegliche Schwerkraft. Und ihr Mund öffnete sich über sehr weißen, leicht vorstehenden Zähnen, was ihre vorgewölbten Lippen erklärte.
»Ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte«, fuhr Ivana ernster fort und ließ sich von ihren eigenen Lügen mitreißen. »Ich hab versucht, einen Job in den Kneipen der Umgebung zu finden, aber da wurde niemand gebraucht. Also habe ich hier mein Glück versucht.«
»Aber was hat dich in unsere Gegend verschlagen? Du siehst eher aus wie ein Mädchen aus der Stadt.«
»Stimmt, ich komme aus Paris. Es gab einen … persönlichen Grund, warum ich hier gelandet bin.«
»Nämlich?«
Ivana tat, als würde sie zögern. Rachel stieß sie mit dem Ellbogen an. Sie schien die Berührung der Fremden überhaupt nicht zu fürchten.
»Ein Typ …«, flüsterte Ivana und legte einen Zeigefinger auf ihre Lippen.
Rachel lächelte wieder, allerdings eher verlegen. War Ivana zu weit gegangen? Sie verstummten, saßen nebeneinander und rauchten. Die anderen interessierten sich nicht mehr für sie. Ivana wurde von einer dumpfen Trägheit ergriffen – am liebsten hätte sie sich gehen lassen und wäre an der Schulter ihrer Nachbarin eingeschlafen.
Zum ersten Mal ließ ihre Wachsamkeit nach. Bis zu diesem Moment war sie angespannt und misstrauisch gewesen, hatte sich aber bemüht, freundlich zu wirken.