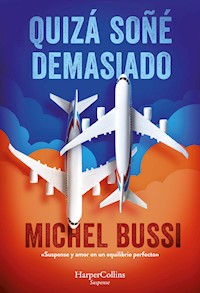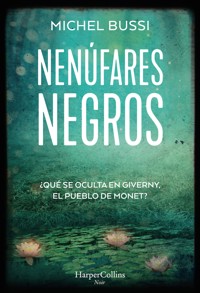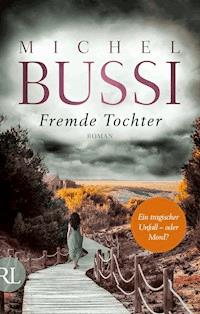9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
„Hochspannung bis zum Schluss!“ Le Point.
Der Chef einer Flüchtlingsorganisation wird tot aufgefunden. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass er von einer jungen Frau ermordet wurde. Handelt es sich bei dieser um Bamby, die Tochter von Leyli, die vor Jahrzehnten aus Nordafrika nach Marseille geflohen ist, und die ein dunkles Geheimnis zu verbergen scheint? Dann passiert ein weiterer Mord, diesmal jedoch wird er von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Beweise scheinen erdrückend – aber warum sollte Bamby gerade jenen Mann töten, der ihre Mutter all die Jahre unterstützt hat?
Atmosphärisch und raffiniert konstruiert: ein packender Thriller aus Marseille.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über Michel Bussi
Michel Bussi, geboren 1965, Politologe und Geograph, lehrt an der Universität in Rouen. Er ist einer der drei erfolgreichsten Autoren Frankreichs. Seine Romane wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und sind internationale Bestseller.
Bei Rütten & Loening und im Aufbau Taschenbuch liegen seine Romane »Das Mädchen mit den blauen Augen«, »Die Frau mit dem roten Schal«, »Beim Leben meiner Tochter«, »Das verlorene Kind«, »Fremde Tochter«, "Nächte des Schweigens" und »Tage des Zorns« vor.
Mehr zum Autor unter www.michel-bussi.fr
Barbara Reitz absolvierte ihr Studium am Institut für Übersetzen und Dolmetschen der Uni Heidelberg. Seit 30 Jahren übersetzt sie hauptsächlich aus dem Französischen, aber auch aus dem Spanischen und Englischen. Sie übertrug u.a. Elena Sender und María Dueñas ins Deutsche.
Eliane Hagedorn studierte Germanistik an der LMU München und Französisch an der Sorbonne. Sie übersetzt seit 30 Jahren aus dem Französischen und lebt in Deutschland und Frankreich. Sie übertrug u.a. Guillaume Musso und Marc Levy ins Deutsche.
Informationen zum Buch
»Hochspannung bis zum Schluss!« Le Point.
Der Chef einer Flüchtlingsorganisation wird tot aufgefunden. Alle Anzeichen sprechen dafür, dass er von einer jungen Frau ermordet wurde. Handelt es sich bei dieser um Bamby, die Tochter von Leyli, die vor Jahrzehnten aus Nordafrika nach Marseille geflohen ist, und die ein dunkles Geheimnis zu verbergen scheint? Dann passiert ein weiterer Mord, diesmal jedoch wird er von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Beweise scheinen erdrückend – aber warum sollte Bamby gerade jenen Mann töten, der ihre Mutter all die Jahre unterstützt hat?
Atmosphärisch und raffiniert konstruiert: ein packender Thriller aus Marseille
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Michel Bussi
Tage des Zorns
Thriller
Aus dem Französischen von Eliane Hagedorn und Barbara Reitz
Inhaltsübersicht
Über Michel Bussi
Informationen zum Buch
Newsletter
Einleitung
Tag des Leids
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Nacht der Eule
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Tag des Bluts
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Nacht der Tinte
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Tag des Windes
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Nacht des Schlamms
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Tag des Steins
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Danksagung
Zitatnachweise
Impressum
Par les quatre horizons,
Qui crucifient le monde.
Über die vier Horizonte,
Die die Welt kreuzigen.
La prière, George BRASSENS
(Text von Francis JAMMES)
Frei übersetzt
Du kannst sagen, ich sei ein Träumer
Aber ich bin nicht der Einzige
Ich hoffe, eines Tages schließt du dich uns an
Und die Welt wird eins sein
nach Imagine, John LENNON
Für die Geographen, Freunde und Kollegen,
die die Welt erkunden.
»Was fehlt Ihnen denn, Leyli? Sie sind hübsch. Sie haben drei hübsche Kinder. Bamby, Alpha, Tidiane. Sie kommen doch ganz gut zurecht.«
»Gut zurecht? Allem Anschein nach, ja. Doch das sieht nur so aus. Nein, o nein, wir sind keine hübsche Familie. Uns fehlt etwas ganz Wesentliches.«
»Ein Papa.«
Leyli kicherte.
»Nein, nein. Auf einen Papa, oder auch mehrere, können wir vier ganz gut verzichten.«
»Was fehlt Ihnen dann?«
Leylis Augen öffneten sich wie die Lamellen einer Jalousie, durch die ein Sonnenstrahl in ein dunkles Zimmer fiel und den Staub funkeln ließ wie Sterne.
»Sie sind sehr indiskret, mein Herr. Wir kennen uns kaum, und Sie glauben, ich würde Ihnen mein größtes Geheimnis anvertrauen?«
Er erwiderte nichts. Die Jalousie vor Leylis Augen hatte sich schon wieder geschlossen, ließ den Alkoven erneut im Dunkel versinken. Sie wandte sich zum Meer, stieß den Rauch aus, wie um die Wolken zu verdüstern.
»Es ist mehr als ein Geheimnis, mein überaus neugieriger Herr. Es ist ein Fluch. Ich bin eine schlechte Mutter. Meine drei Kinder sind verdammt. Meine einzige Hoffnung ist, dass eins von ihnen, wenigstens eins, von diesem Bann verschont bleibt.«
Sie schloss die Augen. Er fragte noch:
»Wer hat sie verflucht?«
Hinter der heruntergelassenen Jalousie ihrer Lider zuckten Blitze.
»Sie. Ich. Die ganze Welt. In dieser Angelegenheit ist niemand ohne Schuld.«
Tag des Leids
1
6:48 Uhr
Lautlos glitt der Lastkahn unter dem Autobus 22 hindurch.
Leyli, die Stirn ans Fenster gedrückt, saß zwei Reihen hinter dem Fahrer und beobachtete, wie sich die riesigen, auf dem flachen Kahn aufgetürmten Pyramiden aus weißem Sand entfernten. Sie stellte sich vor, dass man ihren Sand stahl. Nachdem man ihnen schon alles andere genommen hatte, nahmen sie ihnen auch noch den Strand, Sandkorn für Sandkorn.
Der Autobus 22 überquerte den Kanal, der von Arles nach Bouc führte, und fuhr nun die Avenue Maurice-Thorez hinauf. Leylis Gedanken dümpelten im Fahrwasser des Lastkahns dahin. Sie hatte diesen Kanal immer wie eine aufplatzende Naht empfunden, und die Stadt Port-de-Bouc wie ein Fleckchen Erde, das allmählich ins Meer abdriftete, heute vom Festland durch eine zwanzig Meter breite Meerenge getrennt. Und morgen durch einen Ozean.
Das ist idiotisch, rief sich Leyli zur Ordnung, während der Bus wieder auf die vierspurige Umgehungsstraße traf, deren steter Verkehrsstrom Port-de-Bouc viel mehr vom Rest der Welt trennte als der stille, baumbestandene Kanal, auf dem sich ein paar träge Lastkähne vorwärtsschoben. Es war noch nicht einmal sieben Uhr morgens. Der Tag war zwar angebrochen, hatte aber erst ein müdes Auge geöffnet. Das fahle Licht der Scheinwerfer huschte über ihr Spiegelbild im Busfenster. Dieses eine Mal fand Leyli sich hübsch. Sie hatte sich wirklich Mühe gegeben. Vor über einer Stunde war sie aufgestanden, um bunte Perlen in ihre Haarsträhnen zu flechten. So wie ihre Mutter es in Segu am Fluss gemacht hatte, in jenen Sommermonaten, in denen die Sonne alles verbrannte; in jenen Monaten, in denen man sie ihr vorenthalten hatte.
Sie wollte verführerisch sein. Das war wichtig. Patrice, eigentlich Monsieur Pellegrin, der Angestellte, der sich bei der FOS-IMMO um ihren Antrag kümmerte, war ihren Farben gegenüber nicht abgeneigt. Auch nicht ihrem Lächeln und ihrer Lebensfreude. Ihrer Abstammung von den westafrikanischen Fulbe. Ihrer Mischlingsfamilie.
Der Bus 22 fuhr die Avenue du Groupe-Manouchian entlang und an der Cité Agache vorbei.
Ihre Familie. Leyli schob die Sonnenbrille auf die Stirn und breitete vorsichtig Fotos auf ihrem Schoß aus. Um Patrice Pellegrin zu rühren, waren die Fotos eine genauso wichtige Waffe wie ihr Charme. Sie hatte sie sorgfältig ausgesucht, sowohl die von Tidiane, Alpha und Bamby als auch die Aufnahmen von ihrer Wohnung. War Patrice verheiratet? Hatte er Kinder? War er beeinflussbar? Und wenn ja, hatte er selbst Einfluss?
Sie näherte sich ihrem Ziel. Der Bus 22 fuhr durch das Gewerbegebiet, schlängelte sich zwischen einem riesigen Carrefour, einem Quick und einem Starbucks hindurch. Seit ihrem letzten Besuch bei der FOS-IMMO vor ein paar Monaten waren rund ein Dutzend neue Geschäfte entstanden. Lauter fast identische Wellblechwürfel, und dennoch auf den ersten Blick leicht zu erkennen: der Buffalo Grill an den weißen Hörnern, Jardiland an der orangenen Blume, das Red-Corner-Hotel am pyramidenförmigen Dach. Von einem Plakat an der Fassade eines Multiplex-Kinos aus Glas und Stahl starrte sie ein gigantischer Johnny Depp als Jack Sparrow an. Für einen Moment hatte sie den Eindruck, dass Johnnys mit Perlen durchflochtene Zöpfe ihren glichen.
Hier sah sich alles zum Verwechseln ähnlich, und alles sah aus wie anderswo auch.
Der Bus fuhr Richtung Canal de Caronte, der zwischen dem Mittelmeer und dem Lagunensee Étang de Berre, verlief. Anschließend bog der Bus in die Rue Urdy-Milou, wo sich die Geschäftsräume der FOS-IMMO befanden. Leyli betrachtete ein letztes Mal ihr Spiegelbild. Das zunehmende Tageslicht ließ allmählich ihren Widerschein im Fensterglas verschwinden. Sie musste Patrice Pellegrin vor allem davon überzeugen, dass sie anders war als all diese seelenlosen Orte im Überall und Nirgendwo, auch wenn sie im Grunde ebenso gut hierhin wie dorthin gehörte.
Sie musste, schlicht und ergreifend, Patrice davon überzeugen, dass sie einzigartig war. Übrigens, je länger sie darüber nachdachte, desto unsicherer wurde sie, ob der Typ von der FOS-IMMO tatsächlich Patrice mit Vornamen hieß.
2
6:49 Uhr
Bamby stand François gegenüber.
Die geschickt aufgehängten Spiegel im Zimmer Scheherazade des Red-Corner-Hotels vervielfältigten den Blickwinkel, so als würde sie rundherum von einem Dutzend Kameras gefilmt, die ihr Bild dann an die Wände und die Decke projizierten.
François hatte noch nie ein so hübsches Mädchen gesehen.
Zumindest nicht in den letzten zwanzig Jahren. Nicht, seit er aufgehört hatte, durch die Welt zu reisen und sich für ein paar Dollar eine thailändische oder nigerianische Prostituierte zu gönnen, die eine Miss World hätte werden können, wenn der Lauf des Lebens sie nicht zufällig zur Bordsteinschwalbe gemacht hätte. Nicht, seit er ein geregeltes Leben mit Solène, Hugo und Mélanie führte, sich ein Einfamilienhaus in Aubagne zugelegt hatte, sich jeden Morgen die Krawatte band, um anschließend die Konten von Vogelzug zu prüfen. Seitdem ging er höchstens zweimal pro Jahr auf Geschäftsreise. Und nie weiter als bis nach Marokko oder Tunesien.
François rechnete im Kopf rasch nach: Seit einem Jahr hatte er Solène nicht mehr betrogen. Fast ohne es zu merken, war er treu geworden. Bei Vogelzug, unter den leidenschaftlichen Kämpferinnen für die Sache der Flüchtlinge, waren selten Frauen, die sich freizügig kleideten, ihre Kurven betonten oder die Rundungen ihrer Brüste zur Schau stellten.
Und noch weniger hatte er Gelegenheit, sie zu berühren.
Das Mädchen, das sich vor ihm räkelte, hieß Bamby. Ein Name aus Mali. Sie war vierundzwanzig Jahre alt, besaß den Körper einer afrikanischen Prinzessin und schrieb im Fach Anthropologie gerade ihre Doktorarbeit über Flüchtlingsmigration. Sie hatte ihn zufällig kontaktiert, er gehörte zum Panel von fünfzig Fachleuten zum Thema Einwanderungsregulierung, das Bestandteil ihrer wissenschaftlichen Untersuchungen war. Fünfzig Stunden mit einem Diktiergerät aufgezeichnete Interviews … darunter seines, ein einstündiger Monolog mit Ausnahme einiger Unterbrechungen, wenn ihn die Arbeit in die Vogelzug-Büros rief.
Bamby schien von seinem Werdegang fasziniert gewesen zu sein. François hatte ihn ausgeschmückt, seine Überzeugungen, seine Tätigkeit geschildert und seine Gemütszustände ausgebreitet. Er hatte von der Unbekümmertheit seiner Anfänge und seinen Reisen ohne Gepäck erzählt, die mit den Jahren der Erfahrung, dem fortschreitenden Alter, dem Erfolg und anderen Verlockungen Platz gemacht hatten.
Sie hatte ihm seinen Text per Mail zur Freigabe geschickt, ehe sie sich zwei Wochen später wieder getroffen hatten, ein Abend mit angeregten Gesprächen, diesmal ohne Diktiergerät, an dessen Ende sie sich aber lange umarmt hatten, ehe sie sich trennten. Rufen Sie mich an, wenn Sie wollen…
Die hinreißende Doktorandin hatte ihn angerufen. Sie hatte unglaublich viel zu tun. Die Doktorarbeit, die Vorlesungen an der Fakultät, die sie vorbereiten musste, keine Zeit für eine Affäre, nicht im Moment, ihre Zeit war kostbar und durfte nicht vergeudet werden.
Das traf sich gut: François teilte diese Einstellung.
Keine Zeit vergeuden.
Warum nicht ein Treffen hier, im Red-Corner-Hotel in der Nähe?
Kaum waren sie im Zimmer, legte sich François aufs Bett und täuschte einen plötzlichen Anfall von Müdigkeit vor, den man den drei Fläschchen Wodka zuschreiben konnte, die er unten in der Bar getrunken hatte. Keine Zeit vergeuden? Die Schöne hatte immerhin Stunden gebraucht, bis sie zutraulich geworden war.
Bamby hockte sich neben ihn, ohne falsche Scham, aber mit entwaffnender Zärtlichkeit. Sie begnügte sich damit, ihn zu liebkosen, zwischen Nacken und Hals, da, wo die Haare einen Flaum bildeten. Ihr Körper war in ein afrikanisches sonnengelbes Baumwolltuch gehüllt, das ihr bis zu den Knöcheln reichte, aber den oberen Teil ihres Halses und die nackten braunen Schultern frei ließ. Ein kleiner silberner Anhänger verlor sich unter dem goldenen Stoff.
»Ist das ein Vogel?«
»Eine Eule. Wollen Sie mal sehen?«
Die hübsche Doktorandin ließ das afrikanische Tuch langsam hinabgleiten, wie einen Vorhang. Es hielt über ihren Brüsten einen Moment inne und fiel dann – völlig überraschend – bis auf die Taille herab.
Darunter trug sie nichts …
Ihr prachtvoller, fast schon unwirklich scheinender Busen prangte ihm entgegen. Die kleine Eule zitterte in der Mulde.
Das sonnengelbe Tuch umspielte ihre Lenden, kitzelte ihren Bauchnabel, blieb an ihren Hüften hängen. Bamby erhob sich, ließ ihren Finger an François’ Hals entlanglaufen, am obersten Knopf seines Hemdes innehalten und langsam weiter nach unten gleiten, bis er schließlich am Hosenschlitz seiner Jeans ankam … Die Kleine war offensichtlich wild entschlossen, ihn verrückt zu machen!
Sie war wohl etwas jünger als seine Tochter. Das schockierte ihn nicht. François wusste, dass er mit seinem leicht ergrauten Haar noch attraktiv war und Sicherheit ausstrahlte. Und er wusste natürlich um die Anziehungskraft des Geldes.
Spielte Geld in diesem Fall eine Rolle?
Bamby räkelte sich sanft vor ihm, lächelte und spielte den Schmetterling, der schon im nächsten Augenblick davonfliegen könnte. François zwang sich, seinen Gedanken zu folgen, um sich zu beruhigen, um sich nicht zu rasch auf dieses Mädchen zu stürzen, sondern sein Tempo beizubehalten. Würde Bamby Geld annehmen? Nein, sicher nicht. Das Einfachste wäre, sie gelegentlich wiederzusehen. Sie wie eine Prinzessin zu behandeln. Hier und da ein Geschenk, ein Restaurantbesuch. Ein besseres Hotel als das Red Corner in der Vorstadt. Er bewunderte solche Mädchen, die über das Privileg verfügten, schön und intelligent zugleich zu sein. Ihm war aufgefallen, dass sie – allem Anschein zum Trotz – zugänglicher waren als die anderen, weil sie derart viel Neid erregten, dass sie sich verpflichtet fühlten, die untadelige gute Freundin zu werden, um nicht gesteinigt zu werden. Für sie war Bescheidenheit eine Überlebensstrategie.
Und nur wenige Männer hatten das Privileg, diese Engel zu berühren.
Er hat eine sanfte Stimme und er redet gerne. Aber vor allem hört er sich gerne reden.
Seine Frau heißt Solène. Er hat eine einjährige Tochter. Mélanie.
Er hat eine kleine Narbe in Form eines Kommas unterhalb der linken Brustwarze.
François’ Erregtheit steigerte sich noch, als Bamby näherkam und ihre Finger unter sein Hemd gleiten ließ, zwei Knöpfe aufmachte und sich auf seine Brustwarzen konzentrierte. Sie streichelte ihn lange, und er durfte zum ersten Mal seine Hände auf ihre Brüste legen. Nur ein paar Sekunden, ehe sie zurückwich, als hätte die Berührung sie verbrannt.
Oder weil sie noch mit ihm spielen wollte, diese Interpretation war François lieber. Bamby hielt seinem Blick stand, wandte sich dann betont langsam von ihm ab.
»Ich hole mir ein Glas Wasser.«
François’ Hände fühlten sich verwaist, aber dafür kamen seine Augen zum Zug. Immer mit der Ruhe, entschied er insgeheim, für jeden meiner Sinne ist genug da. Die Augen waren als Erstes an der Reihe. Während Bamby durchs Zimmer ging, ließ sie das sonnengelbe Tuch verführerisch ganz herabsinken.
Sie trug nichts darunter.
Weder oben noch unten.
Sie entfernte sich und kam dabei am bunten Glasfenster vorbei, was eine wahre Farbkaskade auf ihre Haut zauberte. Einen Augenblick später kehrte sie mit einem Glas Wasser in der Hand zurück und bot François eine atemberaubende Frontalansicht.
»Gefällt Ihnen, was Sie sehen?«, säuselte Bamby unschuldig.
Sich am Kopfkissen abstützend, richtete François sich auf. Das war sein Geheimnis bei den Frauen. Niemals den Eroberer spielen. Und das umso mehr, wenn er die Gewissheit hatte, gewonnen zu haben.
Mit einem Blick, aus dem Bewunderung sprach, fixierte er sie. So, wie man ein langersehntes Geschenk betrachtete und dabei so tat, als hätte man es nicht verdient.
»Meine Schöne, meine Wunderschöne, meine Schwalbe, was treibst du nur mit einem alten Mann wie mir?«
»Schweigen Sie, François.«
Bamby trat auf ihn zu. Sie trug nur noch das Kopftuch, das ihr Haar bedeckte. Schon bei ihrer ersten Begegnung hatte diese Tatsache François überrascht. Das Kopftuch wollte nicht so recht zur Persönlichkeit dieser emanzipierten Studentin passen. Dadurch konnte man sie noch weniger einordnen. Bamby hatte die Frage danach mit schallendem Gelächter abgetan.
»Finden Sie mich so nicht hübscher?«
Natürlich hatte diese göttliche Circe recht. Das Kopftuch verhüllte das Oval ihres Gesichts, warf einen Schatten auf ihre Wangenknochen, und wie ein Bilderrahmen hob es das Glanzstück dieses Gemäldes hervor, auf das sich der Betrachter konzentrieren konnte: zwei mandelförmige Augen, Booten aus Perlmutt gleich, die je eine schwarze Perle mit honigfarbenen Reflexen durch das tiefschwarze Schilf ihrer dichten Wimpern trugen.
Ein würziger Duft erfüllte das Zimmer, und aus unsichtbaren Lautsprechern erklangen orientalische Rhythmen. François fing an, sich Sorgen zu machen, dass es hier womöglich auch Kameras gab.
Zum Rhythmus der Musik wiegte sich Bamby langsam in den Hüften und weckte bei François die Illusion, er könnte, sobald sie es entschied, ihren nackten Körper zum Vibrieren bringen. Als wäre sie ein Instrument in seinen Händen, ein ganz außergewöhnliches Instrument, auf dem nur wenigen Virtuosen erlaubt war zu spielen.
»Sie lieben mich, weil ich schön bin.«
Bamby besaß eine fast kindliche Stimme. Keine raue wie diese Gospelsängerinnen.
»Ich kenne dich ja noch gar nicht.«
»Dann schließen Sie die Augen.«
François behielt seine Augen weit offen.
Langsam löste Bamby das Kopftuch aus ihren langen, schwarzen, geflochtenen Haaren.
»Ich möchte, dass Sie mich mit geschlossenen Augen lieben.«
Das junge Mädchen kletterte aufs Bett. Plötzlich ließ sie jedes Schamgefühl beiseite, legte ihre Schenkel um seinen Oberkörper und hob ihre Brüste vor seine Augen, dann ihr Geschlecht nur wenige Zentimeter vor seinen sprießenden Bart. Bambys ganzer Körper roch nach Wusulan, einer duftenden Tinktur, mit der die malischen Frauen ihre Kleidung sowie ihr Haar besprühten und mit der sie sich einrieben, um ihre Liebhaber zu betören.
»Ich möchte, dass Sie mich ertasten, wenn Sie mich lieben.«
François war bereit, sich auf dieses Spiel einzulassen. Es wäre nicht das erste Mal, dass er mit verbundenen Augen Liebe machte. Bei Solène und ihm war das am Anfang häufig vorgekommen. Dann nicht mehr. Diese Wollust fehlte nun in ihrer Beziehung. Dafür war er schließlich hier, und nur deswegen. Er schloss die Augen. Bamby verknotete sorgfältig das Tuch über seinen Augen, während François unbeholfen im Blindflug versuchte, ihre Brustwarzen mit seiner Zungenspitze zu erhaschen und ihren Busen mit seinen Händen abzuwiegen.
»Seien Sie vernünftig, Monsieur«, sagte Bamby mit ihrer unwiderstehlichen Kleinmädchenstimme.
Ihre zarten Finger umschlossen sein Handgelenk, so wie man es bei einem Lausbuben machte, dem man nicht erlaubte, ins Bonbonglas zu fassen.
Klick.
Zunächst verstand François nicht, was da mit ihm geschah. Im ersten Reflex wollte er das Tuch über seinen Augen wegziehen. Unmöglich, denn erst wurde sein rechtes, dann sein linkes Handgelenk daran gehindert. Und im Bruchteil einer Sekunde begriff er, dass Bamby ihm gleich nach der neckischen Nummer mit dem Tuch Handschellen angelegt hatte. Daraus schloss er, dass die Handschellen schon an den Streben des Bettes hinter dem Kopfkissen angebracht gewesen sein mussten, die ganze Sache also vorbereitet worden war.
Dieses Mädchen hatte alles ganz genau geplant. Verdammt … was wollte sie von ihm?
»Seien Sie vernünftig, mein Abenteurer«, fuhr Bamby fort, »das Spiel hat gerade erst begonnen.«
Er träumt davon, in einem Haus oberhalb von Marseille zu leben, in Aubagne. Er hat ein Grundstück unterhalb des Parks von La Coueste entdeckt.
Er nennt seine Frauen gerne ›mein Schmetterling, meine Schwalbe, meine Libelle‹.
Er ist verrückt nach Wusulan, er weigert sich, mich zu berühren, wenn mein Körper nicht damit parfümiert ist.
Er ist fordernd, manchmal sogar grob.
François hatte noch Hoffnung, als Bamby sein Hemd weiter aufknöpfte, als sie sich mit ihrem duftenden Körper an seinem rieb. Es war nur ein Spiel. Und außerdem noch viel erregender!
Was konnte die Kleine schon von ihm wollen? Er hatte sich nichts vorzuwerfen. Er hatte nicht mehr als zweihundert Euro bei sich. Ihn erpressen? Das konnte sie gerne versuchen! Jetzt, wo Mélanie und Hugo schon volljährig waren, würde ihm das sogar einen Vorwand liefern, um Solène zu verlassen. Er war fast so weit, sich wieder zu beruhigen, es zu genießen, diesem raffinierten Ding ausgeliefert zu sein. Mit neunundvierzig Jahren brachte er sich nicht mehr in Gefahr, er hatte dieses so beruhigende Stadium der Ausgeglichenheit erreicht … als er plötzlich den Schmerz in seinem Arm verspürte.
Ein Stich! In die Vene. Dieses kleine Miststück hatte ihm etwas gespritzt!
François geriet in Panik, zog an den Handschellen, wollte sogar um Hilfe schreien, obwohl er wusste, dass diese Scheißzimmer schallisoliert waren, damit die Liebenden sich sexuell ausleben konnten, ohne die Intensität ihrer Freuden mit denen der Zimmernachbarn vergleichen zu müssen. Und nach längerer Überlegung: Bamby hatte ihm nichts injiziert. Er hatte lediglich eine Art … Sog verspürt. Das Mädchen hatte ihm Blut abgenommen!
»Es wird nicht lange dauern«, murmelte Bambys ruhige Stimme. »Nur ein paar Augenblicke.«
François wartete. Lange.
»Bamby?«
Niemand antwortete ihm. Er glaubte, jemanden weinen zu hören.
»Bamby?«
Er verlor allmählich das Zeitempfinden. Wie lange lag er schon hier? War er allein im Zimmer? Jetzt musste er um Hilfe rufen, selbst schuld, wenn sie ihn so vorfanden. Selbst schuld, wenn ihm das peinlich war. Selbst schuld, wenn er das alles jetzt erklären musste. Selbst schuld, wenn er damit Solènes heile Welt zum Einsturz brachte. Selbst schuld, wenn Mélanie erfuhr, dass ihr Vater mit einem Mädchen in ihrem Alter schlief. Einem Mädchen, von dem er im Grunde rein gar nichts wusste. Vielleicht hatte sie ihn von Anfang an manipuliert mit ihrer Geschichte von der Doktorarbeit, dem Panel und dem Interview? Wenn man länger darüber nachdachte, war das Mädchen sowieso viel zu sexy, um an einer Doktorarbeit zu schreiben …
Er wollte gerade um Hilfe schreien, als er jemanden in seiner Nähe spürte.
Er versuchte sich zu konzentrieren, den Wusulan-Geruch von Bamby wieder wahrzunehmen, aber die würzigen Aromen des Raumdufts in diesem verdammten Scheherazade-Zimmer überdeckten einfach alles. Und egal, ob es das Geräusch von Schritten, ein Atmen, das Rascheln eines Anhängers auf nackter Haut war, alles wurde von diesem orientalischen Dauergedudel übertönt.
»Bamby?«
François verspürte lediglich einen kurzen Schmerz an den Handgelenken, wie einen kleinen Kratzer, der weniger schmerzte, als wenn man sich beim Rasieren schnitt. Er begriff es erst, als die warme Flüssigkeit an seinen Armen hinabrann.
Mit der Präzision eines Barbiers hatte man ihm die Venen aufgeschlitzt.
3
8:30 Uhr
Der lange Gang mit den vor den Türen aufgereihten Stühlen erinnerte Leyli an die unendlich langen Wartezeiten bei Elternsprechtagen, erst in der Grundschule, dann in der Mittelstufe. Oft vereinbarte sie den spätesten Termin und kam als Letzte, saß dann allein dort, oft über eine Stunde, bevor sie von Englisch- oder Mathelehrern in zwei Minuten abgefertigt wurde, weil sie endlich nach Hause wollten. Bei Bamby wie bei Alpha war es stets die gleiche Geschichte gewesen. Immer allein im Gang, genau wie heute Morgen.
Das Büro der FOS-IMMO würde erst in einer halben Stunde öffnen, doch man hatte sie hereingelassen, ohne weiter nachzufragen. In den gläsernen Kästen des Geschäftsviertels waren schwarze Frauen vor neun und nach achtzehn Uhr austauschbare Geister. Leyli wollte die Erste sein. Es war noch nicht einmal 8:30 Uhr, als sie Patrice Pellegrin aus der Fahrstuhltür kommen sah.
»Madame Maal?«
Der Berater der FOS-IMMO lief den Gang zu seinem Büro entlang, verwundert, als ginge er den Weg zum ersten Mal.
»Madame Maal? Aber ich mache doch erst in einer halben Stunde auf!«
Ihr Blick sagte ihm, dass es nicht schlimm war, dass sie alle Zeit der Welt hatte und dass er sich nicht zu entschuldigen brauchte.
Dennoch suchte Patrice Pellegrin nach Worten.
»Hm, tut mir leid. Ich komme sofort zurück. Ich hole mir nur schnell einen Kaffee.«
Mit ihrem bezauberndsten Lächeln fragte sie:
»Bringen Sie mir ein Croissant mit?«
Pellegrin kam zehn Minuten später mit einem voll beladenen Tablett zurück. Zwei Espressi, eine Tüte mit Frühstücksgebäck, zwei Flaschen Fruchtsaft und ein Korb mit frischem Brot, Butter und Konfitüre.
»Wenn Sie schon mal da sind, kommen Sie doch herein! Sie können mit mir frühstücken.«
Ganz offensichtlich hatten Leylis Lächeln, die warmen Farben ihrer afrikanischen Tunika sowie die Zöpfchen mit eingeflochtenen Perlen ihre Wirkung getan. Sie wagte nicht, Patrice zu gestehen, dass sie zwar literweise Tee trank, aber niemals Kaffee. Frechheit war eine Waffe, die man nur sparsam einsetzen durfte.
Sie tunkte ihr Croissant in das schwarze Gebräu und hoffte, der Teig würde es vollständig aufsaugen.
Durch die riesige Fensterfront des Büros hatte man einen großartigen Blick auf Port-de-Bouc, die auf der Halbinsel zusammengedrängten Wohnblocks und Einkaufszentren zum Festland hin sowie auf die wie Tentakel ins Meer ragenden Molen. Die Straßenlaternen erloschen, Ampeln blinkten, und hinter den Fenstern der Wohnungen gingen die Lichter an.
»Ich bin gern vor allen anderen auf«, murmelte Leyli. »Als ich nach Frankreich kam, habe ich jede Nacht in den oberen Stockwerken vom Hochhaus CMA CGM im Viertel Euroméditerranée geputzt. Das fand ich wundervoll. Ich hatte den Eindruck, auf die ganze Stadt aufzupassen, ihr beim Aufwachen zuzusehen, die ersten erhellten Fenster, die ersten Fußgänger, die ersten Autos, die ersten Passanten und die ersten Busse, all das erwachende Leben, während ich, im Gegensatz zu allen anderen, schlafen gehen würde.«
Pellegrin blickte eine Weile träumerisch auf das Panorama.
»Ich wohne auf der anderen Seite, in der Gegend von Martigues, in einem Bungalow. Von dort aus kann ich nur die Thujenhecke rund ums Haus sehen.«
»Aber Sie haben wenigstens einen Garten.«
»Ja … Und um ihn genießen zu können, breche ich morgens früh auf, bevor in Marseille und Umgebung überall Staus sind. Ich komme zeitig, um in Ruhe die Akten zu studieren.«
»Außer, ein Mieter stört sie.«
»Leistet mir Gesellschaft!«
Patrice Pellegrin war um die vierzig, etwas dicklich und strahlte die Sicherheit eines verheirateten Mannes aus. Die Frau, die ihn sich geschnappt hatte, würde ihn wohl kaum wieder loslassen und hatte ihm wahrscheinlich rasch ein oder zwei Kinder geboren, um sicher zu sein, sich für alle Ewigkeit an ihn klammern zu können. Er war die Art von Mann, der freundlich zu Frauen sein konnte, ohne sie gleich anzumachen.
»Ich wohne dort«, sagte Leyli und deutete auf die acht weißen Wohnsilos mit Namen Aigues Douces, die wie Dominosteine aus Zucker direkt am Mittelmeer aufgereiht standen.
»Ich weiß«, antwortete der Berater.
Sie unterhielten sich noch ein paar Minuten und beendeten ihr Frühstück, bevor sich Pellegrin hinter seinen Schreibtisch setzte, eine Akte hervorholte und Leyli bat, ihm gegenüber Platz zu nehmen. Ein scheußlicher Schreibtisch aus heller, lackierter Fichte trennte sie nun. Die Erholungspause war vorüber.
»Nun, Madame Maal, was kann ich für Sie tun?«
Auch Leyli hatte sich vorbereitet. Sie breitete vor dem Mitarbeiter der FOS-IMMO eine Reihe Fotos von ihrer Wohnung aus und erklärte sie.
»Ich sage Ihnen da nichts Neues, Monsieur Pellegrin, Sie kennen die Einzimmerwohnungen so gut wie ich. Sie sind alle gleich, egal in welchem Block: fünfundzwanzig Quadratmeter, Wohnküche und ein Zimmer. Wie sollen wir zu viert darin leben?«
Sie hielt Pellegrin die Abbildung von ihrem Sofa vor die Nase, das sie jeden Abend in ein Bett umwandelte, dann ein Foto des Kinderzimmers, in dem Bamby, Alpha und Tidiane schliefen. Überall lag oder stapelte sich alles Mögliche, Kleidung, Schulhefte, Bücher und Spielzeug. Leyli hatte Stunden damit verbracht, die Fotos so zu gestalten, dass sie improvisiert wirkten. Sie sollten nach Chaos aussehen, um Patrice Pellegrin ihre Notsituation deutlich zu machen, gleichzeitig aber das Bild einer guten, durchorganisierten Mutter widerspiegeln, die Schulsachen sortierte, Kleidung ordentlich auftürmte und die Wohnung sauber hielt. Es gibt da nur ein Problem, Patrice, die Enge!
Patrice zeigte aufrichtige Anteilnahme.
Die Sonne hatte plötzlich die mächtige Silhouette des wellblechverkleideten Gebäudekomplexes passiert, und ihre Strahlen fielen durch das Fenster wie eine Sonnenuhr, die die Öffnungszeiten der Büros anzeigte. Leyli zog instinktiv eine Sonnenbrille aus ihrer Tasche. Eine Brille in Form eines Eulengesichts, zwei runde Gläser, verbunden durch einen orangenen Schnabel und mit zwei spitzen rosa Öhrchen. Patrice fand sie amüsant.
»Stört Sie die Sonne?«
Er ließ, ohne weitere Fragen oder Erklärungen, die Stores herab. Leyli war ihm dankbar dafür. Oft bemerkte sie, wie die Leute peinlich berührt waren – die Aggressiven hielten sie für eine Angeberin, die Depressiven für eine unglückliche Frau –, wenn sie auch bei wenig Sonne eine Brille aus ihrer Sammlung – fünf Euro pro Stück maximal – aufsetzte. Doch Leyli war nachsichtig. Wie hätten sie denn auch die Wahrheit erahnen sollen?
Pellegrin sah darin anscheinend nichts als eine liebenswerte Schrulle. Sobald das Büro wieder im Halbdunkel lag, schob Leyli ihre Brille auf die Stirn.
»Ich verstehe Sie ja, Madame Maal.«
Seine Augen richteten sich auf den hohen Stapel bunter Akten, die ausschließlich die Anträge für Sozialwohnungen enthielten.
»Aber Familien, die wie die Ihre warten, habe ich hier hundertfach.«
»Ich habe Arbeit gefunden«, sagte Leyli.
Patrice Pellegrin schien hocherfreut.
»Ein unbefristetes Anstellungsverhältnis im Ibis-Hotel von Port-de-Bouc«, erklärte sie. »Reinigung der Zimmer und des Speisesaals, alles, was ich mag! Ich fange heute Nachmittag an. Also könnte ich eine größere Wohnung bezahlen, wenn Sie eine für mich finden. Den Arbeitsvertrag habe ich dabei. Wollen Sie ihn sehen?«
Sie reichte ihm das Papier, Pellegrin verließ den Raum für ein paar Sekunden, machte eine Kopie und gab es ihr zurück.
»Ich bin nicht sicher, ob das ausreicht, Madame Maal. Das ist zwar ein zusätzlicher Pluspunkt, aber …«, wieder betrachtete er den Aktenstapel, »ich … ich schicke Ihnen eine Mail, wenn ich etwas Neues erfahre.«
»Das haben Sie mir schon beim letzten Mal gesagt. Und ich warte immer noch darauf!«
»Ich weiß … hm … Wie viele Quadratmeter bräuchten Sie denn im besten Fall?«
»Mindestens fünfzig …«
Er notierte es auf einem Zettel, ohne die Stirn zu runzeln.
»In Aigues Douces?«
»Egal wo. Das ist mir gleichgültig. Hauptsache, die Wohnung ist größer.«
Pellegrin schrieb wieder etwas auf. Leyli konnte nicht erkennen, ob ihre Anfrage auf den Berater unrealistisch wirkte oder nicht. Er erinnerte sie an einen Papa, der gewissenhaft den verrückten Weihnachtswunschzettel seiner Kinder niederschrieb. Pellegrin hob den Blick.
»Nicht zu entsetzlich, Aigues Douces?«
»Wir haben den Strand, das Meer. Das hilft, den Rest zu ertragen.«
»Ich verstehe.«
Patrice schien aufrichtig berührt. Er zögerte, noch einmal den Aktenstapel zu begutachten, das wurde zum Tick. Vielleicht wiederholte er vor allen Mietern diese Geste. Und wenn nur weiße Blätter in den dummen Akten steckten?
Er verstand, er verstand ja alles. Als wäre er ein Abbild der Romanfigur Monsieur Malaussène, dem ewigen Sündenbock, den man in die Abteilung Sozialwohnungen versetzt hatte. Leyli wickelte die Perlenzöpfchen um ihre Finger.
»Danke, Sie sind ein guter Mensch, Patrice.«
»Hm … ich heiße Patrick. Aber macht nichts … Leyli, Sie sind …«
Sie ließ ihn nicht aussprechen.
»Sie sind nett, aber im Endeffekt wäre ich lieber an einen Dreckskerl geraten! Ich hätte ihm die gleiche Charme-Nummer serviert, hätte ihn aber dazu gebracht, meine Akte ganz oben auf den Stapel zu befördern, er hätte die Sekretärinnen aufgemischt und dem Chef die Stirn geboten. Aber Sie, Sie sind zu ehrlich. Im Grunde ist es blöd, dass ich ausgerechnet mit Ihnen zu tun habe.«
Leyli hatte ihre Worte mit einem charmanten Lächeln begleitet, das Pellegrin den Wind aus den Segeln nahm. Sein Stift schwebte so lange in der Luft, wie er sich fragte, ob sie Witze machte, dann brach er in Gelächter aus.
»Ich werde mein Möglichstes tun. Das verspreche ich Ihnen.«
Patrick schien ebenso ehrlich wie Patrice. Er erhob sich, und Leyli verstand, dass sie seinem Beispiel folgen sollte. Einen Augenblick lang musterte er die Eulenbrille auf der Stirn der Mieterin.
»Diese Eulenbrille ist genau wie Sie, Madame Maal. Sie kommen vor Sonnenaufgang. Sie hassen die Sonne. Sind Sie ein Nachtvogel?«
»Das war ich. Das war ich lange Zeit.«
Er sah, wie sich die Melancholie wie ein Schleier über ihre Augen legte. Als Patrick Pellegrin die Jalousie seiner Bürotür aufzog, um in der Mittelmeersonne die tägliche, lange Schlange von Mietern abzufertigen, setzte Leyli ihre Eulenbrille wieder auf die Nase und ging.
***
Als Patrick Pellegrin die Akte Leyli Maal schloss und auf den Stapel mit den über hundert anderen Akten legen wollte, die in den nächsten drei Tagen vom Vermittlungsausschuss geprüft werden würden, um das kleine Dutzend verfügbarer Wohnungen zuzuteilen, hielt er in seiner Bewegung inne.
Es würde sicher Monate dauern, bis Leyli Maals Akte positiv beschieden würde. Daran änderte auch das neue Arbeitsverhältnis nichts! Dennoch mochte Patrick sie nicht zu den anderen Akten legen. Das wäre, als würde er Leyli Maal in der Anonymität Hunderter alleinerziehender Mütter afrikanischer Herkunft verschwinden lassen, die hart kämpften, um ihre Kinder aufzuziehen, Arbeit zu finden, ein Dach über dem Kopf zu haben und über die Runden zu kommen.
Aber Leyli war einzigartig.
Nachdenklich starrte Patrick auf seine leere Kaffeetasse und auf Leylis, in der ein widerlicher grauer Schwamm aus Teig und aufgeweichten Krümeln schwamm.
Leyli Maal konnte man nicht einordnen.
Zunächst überlegte Patrick, ob Leyli Maal eigentlich schön war.
Ja, das war sie zweifellos. Sie war spritzig, lebendig, voller entwaffnender Phantasie, doch hinter den funkelnden Augen erahnte Patrick die Last vergangener Schicksalsschläge und unter der Tunika in Regenbogenfarben den müden Körper, den sie vor keinem Mann mehr entblößen würde.
Machte er sich etwas vor? Unmöglich, sich eine Meinung zu bilden, doch eine andere Frage spukte ihm durch den Kopf. War Leyli Maal wirklich ehrlich?
Durch das Fenster sah er sie an der Bushaltestelle Urdy-Milou stehen und nach ein paar Minuten in den Bus Nummer 22 steigen, der so vollgestopft war wie eine Legebatterie. Er folgte ihr mit den Augen, bis der Bus an der Ecke Boulevard Maritime verschwand. Der Widerstreit seiner Gefühle verwirrte ihn. Er spürte eine unerwartete Nähe zu dieser einfachen und natürlichen Frau. Ja, er könnte sich vielleicht sogar in sie verlieben, doch trotz allem, und ohne zu wissen, warum, war er überzeugt, dass Leyli ihm nicht die Wahrheit sagte.
Patrick beobachtete eine Weile, wie die Laster am Kanal Caronte entlangfuhren, dann klappte er die Akte Maal zu. Eine Akte, über der sich am Tagesende neunundneunzig weitere stapeln sollten.
4
9:01 Uhr
Polizeihauptkommissar Petar Velika betrachtete mit einer Mischung aus Betroffenheit und Ekel jedes Detail im Zimmer Scheherazade. Der fahle Körper des nackten Mannes auf dem blutroten Laken schien wie in Stein gehauen. Dazu die Teppiche mit den persischen Motiven und die schillernde Wandbespannung! Sein Blick fiel auf die Handschellen, mit denen das Opfer an die Streben des Baldachins gefesselt war.
»Mein Gott …«
Petar Velika hatte bereits etliche Tatorte gesehen, und noch mehr Verbrechen ohne Inszenierung.
Nachdem er mit fünfzehn aus Titos Jugoslawien geflüchtet war und die Hälfte seiner Familie in Bjelovar hatte zurücklassen müssen, besuchte er mit kaum zwanzig die Polizeischule und erlangte schon nach wenigen Monaten den Ruf, ein hartgesottener Kerl mit einer weißen Weste unter der schwarzen Lederjacke zu sein. Und auch dreißig Jahre später, die er zum großen Teil damit verbracht hatte, Leichen in allen Ecken der Metropole Marseille einzusammeln, hatte sich daran nichts geändert.
»Es hat über eine Stunde gedauert, bis er verblutet ist«, klärte ihn Julo auf, der neben ihm stand.
»Wie bitte?«
»Nach den Einschnitten an den Handgelenken zu urteilen, würde ich sagen, dass er fünfzig bis sechzig Milliliter Blut pro Minute verloren hat. In einer Stunde hat er insgesamt somit dreitausendsechshundert Milliliter verloren, also etwa die Hälfte der gesamten Blutmenge in seinem Körper, und das ist der Moment, in dem die Organe, eins nach dem anderen, versagen.«
Velika lauschte seinem Assistenten, den man ihm aufgehalst hatte, nur mit halbem Ohr. Ein anständiger junger Mann, der frisch von der Polizeischule kam. Petar fragte sich, weshalb wohl dieser brillante Junge von dreiundzwanzig Jahren unbedingt der undankbaren Dienststelle hatte zugeteilt werden wollen, deren Leiter er war. Julo Flores. Ein Kommissaranwärter, freundlich, höflich, flink und von rascher Auffassungsgabe, der nichts übel nahm und zudem noch mit einigem Sinn für Humor ausgestattet war. Alles, was ihm auf die Nerven ging!
Zwar nickte er von Zeit zu Zeit seinem Assistenten zu, doch beobachtete Hauptkommissar Velika vor allem die beiden anderen Polizisten, die sich im Zimmer Scheherazade zu schaffen machten. Die Illusion, sich in einer anderen Welt zu befinden, war perfekt. Hier schien es sich um eine Art Ritualmord zu handeln, ausgeführt im Palast des Kalifen, als hätte man den Eunuchen bestraft, der sich an der Lieblingsfrau des Wesirs vergriffen hatte. Der würzige Geruch von Weihrauch stieg Petar in die Nase. Niemand war bisher auf die Idee gekommen, die orientalische Musik abzuschalten, die im Hintergrund aus unsichtbaren Lautsprechern drang. Mit ihren schmutzigen Stiefeln trampelten die Polizisten auf dem wollenen Teppich herum, ihre Leuchtstäbe warfen ein grelles Licht auf ein Porzellanbecken und Arganöl-Fläschchen. Das Zimmer Scheherazade trug seinen Namen zu Recht, man fühlte sich in einen Basar in Bagdad versetzt. Velika wandte sich an Mehdi und Ryan, die gerade Fingerabdrücke sicherten.
»Kann ich das Fenster aufmachen?«
»Ja sicher …«
Velika zog die Gardinen zurück und öffnete es.
Sofort verschwand die Magie.
Das Fenster ging auf einen betonierten Hof mit Müllcontainern hinaus, und mit einem Schlag übertönte das Geschrei der Möwen, das unaufhörliche Brummen der Laster und Busse auf der Nationalstraße die exotische Musik. Er sah zu den Läden neben dem Einkaufszentrum hinüber: ein Starbucks, ein Carrefour und ein Multiplex-Kino. Johnny Depp mit Dreadlocks starrte ihn von einem fünf mal vier Meter großen Plakat an. Der orientalische Zauber verflüchtigte sich mit den Abgasen. Gegenüber gab es keine Minarette, stattdessen Wohnblocks und Hafensilos. Der Palast des Kalifen war nichts weiter als ein Wellblechwürfel. Das Wunder der Moderne!
»Chef«, hörte er Julo leise hinter sich sagen, »das ist Serge Tisserant, der Hotelmanager.«
Vor dem Hauptkommissar stand ein etwa vierzigjähriger Mann mit Krawatte, der ebenso gut Sofas oder Kamine hätte verkaufen können, eine Art sprechender Katalog.
»Sie kommen gerade richtig«, sagte Petar und warf einen Blick in die Runde und auf die purpurroten Wandbehänge. »Erklären Sie mir doch bitte das Prinzip dieser Hotelkette, Red Corner. Anscheinend sprießen solche Etablissements ja seit einigen Jahren wie Pilze aus dem Boden.«
Der Hauptkommissar lächelte und warf einen Blick zu Julo hinüber, der im Hintergrund auf einem kleinen, ultraflachen Tablet – kaum größer als ein Taschenbuch – etwas notierte. Dieses Utensil sollte die Stapel Notizzettel ersetzen, die er für gewöhnlich überall deponierte.
»Das ist ein neues Hotelkonzept«, erklärte der Manager.
»Erzählen Sie mir mehr!«
»Es handelt sich um ein Franchise-System, das sich gerade weltweit ausbreitet. Es gibt eine Bar im Erdgeschoss und darüber Zimmer. Ein Selbstbedienungsprinzip, wenn Sie so wollen. Der Kunde braucht nur eine Kreditkarte, um die Tür zu seinem Zimmer zu öffnen, ebenso simpel wie bei einer Mautstation auf der Autobahn. Abgerechnet wird pro Viertelstunde, dann pro halber oder ganzer Stunde. Der Betrag wird abgebucht, wenn der Kunde das Hotel verlässt, wie bei einer Parkgarage. Danach kommt gleich eine Putzfrau und reinigt das Zimmer, das anschließend wieder zur Verfügung steht. Keine Reservierungen, keine Gästeliste, kein Zimmerservice! Ein Hotelzimmer im klassischen Sinn, aber viel praktischer.«
Petars Blick schweifte wieder über das orientalische Dekor des Raums.
»Gut … Aber die Ausstattung Ihrer Zimmer ist nicht gerade mit der eines Low-Cost-Hotels vergleichbar!«
Tisserants Gesicht drückte zurückhaltenden professionellen Stolz aus.
»Das ist eine weitere Besonderheit der Red-Corner-Hotels! Jedes Zimmer hat ein besonderes Thema. Konnten Sie sich schon im Hotel umsehen? Wir haben Zimmer mit Themen wie Luxor, Taj Mahal, Montmartre, Karawanserei, Venedig La Serenissima …«
Der Hoteldirektor schien die ganze Palette des Prospekts aufzählen zu wollen. Petar unterbrach ihn, Julo hatte inzwischen sicher alle Dokumente heruntergeladen.
»Individuelle Gestaltung? Findet man die gleichen Zimmer in allen Red-Corner-Hotels der Welt?
Herr Katalog warf sich nochmals in die Brust.
»Genau die gleichen! Gleiche Reise, gleicher Trip, egal wo Sie sich auf der Welt befinden.«
Das schien Julo zu amüsieren, wie Petar feststellte, er schien sich sogar dafür zu interessieren. Womöglich war das vielleicht das ideale Konzept für junge Romantiker mit Hungerlöhnen. Er selbst konnte über dieses Theaterdekor aus Pappmaschee nur staunen. Warum nicht gleich ein Vukovar-Zimmer? Die beiden anderen Polizisten arbeiteten immer noch fieberhaft. Ryan versuchte gerade, die Handschellen aufzusägen, um den Leichnam abtransportieren lassen zu können.
»Gibt es Kameras in den Zimmern?«
»Wo denken Sie hin? Natürlich nicht!«, betonte der Direktor, doch die Rolle des empörten Kleinunternehmers beherrschte er nicht so gut. »Bei uns bieten alle Zimmer absolute Anonymität, sind schallisoliert und sicher. Wir garantieren Vertraulichkeit …«
Aha, dachte Petar, er hat diese Manie, »bei uns« zu sagen, wie so manche Angestellte, die in weniger als sechs Monaten aus ihrer Firma entlassen werden.
»Und draußen?«
»Wir haben drei Kameras auf dem Parkplatz und eine vor der Tür, die rund um die Uhr aufnehmen.«
»Okay, das schauen wir uns an …«
Er blickte seinem Gesprächspartner in die Augen.
»Aber bitte stoppen Sie dieses entsetzliche Gedudel aus Tausendundeiner Nacht!«
»Ich will es versuchen«, stammelte Tisserant. »Hm … die musikalische Untermalung wird zentral gesteuert.«
»Na gut, dann rufen Sie doch einfach Sydney, Honolulu oder Tokio an, damit sie die Anlage abschalten!«
***
Schließlich hörte die Musik in den Zimmern auf, die Leiche war abtransportiert worden, das würzige Raumspray verflogen und die meisten Polizisten waren gegangen. Petar lehnte sich an das Fensterbrett, die einzige Möglichkeit, sich eventuell noch irgendwo hinzusetzen, abgesehen von der Matratze, die sich in einen blutgetränkten Schwamm verwandelt hatte. Der Hauptkommissar wandte sich an seinen Assistenten:
»Spuck’s aus, Julo! Ich bin sicher, du hast schon alle Websites durchkämmt und weißt genau, wer der arme Teufel ist.«
Der Kommissaranwärter Flores begnügte sich mit einem Lächeln.
»Da haben Sie recht, Hauptkommissar! Das Opfer heißt François Valioni. Neunundvierzig Jahre alt. Verheiratet. Zwei Kinder. Hugo und Mélanie. Er wohnt in Aubagne, Chemin de la Coueste.«
Petar hatte sich eine Zigarette angezündet und stieß den Rauch aus dem Fenster in Richtung Einkaufszentrum.
»Du bist wirklich von der schnellen Truppe, Julo. Flink und präzise. Du wirst mich noch von den Vorzügen der verdammten Big Data überzeugen.«
Der Polizist wurde rot und zögerte eine Sekunde.
»Hm … Um ehrlich zu sein, Chef, ich habe vor allem die Brieftasche des Opfers in seinem Jackett gefunden.«
Petar lachte laut auf.
»Phantastisch! Gut. Rede weiter, was haben wir noch?«
»Ein sonderbares Detail. Ryan hat diesen Einstich im rechten Arm entdeckt, aber es ist kein beliebiger Einstich. Man … Man hat ihm Blut abgenommen!«
»Wie bitte?«
»Natürlich, als er noch welches hatte.« Petar mochte den unterschwelligen schwarzen Humor seines Assistenten. Nach und nach begann der Junge im Umgang mit ihm lockerer zu werden.
»Allem Anschein nach hat ihm sein Mörder das Blut mit einem Blutentnahme-Kit abgenommen, bevor er ihm die Pulsadern aufgeschnitten hat.«
Julo zeigte ihm einen transparenten Plastikbeutel mit einer Nadel, einem kleinen Reagenzglas und einem blutigen Wattestäbchen.
»So ein Ding kostet fünfzehn Euro, und wir haben es im Papierkorb gefunden. Damit kann man in weniger als sechs Minuten die Blutgruppe feststellen.«
Petar warf seine Kippe aus dem Fenster. Sie würde sich zu den Präservativen neben den Müllcontainern des Red Corner gesellen.
»Warte mal, Julo, wenn ich es richtig zusammenfasse, so ist dieser François Valioni freiwillig in das Zimmer Scheherazade gekommen, wahrscheinlich in Begleitung seines Mörders. Er lässt sich mit Handschellen ans Bett fesseln, der Mörder nimmt ihm Blut ab, wartet auf das Ergebnis, schneidet ihm dann die Pulsadern auf und geht.«
»So kann man es ausdrücken.«
»Verdammt …«
Petar überlegte und fuhr dann ironisch fort:
»Wir haben es bei dem Mörder mit jemandem zu tun, der einen Blutspender sucht. Es ist dringend, eine Frage von Leben und Tod. Er testet einen potenziellen Spender, die Blutgruppe passt nicht, das nervt ihn und er bringt ihn um. Was für eine Blutgruppe hat Valioni?«
»Null Rhesus positiv«, antwortete Flores, »wie mehr als ein Drittel der französischen Bevölkerung. Oder es handelt sich hier um ein Remake von Twilight.«
Petar verdrehte verständnislos die Augen.
»Eine Vampirgeschichte«, erläuterte Julo.
»Ah, kannst du nicht wie alle anderen Leute von Dracula sprechen? Dann wollen wir mal die Außenkameras befragen, was sie gesehen haben. Die Person, die mit François Valioni dieses Zimmer betreten hat, ist mit Sicherheit eine Frau. Ich kann mir den braven Familienvater hier kaum mit einem kleinen Gespielen vorstellen.«
Julo Flores blieb vor seinem Chef stehen. Er zog zwei weitere transparente Beutelchen hervor.
»Wir haben auch das hier in Valionis Taschen gefunden.«
Petar beugte sich vor, um die Indizien aus der Nähe zu inspizieren. Er entdeckte zunächst ein rotes Plastikarmband, wie Gäste es in All-inclusive-Hotels am Handgelenk trugen. Länger hielt er sich bei dem zweiten Tütchen auf, das … sechs Muscheln enthielt. Sechs fast identische Muscheln, oval, weiß und wie Perlmutt schimmernd, circa drei Zentimeter lang, deren gewellte Ränder sich in der Mitte leicht öffneten.
»Solche Muscheln habe ich an den hiesigen Stränden noch nie gesehen!«, stellte der Hauptkommissar fest. »Mysterium Nummer zwei. Wo mag unser guter François diese Dinger wohl eingesammelt haben?«
»Auf Geschäftsreisen, Chef.«
»Hast du auch seinen Terminkalender gefunden?«
»Nein, aber in seiner Brieftasche stecken Visitenkarten. François Valioni leitet die Finanzabteilung eines Vereins, der Flüchtlingen hilft. Vogelzug.«
Aus der bisher gelangweilten Haltung Petar Velikas sprach plötzlich echtes Interesse.
»Vogelzug! Bist du sicher?«
»Ich kann Ihnen den Dienstausweis mit seinem Foto zeigen, und …«
»Schon gut …«
Petar Velikas Neugier war nun einer inneren Unruhe gewichen.
»Gib mir zwei Sekunden, ich muss nachdenken … Hol mir doch mal einen Kaffee aus dem Starbucks nebenan.«
Kommissaranwärter Julo Flores, zunächst überrascht, zögerte und verließ den Raum erst, als er begriffen hatte, dass sein Chef es ernst meinte.
Sobald sein Assistent außer Hörweite war, prüfte Petar Velika, ob er wirklich allein war und zückte sein Handy.
Er zitterte ein wenig.
Vogelzug.
Das konnte kein Zufall sein.
Er betrachtete noch einmal die Hochhäuser, den Hafen, das Gewerbegebiet und ganz in der Nähe, auf der anderen Seite, den Jachthafen. Eine fatale Mischung aus purer Not und protzigem Reichtum.
Der Ärger fing erst an.
5
10:01 Uhr
»Dürfen wir noch Cola haben, Opa?«
Jourdain Blanc-Martin nickte. Er würde seinen Enkeln nicht verbieten, sich Cola oder irgendetwas anderes zu nehmen, schon gar nicht an ihrem Geburtstag. Er saß, in einiger Entfernung von den spielenden Kindern, mit einem Espresso in der Hand auf der Veranda.
Letztlich lief alles bestens.
Es fiel ihm ein wenig schwer, sich einzugestehen, dass ihn die Organisation des Kindergeburtstags von Adam und Nathan, den Zwillingen seines Sohnes Geoffrey, mehr Kopfzerbrechen bereitet hatte als die Vorbereitung des Frontex-Symposiums, das in drei Tagen im Kongresspalast von Marseille stattfinden würde. Über tausend Teilnehmer aus dreiundvierzig Nationen. Staatschefs und Unternehmer … Als würde ihn die ganze Aufregung rund um das Flüchtlingsthema nicht mehr so recht interessieren. Es war zweifellos an der Zeit, die Verantwortung an Geoffrey, dem ältesten seiner drei Kinder, zu übergeben und, in einem Liegestuhl sitzend, den Sonnenuntergang über Port-de-Bouc zu genießen. Endlich einmal einen Kaffee zu trinken, der nicht von einer Sekretärin gebracht wurde, dem Lachen der Kinder zu lauschen, und zwar nicht über den Lautsprecher der Freisprechanlage eines Taxis!
Dieser Geburtstag lief bestens, aber das hatte natürlich auch seinen Preis. Fünf Animateure für vierzehn Kinder. Nur Klassenkameraden aus der Montessori-Schule Les Oliviers. Eltern, die man nicht gerade als unvermögend bezeichnen konnte, die er aber dennoch mit seiner Einladung an den Pool im fünften Stock seiner Villa La Lavéra mit Blick über den Golf von Fos beeindruckt hatte. Bitte nichts mitbringen, hatte auf der Einladung gestanden, keine Geschenke, aber den Badeanzug nicht vergessen!
Für die Kleinen gab es Limo-Brunnen, Bonbon-Pyramiden und Konfettiregen. Eine wahre Orgie für die Kinderschar!
Aus Jourdains rechter Tasche ertönte Violinenmusik, das Adagiofor Strings von Samuel Barber: sein Handyklingelton. Er ging nicht ran. Nicht jetzt. Er erfreute sich am Einfallsreichtum der Animateure. Einer war als Peter Pan verkleidet, eine eher zierliche junge Frau als Tinkerbell, die dritte als Indianerin, und alle Kinder waren als Piraten kostümiert. Mitten im Pool war eine große, aufblasbare Insel vertäut, die von rund einem Dutzend Plastikkrokodilen bewacht wurde. Die Kinder paddelten auf Luftmatratzen zwischen den harmlosen Reptilien umher, um zu der mit Goldstücken gepflasterten Insel zu kommen und ihre Beute einzukassieren. Offensichtlich amüsierten sie sich hervorragend.
Für einen Moment wandte sich Jourdain von dem Getümmel im Pool ab und genoss die Aussicht von der Veranda. Im Süden erhob sich die Hochhaussiedlung des Problemviertels Aigues Douces, in dem er aufgewachsen war. Unterhalb seiner Villa, ein paar hundert Meter von den Wohnblöcken entfernt, erstreckte sich der Hafen Port Renaissance. Er hatte freien Blick auf seine Jacht Escaillon und auf die viel kleinere seiner Schwiegertochter, die Maribor.
Lediglich ein paar hundert Meter lagen zwischen diesen beiden Welten, die verschiedener nicht hätten sein können und die hermetisch voneinander getrennt waren. Er hatte fünfzig Jahre gebraucht, um es von der einen auf die andere Seite zu schaffen. Es war sein ganzer Stolz, kaum einen Kilometer von der Trabantensiedlung seiner Kindheit entfernt, zu Wohlstand gekommen zu sein. Ohne auswandern zu müssen hatte er alle Etappen des Aufstiegs gemeistert und konnte jetzt von hier oben auf die Wohnblocks hinabsehen, deren Schatten einst seine Kindheit erdrückt hatten. Wie ein Häftling, der sich ein Haus neben seinem ehemaligen Gefängnis gekauft hat, um seine Freiheit noch mehr genießen zu können.
»Dürfen wir noch Cola haben, Opa?«
»So viel du willst, mein Schatz.«
Nathan trank inzwischen seinen vierten Becher. Er ähnelte schon kaum mehr seinem Zwillingsbruder. Pro Jahr nahm er ein Kilo zu. Eigentlich eine bequeme Möglichkeit, die beiden auseinanderzuhalten, doch Geoffrey verwechselte seine Söhne noch immer. Geoffrey reiste für Vogelzug durch die Welt und kam nur jeden dritten Sonntag mal nach Hause, um die Kinder zu umarmen und mit seiner Frau zu schlafen. Ivana, eine sehr schöne Slowenin, interessierte sich nicht so sehr für das Spielzeug ihrer Kinder wie für ihr eigenes: die kleine Luxusjacht und den Jaguar F-Type. Ivana würde seinen Sohn, den großen Einfaltspinsel, früher oder später betrügen, weil sie davon überzeugt war, dass er sich in den Hiltons und Sofitels dieser Welt schadlos hielt.
Als Jourdain 1975 seine Organisation gegründet hatte, gab es weltweit nicht einmal fünfzig Millionen Menschen, die mangels Arbeit, aufgrund von Kriegen oder Elend ihre Heimat verlassen mussten. Im Jahr 2000 waren es schon weit über hundertfünfzig Millionen, und die Kurve stieg weiter exponenziell an. Welcher Rohstoff, welche Energieform, welche Bodenschätze konnten sich rühmen, in den letzten fünfzig Jahren mit solcher Regelmäßigkeit angestiegen zu sein? Er hoffte inständig, dass der gute Geoffrey, auf dessen Schultern bald die Verantwortung der Organisation lasten würde, etwas Besseres zu tun hatte, als sich mit Prostituierten zu vergnügen.
Wieder ertönte das Adagio von Samuel Barber. Jourdain ging auf die Dachterrasse, um sich vom Kindergeschrei zu entfernen, das ihm allmählich auf die Nerven ging, und um das Gespräch schließlich doch anzunehmen. Peter Pan und Tinkerbell war es nicht gelungen, die kleinen sechsjährigen Monster länger als zwanzig Minuten mit ihrer Jagd nach dem Schatz im Wasser abzulenken. Die mit Montessori-Pädagogik genährten Kinder hatten ihre Aufgabe ernst genommen und sich gegenseitig mit Säbeln aus Schaumstoff niedergeschlagen. Im Wasser schwammen Haribo-Erdbeeren, die an Blutstropfen erinnerten, und die Bonbonspieße dienten als Harpunen zum Abstechen der unschuldigen Krokodile oder um auf der Insel nach Goldstücken aus Schokolade zu angeln.
Jourdain schloss die Glastür der Veranda hinter sich und las den Namen auf dem Display.
Petar Velika
Was zum Teufel …
»Blanc-Martin?«
»Am Apparat.«
»Velika hier. Ich weiß, dass ich Sie nicht auf Ihrem privaten Handy anrufen soll, aber …«
»Aber?«
Jourdain betrachtete in der Ferne die Spitze der Halbinsel, die gegenüber von Fort de Bouc fast bis zum Ende der Hafenmole ins Meer ragte.
»Wir haben hier einen Toten. Das wird Ihnen nicht gefallen. Es handelt sich um einen leitenden Angestellten Ihrer Firma. François Valioni.«
Jourdain ließ sich auf einen Teakholz-Liegestuhl fallen, der dabei fast umkippte. Das Geschrei der Möwen vermischte sich mit dem durch die Scheibe gedämpften Gebrüll der Kinder.
»Fahren Sie fort.«
»Es war Mord. Man hat Valioni heute Morgen in einem Red-Corner-Hotelzimmer mit verbundenen Augen und in Handschellen vorgefunden, die Pulsadern aufgeschlitzt.«
Unwillkürlich blickte Jourdain in Richtung des Gewerbegebiets von Port-de-Bouc, auch wenn man es von seiner Dachterrasse aus nicht sehen konnte. Er hatte zehntausende Euros für die Aufforstung ausgegeben, um von seiner Villa aus in nördlicher Richtung nur Blick auf die Seekiefern zu haben, die den Kanal zwischen Arles und Bouc säumten.
»Haben Sie schon eine Spur?«, fragte er.
»Mehr als das. Man hat mir vorhin die Filme der Überwachungskameras gebracht.«
Am anderen Ende der Leitung kniff Petar Velika die Augen zusammen, um das verpixelte Bild besser sehen zu können: Ein Tuch verhüllte das Gesicht des Mädchens größtenteils, das in die Kamera vor der Tür des Hotels blickte, sich jedoch fast im gleichen Moment abwendete, so als wollte sie einen deutlichen, aber unzureichenden Hinweis hinterlassen.
Blanc-Martin gegenüber behauptete er jedoch:
»Man kann deutlich erkennen, wie Valioni das Hotel mit einem Mädchen betritt. Mit einem sehr schönen Mädchen.«
Blanc-Martin entfernte sich noch weiter vom Kindergeburtstag und vergewisserte sich, dass auch wirklich niemand in der Nähe war: weder Captain Hook noch Mr. Smee oder ein Indianerhäuptling.
»Na, dann identifizieren Sie sie doch! Anschließend finden Sie die Frau und sperren sie ein. Wenn Sie ein Bild von ihr haben, dürfte das doch nicht so schwer sein.«
Petar wurde deutlicher.
»Sie … sie trägt ein Tuch, ein seltsames Tuch mit Eulenmotiven …«
Die Betonbrüstung war über einen Meter hoch, aber Jourdain Blanc-Martin hatte mit einem Mal das Gefühl, in die Tiefe gezogen zu werden.
»Sind Sie sicher?«
»Was das angeht, ja.«
Jourdains Blick glitt über die einförmigen Wohnsilos von Aigues Douces, die wie die Türme einer weißen Festung am Mittelmeer wirkten, eine unfertige Zitadelle, deren Befestigungsmauern nie gebaut worden waren.
Ein mit Eulen bedrucktes Tuch, dachte Blanc-Martin. Die Augen verbunden, die Venen aufgeschlitzt.
Ein sehr schönes Mädchen …
Ihm schwante nichts Gutes. Das Mädchen würde erneut zuschlagen, töten und Blut vergießen.
So lange, bis sie bekommen hatte, wonach sie suchte.
6
10:27 Uhr
In ihrem Stockwerk angekommen, tastete Leyli nach dem Lichtschalter. Ihre Hand glitt über die abgeblätterte Farbe, bis sie ihn im Flur der siebenten Etage des Blocks H9 im Viertel Aigues Douces gefunden hatte.
Leyli verzog beim Anblick der gesprungenen Fliesen, des verrosteten Treppengeländers, der feuchten, aufgeworfenen Schimmelstellen an Wänden und Fußleisten das Gesicht. FOS-IMMO hatte im letzten Sommer die Fassaden der Wohnblocks streichen lassen, doch offenbar war die Farbe ausgegangen, bevor man auch die Hausflure hatte tünchen können. Oder aber, dachte Leyli beim Anblick der auf die Wände geschmierten Herzchen, Totenköpfe und Pimmel, die Stadtverwaltung hatte eine Kommission zur Erhaltung der Graffitis einberufen – schützenswerte Zeugnisse der Urban Art des frühen 21. Jahrhunderts. Worüber beklagte sie sich? In tausend Jahren würde man ihr Stockwerk wie heute die Grotte von Lascaux besichtigen. Leyli dachte gern positiv! Wer weiß, vielleicht hatte ihre Charme-Nummer ja gewirkt, und Patrick Pellegrin würde für sie die Traumwohnung auftun. Vielleicht wartete schon eine entsprechende Mail auf sie … fünfzig Quadratmeter … Erdgeschoss … Gärtchen … voll ausgestattete Kü…
»Madame Maal?«
Eine Stimme, eher ein Kreischen, dröhnte ihr aus der unteren Etage ans Ohr. Das Gesicht einer jungen Frau tauchte im Treppenhaus zwanzig Stufen tiefer auf. Kamila! Die hatte gerade noch gefehlt.
»Madame Maal«, wiederholte das Mädchen, »könnten Ihre Kinder die Musik leiser stellen? Hier im Haus gibt es Leute, die ernsthaft studieren. Mit dem Ziel, es irgendwann endlich verlassen zu können.«
Kamila Saadi. Die Nachbarin, die einen Stock unter ihr wohnte. Psychologiestudentin. Im sechsten Semester, wie Bamby. Übrigens machte Kamila alles genauso wie Bamby. Durch einen sonderbaren Zufall des Lebens war Kamila durch Vermittlung der FOS-IMMO vor zwei Jahren im Hochhaus eingezogen. Das hiesige Sozialamt versuchte, in Aigues Douces Studenten, Rentner, Arbeitslose und auch Bedürftige aus anderen Vierteln unterzubringen, die hier keine Wohnung ablehnen konnten, und gaukelte damit so etwas wie eine bunt gemischte Vielfalt vor. Bis die Leute daran kaputtgingen und wegzogen.
Kamila hatte ihre Nachbarin von oben, Bamby, unter den sechshundertfünfzig Studenten in den überfüllten Hörsälen der Psychologischen Fakultät an der Universität Aix-Marseille wiedererkannt. Ein Jahr lang waren die beiden gemeinsam mit dem Bus 22 gefahren, hatten für dieselben Kurse gebüffelt und ihre Kebabs geteilt. Kamila und Bamby hatten damals alles gemeinsam gemacht, wenn auch Kamila immer ein wenig schlechter abschnitt. Kamila und Bamby sahen sich ähnlich, das gleiche lange Haar, glatt und offen oder zu Zöpfen geflochten, die gleichen schwarzen, mandelförmigen Augen mit den hellen Sprenkeln, die gleiche dunkle Haut, nur dass Kamila nicht so hübsch war wie Bamby. Sie hatten ihre Examen zur gleichen Zeit bestanden, Bamby allerdings mit besseren Noten. Sie waren mit den gleichen Freunden ausgegangen, aber Bamby angelte sich immer die besseren Typen. Die schöne Freundschaft der beiden war nach und nach einer hässlichen Eifersucht gewichen. Dabei hatte Leyli zu Beginn dieser Freundschaft befürchtet, Bamby könne bei Kamila einziehen. »Keen’V«, zählte Kamila auf, »Canardo, Soprano. Es reicht, aus dem Alter bin ich raus!«
Und Gaël Faye, dachte Leyli. Bamby fand Gaël Faye super. Und dann Maître Gims, den Tidiane verehrte. Alpha mochte Seth Gueko und zuweilen Goldman, Balavoine und Renaud. Leyli hörte beim Bügeln gerne Radio Nostalgie. In ihrer Firma arbeitete sie mit Kopfhörern, aber zu Hause drehte sie die Musik voll auf! Wenn man auf fünfundzwanzig Quadratmetern wohnte, war das die einzige Möglichkeit, die Enge der Räume zu sprengen.
In Kamilas Stockwerk öffnete sich die Tür ihr gegenüber, und ein etwa fünfzigjähriger Mann trat heraus, den Leyli hin und wieder im Treppenhaus gesehen hatte. Er schien gerade aufgestanden zu sein und trug ein zerknittertes T-Shirt, so eines, wie man es morgens anzog, um arbeiten zu gehen, und anbehielt, wenn man nachmittags müde ins Bett fiel. Sein Gesicht war ebenso zerknittert wie sein T-Shirt, und seine sehr hellen blauen Augen schienen noch zu träumen. Ein Bart bedeckte Kinn und Hals, während sein schütteres graues Haar auf dem Kopf gegen eine beginnende Glatze ankämpfte. Das T-Shirt spannte über seinem Bauch.
»Ich habe nichts gehört«, meldete sich der Nachbar zu Wort und lächelte ihr verschwörerisch zu. Also wirklich, dachte Leyli und erinnerte sich an das Lächeln von Patrice Pellegrin, heute Morgen strahlten die Männer ja geradezu.
Der Nachbar bedachte Kamila mit dem gleichen Lächeln.
»Ich geh um 6 Uhr morgens zu meiner Schicht und schlafe hier den ganzen Nachmittag. Wenn die Musik zu laut wäre, meine Schöne, dann würde ich sie hören.«
Seine Stimme klang sonderbar heiser, als hätte er zu viel geschrien. Und deshalb hatte man keine große Lust, ihm zu widersprechen oder ihn etwas wiederholen zu lassen. Kamila zuckte mit den Achseln und knallte ihre Wohnungstür zu. Der Unbekannte stieg die Treppe hinauf zu Leyli und reichte ihr die Hand.
»Guy. Guy Lerat.«
Gleichzeitig nahm er ihr die beiden Einkaufstüten aus den Händen. Joghurt und Kuchen zum günstigsten Preis, Nutella-Ersatz und ähnliches Junkfood, das sie bei Lidl gekauft hatte, um den Kühlschrank aufzufüllen. Guy stand verlegen vor der Tür, während Leyli ihren Schlüssel herauskramte und die Tür aufschloss. Sie fand diesen großen schüchternen Mann rührend, der sich offensichtlich traute, in ihr Zuhause einzudringen.
»So kommen Sie doch herein!«
Er zögerte.
»Wenigstens bis zum Kühlschrank …«
Er setzte einen Fuß auf unbekannten Boden.
»Stimmt das?«, fragte Leyli und nahm ihm die Tüten ab. »Stört Sie die Musik wirklich nicht?«
»Keine Ahnung«, krächzte er, »ich schlafe mit Oropax.«
Guys Augen funkelten schalkhaft, und Leyli lachte beim Gedanken an Kamilas Wut laut auf. Aber dieses Miststück würde sicher einen Weg finden, sich zu rächen.
»Wissen Sie, ich arbeite an Maschinen, in der Raffinerie, im Ölhafen. Die haben gemessen, dass wir den ganzen Tag lang mehr als hundert Dezibel auf die Ohren kriegen. Auch mit Ohrenschützern müssen wir Kollegen schließlich mal miteinander sprechen. Wir alle haben kaputte Stimmen. Die sagen, das kommt vom Krach, und das glauben wir ihnen auch gern. Mit Asbest hätte das nichts zu tun, tja, bis sie noch was Fieseres finden, bevor wir in Rente gehen …«