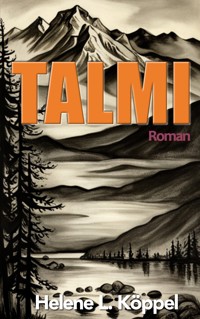
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Tod ist ein eiliger Gesell ... In einem dunklen Bergsee in den Pyrenäen verschwindet ein englischer Schatztaucher. Ein Unglücksfall? Mord? Kommissar Claret schöpft Verdacht, zumal sich die Reisebegleiter des Engländers, die sich lediglich aus dem Internet kennen, seltsam bedeckt halten. Was verheimlichen die Freunde des Tauchers? Ein abgründiger Reise-Psychoroman auf der Suche nach den rätselhaften Cagoten. Südfrankreich pur!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Und der Mensch versuche die Götter nicht Und begehre nimmer und nimmer zu schauen, Was sie gnädig bedecken mit Nacht und Grauen.
Friedrich Schiller, (Der Taucher)
Personen
René Labourd, Polizeipsychologe, ToulouseMaurice Claret, Kommissar, Ligue ToulouseAlain Bot, Sous-Brigadier, CouizaJean-Claude Sabot, Archäologe, Toulouse
Lisa Söllner, Hausfrau, DetmoldFrédéric Maury, Verkäufer, TroyesAnne-Sophie Tisseire, Autorin, ParisNigel Scott, Schatztaucher, TintagelWalter Schilcher, Journalist, Hamburg
Inhaltsverzeichnis
DER EINSATZ
DAS UNGLÜCK
DONNERSTAG, 24. Mai 2012
FREITAG, 25. Mai 2012
SAMSTAG 26. MAI 2012
PFINGSTSONNTAG, 27. Mai 2012
DIE REISE
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
DIE BERGUNG
PFINGSTSONNTAG, 27. Mai 2012
PFINGSTMONTAG, 28. MAI 2012
DIENSTAG, 29. MAI 2012
MITTWOCH, 30. MAI 2012
DIE SCHULDFRAGE
DAS SPIEL WAR AUS?
DIE NABELSCHAU
ERINNERST DU DICH, ANNE-SOPHE?
DAS ENDE
RIEN NE VA PLUS
PRESSEBERICHT
Hamburger Wochenzeitung, 22. August 2012
NACHWORT
MANCHE GESCHICHTEN MÜSSEN REIFEN
PERSONEN, ORTE UND ERKLÄRUNGEN
DIE CAGOTEN
SONSTIGE ANMERKUNGEN
QUELLEN UND ENTNOMMENE ZITATE
DER EINSATZ
René Labourd, Toulouse
Kommissar Claret hatte ein feines Gespür für das Böse. Er vermutete sofort, dass hinter dem Unglück, das den jungen Engländer Nigel Scott traf, mehr steckte.
Und er hatte recht ...
Mein Name ist René Labourd.
Ich bin Polizeipsychologe bei der Ligue Toulouse. Am 24. Mai 2012 forderte mich Kommissar Claret an, bei der Aufklärung eines mysteriösen Unfalls vor Ort mitzuwirken. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle erklären, dass ich kein gewöhnlicher Profiler bin, wie man sie von den amerikanischen Krimis her kennt. (Die Erstellung eines Täterprofils, bei dem man der verdächtigen Person gewissermaßen eine Kontur gibt, ist nur eine von zahlreichen Facetten, die zu meinem Beruf gehören.)
Meine Arbeitsschwerpunkte liegen in der kriminalpsychologischen Beurteilung nach Abschluss eines Falles und/oder der Stressbewältigung der Kollegen nach belastenden Einsätzen. Ich rede mit den Betroffenen, nehme mir Zeit für ihre Zweifel, ihre Ängste und bohrenden Fragen.
Mitunter werde ich aber auch bei komplizierten Voruntersuchungen mit herangezogen, wie es im nachstehenden Fall geschah.
R. Labourd, Toulouse
DAS UNGLÜCK
René Labourd, Toulouse
DONNERSTAG, 24. Mai 2012
Ich wollte an diesem Tag eigentlich nur in Ruhe gelassen werden – doch dann musste alles schnell gehen. Als ich nach eineinhalbstündiger Fahrt meinen Jeep neben dem Range-Rover der beiden Polizeitaucher abstellte, atmete ich erleichtert auf: Ich kam spät, aber nicht zu spät.
Ich schulterte meinen Rucksack und hetzte quer über den Parkplatz der Station Monts d’Olmes zum Hubschrauber hinüber, wo die Kollegen schon dabei waren, ihr umfangreiches Equipment einzuladen: Drucklufttauchgeräte, Sauerstoffflaschen, Unterwasserlampen, Akkus, Trockentauchanzüge und Flossen.
Nacheinander kletterten wir in den rot-weißen Rettungshelikopter, der uns über den Col de Girabal auf fast sechzehnhundert Meter hinaufbringen sollte. Es war ein trüber, kühler und windiger Tag, die Berge waren wolkenverhangen.
Kaum, dass ich angeschnallt war, ging es wie in einem Lift senkrecht in die Höhe. Mir war etwas mulmig zumute, auch weil ich nicht wusste, was genau der Kommissar von mir erwartete. Andererseits freute ich mich auf den Flug, denn wann hatte ein Polizeipsychologe schon die Gelegenheit, die Pyrenäen aus einer anderen Perspektive heraus zu betrachten. Und tatsächlich: Es war grandios. Das Panorama nahm mir den Atem.
Aber es ging auch etwas Ungezähmtes, Furchterweckendes von den schroffen, schneebedeckten Felskämmen und steilen Schluchten aus, die wir überflogen, und die grauweißen Wolkenfetzen, die den Helikopter begleiteten wie »Wotans Wilde Jagd«, verstärkten diesen Eindruck noch.
Die beiden Piloten, mit denen wir uns über die Head-Sets unterhielten, erzählten uns aufgeräumt von einer heiklen Rettungsaktion im letzten Winter, als sie zwanzig Touristen aus den Gondeln einer defekten Seilbahn herausgeholt und heil ins Tal hinunter gebracht hatten.
»Was unsere Arbeit im Gebirge so erschwert«, klagte abschließend der Ältere, »ist, dass man nie weiß, aus welcher Richtung gerade der Wind kommt.«
»Tiens, im Grunde geht es uns ähnlich«, meinte daraufhin einer der Taucher, ein rotblonder Krauskopf, der sich mir als Luca vorgestellt hatte. »In den Bergseen herrschen andere Druckverhältnisse als beispielsweise im Meer, und das Wasser ist kälter. Ich vermute, der Verrückte dort oben hat genau dies unterschätzt. Wie man bei dem Wetter überhaupt daran denken kann, im Forellensee zu tauchen, ist mir ein Rätsel.«
Ich konnte Luca nur zustimmen. Manchmal arbeitete der Mensch auch dem Schicksal in die Hände.
Das Landemanöver – ein ganzes Stück oberhalb des Sees, auf einer leicht abfallenden Graspiste – war ein Abenteuer für sich. Zweimal überflogen wir die abgesicherte Stelle, starteten selbst vor dem Aufsetzen noch einmal durch, um uns »neu zu positionieren«, wie uns die Piloten erklärten. Wir flogen eine weitere Schleife und setzten abermals zur Landung an. Als der Helikopter im Schwebeflug für Sekunden bedrohlich schwankte, stöhnte Luca theatralisch und hielt sich die Augen zu. Die Piloten lachten. Ich selbst war vermutlich leicht grün im Gesicht. Endlich kamen wir zum Stehen, Staub und Gras wirbelten auf – und mit einem Ruck war alles vorüber.
Der Kommissar wartete bereits auf uns. Nachdem die Rotorblätter ebenfalls zum Stillstand gekommen waren, eilte er herbei und erklärte uns kurz den Sachverhalt. Er deutete zum See hinunter, wo seine Leute beim Spurensichern waren. Ich wunderte mich über die große Betriebsamkeit, denn es hatte am Telefon geheißen, es handele sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Unfall, davon waren auch die beiden Taucher ausgegangen.
Maurice Claret war in Zivil. Wie selbstverständlich schulterte er sich einen der Ausrüstungssäcke und stapfte voraus. Der Trampelpfad, zu dem er uns führte – eine Abkürzung? –, befand sich ein Stück unterhalb einer überhängenden Felswand. Der Weg war stellenweise keinen halben Meter breit. Jemand mit Höhenangst, dem bereits beim Blick von der Bahnsteigkante auf die Gleise schwindlig wird, hätte sich schwergetan Claret zu folgen, zumal der Wind an uns zerrte und wir ständig Steine lostraten, die klackernd in die Tiefe fielen.
Auf halber Strecke zum See hinunter erreichten wir rechter Hand ein relativ windgeschütztes Plateau inmitten von Latschen und Zirbelkiefern. Von hier aus war ein direkter Blick auf den See nicht möglich. Vier silberne Iglu-Zelte standen eng beieinander, ein fünftes war abseits neben einem ausladenden Wacholderstrauch aufgebaut: davor, ratlos wie Gestrandete, die Reisebegleiter des Verunglückten: Zwei Männer, zwei Frauen. Die Jüngere weinte, die andere, eine fast schon verstörend gutaussehende Frau in Jeans und schwarzem Rollkragenpullover, hatte den Arm um sie gelegt, und ich hörte sie halblaut sagen: »Schon gut, du hast recht, Lisa, er hat die Eule nicht gestreichelt!«
Claret stellte mich den Leuten vor, dann bat er sie um Geduld und kletterte mit uns das letzte Stück zum See hinunter. Über dem Gewässer lagen Nebelschwaden. Als wir am Ufer ankamen, riss für einen Augenblick die Wolkendecke auf und gab einen kühnen Blick auf die Pyrenäen-Zweitausender frei.
Ich wünschte den Tauchern Glück, begrüßte das technische Personal, nahm dann aber Claret beiseite und fragte ihn leise, so dass es die anderen nicht hören konnten: »Was hatten diese Leute vor? Kein vernünftiger Mensch schleppt seine Tauchausrüstung hier herauf, nur um sich in ein finsteres Loch wie dieses zu stürzen.«
Clarets dunkle Augen blitzten. Er entsprach nicht dem gängigen Bild eines Kommissars, dazu war er einen Tick zu gutaussehend, doch er galt seit langem als einer der fähigsten und fleißigsten Kriminalisten unserer Ligue. »Weißt du denn nicht, wo du dich befindest, René?«
»Natürlich weiß ich das. Worauf willst du hinaus?«
Claret hob die Brauen. »Es ist der Weg zum Tabor«, sagte er, irgendwie bedeutungsschwanger, und wies zum Gipfel hinauf. »Dort weht der Geist.«
Ich lachte auf. »Dort weht was? Verstehe ich nicht. Was bedeutet das?«
»Der Pic de Saint Barthélémy ist zugleich der Heilige Berg der Katharer! Sie nannten ihn den Tabor.«
»Ich dachte immer, ihr Heiligtum wäre auf dem Montségur gewesen? Der befindet sich doch in der Nähe.«
»Exactement! Aber mit dem Tabor hat es was anderes auf sich.«
Er erzählte mir in wenigen Worten die Legende, nach der die Katharer auf dem Montségur den Heiligen Gral gehütet hätten, während unten im Tal die Soldaten des Papstes und des französischen Königs lauerten, um diesen Gral in ihren Besitz zu bringen. Da sei plötzlich eine Taube vom Himmel gestürzt, hätte mit ihrem Schnabel den Tabor gespalten, worauf die Große Esclarmonde den Gral in den Berg geworfen hätte, welcher sich dann für immer schloss.
»Oh lá, lá, Gralsforscher also, wie seinerzeit dieser Nazi, Otto Rahn«, sagte ich und grinste. »Ehrlich gesagt, wie Ewiggestrige sehen die vier nicht aus. Aber hier rund um den Montségur muss man immer mit Verrückten rechnen, das stimmt, Maurice! Was genau haben sie dir erzählt?«
Claret zuckte die Schultern. »Bislang halten sie sich bedeckt. Angeblich kennen sie sich aus dem Internet, unterhalten dort ein Forum, interessieren sich für Historisches. Es ist ihr erstes persönliches Treffen. Sie haben sich übrigens unweit von hier in einer kleinen Bergpension eingemietet, von wo aus sie sich vorgestern an den Aufstieg gemacht haben. Mit knappem Gepäck, aber der Tauchausrüstung im Schlepptau.« Er deutete auf ein am Ufer liegendes blaues Ungetüm aus Kunstleder. »Doch weil du gerade diesen Rahn ansprichst ... Es sind tatsächlich zwei Deutsche darunter, eine Frau und ein Mann, jedoch nicht miteinander verwandt. Die Gruppe wartet seit Tagen auf eine weitere Person, einen jungen Franzosen namens Lancelot. So nennt er sich jedenfalls in ihrem Forum. Dieser Mann hat offenbar die gesamte Reise organisiert, ist aber seit Samstag abgängig.«
»Lancelot?« Ich verzog das Gesicht. »Sag, dass das nicht wahr ist!«
»Doch!«, Claret lachte auf. »Lancelot und der Gral, n’est-ce pas? Nun, vielleicht täusche ich mich, und diese Leute sind durch und durch seriös; das kann alles sein, René, ich will ihnen nichts unterstellen. Aber dass dieser Engländer Scott, wie sie behaupten, am frühen Morgen und bei diesem Wetter einzig aus sportlichen Gründen in den See stieg, das können sie mir nicht weismachen. Da stimmt was nicht. Mein Gefühl sagt mir, dass hier mehr passiert ist als ein Unfall.« Claret strich sich über das millimeterkurz geschnittene schwarze Haar. »Der Forellensee ... alors, das ist kein See zum Tauchen, sondern, wie auch du bemerkt hast, ein finsteres Loch. Also, René, wenn die vier sich einig sind zu schweigen, weil es etwas zu verbergen gibt, erfahren wir vielleicht nie, was passiert ist.«
»Deshalb hast du mich also gerufen …«
Claret nickte. »Ich selbst bin übrigens nur hier, weil ich mich derzeit mit meiner Familie im Urlaub befinde. In Couiza. Besuch bei meinem Schwager, einem Kollegen: Sous-Brigadier Alain Bot. Ich stelle ihn dir später vor.«
Luca trat zu uns heran. Er sah ernst aus und strich sich mehrmals über seine Nase. »Wir haben ein Problem, Monsieur le Commissaire!«, sagte der gutgebaute Taucher. »Normalerweise sind die Sichtverhältnisse in den Bergseen optimal, weil das Wasser weniger Schwebeteilchen enthält. Aber hier ist das Gegenteil der Fall. Wir benötigen unbedingt stärkere Lampen und auch Spezialgerät, was aber leider nicht so schnell zu beschaffen ist.«
Nach kurzer Beratung mit seinen Leuten, und weil es sich weiter eintrübte, beschloss der Kommissar, die Bergung für diesen Tag abzubrechen und die Befragung der Zeugen in der Pension Serrede vorzunehmen, in der die Reisenden Zimmer belegt hatten.
Mit einem Blick auf meine Bergstiefel fragte er mich, ob ich es mir in Begleitung zweier Brigadiers zutrauen würde, die Leute zu Fuß dorthin zu bringen. »Sie kennen den Weg, und ich möchte den Helikopter ungern ein drittes Mal auf den Berg schicken«, sagte er. »Überdies hat eine der Damen Flugangst.«
An diese Herberge erinnerte ich mich sogar. Ich hatte sie, wie auch den Montségur, vom Helikopter aus wahrgenommen, aber der Teufel sollte mich holen, wenn mir in meinem momentanen humorlosen Zustand Clarets »Bitte« gefiel! Mein Beruf setzte zwar Flexibilität und Mobilität voraus, doch ich hatte die letzte Nacht durchgemacht, war unausgeschlafen und verkatert.
»Geht klar, Maurice!«, sagte ich gleichwohl und trat meine Zigarette aus.
Während Claret über Funk noch mit dem Besitzer sprach, um auch für mich nach einer Übernachtungsmöglichkeit zu fragen, machte ich mich verdrossen wieder auf den Weg nach oben, um die Gruppe zu informieren.
»Packen Sie bitte nur Ihre persönlichen Dinge zusammen«, sagte ich zu den Leuten. »Leichtes Gepäck. Alles andere, die Zelte und die Ausrüstung Ihres Freundes, verfrachten die Kollegen in den Helikopter.«
Die junge Frau mit dem blonden Pferdeschwanz war die einzige, die mich völlig entrüstet ansah, als ich sie bat, mitzukommen.
Sie meinte: »Aber wir können doch hier nicht weggehen, bevor Nigel ...«
Die anderen machten sich wortlos ans Packen.
Auf dem gut eineinhalbstündigen Abstieg hinunter zur Pension war ein Gespräch unmöglich, was zum einen am Wind lag, der permanent pfiff, zum anderen daran, dass das Unglück die kleine Reisegesellschaft geradezu stumm geschlagen hatte. Es war, als trügen sie gemeinschaftlich die Leiche ihres Freundes zu Tal.
Einsam und wildromantisch, wie eine kleine Festung, lag die Pension Serrede auf einem Felsplateau. Aus dem Kamin des zweistöckigen, teils mit Efeu bewachsenen Steinhauses stieg Rauch auf. Als wir uns näherten, bellten Hunde. Das Gebäude war ausschließlich über eine steile Steintreppe zu erreichen. Unterhalb der Treppe befand sich ein bescheidener, mit hohen Tannen gesäumter Parkplatz, auf dem die Autos der Reisenden standen.
Monsieur Richard, der Patron, erwartete uns schon. Mit besorgter Trauermiene, jedoch ohne lang Fragen zu stellen, geleitete er uns in seine Gaststube, wo Tassen und Warmhaltekannen bereitstanden. Es roch einladend nach Zitronenkuchen. Mein Magen knurrte, denn ich hatte heute noch nichts gegessen.
»Fühlen Sie sich wie zuhause«, sagte Richard. »Sie sind bis auf Weiteres unsere einzigen Gäste. Die letzte Wandergruppe ist heute morgen abgereist.« Verlegen strich sich der kleine Mann über seine gelb-rotgestreifte Halbschürze, die ihm bis hinunter auf die Waden reichte. »Tut mir aufrichtig leid, was mit Ihrem Freund geschehen ist. Furchtbar.«
Die Reisenden dankten stumm, und weil alle durchgefroren waren und sich vor dem Kaminfeuer drängelten, schleppte Richard weiteres Holz herbei. Ich hörte, wie einer der Brigadiers ihm zuraunte, dass er das Zimmer des Tauchers versiegeln müsse. Richard nickte wissend und führte den Kollegen hinaus.
Die Frau des Patrons, eine dunkelhaarige, drahtige Person – wie ihr Mann wohl um die Fünfzig – servierte frischgebackene Madeleines und schenkte Kaffee und Tee ein. Dem Deutschen trug sie einen Cognac auf. Als wir uns gestärkt hatten, brachte Monsieur Richard die beiden Brigadiers nach Couiza zurück. Mich lud er unterwegs ab, beim Parkplatz Monts d’Olmes, damit ich mein Auto und mein Gepäck holen konnte.
Nach meiner Rückkehr zeigte mir Madame Richard mein Zimmer im ersten Stock, das, obgleich mit Dachschräge, so schlicht und gemütlich aussah wie die Gaststube: viel helles Holz, Blumenbilder und Geweihe an den Wänden, freundlich gemusterte Vorhänge und helle Teppiche aus Wolle. Ich hätte es schlechter treffen können.
»Sie sind doch der Herr von der Polizei aus Toulouse?«, fragte sie mich leise, als ich das Fenster öffnete, um mich zu orientieren. (Zwei Hunde schlugen an. Kurz und kräftig.)
Ich nickte. »René Labourd, ja. Ich betreue die Reisengruppe. Gewissermaßen. Ich benötige das Zimmer vorerst für ... zwei Nächte.«
»Das geht in Ordnung, Monsieur Labourd. Darf ich ... nun, darf ich Ihnen zu dem Unglück meine Meinung sagen?«
Ich warf einen sehnsüchtigen Blick auf das Bett und unterdrückte ein Gähnen. »Nur zu, Madame! Nehmen Sie sich kein Blatt vor den Mund.«
»Alors, wir haben diese Leute gewarnt, als sie am Dienstag hier eintrafen. Nachdrücklich gewarnt. Aber vor allem der Engländer, der Taucher, hatte nicht auf uns hören wollen. Er hat uns nicht ernst genommen. Er sei Profi, hat er erklärt. Er wisse, was machbar sei und was nicht.«
»Und die anderen, wie haben die sich verhalten?«
»Die haben über ihn gelacht, besonders als er uns um einem Esel bat, der ihm seine Tauchsachen nach oben bringen sollte. Ich sage selten was Schlechtes über unsere Gäste, Monsieur, und es tut mir natürlich leid um den Mann, aber das sind für mich ... Verrückte. Mit unseren Bergen ist nicht zu spaßen! Vor kurzem erst hat es wieder eine Wanderin erwischt. Auf 1800 Meter ist sie hochgeklettert – und abgestürzt. Tot. Als nach zwei Stunden der Rettungshubschrauber eintraf, waren von ihr nur noch die Knochen übrig.«
Ich fuhr herum. »Wie bitte?«
»Knochen und ... Geierspuren«, flüsterte Madame Richard. Sie bekreuzigte sich. »Aasgeier. Die sind noch gekreist, als die Rettungsmannschaft ankam. Innerhalb von zwei Stunden hatten sie die arme Frau aufgefressen!«
Nach einem erschrockenen Blick auf ihre Armbanduhr, eilte sie in die Küche zurück, um das Abendessen vorzubereiten, wie sie sagte.
Zum Diner gab es bezeichnenderweise Poulet aux trompettes de la mort (Hühnchen mit Todespilzen). Der verführerische Geruch nach Knoblauch, Wein und Pilzen war durch das ganze Haus gezogen und hatte mich gerade noch rechtzeitig geweckt.
Beim Essen konnte ich meine Schützlinge endlich genauer studieren:
Die beiden Frauen – Anne-Sophie Tisseire aus Paris und die aus Detmold stammende Lisa Söllner – waren blass, standen noch ziemlich unter Schock. Dasselbe galt für den jungen Franzosen Frédéric Maury, der aus Troyes kam. Er machte einen äußerst niedergeschlagenen Eindruck, wirkte schüchtern und unsicher.
Gefasster, wenngleich übernervös und ungeduldig, schien mir der Deutsche aus Hamburg zu sein, Walter Schilcher, der am Morgen Monsieur Richard alarmiert hatte, nachdem Scott nicht mehr aufgetaucht war.
(Die Deutschen sprachen übrigens nahezu fließend französisch.)
Nachdem sich Walter Schilcher, der sich einen Sonnenbrand zugezogen hatte, als Sprecher der Gruppe gebärdete, gab ich ihm nach dem Dessert Gelegenheit, zusammenhängend zu berichten.
Nach einem kurzen Abriss des Reiseverlaufs und der Vorgänge oben am See, erklärte er mit Nachdruck, dass sich Nigel Scott diesen frühmorgendlichen Tauchgang geradezu ausbedungen hätte. »Er wollte sich nur kurz umsehen, hat sich von der Morgensonne optimalere Sichtverhältnisse erhofft. Wir haben ihn dennoch vor seinem Alleingang gewarnt.«
»Angefleht haben wir ihn!«, warf Lisa Söllner ein. Sie trank keinen Wein, sondern wie ich Coca-Cola. Wie unter Zwang spielte sie mit dem weichen Wachs einer der Tischkerzen, die sie zu sich herangezogen hatte. Ihre Finger waren ständig in Bewegung.
»Dann war Ihr Freund offenbar recht eigenwillig gewesen?«, fragte ich nach. »Die Wirtsleute haben mir erzählt, er hätte bei ihnen sogar nach einem Transportesel gefragt?«
»Das mit dem Esel stimmt, aber das war nicht ernst gemeint«, wiegelte Schilcher ab. »Scott war eigenwillig, ja, aber oft auch witzig und spottlustig. Ein netter Kerl. Ich mochte ihn. Jovial, hilfsbereit. Und auch ehrgeizig: Bereits mit fünfzehn hat er sich bei einer Tauchschule angemeldet, hat er mir erzählt, und sich zielstrebig auf seine Prüfungen und Examina vorbereitet. Seine älteren Brüder sind ebenfalls Berufstaucher. Von ihnen wusste er, dass er nur dann Aufträge als Schatztaucher bekommen würde, wenn er zuvor im Zentrum für Meeres-Archäologie in Southampton studierte. Begehrte Studienplätze, wie er sagte. Dennoch gelang es Scott, einen zu ergattern. Darauf war er unheimlich stolz gewesen, aber auch, dass er als einer der Jüngsten zu einer Gruppe von Schatztauchern gehörte, die 2008 eine spanische Galeone entdeckt hat. Die Genehmigung sie zu heben stand allerdings noch immer aus, weswegen er sich in den letzten Jahren gezwungen sah, zur Überbrückung kleinere Aufträge anzunehmen.«
»Ich verstehe …«, sagte ich und machte mir einen ausführlichen Vermerk. Dann, nachdem ich mir vom Patron doch noch ein Glas Wein hatte einschenken lassen, fuhr ich fort: »Gab es Streit unter Ihnen? Vielleicht wegen Ihres ... verschwundenen Reiseleiters? Am Ende ist Scott gar nicht ertrunken, sondern hat sich auf Nimmerwiedersehen auf und davon gemacht? Wäre das vorstellbar für Sie?« (Ich dachte nicht zuletzt an die Geier; das Drama hatte mich schockiert.)
Doch die Freunde des Tauchers waren sich offenbar einig, die Stärken des Engländers über seine Schwächen zu stellen. Allen voran Schilcher: »Niemals hätte er sich ohne ein Wort davongeschlichen. Er hätte auch nicht sein Gepäck und seine Ausrüstung zurückgelassen. Auf Scott war Verlass!«
Mit ihren verweinten Augen fixierte Lisa Söllner Frédéric Maury, der daraufhin dem Hamburger beisprang: Scott sei tatsächlich stets offen und ehrlich gewesen, sagte er, und es hätte keinen Streit und auch keinerlei Vorzeichen oder Vorahnungen gegeben.
Ich erkannte indes eine gesteigerte Unsicherheit im Gebaren des jungen Mannes, der mir, nebenbei bemerkt, etwas eigenbrötlerisch vorkam, und warf ihm über den Rand meiner Hornbrille hinweg einen spöttischen Blick zu: »Über die Toten nichts Böses, Monsieur Maury?«
Sofort herrschte Stille am Tisch.
Claret hatte also recht gehabt: Sie mauerten. Sie verschanzten sich. Ich musste mich behutsamer an sie herantasten.
»Und wie ist Scott Mitglied in Ihrem Forum geworden?«
Schilcher wies auf Anne-Sophie Tisseire.
Der teilnahmslose Ausdruck auf dem Gesicht der attraktiven Pariserin verschwand. Sie neigte den Kopf zur Seite und seufzte hörbar. »Er ist im Internet auf uns gestoßen und hat sich aufgrund seiner Kenntnisse über den sagenhaften König Artus beworben.«
»Hatte er denn keine Probleme mit der Verständigung?«
»Seine Mutter ist Französin, stammt aus der Bretagne. Von daher ... «
»Hm, König Artus also ... Für einen Taucher ein eher abgedrehtes Thema, oder?«
Madame Tisseire schüttelte den Kopf. »Das finde ich nicht. Scott lebte in Tintagel, wo der Legende nach die Reste von Artus’ Schloss liegen. Jedes Kind weiß dort Bescheid.«
»Unterwegs hat sich Nigel häufig mit seinen Tauchabenteuern gebrüstet«, ergänzte Lisa Söllner den Bericht – möglicherweise, um ihre schöne Freundin in Sachen Auskunftsfreudigkeit zu überbieten. »Und er hat oft von einer Schatzgeschichte erzählt, bei der es um das Gold von Toulouse ... äh, ging.« Sie senkte errötend die Augen.
Ich merkte auf. Das Gold von Toulouse? Hatte sich Lisa Söllner gerade verplappert?
»Aber ernsthaft hat er nicht danach gesucht«, setzte sie beflissen nach, die honiggelbe, inzwischen stark ausgefranste Kerze zur Tischmitte zurückschiebend. »Ganz sicher nicht. Und schon gar nicht im Forellensee. Das Gewässer hat ihn nur als Taucher interessiert. Selbst im Forum nannte sich Scott … Diver.«
Ich hob die Brauen, erwartete eine Reaktion auf diese schwache Ansage. Aber von den anderen kam nichts. Nun war ich mir völlig sicher, dass sich die Leute untereinander abgesprochen hatten, dass sie vor der Polizei etwas verbargen. Der Fall würde mich endlos Zeit kosten, und das gefiel mir ganz und gar nicht.
In der Causa Lancelot verlief die Befragung ebenfalls im Sand: Niemand konnte sich das Fernbleiben und Schweigen des Forumsleiters erklären. Immerhin gewann ich den Eindruck, dass sie zumindest in diesem Punkt die Wahrheit sagten – was mich wieder etwas beruhigte.
Nach dem Espresso ergänzte ich die Notizen, dann sah ich auf die Uhr.
»Ich denke, wir kommen heute nicht weiter«, sagte ich zu den Leuten, »es war ein anstrengender Tag. Sie sind erschöpft, ich sehe es Ihnen an. Der plötzliche Tod eines guten Freundes ist nun mal ein tiefer Einschnitt im Leben eines Menschen. Bien, bonsoir – gehen Sie zu Bett, schlafen Sie sich aus! Wir treffen uns morgen um halb neun zum Frühstück. Danach bleibt uns noch genügend Zeit, um miteinander zu reden.«
FREITAG, 25. Mai 2012
Am nächsten Morgen gab es ein unliebsames Erwachen. Es regnete und eine dicke Nebelsuppe hatte die umliegenden Berge verschluckt. Nicht einmal der stolze Montségur war zu sehen.
»Heute können Sie nicht zum See aufsteigen, Monsieur Labourd«, bedauerte der Patron, als er mit seinen beiden Border-Collies von draußen hereinkam, »zu gefährlich. Aber es trocknet hier auch schnell wieder ab. Der Wind!«
Die Stimmung beim Frühstück war dem Wetter angepasst. Gleichwohl hatte das Entsetzen der Gralsforscher über Scotts Unglück seine erste Schärfe eingebüßt: Fragen nach der Abreise kamen auf. Ich sagte, man müsse abwarten, bis die Leiche des Tauchers geborgen sei.
Nach dem Frühstück ging ich zu den Einzelgesprächen über, wobei ich die Gralsforscher, wie ich sie längst für mich nannte, um ihr Einverständnis bat, einen Tonträger benutzen zu dürfen.
Es gab erschrockene Blicke. Ich erklärte den Leuten, dass man sie weder festhalte noch offiziell verhöre, schließlich gäbe es bislang kein Anzeichen für ein Fremdverschulden am Unglück des Tauchers. Es ginge dem Kommissar und mir nur um eine informatorische Zeugenbefragung. Das Diktiergerät erleichtere mir meine Arbeit.
Mit Erlaubnis des Patrons zog ich mich in ein kleines Nebenzimmer zurück und bat als erstes die junge Deutsche zu mir.
Lisa Söllner war 28 Jahre alt, verheiratet, derzeit Hausfrau, lebte in Detmold und hatte Zwillingstöchter im Alter von drei Jahren. Sie gab sich als »Seelchen«. Ihre Naivität, ihre ständigen Tränen, ihr häufiges Erröten und ihr Mädchenlächeln kamen mir aufgesetzt vor.
Niederschrift der Tonaufzeichnung Lisa Söllner
»... Als Lancelots Mail eintraf, worin er mich einlud, über Pfingsten mit der Clique auf Forschungsreise zu gehen, spürte ich die Erregung fast körperlich. Verstehen Sie, was ich meine, Monsieur? Bislang war für mich eine solche Reise nur ein Gedankenspiel gewesen, doch als es von heute auf morgen ernst wurde, war ich sehr aufgeregt … Südfrankreich ist das schönste Land der Welt, hatte Lancelot geschrieben und mir eine Vision von Sonne, Palmen und einsamen Stränden beschert, was natürlich Unsinn war. Es sollte ja eine Recherchereise werden. Romanische Kirchen und Pyrenäendörfer. Aber ich kannte den Süden noch nicht. Ich war überhaupt zuvor nur wenige Male in Frankreich gewesen, zweimal für einige Wochen als Austauschschülerin und dann später, während meines Studiums, da habe ich die Semesterferien in unserer Partnerstadt Saint-Omer verbracht; das liegt im Norden, in der Nähe von Calais ... Dass nun meine erste Südfrankreichreise so endet – herrje, ich fasse es noch immer nicht! Allerdings klang das, was Lancelot in seiner Einladung andeutete, ein wenig – wie soll ich es nur ausdrücken – ein wenig mysteriös. Aber er hat nun mal diese Art zu reden. Er legt sich auch im Forum selten fest, hinterfragt vieles wieder und wieder. Das weiß jeder. Heute wünschte ich mir, dass diese Mail nie angekommen wäre oder ich spontan abgesagt hätte. Vielleicht hätte sich dann alles zerschlagen und Nigel lebte noch. Doch damals ...
Tja, wie ging es weiter an diesem Tag? Ich soll ausführlich berichten?
Nun, ich sah wie unten der Postbote heranradelte, schnappte mir den Briefkastenschlüssel und stellte mich wie fast jeden Morgen um diese Zeit ins Treppenhaus, um auf das Klappern der Briefkastendeckel zu warten. Ich weiß, dieses Verhalten ist albern, Monsieur Labourd, aber ... ich dachte immer, ich würde vielleicht etwas Wichtiges versäumen. Als es so weit war, eilte ich die Treppen hinunter und schloss den Kasten auf.
Nein, nein, ich war nie wirklich berufstätig, ich habe nach meinem Französisch-Studium ein bisschen hier und dort gejobbt, dann kamen die Kinder. Axel, mein Mann, ist Tiefbau-Ingenieur in Detmold, wo wir auch wohnen, meine beiden Töchter heißen Silvie und Marie.
Aber zurück: Die offizielle Einladung mit den Reiseinformationen lag tatsächlich im Briefkasten. Ich spürte etwas Hochgestimmtes in mir aufwallen. Vive la France, flüsterte ich aufgeregt.
Ja, ich muss heute selbst lachen, wie geschmeichelt ich mich fühlte, weil die Freunde mich brauchten. Ich sollte das Reisetagebuch führen, was ich als großen Vertrauensbeweis betrachtete – und auch sorgfältig erledigt habe. Mit einem Schlag war die Zeit vorüber, in der ich aus nichtigem Grund drauflos weinte.
Na ja, ich weinte schon immer zu viel, Monsieur, vor allem als Kind. Spielten sie im Radio Mozart, flennte ich. Und jetzt die schlimme Sache mit Nigel ... Allein die Vorstellung, wie er dort unten in diesem grässlichen See liegt. Die Augen weit aufgerissen ... Ja, ich denke, Sie haben recht: Mein Leben ist nicht ausgefüllt genug, obwohl mich die Kinder fordern und ich obendrein eine Viel-Leserin bin, das heißt, ich lese alles Gedruckte, was mir (schneidet eine Grimasse) unter die Finger kommt.
Nun hatte ich also die ersehnte Einladung von Lancelot in Händen, wusste aber nicht, wie ich mein Vorhaben Axel, meinem Mann, erklären sollte. Bei diesem Problem konnte mir die Clique nicht helfen, da musste ich schon selbst die Initiative ergreifen.
Wie ich zum Forum kam? Nun, als ich eines Tages aus Langeweile im Internet surfte, gab ich als Stichwort ›Heiliger Gral‹ ein, ein Thema, das mich schon immer interessierte. Dort stieß ich auf die Gralsforscher. Ich bewarb mich, gab als Referenz meine Kenntnisse über Romanische Madonnen an ... damit kenne ich mich wirklich sehr gut aus, Monsieur! Zwei Tage später meldete sich Anne-Sophie Tisseire telefonisch bei mir, um mein Französisch zu testen. Nun, ich hätte die Prüfung mit Auszeichnung bestanden, sagte sie mir am Ende des Gesprächs, obwohl ich natürlich sehr aufgeregt war und dumm herumstotterte. Damals war noch sie die Managerin des Forums, nicht Lancelot. Ich nannte mich fortan Ellida. Das ist eine Gestalt von Ibsen, wissen Sie. Ich hatte damals viel von ihm gelesen und mir spontan diesen Namen ausgesucht. An Ibsen werde ich mich nie sattlesen ...
Na klar, jeder Teilnehmer hat einen solchen Nicknamen. Lancelot allerdings ist Lancelot. Er will seinen Namen nicht preisgeben. Seltsam eigentlich, so unter Freunden, oder? Aber wenn ich ehrlich bin, hab ich mir bis vor kurzem darüber keinen Kopf gemacht. Ich dachte, das sei eben eine Marotte von ihm ...«
Wie viel ein Mensch von sich preisgibt, hängt auch davon ab, wie freimütig er im Allgemeinen ist. Frédéric Maury, den ich als Nächsten zum Gespräch bat, war vom Typ her deutlich distanzierter als Lisa Söllner. Seine Stimme klang vorsichtig gespannt, seine Körperhaltung spiegelte fraglos sein verstörtes Inneres wider; es war nicht leicht, Zugang zu ihm zu finden.
Er hätte noch nie Ärger mit der Polizei gehabt, sagte er mir, ohne dass ich in diese Richtung insistiert hatte, und er sei auch nur zu einem Gespräch mit mir bereit, weil er mithelfen wolle, Licht ins Dunkel zu bringen. Verpflichtet sei er dazu nicht, das bat er mich festzuhalten. Eine Tonaufzeichnung lehne er ab.
Ich erklärte ihm, dass die Polizei stets den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren wisse und dass auch von meiner Seite weder Druck noch Einschüchterungsversuche zu erwarten seien.
Ich ließ also die Zügel locker und machte mir eingangs wiederum nur kurze Notizen:
Frédéric Maury, 33 Jahre, wohnhaft Rue Emile Zola, Troyes; abgebrochenes Theologie- und Philosophiestudium, derzeit Verkäufer in einem Andenkenladen, verheiratet, jedoch getrennt lebend, keine Kinder.
Sein Forumsname Jargonaut hinge, so erklärte er mir nach der Feststellung seiner Personalien, mit einer gewissen Affinität für kryptische Kürzel und Synonyme zusammen; seine Forumsbeiträge unterzeichne er aber stets mit Frédéric. Er sei im Juni letzten Jahres zur Clique gestoßen, nachdem ein von ihm verfasster Internetbeitrag über die Gralsgeschichte Lancelot in die Hände gefallen sei. Dieser habe daraufhin per E-Mail Kontakt zu ihm aufgenommen und ihm bedeutet, er, Frédéric, sei mit seinen speziellen Kenntnissen gewissermaßen der Missing Link der Clique.
Über Lancelot – inzwischen selbst das fehlende Glied – wisse er indes nur wenig, sagte Maury. Der Boss sei in der Werbebranche tätig. Maury erinnerte sich auch an ein Gespräch mit ihm, bei dem es um ein Motorboot gegangen war, das in Cap Agde liege.
Zur Recherchereise erklärte mir Maury folgendes (zu diesem Zeitpunkt war das Eis gebrochen und der junge Mann gestattete mir die Benutzung des Diktiergerätes):
Niederschrift der Tonaufzeichnung Frédéric Maury
»Es war Gründonnerstag, als ich Lancelots Einladung erhielt. Donnerstag ist mein einziger freier Tag in der Woche, deshalb weiß ich das so genau. Die Reise lockte mich, aber ich hatte das Geld nicht dafür. Das schrieb ich Lancelot offen und sagte ab. Zwei Stunden später erreichte mich eine neue Mail: Ich solle mir über die finanzielle Seite keine Sorgen machen. Er übernehme meine Kosten, ich müsse mitkommen, würde dringend gebraucht. Ich dachte, dass die Reise etwas mit der Gralsgeschichte zu tun hätte, die, wie gesagt, mein Schwerpunkt im Forum ist. Schon deshalb lockte es mich mitzufahren, auch um die potentiellen Gralsburgen endlich mit eigenen Augen zu sehen. Aber es widerstrebte mir, mich von jemandem abhängig machen. Ich schnappte mir meine Flöte und dachte nach.
Aber ja, Monsieur Labourd, mir kommen beim Musizieren oft die besten Ideen. Das ist so. Poulenc z.B. inspiriert mich besonders. Aber das führt jetzt wohl zu weit. Kurz, ich fasste den Entschluss, meine Kamera zu verkaufen. Ein Geschenk von meiner Ex. Auf der Fahrt würde ich nicht selbst fotografieren müssen, das war Walters Job. Monsieur Schilcher ist Journalist, und die Fotos sollten später für alle zugänglich ins Forum eingestellt werden.
Freut mich, dass auch Sie Poulenc schätzen, Monsieur, aber was wollen Sie denn von mir über ihn wissen?
Ja, das stimmt, Poulenc war melancholisch. Doch die Traurigkeit ist auch immer Bestandteil des Fröhlichen. Oder etwa nicht?«
Kurz vor dem Mittagessen trafen Kommissar Claret und sein Schwager ein, der hiesige Sous-Brigadier Alain Bot, dem ich bereits oben am See kurz vorgestellt worden war. In ihrer Begleitung einer der jungen Brigadiers von gestern, der die Zelte und das verbliebene Gepäck der Gralsforscher mitbrachte.
Bot, ein fülliger Mann mittleren Alters, mit Aknenarben im Gesicht, ließ sich von Madame Richard den Schlüssel für das Zimmer des Tauchers aushändigen. Es befand sich im Erdgeschoß, direkt gegenüber der Gaststube.
Während die Gralsforscher ihre »Utensilien« wegbrachten, beobachtete ich, wie Bot das Siegel an der Tür entfernte und wie sich auch der Kommissar vor dem Eintreten vorschriftsmäßig Handschuhe überstreifte. Erneut fragte ich mich, weshalb Claret einen solchen Aufwand betrieb.
Die Tür quietschte beim Öffnen.
Nach ungefähr einer halben Stunde kamen die beiden wieder heraus. Ihrer Mimik war nichts zu entnehmen.
»Wir müssen Sie leider noch um ein, zwei Tage Geduld bitten, Messieurs-dames«, sagte der Kommissar zu den Gralsforschern, die sich inzwischen wieder bei mir in der Gaststube eingefunden hatten. »Sobald der Regen nachlässt, wird die Suchaktion anlaufen.«
Bot, die Türklinke bereits in der Hand, nickte wie zur Bestätigung.
Madame Tisseire meldete sich zu Wort: »Dafür, dass wir noch hierbleiben müssen, haben wir vollstes Verständnis, Monsieur le Commissaire«, sagte sie, »wir alle möchten wissen, was Nigel Scott zugestoßen ist. Aber weshalb verhört man uns? Was hat denn unser Privatleben mit diesem fatalen Unfall zu tun?«
Sie warf mir einen ungnädigen Blick zu.
Claret, der schon einen halben Schritt zur Tür gemacht hatte, drehte sich noch einmal um. Er lächelte nachsichtig. »Madame«, sagte er, ruhig und gelassen, wie es seine Art war, »Monsieur Labourd« – er wies auf mich – »soll Ihnen in erster Linie helfen, das Unglück, das Ihren Freund traf, zu verarbeiten. Darüber hinaus brauchen wir für unsere Ermittlungen auch die eine oder andere Information über die Tage vor dem Unglück. Ein Blick auf die Lebensumstände der Beteiligten und Zeugen gehört dazu. Das kann ich Ihnen leider nicht ersparen.«
Clarets Handy klingelte. Er klopfte entschuldigend auf die Brusttasche seines stahlblauen Hemdes, verabschiedete sich und eilte mit Bot hinaus.
Die Pariserin warf mir erneut einen unfreundlichen Blick zu.
Gestern Abend hatte sie mich vor dem Zubettgehen zur Seite genommen und auf ziemlich subtile Weise versucht, mich um den Finger zu wickeln. Mit tränenfeuchtem Flackern in den Augen bat sie mich, meinen Einfluss beim Kommissar geltend zu machen, damit er sie heute, notfalls unabhängig von den anderen, entließ. Sie müsse dringend zurück nach Paris. Termine.
»Sie machen mich überaus verlegen, Madame!«, hatte ich zu ihr gesagt und dann ihr Ansinnen freundlich aber bestimmt abgelehnt.
Ihr »Fluchtversuch« erregte meine Aufmerksamkeit. Was verbarg sich hinter der schönen Fassade und dem souveränen und zugleich nervösen Auftreten dieser Frau? Ihr Ehrgeiz? Verglich ich ihr Verhalten mit anderen Fällen, deutete alles auf eine eingeschränkte Stresstoleranz hin. Oder auf Angst – was sie jedoch in jedem Fall gut zu überspielen wusste. Während der Befragung drängte sich mir zudem der Verdacht auf, dass Madame Tisseire Schwierigkeiten haben könnte, Erfahrungen und Gefühle miteinander zu verknüpfen und in ihr Leben einzubinden.
Niederschrift der Tonaufzeichnung Anne-Sophie Tisseire
»Lancelot rief mich zu einem wahnsinnig ungünstigen Zeitpunkt an, Monsieur Labourd, denn ich brütete gerade über einem Vortrag und wollte mich an diesem Abend durch nichts und niemanden stören lassen.
Ja, ich bin verheiratet, seit langem, aber Sébastien und ich … nun, wir haben uns ein wenig auseinandergelebt, seit unser Sohn aus dem Haus ist. Dennoch ist unsere Ehe gut. Mein Mann ist Musiker ...
Aber ja, ich habe selbstverständlich an diesem Abend Lancelot zugesagt, zum einen, weil ich ihn rasch wieder loswerden wollte – wissen Sie, er redet am Telefon mitunter zuviel – (verzieht spöttisch das Gesicht), und zum anderen, weil der Zeitpunkt für diese Reise ganz ausgezeichnet in meine Pläne passte. Ich wollte nach Pfingsten sowieso in den Süden fahren, um für ein neues Thema zu recherchieren. Außerdem fühlte ich mich als Gründerin des Forums für seinen Fortbestand verantwortlich.
Ja, Lancelot war fast von Anbeginn mit dabei, ich selbst habe ihn seinerzeit ins Forum gebeten, nachdem längere Telefongespräche vorausgegangen waren. Inzwischen haben uns einige Leute verlassen, andere sind hinzugestoßen. Seit knapp einem halben Jahr ist nun Lancelot der Boss, wenn auch die Website noch immer unter meinem Namen läuft. Ich finde, er macht seine Sache ausgezeichnet. Nur jetzt irritiert er mich sehr. In meinem Kopf schwirrt es nur so (seufzt) nach Nigels Unglück und Lancelots Verschwinden. Irgendetwas, vermutlich das Schicksal, hat alles über den Haufen geworfen.
Ah, non, Monsieur Labourd, ich habe die Forumsleitung aus freien Stücken an Lancelot weitergegeben, aus freien Stücken! Meine ehrenamtlichen Engagements ließen die vielfältigen Management-Aufgaben, die das Forum mit sich brachte, nicht länger zu.
Alors, ich unterstütze aktiv diverse soziale Einrichtungen in Paris. Wissen Sie, Monsieur, wenn ich etwas auf die Beine stelle, so mache ich das nach Möglichkeit korrekt, und ich pflege mich zurückzuziehen, wann immer ich merke, dass ich aus Zeitgründen zur Nachlässigkeit tendiere oder nervös werde.
Ja, Sie haben richtig gehört: Mein Forumsname ist Narada, nach einem alten Hindu-Philosophen ... Zurück zu Lancelot (sieht, nach mir, ebenfalls auf die Uhr). Nun, ich traf mich mit ihm in Toulouse, im letzten Frühjahr ...
Nein, nicht bei ihm zuhause, sonst hätten wir jetzt ein Problem weniger, ihn ausfindig zu machen. Wir haben uns im Vestibül des Augustiner-Museums verabredet. Derselbe Ort, an dem wir uns am vergangenen Samstag mit ihm hatten treffen wollen, und er nicht kam. Er zeigte mir damals verschiedene Sehenswürdigkeiten; später tranken wir auf dem Place Wilson Yasmintee, saßen etwa eine Stunde zusammen, um Pläne für das Forum zu schmieden.
Ja, das ist richtig. Ich war Lancelots Vertraute, auch was diese Reise betraf, aber über sein Privatleben haben wir nie gesprochen – und nein, das stimmt nicht: Unsere Exkursion hat nichts oder nur am Rande mit den Katharern oder dem Heiligen Gral zu tun, obwohl vieles miteinander verflochten ist. Unsere Reise hatte, historisch gesehen, andere Schwerpunkte, es ging um die Pyrenäen und ihre ehemaligen Bewohner. Dass Lancelot auf die verrückte Idee kam, eine Art besonderen Spannungsbogen für unsere Freunde aufzubauen, damit wirklich alle auf ihre Kosten kämen, auch diejenigen, die noch immer dem Hype um den Heiligen Gral verfallen sind, könnte allerdings ein Fehler gewesen sein. Er hat da wohl etwas übertrieben ...
Nein, keine Schnitzeljagd, Monsieur, das wäre ja albern gewesen. Da hätte ich mein Veto eingelegt. Lancelot hat sich etwas Subtileres ausgedacht, um den Forschertrieb unserer Freunde anzustacheln: Er hat neue Themen eingeflochten. Wissen Sie, Monsieur Labourd, das sind ja alles gebildete Leute – nun, bis auf Lisa Söllner vielleicht, die eher kleinkariert ist, also zu ›Lieschen Müller‹ tendiert, wie man in Deutschland solche Frauen bezeichnet. In ihr habe ich mich getäuscht.
Weshalb ich das sage? Alors, Lisa behauptet seit Scotts Unfall allen Ernstes, Lancelot hätte sich oben auf dem Berg versteckt, um uns heimlich zu beobachten, was ... also, das ist einfach lächerlich! Weshalb sollte er so etwas getan haben, wenn er nicht ... nun, wenn er nicht über Nacht komplett irre geworden ist?
Ja, natürlich besitzt Lancelot auch einen bürgerlichen Namen. Aber damit scheint er ein größeres Problem zu haben.
(Seufzt wieder) Na gut, ich sehe schon, Sie lassen nicht locker. Notieren Sie also seinen Namen: Baptiste-Perceval Perrier. Baptiste wie der Heilige, Perceval wie Parzival, der Held, und Perrier – nun, wie das gleichnamige Tafelwasser ... Jetzt lachen Sie doch nicht, Monsieur, ICH habe mir das nicht ausgedacht!
Geheimnisumwobene Familienverhältnisse? ... Aber ja, natürlich frage auch ich mich, welche Mutter im 20. Jahrhundert ihr Kind Parzival nennt? Kein Wunder, dass er sich für den glänzenden Lancelot als Forumsnamen entschied. Was meinen Sie als Psychologe dazu? War diese Frau vielleicht die sprichwörtliche Herzeloyde?«
(Anmerkung René Labourd: Herzeloyde erzieht ihren Sohn Parzival in völliger Abgeschiedenheit und Unwissenheit, um ihn vor einem Leben als Ritter zu beschützen. Als er sie dennoch verlässt, kleidet sie ihn in Narrengewänder, damit er, vom Spott der anderen getrieben, bald wieder zu ihr nach Hause eilt.)
Walter Schilcher war von der Persönlichkeitsstruktur her auf den ersten Blick ein »Alphamännchen«. Er reagierte von allen Gralsforschern am ungehaltensten – aber somit am menschlichsten und ehrlichsten.
Er stellte das Glas mit Cognac, das er ins Verhörzimmer mitgebracht hatte, mit einem Knall auf den Tisch und machte sogleich den Versuch, die Leitung des Gesprächs an sich zu reißen.
»Madame Tisseire hat völlig recht«, schnarrte er, »unsere familiären Katastrophen haben mit diesem Unglück nichts zu tun. Aber nur darum, um dieses Unglück, geht es doch! Ich tippe auf Herzinfarkt. Scott war durchtrainiert, aber er hatte Übergewicht, vermutlich hohen Blutdruck. Und das Gewässer war eiskalt. Ich weiß das, denn ich habe, wie Sie wissen, den Versuch unternommen, ihn zu retten. Darüber, dass er leichtfertig gehandelt hat, besteht im übrigen Einigkeit. Kein Anlass also, uns hier wie Verbrecher festzuhalten und zu verhören.«
Das war natürlich maßlos übertrieben. Ich hatte aber schon am Abend zuvor gemerkt, dass sich der zweiundfünfzigjährige Auslandsjournalist kein X für ein U vormachen ließ. Schilcher war ein Mann, der seine Erfahrungen im Leben gemacht hatte.
Niederschrift der Tonaufzeichnung Walter Schilcher
»Mein Forumsname ist Freeman.
Ja, die Einladung zur Reise kam von Lancelot selbst und zwar per Mail.
Nein, ich kenne ihn nur aus dem Internet. Sein richtiger Name ist mir nicht bekannt. Er arbeitet meines Wissens als Akquisiteur bei einer großen Toulouser Spedition und fliegt in der ganzen Welt herum, aber ich weiß nicht, von wem ich das weiß.
Selbstverständlich kann er das Forum von überall leiten, Monsieur Labourd! Fast jedes Hotelzimmer verfügt heute über einen Internetzugang (schüttelt ungeduldig den Kopf).
Meine erste Reaktion, nachdem ich Lancelots Einladung erhielt? Sind Sie sicher, das Sie das wirklich wissen wollen?
Detailliert? Okay (grinst unverschämt): Ich stellte mein Abendessen, zwei Flaschen Holsten, aufs Fensterbrett und wärmte mir die Finger am Heizkörper, der aber nur zur Hälfte warm war und obendrein blubberte. Ich hatte vergessen, ihn zu entlüften, so wie ich ebenfalls vergaß, am Morgen die Wäsche aus der Waschmaschine zu nehmen. Liegt sie zu lange in der geschlossenen Maschine, pflegt sie zu stinken, nicht wahr?
Also gut, zur Sache: Ich lebe allein, in Scheidung, ich war einsam und ich nahm noch in der Nacht Lancelots Einladung an. Punkt.
Sicher. Das war eine Entscheidung aus dem Bauch heraus, Monsieur! Sagen wir so: Meinem üblichen rationalen Verhalten diametral entgegengesetzt. Wobei sich natürlich immer die Frage stellt, wie rational der Mensch überhaupt sein kann, nicht wahr?
Nein, über die Vernunft oder Unvernunft lasse ich mich jetzt nicht weiter aus. Ich bin so müde wie die anderen, Monsieur! Das Unglück steckt uns allen in den Knochen.
Also in Kürze: Mein Schwerpunkt im Forum liegt in meinen Kenntnissen von Südwestfrankreich und Nordspanien. Ich interessiere mich sowohl für die politischen als auch für die soziologischen Verhältnisse dieser Gegend. Obendrein bin ich ein wenig in der Historie des Mittelalters, 12. bis 14. Jahrhundert, bewandert. Mein Hobby.
Okay, Monsieur, bringen wir auch den nächsten Punkt hinter uns. Aber viel mehr als das, was wir Ihnen in der Gaststube bereits über Lancelot erzählt haben, weiß ich wirklich nicht. Schätze, er steht morgen vor der Tür und tischt uns eine haarsträubende Story auf. Das würde zu ihm passen.
Ja doch, das meine ich völlig ernst!
Aber weshalb hätte ich mich denn für seinen Real-Namen interessieren sollen? Kennen Sie sich mit Internet-Foren aus?
Nun, dann wissen Sie doch, dass man sich dort häufig mit Nicknamen anspricht. Das Private bleibt privat. Anonym. Kommt mir gelegen, mein Name Freeman hat mit dieser gesunden Einstellung zu tun. Natürlich ist es in unserem Fall etwas anders. Wir Gralsforscher – blöder Terminus! – sind eine kleine geschlossene Gruppe, entscheiden stets gemeinsam, ob und wann ein neues Mitglied aufgenommen wird. Da ist an sich die Gefahr des Missbrauchs von Daten weniger groß als im übrigen Netz. Dennoch – nun, Sie bekommen es ja doch heraus: Schilcher ist sozusagen mein ... Künstlername. Eine weitere Absicherung. Aber ich möchte Sie bitten, dies den anderen nicht zu sagen. Ich rede selbst mit ihnen.«
Als ich nach dem Abendessen vors Haus trat, zeigte sich, obwohl es leicht regnete, noch einmal die Sonne. Es roch intensiv nach Wald. Nach den Tannen unten am Parkplatz, die leise rauschten. Weil ich allein sein wollte, lief ich ein Stück um das Haus herum und zündete mir unter der Dachtraufe der Hausrückseite eine Zigarette an. Es ging mir so allerlei durch den Kopf. Nicht nur Walter Schilcher.
Dieser Fall war einfach und diffizil in einem. Kaum Lügen. Dafür vielsagendes Schweigen. Unterströmungen. Unerfüllte Wünsche. Ängste, diffuse Ängste ... Womöglich war es ein Fehler von Claret, den Aufmerksamkeitsfokus allzu sehr auf diesen Lancelot auszurichten ...
Im Zwielicht des Sonnenuntergangs leuchtete das feucht-üppige Grün auf, das an vielen Stellen aus der vor mir liegenden schroffen Felswand wucherte. Der Himmel war violett. Ein eindrucksvoller Anblick, der mich an den Ort La Malène erinnerte, an jenes einsam gelegene Hotel im Herzen der Tarnschlucht, wo ich vor zwölf Jahren vergeblich Philippe S. gesucht hatte, einen Kollegen. Ein Fehlschlag, der mir unter die Haut gegangen war. Philippe. Gutaussehend. Hochintelligent. Wissensdurstig. Fleißig. Zuverlässig … Tot. Lange hatte ich nicht mehr an ihn gedacht, ja, ich hatte schon fast vergessen gehabt, wie er aussah. Der junge Frédéric Maury hatte mich wieder an ihn erinnert ...
Es wurde dunkel und kalt. Kein Stern am Himmel. Das Rauschen der Tannen machte mich nervös. Ich ging hinein, um vor dem Zubettgehen noch ein Glas Wein zu trinken. Die Gralsforscher hatten sich bereits zurückgezogen. Monsieur Richard saß mit übergeschlagenen Beinen im Sessel und las die Midi-Libre, seine Frau wechselte die Kerzen aus und deckte den Frühstückstisch. Sie lächelte mich freundlich an. Eine Katze strich schnurrend um ihre Beine.
Ich nahm mein Glas und setzte mich an einen kleinen Fenstertisch. Dort öffnete ich mein Laptop, um die Verhöre zu überarbeiten. Ich versuchte, mich knapp zu fassen. Um halb Elf ging ich hinauf und las mir auf dem Zimmer alles noch einmal gründlich durch, damit ich nur ja nichts übersah. Dann brachte ich die Mail mit den Anhängen auf den Weg. Zuletzt schickte ich dem Kommissar noch eine SMS, um ihn über den richtigen Namen des Hamburgers zu informieren.
Ich hatte meinen Auftrag erledigt, schlief aber dennoch schlecht in dieser Nacht. Einmal weckte mich entferntes Felsgepolter, woraufhin ich eine geschlagene Stunde wachlag und an Nostradamus dachte, der seinerzeit ein Erdbeben für die »pyrenäischen Berge« vorausgesagt hatte.
SAMSTAG 26. MAI 2012
Am Samstag wusste ich bereits beim Aufstehen, dass es erneut kein guter Tag werden würde. So überraschte es mich nicht wirklich, dass der Nebel draußen noch dicker war als am Tag zuvor und es noch immer – oder schon wieder – regnete.
Ich rief sofort Claret an.
»Die Taucher sind eingetroffen«, sagte er, »aber ich gehe kein Risiko ein. Klart es bis Zehn nicht auf, blasen wir alles wieder ab. Dann komme ich rauf zu euch. Sieh zu, dass du die Leute bei Laune hältst. Erzähl ihnen, dass wir trotz Handy-Nummer und Mail-Adresse Lancelot bislang nicht ausfindig machen konnten. Ist wirklich seltsam. Irgendwo muss dieser Mann doch stecken.«
Um elf Uhr dreißig standen Claret und Bot tatsächlich auf der Matte. Sie hängten ihre durchnässten Windjacken vor den Kamin und setzten sich zu uns an den runden Tisch.
Walter Schilcher hob erstaunt die Brauen. »Ihr neuerlicher Besuch irritiert mich, Kommissar«, sagte er. »Gehen Sie denn inzwischen von einer Straftat aus?«
Ich hatte eigentlich erwartet, dass Claret zu Beginn die inkorrekte Identität des Hamburgers ansprechen würde, aber er lehnte sich nur zurück und verschränkte die Arme: »Niemand geht bislang von einer Straftat aus, Monsieur Schilcher«, sagte er. »Doch selbst wenn Ihr Freund unter Wasser gesundheitliche Probleme bekam, hat ein Tauchunfall in einem einsamen Bergsee eine andere Wertigkeit als beispielsweise ein Herzinfarkt während eines Autounfalls. Eines stimmt uns besonders nachdenklich: Scott war doch Profi. Was hat er in diesem See gesucht?«
Ich beobachtete, wie Frédéric Maury geschickt das halbe Gesicht hinter seinen Haarsträhnen verbarg; die anderen starrten betreten auf den Tisch.
Claret ließ sie eine Weile schmoren. Irgendwann meinte er, ihr kollektives Schweigen missfalle ihm.
»Wie uns dieses Verhör«, antwortete die Pariserin frech.
»Das noch immer keines ist, Madame«, gab ihr Claret zurück, »aber auch kein Small-Talk.«
Alain Bot – sein linkes Augenlid zuckte – hatte gerade etwas sagen wollen, als es klopfte. Madame Richard steckte den Kopf zur Tür herein.
Schilcher bestellte einen doppelten Hennessy, Claret und Bot Kaffee, die anderen winkten ab.
»Es gibt also von Ihrer Seite aus nichts weiter zu diesem ominösen Tauchgang zu sagen?«, fuhr Claret fort, als wir wieder unter uns waren. »Dann lassen Sie uns jetzt ernsthaft über ihren Freund Lancelot reden, den Boss.«
Ich beobachtete, wie Lisa Söllner zurückwich. »Ist er ... tot?«, stieß sie hervor. (Sie dachte nie nach, bevor sie redete, sie posaunte frei heraus.)
Maurice Claret forderte seinen Schwager zum Reden auf.
»Wir sehen uns außerstande, darauf zu antworten, Madame«, sagte Bot freundlich, aber bestimmt. »Unsere Leute versuchen noch immer, ihn ausfindig zu machen. Heute geht es uns jedoch vordergründig um eine ... vertrackte Angelegenheit: Unter den Kleidungsstücken, die sich im Zelt des Tauchers befanden, lag eines, das größenmäßig nicht zu den anderen passte. Es handelt sich um eine schlammfarbene Designer-Jeans in der Größe S. Die Hose besaß kein Etikett mehr, war also bereits getragen. Kann uns jemand von Ihnen erklären, weshalb Scott eine Hose mit auf den Berg nahm, die ihm definitiv zu kurz und zu eng war?«
»Könnte es sich um Lancelots Jeans handeln?«, ergänzte der Kommissar.
»Größe S käme wohl hin ...«, meinte Madame Tisseire zögerlich (sie kannte den Boss als einzige vom Sehen), während die anderen erneut nichts zu sagen wussten.
»Merci beaucoup, Madame«, Claret machte sich eine Notiz. »Dann zum Portable des Engländers, zu seinem Handy«, fuhr er fort. »Um die Zeit Ihres Aufstiegs, möglicherweise kurz bevor Sie ins Funkloch gerieten, hat Nigel Scott eine SMS erhalten. Der Text lautete folgendermaßen: Bin bei Sonnenaufgang am See, Gruß Lancelot.«
Nun sahen sich die vier erst recht verdutzt an. Und wieder war es Anne-Sophie Tisseire, die als erste sprach.
»Lancelot hat sich mit ihm am See verabredet?«
Der Kommissar nickte. »Jawohl, Madame, mit ihm, mit Nigel Scott.«
Als Schilcher nach vorausgegangenen Mails fragte, erklärte ihm Sous-Brigadier Bot, dass alle älteren Nachrichten gelöscht gewesen seien.
»Aber das ist doch …«, Schilcher nahm eine Pose wie Der Denker von Rodin ein, und bat um eine Unterbrechung.
Ich lehnte mich abwartend zurück. Bot ebenfalls. Claret schrieb …
»Und … und wenn Lancelot längst oben war?«, durchbrach Lisa Söllner die Stille.
»Oben? Ja, wo denn, um Himmels Willen?«, fuhr Anne-Sophie Tisseire sie an. »Was soll das, Lisa! Glaubst du ernsthaft, Lancelot hat dich mit einem Nachtsichtgerät beobachtet und sich heimlich über dich amüsiert?«
Die Deutsche verzog beleidigt das Gesicht.
Schilcher wandte sich an Frédéric Maury: »Könnte es deine Hose gewesen sein, die in Nigels Zelt lag?«
»Darauf gibt’s nur eine Antwort, Walter: Ich kann mir Designer-Klamotten nicht leisten.«
Schilcher erhob sich. »Verstehe. Ich muss mal an die frische Luft. Entschuldigen Sie mich bitte.« Mit diesen Worten stürmte er aus dem Gastraum.
Mit gequältem Blick wandte sich Frédéric Maury an den Kommissar, um ihm zu erklären, dass er zu keinem Zeitpunkt in Nigels Zelt gewesen sei. »Ich empfinde es als demütigend«, fuhr er fort, »wie uns hier suggeriert wird, wir könnten etwas mit dem Tod unseres Freundes zu tun haben. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass Nigel Scott noch leben würde, wenn wir in Toulouse, als Lancelot nicht erschien, die Reise abgebrochen hätten. Hier liegt unsere Schuld, nur hier.«
»D’accord, Monsieur Maury, doch wessen Schuld ist es dann? Fünf Leute gehen auf Forschungsreise und am Ende ...«
»Ganz einfach. Es war ein Unglück«, unterbrach ihn Maury, ungewohnt forsch.
Der Junge kam mir heute männlicher vor, gereifter.
»Darf ich auch mal was sagen?« Anne-Sophie Tisseire, offenbar im nervösen Bemühen, irgendwie hilfreich zu sein, beugte sich über den Tisch. Sie hatte Tränen in den Augen. »Ich habe ebenfalls nachgedacht. Wenn Lancelot heimlich mit Nigel Scott Kontakt aufnahm, dann steht doch wohl fest, dass die beiden einen gemeinsamen Tauchgang planten.«
»Aber das würde bedeuten, dass Nigel absichtlich mit uns Streit suchte, am letzten Abend«, empörte sich Lisa Söllner. »So hinterhältig war er nun auch wieder nicht.«
»Streit? Es gab also doch Streit unter Ihnen?« Claret richtete sich abrupt auf und warf mir einen fragenden Blick zu. Dann sah er erwartungsvoll in die Runde. »Darüber wüsste ich gerne mehr. Erzählen Sie!«
»Ah, im Grunde nichts Ernstes, Kommissar«, spielte die Pariserin die Sache herunter. »Als ich vorschlug, vorzeitig aufzubrechen, stellte sich Scott stur. Keiner kapierte, warum. Jetzt kennen wir den Auslöser für seinen Starrsinn. Er hatte eine Verabredung mit Lancelot, und zwar am See. Die beiden wollten ungestört sein, Gott, weiß aus welchem Grund.«
Sofort legte Frédéric Maury Protest ein. »Diese Rechnung geht nicht auf«, zischte er. »Hätte ich nicht verschlafen, wäre ich bei Sonnenaufgang ebenfalls am See gewesen. Niemand hätte mich daran hindern können.«
»Nun, es stimmt jedenfalls, dass Lancelots schriftliche Instruktion – seine To-do-Liste – eine zweite Tauchausrüstung vorsah, die er in Toulouse besorgen wollte«, sagte Anne-Sophie Tisseire vorsichtig.
»Blödsinn. Was phantasiert ihr euch da bloß zusammen?« Walter Schilcher kam wieder herein. Er knallte die Tür hinter sich zu und setzte sich. Sein Haar war vom Wind zerzaust, sein Gesicht rot. »Das ergibt doch keinen Sinn. Es war der Tag unserer geplanten Abreise. Lancelot war an diesem Morgen nicht am See. Punkt.«
»Und wenn beide ertrunken sind?«, flüsterte Lisa Söllner.
Totenstille am Tisch. Nur der Filzstift, mit dem der Kommissar schrieb, quietschte leise.
Ich sah durchs Fenster. Der Wind peitschte den Regen gegen den Blechverschlag des Hundezwingers. Es fröstelte mich und ich wünschte mir einmal mehr, die Sache zum Abschluss bringen zu können.
Endlich legte Claret den Stift weg und blickte hoch. Er sah angespannt aus, seine Stirn war gefurcht. »Ich stelle Ihnen jetzt eine wichtige Frage: Hat Ihr Freund Lancelot ... nun, hat er vielleicht ein Identitätsproblem?«
»Wie bitte? Das verstehe ich nicht«, rief Lisa Söllner. Sie bekam hektische Flecken auf den Wangen. »Meinen Sie, er glaubt, tatsächlich dieser Ritter Lancelot zu sein? Lancelot ... vom See? Das ist doch total abwegig! Krass!«
Claret wies auf mich. »Mein Mitarbeiter weiß über solche Dinge besser Bescheid«, sagte er. »Bitte, Monsieur Labourd!«
Ich war verblüfft, vor allem, dass sich Claret für diesen Fall soviel Zeit nahm. Er hatte doch Urlaub. Weshalb überließ er die Untersuchung nicht seinem Schwager?
»Ein Identitätsproblem? Nun, es gibt viele Menschen, die sich manchmal fremd vorkommen. Dies ist jedoch mehr oder weniger harmlos, oft sogar nur eine Folge von zu viel Stress. Problematisch wird es allerdings«, fuhr ich fort, »wenn Menschen, von ihrer Umgebung unbemerkt, zu bestimmten Zeiten in einen anderen Körper schlüpfen. Das deutet dann auf eine kompliziertere Persönlichkeitsstörung hin. Um jedoch über Lancelots Psyche ein Urteil abgeben zu können«, sagte ich, »müsste ich entschieden mehr über ihn wissen. Fest steht, dass mit den virtuellen Welten des Internets, vor allem bei labilen Charakteren, die Gefahr für derartige Entgleisungen zunimmt. Vielleicht hat sich Ihr Freund noch weitere Pseudonyme zugelegt und sich mit der Zeit mit ihnen identifiziert. Aber das ist nur eine Spekulation.«
Claret dankte mir, machte aber noch immer keine Anstalten zu gehen, sondern wandte sich an Anne-Sophie Tisseire: »Sie haben erzählt, Madame, Sie hätten unterwegs mehrmals versucht, ihren Forumsleiter telefonisch zu erreichen?«
Die Pariserin nickte. »Zuletzt habe ich am Mittwoch vor einer Woche mit ihm gesprochen, am späten Nachmittag. Drei Tage vor dem ausgemachten Treffen in Toulouse. Da freute er sich auf uns, und er war nicht etwa auffällig. Danach muss sich ... etwas Gravierendes ereignet haben. Entweder hat er sein Handy und sämtliche Papiere verloren, darunter auch unsere Telefonnummern – oder aber er ist verunglückt, wurde gekidnappt. Ach, ich weiß nicht, was ich denken soll!«
»Aber das stimmt doch nicht länger, Anne-Sophie«, widersprach ihr Schilcher. »Wir wissen jetzt, dass er vier, nein, fünf Tage später Scott kontaktiert hat. Warum uns Nigel das verschwieg, begreife ich noch immer nicht. Er wusste doch, wie sehr wir auf Lancelots Anruf warteten.«
»Das kann ich Ihnen erklären, Monsieur Schilcher«, sagte Claret. »Ihr Freund Scott hat die Nachricht gar nicht gelesen. Sein Handy befand sich hier in der Pension.«
»In seinem Handgepäck – und es war auf Vibration gestellt«, ergänzte Alain Bot. »Wir haben es überprüft. Vermutlich hat er angenommen, es auf dem Berg sowieso nicht benutzen zu können.«
»Das wird ja immer bizarrer«, meinte Schilcher. Seine Hände zitterten, als er sich eine Pfeife stopfte. »Das schwere Tauchgerät schleppt er nach oben, das Handy lässt er zurück.«
Auch Frédéric Maury schüttelte den Kopf. Er schien ehrlich fassungslos zu sein.
Die Damen sahen sich verwirrt an.
»Tiens, die Nachricht Ihres Forumsleiters blieb ungelesen«, sagte Claret nachdenklich. Er hob die Schultern. »Wie Sie sehen, passen keine zwei Teile in diesem Puzzle ordentlich zusammen. Bitte denken Sie noch einmal gründlich über alles nach. Sprechen Sie mit Monsieur Labourd. Das lege ich Ihnen ans Herz. Wir haben für alles Verständnis.«
Claret stand auf und zog seine Jacke wieder an.
»Vielleicht wissen wir ja nach der Bergung mehr«, meinte Bot, der sich ebenfalls erhob.
»Dann beten Sie um schönes Wetter, Sou-Brigadier«, sagte ich leise.
»Keine Angst, Monsieur Labourd, der Wind dreht auf West!«
Weil ich Claret kurz unter vier Augen sprechen wollte, begleitete ich die beiden hinaus. Erneut stürmte es. Bot grüßte und eilte sofort zum Parkplatz hinunter, jeweils zwei Stufen auf einmal nehmend. Claret und ich blieben auf dem obersten Treppenabsatz stehen.
»Der Wind dreht auf West?«, sagte ich spitz und deutete auf die Wetterfahne des Patrons, die in den Farben Kataloniens den Hundezwinger zierte – und nach Süden zeigte.
Claret stellte den Kragen seiner Windjacke auf. Er grinste. »Westwind ist immer gut, René! Er bläst den Hühnern die Federn auf, sagen die Leute hier. Ernsthaft: Das Wetter gefällt mir so wenig wie der vorliegende Fall. Bleib dran. Irgendetwas ist hier faul. Warum erzählt uns keiner, was Scott im See suchte?«
Ich nahm die Brille ab, und betrachtete die Spritzer, die der Regen auf den Gläsern hinterlassen hatte. »Nun, vielleicht ist es ihnen nur peinlich, über ihre kindischen Grals-Phantasien zu sprechen.«
Claret wiegte den Kopf. »Mein Schwager meint, wir könnten es mit illegalen Schatzgräbern zu tun haben. Hat er dir erzählt, dass Scott einen Magnetometer bei sich hatte, als er in den See stieg? Die Schutzhülle befand sich im blauen Sack.«
»Mon Dieu, das wusste ich nicht!« Ich setzte die Brille wieder auf. »Einen Magnetometer? Da werde ich noch einmal nachhaken müssen. Langsam vertrauen sie mir. Dennoch läuft es für mich auf einen Unfall hinaus. Oder rechnest du ernsthaft mit einer ... Überraschung?«
Claret hob die buschigen Brauen. »Mit einer Überraschung? Im allerschlimmsten Fall rechne ich mit zwei Toten.«
»Verdammt«, hörte ich Schilcher fluchen, als ich zur Gaststube zurückkehrte, »dieser Kommissar hat vielleicht Nerven!«
Ich stellte mich vor die nur angelehnte Tür und lauschte.
»Ich muss in drei Tagen in Hamburg sein, einen Artikel abliefern, sonst bin ich meinen Job los ... Was siehst du mich wieder so vorwurfsvoll an, Lisa? Das ist doch kein Treuebruch gegenüber Nigel oder euch anderen.«
»Reg dich nicht so auf, ich hab doch gar nichts gesagt!«, entrüstete sich die junge Frau, »aber was für dich gilt, gilt für uns alle. Anne-Sophie muss dringend nach Paris, und ich nach Detmold. Meine Mädchen haben gestern Abend wieder geweint, als ich mit ihnen telefonierte.«
»Kommt, Leute, beruhigt euch«, versuchte die Pariserin einzulenken, mit einem kurzen Seitenblick auf mich, als ich eintrat. »Wer das Spiel aufgibt, hat verloren.«





























