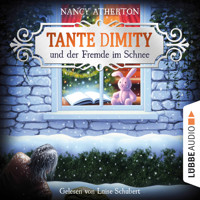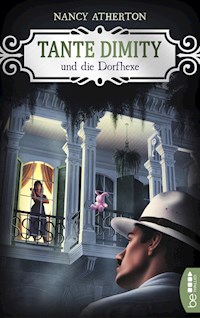5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Wohlfühlkrimi mit Lori Shepherd
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit im Radcliffe-Krankenhaus begegnet Lori der Patientin Elizabeth Beacham und freundet sich schnell mit der sympathischen alten Dame an. Als diese unerwartet stirbt, erhält Lori einen Umschlag mit einem Schlüsselbund und einem geheimnisvollen Brief, den Miss Beacham noch kurz vor ihrem plötzlichen Tod geschrieben hat. Lori macht sich auf die Suche nach den Angehörigen und nimmt sich vor - mit Hilfe von Tante Dimitys übernatürlichen Fähigkeiten - dem Geheimnis ihrer verstorbenen Freundin auf den Grund zu gehen ...
Ein wundervoller Wohlfühlkrimi mit Tante Dimity. Jetzt als eBook bei beTHRILLED.
Versüßen Sie sich die Lektüre mit Tante Dimitys Geheimrezepten! In diesem Band: Miss Beachams Rosinenbrot.
"Nancy Atherton gelingt es, eine Welt zu erschaffen, in der wir alle gerne leben würden." Publishers Weekly
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 356
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Epilog
Miss Beachams Rosinenbrot
Über dieses Buch
Bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit im Radcliffe-Krankenhaus begegnet Lori der Patientin Elizabeth Beacham und freundet sich schnell mit der sympathischen alten Dame an. Als diese unerwartet stirbt, erhält Lori einen Umschlag mit einem Schlüsselbund und einem geheimnisvollen Brief, den Miss Beacham noch kurz vor ihrem plötzlichen Tod geschrieben hat. Lori macht sich auf die Suche nach den Angehörigen und nimmt sich vor – mit Hilfe von Tante Dimitys übernatürlichen Fähigkeiten – dem Geheimnis ihrer verstorbenen Freundin auf den Grund zu gehen …
Über die Autorin
Nancy Atherton ist die Autorin der beliebten »Tante Dimity« Reihe, die inzwischen über 20 Bände umfasst. Geboren und aufgewachsen in Chicago, reiste sie nach der Schule lange durch Europa, wo sie ihre Liebe zu England entdeckte. Nach langjährigem Nomadendasein lebt Nancy Atherton heute mit ihrer Familie in Colorado Springs.
NANCY ATHERTON
Aus dem Amerikanischen von Peter Pfaffinger
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Dieses Werk wurde im Auftrag der Jane Rotrosen Agency LLC vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Garbsen.
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Kathrin Kummer
Covergestaltung: Jeannine Schmelzer unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Alvaro Cabrera Jimenez | Montreeboy
Illustration: © Jerry LoFaro
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-3501-9
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Aunt Dimity and the Next of Kin« bei Penguin Books, New York.
Copyright © der Originalausgabe 2005 by Nancy T. Atherton
Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 2007
by RM Buch und Medien Vertrieb GmbH
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Miss Mousehole und Mister Scooter-Pie,meine kleinen Lieblinge
Kapitel 1
SCHON VOR JAHREN habe ich damit aufgehört, Zeitungen zu lesen, und ich erspare mir auch die Nachrichten im Fernsehen. In Bezug auf das große Ganze mag das verantwortungslos erscheinen, aber auch damit ist Schluss: mit dem großen Ganzen.
Ich habe das einfach nicht mehr ausgehalten. Endlose Geschichten über herzzerreißende Katastrophen, die sich rund um den Erdball ereigneten, bestärkten mich nicht gerade in meiner Entschlossenheit, die Welt lebenswerter zu machen. Das gnadenlose Sperrfeuer aus Hiobsbotschaften zermürbte mich, erfüllte mich mit Verzweiflung, mit dieser lähmenden Hoffnungslosigkeit, die alle Protestschreie des Herzens ersterben lässt. In meiner großen Schwermut kam ich mir klein, schwach und nutzlos vor, unfähig, jemals einem Menschen zu helfen.
Es war töricht, mich so zu fühlen. Ich war weder klein noch schwach, und nutzlos war ich nur dann, wenn ich mich dafür entschied, es zu werden. Ich war Mitte dreißig, hatte einen Mann, der mich liebte, wunderbare Zwillingssöhne, strotzte vor Gesundheit, und finanzielle Sorgen kannte ich nicht. Von der besten Freundin meiner Mutter hatte ich ein Vermögen geerbt, und mein Mann, Bill, stammte aus einem gut betuchten Clan aus Boston-Brahmin, sodass ich durchaus die Mittel hatte, ansehnliche Beträge für gute Zwecke zu spenden, was ich auch tat. Ich unterstützte Alphabetisierungskampagnen, Unterkünfte für in Not geratene Familien, Projekte der Welthungerhilfe und, nicht zu vergessen, ein Schutzgebiet für Orang-Utans sowie natürlich »Aunt Dimity’s Attic«, die Kette von Wohltätigkeitsläden.
Doch lediglich Gelder in eine Pipeline zu schleusen, die in die Ferne führte, erschien mir zu einfach, zu anonym. Ich wollte mehr tun. Ich wollte meine Zeit und Energie für etwas verwenden, das mir wirklich am Herzen lag. Und was mir am meisten bedeutete, das waren Menschen.
Statt mir die Haare zu raufen, weil es einfach nicht möglich war, die Übel der Welt zu beseitigen, richtete ich den Blick auf die Beseitigung von Übeln, die meiner Heimat viel näher lagen. Und meine Heimat war ein honigfarbenes Cottage im Dörfchen Finch in den westlichen Midlands von England. Auch wenn mein Mann, meine Söhne und ich Amerikaner waren, lebten wir inzwischen so lange in England, dass wir das Gefühl hatten, hierher zu gehören. Will und Rob, die gerade fünf geworden waren, kannten kein anderes Zuhause als das Cottage. Bill führte die europäische Zweigstelle der altehrwürdigen Anwaltskanzlei seiner Familie von einem Büro mit Blick auf den Dorfplatz aus. Und was mich betraf, war ich immer zur Stelle, sobald in Finch eine helfende Hand gebraucht wurde.
Die ehrbaren Bürger von Finch wussten nicht so recht, was sie von einer Ausländerin halten sollten, die bei jeder Gelegenheit so bereitwillig für das Gemeinwohl einsprang. Andererseits wussten sie frisches Blut in ihren Reihen sehr wohl zu schätzen und gestatteten mir in echter Tom-Sawyer-Manier großmütig, ihre Zäune zu streichen. Ich half Wohltätigkeitsbazare der Kirchengemeinde zu organisieren, sammelte nicht mehr benötigte Holzmöbel für die Freudenfeuer am Guy-Fawkes-Tag, strich Verkaufsstände für die Herbstjahrmärkte und baute jedes Jahr zu Weihnachten die Dekoration für die Krippenspiele auf. Gelegentlich wurde mir der Vorsitz bei einer Veranstaltung im Dorf angeboten, aber als ich mitbekam, was für verheerende Territorialkriege zwischen den mildtätigen Damen ausbrachen, die die angesehensten Projekte leiteten, beschloss ich wohlweislich, auf Nummer sicher zu gehen und mich bescheiden im Hintergrund zu halten.
Auch wenn meine Fähigkeiten als Gärtnerin äußerst begrenzt waren, stand mein Name im Dienstplan der Pfarrkirche St. George’s für die Pflege der Blumenarrangements, und jeden zweiten Samstag polierte ich die Kirchenbänke. Einmal im Monat widmete ich einen Vormittag dem Kriegerdenkmal, von dem der Vogeldreck geschrubbt werden musste, und einen Nachmittag dem Kehren des Kirchhofs. Es versteht sich von selbst, dass ich Stammkundin der örtlichen Läden und Firmen war.
Wenn ein Dorfbewohner krank wurde, schaute ich bei ihm vorbei, um das Geschirr zu spülen und eine Mahlzeit mitzubringen. Ich machte es mir zur Gewohnheit, meinen älteren Nachbarn Besuche abzustatten, um mich zu vergewissern, dass sie genug Lebensmittel im Haus hatten, eine Kanne Tee mit ihnen zu trinken und ein gemütliches Plauderstündchen zu genießen.
Meine Söhne begleiteten mich bei meinen spontanen Runden und bewiesen eine verblüffende Fähigkeit, sich auf die verschiedensten Situationen einzustellen. Wenn ein alter gichtkranker Bauer ein bisschen Trubel in seinem Haus sehen wollte, tollten Will und Rob mit dem größten Entzücken herum. Zog ein Nachbar dagegen Stille und Frieden vor, setzten sich die Jungs mit ihrem Kasten Wachsmalstifte auf den Boden und verewigten ihre Umgebung für die Nachwelt. Bald standen ihnen sämtliche Keksdosen offen, und ihre Ankunft rief überall ein Grinsen statt einer Grimasse hervor.
Ich will keinen falschen Eindruck erwecken. Nicht immer war ich die strahlende Fee, die mit ihren Gaben Pirouetten drehend durchs Dorf wirbelte und gute Laune verbreitete. Auch ich hatte mitunter schlechte Laune, meine faulen Tage und Tage, an denen mir nichts anderes einfiel, als Schuhe zu kaufen. Aber in der Zeit dazwischen gab ich mir redlich Mühe, mein Bestes zu tun. Und selbst wenn mir das nicht gelang – was wegen meiner spitzen Zunge, einem Hang zur Sturheit und meinem irgendwie schnell erregbaren Temperament mit erschreckender Regelmäßigkeit der Fall war –, schlief ich in den Nächten trotzdem besser, wusste ich doch, dass ich es zumindest versucht hatte.
Aufgrund einer Kette überaus merkwürdiger Umstände war ich Schirmherrin des Oxforder Obdachlosenasyls der St. Benedict’s Church geworden, das ich seit ein paar Jahren zweimal wöchentlich besuchte. Als Vorsitzender des Förderkreises war es mir gestattet, Töpfe zu scheuern, Betten zu machen und großzügige Schecks auszustellen. Ich hoffte, mich so weit nach oben zu arbeiten, dass ich eines Tages auch die Badezimmer putzen durfte.
Will und Rob begleiteten mich auch bei diesen Fahrten und erwarben sich unter den Obachlosen, die das Asyl ihr Zuhause nannten, eine ergebene Anhängerschar. Obwohl mich bei einigen ihrer schillerndsten Bewunderer gewisse Bedenken beschlichen, hatte ich im Laufe der Jahre gelernt, nicht allzu deutlich zu erbleichen, wenn meine kleinen Jungs auf offener Straße mit strahlenden Augen stehen blieben, ihren Lieblingsbettler namentlich ansprachen und mit ihren Piepsstimmen klar vernehmbar fragten: »Gute Geschäfte gemacht, Mr Big Al, oder haben die Kunden geknausert?«
Es gab natürlich auch Zeiten, in denen ein Ausbruch bester Gesundheit im Dorf und eine Flaute in den Gemeindeaktivitäten dafür sorgten, dass ich bis auf meine Pflichten im St.-Benedict’s-Asyl nicht viel zu tun hatte. Und es war in einer dieser unproduktiven Phasen, als ich in ein Projekt stolperte, das mich zu einer völlig unerwarteten Entdeckungsreise führen sollte.
Angeregt wurde dieses Projekt von Lucinda Willoughby. Ich hatte die rothaarige Frau mit dem runden Gesicht beim Besuch einer kranken Freundin in dem renommierten Oxforder Krankenhaus Radcliffe Infirmary kennengelernt. Damals war sie noch Schwesternschülerin gewesen, aber inzwischen hatte sie die Ausbildung mit sämtlichen Qualifikationen abgeschlossen, und wann immer wir uns zum Mittagessen in der Krankenhauscafeteria trafen, fühlte sie sich mehr als qualifiziert, sich über die Welt im Allgemeinen zu äußern.
»Das ist doch wirklich eine Schande«, erklärte sie bei einem dieser Anlässe. »Stell dir vor, Lori, der alte Mr Pringle liegt hier nun schon seit drei Tagen, und nicht eines seiner Kinder hat es für nötig befunden, ihn zu besuchen. Ich tue, was ich kann, um ihn aufzumuntern, aber ich habe sowieso schon alle Hände voll zu tun. Es ist schwer genug, krank und alt und obendrein Witwer zu sein, aber derart von den eigenen Kindern im Stich gelassen zu werden …« Sie schnalzte angewidert mit der Zunge. »Eine Schande!«
Mit ihrer Empörung rannte sie bei mir offene Türen ein. Ich musste an einen Freund denken, der fast drei Wochen lang auf der Intensivstation gelegen hatte, ohne auch nur ein Wort von seiner Familie zu hören. Und spontan beschloss ich, etwas für Menschen zu tun, die in vergleichbaren Situationen alleingelassen wurden.
Nachdem ich den Segen der Krankenhausverwaltung erhalten hatte, wurde ich die erste ehrenamtliche Besucherin des Radcliff Hospital. Schwester Willoughby behielt all die Patienten im Auge, die aus welchem Grund auch immer von ihren lieben Angehörigen vernachlässigt wurden, und ließ es mich wissen, sobald meine Dienste benötigt wurden. Zu meiner Freude kann ich sagen, dass das nicht oft der Fall war, aber wenn ich gebraucht wurde, war ich zur Stelle.
Aus Rücksicht auf die Gefühle der Patienten – niemand wird gern daran erinnert, dass sich keiner um ihn kümmert – platzte ich nicht mit irgendeinem Wohlfahrtsabzeichen am Ärmel bei ihnen herein, sondern tarnte meine Mission diskret. Von einem befreundeten Buchhändler lieh ich mir einen Handwagen voller Bücher und karrte ihn zu Beginn der Besuchszeit in die mir genannten Zimmer. Oft genug hörte dann bald der Fernseher auf zu plärren und ein Gespräch begann: zunächst über Bücher und schließlich über Gott und die Welt.
Ein Mann erzählte von seinen Kriegserfahrungen mit Rationierungsmarken und Luftschutzkellern, alles sicher ausgeleierte Geschichten, mit denen er seine Kinder wahrscheinlich zu Tode gelangweilt hatte, aber ich lauschte gebannt. Eine von Chemotherapie und Lungenentzündung geschwächte Lehrerin bat mich einfach, ihr etwas vorzulesen, was ich sieben Tage lang tat, bis sie kräftig genug war, um in ein Pflegeheim umzuziehen, in dem dann schließlich ihre Tochter und ihr Schwiegersohn ihre Aufwartung zu machen geruhten.
Größtenteils war ich eine passive Besucherin, die sich zurücklehnte und ihre Schützlinge reden ließ. Meistens waren sie froh darüber, mir ihre Geschichten erzählen und sich über das Essen beklagen zu können, und wünschten mir alles Gute, wenn sie entlassen wurden. Erst Mitte März, eine Woche nach dem fünften Geburtstag der Zwillinge und drei Wochen vor der ersten Sitzung des Fincher Sommerfestkomitees, lernte ich eine Patientin kennen, die meine Fantasie beflügelte, indem sie so gut wie nichts sagte.
Elizabeth Beacham war unverheiratet und bekam wegen einer seltenen Form von Leberkrebs eine Chemotherapie. Eine Woche nach ihrer Einlieferung rief Lucinda Willoughby bei mir an und machte mich auf ihr Los aufmerksam.
»Sie ist todkrank, aber das scheint niemanden zu kümmern«, informierte mich die junge Schwester. »Ich weiß, dass sie einen Bruder hat – sie hat ihn als ihren nächsten Angehörigen angegeben –, aber er hat sich nie die Mühe gemacht, sie hier zu besuchen. Niemand hat ihr was gebracht, weder eine Topfpflanze noch einen Blumenstrauß, nicht einmal einen Anruf hat sie gekriegt. Ich wünschte, sie läge wenigstens nicht in einem Einzelzimmer für Privatpatienten. Auf der allgemeinen Station wäre sie mit anderen zusammen, aber so hat sie nichts als den Fernseher und keinerlei Ansprache, außer den Leuten vom Personal, und die haben keine Zeit, um mit ihr zu reden. Es ist einfach schrecklich.«
Ich gab ihr recht, und gleich am nächsten Morgen schob ich um neun Uhr meinen Bücherwagen in Miss Beachams Privatzimmer.
Das Erste, was mir an Miss Beacham auffiel, war ihre Gebrechlichkeit. Ihr Gesicht war eingefallen wie das eines ausgehungerten Kriegsgefangenen, die Haut ihrer Hände glich blau geädertem Pergament, und von ihrem grauen Haar waren nur noch ein paar vereinzelte Strähnen übrig, die sie unter einem rot karierten Kopftuch zu verbergen suchte, das sie vom Krankenhaus bekommen hatte. Wie sie so an allen möglichen Infusionsschläuchen hängend in dem riesigen Bett lag, über sich eine Reihe von Überwachungsmonitoren, wirkte sie wie ein kleines Kind, doch der prüfende Blick, mit dem sie mich bei meinem Eintreten musterte, war alles andere als kindlich. Sie durchleuchtete mich förmlich, mit Augen so klar und voller Leben, dass ihre Zerbrechlichkeit in den Hintergrund zu rücken schien.
»Guten Morgen«, sagte ich. »Ich heiße Lori Shepherd.«
»Die Frau, die allen zuhört und Bücher bringt.« Miss Beachams Stimme war schwach, ihr Atem ging rasselnd. Außerdem sprach sie mit häufigen Pausen, als reichte ihre Kraft nicht für ganze Sätze. »Ich habe schon von Ihnen gehört, Ms Shepherd. Und ich fragte mich bereits, ob Sie auch mal bei mir vorbeischauen.«
»Bitte nennen Sie mich Lori.« Ich rollte den Wagen näher an ihr Bett heran. Es brachte mich etwas aus dem Konzept, zu hören, dass mein Ruf mir vorausgeeilt war. »Wie haben Sie denn von mir erfahren?«
»Mr Walker hat Sie erwähnt.«
»Ach, der pensionierte Steinmetz«, erwiderte ich. Den alten Mann mit seinen mächtigen, vernarbten Händen hatte ich nicht vergessen.
Miss Beacham nickte. »Richtig. Mr Walker und ich waren nebeneinander abgestellt – jeder in seinem Rollstuhl, verstehen Sie –, und gemeinsam warteten wir auf unseren Test. Da hat er mir erzählt, dass ihm Ihre Besuche lieber sind als die morgendlichen Talkshows im Fernsehen. Ein hohes Lob.«
»Wirklich?« Ich warf einen Blick auf den leeren Bildschirm des gegenüber Miss Beacham an der Wand angebrachten Apparats. »Mir drängt sich der Eindruck auf, dass Sie sich keine Talkshows ansehen.«
»Lieber würde ich mir sämtliche Zähne aufbohren lassen«, entgegnete sie gelassen.
»Das Fernsehen hat es mir auch nicht gerade angetan«, erwiderte ich mit einem anerkennenden Lachen. »Ein gutes Buch ist mir allemal lieber als eine Talkshow.«
Sie ließ den Blick über die Buchrücken wandern. »Sie mögen Krimis, wie ich sehe.«
»Menschen, die im Krankenhaus liegen, scheinen sie gern zu lesen. Das ist der Grund, warum ich so viele mitbringe.« Ich wählte ein Buch mit einem besonders schauerlichen Cover aus und hielt es Miss Beacham vor die Augen. »Einer von Mr Walkers Lieblingskrimis«, erklärte ich. »Es kann ihm gar nicht blutrünstig genug zugehen. Die Opfer in einem Krimi sollen am liebsten geköpft, erdrosselt oder mit einer Axt massakriert werden – das ist seine Vorstellung von leichter Unterhaltung. Je abscheulicher der Mord, desto besser, wenn es nach Mr Walker geht.«
»Aber Sie persönlich sprechen Krimis nicht so an?«, bemerkte Miss Beacham.
»Ach, ich hab nichts dagegen, hin und wieder in einem zu schmökern«, gab ich zu, »aber normalerweise ziehe ich eine gesunde Kost aus Geschichte, Memoiren und Biografien vor.«
»Auch solche Bücher sind bisweilen gehörig mit Blut getränkt«, gab Miss Beacham zu bedenken. »Mary, die Königin Schottlands, hat beispielsweise ein besonders grässliches Ende gefunden.«
»Stimmt.« Ich deutete nochmals auf Mr Walkers Lieblingsbuch im Wägelchen. »Aber Mary wurde nicht in einem Hinterhof von einer psychotischen Bestie in Stücke zerhackt. Man gab ihr immerhin die Gelegenheit, ihre Perücke zurechtzurücken, ihre Gebete zu sprechen und feierlich ihren letzten Gang anzutreten, bevor man ihr den Kopf abschlug. Und der Scharfrichter hatte gute Manieren.«
Miss Beachams Augen leuchteten auf. »Mit anderen Worten: Sie haben nichts gegen Mord, solange er von Prunk und Pomp begleitet wird.«
»Stil ist so ungemein wichtig, finden Sie nicht auch?«, erwiderte ich leichthin.
Lächelnd forderte mich Miss Beacham mit einer Geste auf, den Besucherstuhl näher ans Bett zu ziehen. Ich schob das Wägelchen zur Seite, und nachdem ich Platz genommen hatte, erkundigte ich mich, welche Lektüre sie bevorzugte.
»Mein Geschmack ähnelt dem Ihren«, antwortete sie. »Eine besondere Vorliebe habe ich für Geschichte, vor allem für die britische. Drücken Sie mir eine Biografie von Benjamin Disraeli in die Hand, und ich bin glücklich.« Sie schloss einen Moment lang die Augen, als müsste sie sich ausruhen. »Ansonsten halte ich das normale Leben für aufregend genug. So viele Fragen, die nach einer Antwort schreien. So viel Verlorenes, das nur darauf wartet, gefunden zu werden.«
Ich nickte. »Ich verstehe, was Sie meinen. Ich selbst bin in genug Krimis aus dem echten Leben gestolpert. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich nicht das Bedürfnis verspüre, auch noch zwischen Buchdeckeln danach zu suchen.«
Miss Beachams Augenbrauen wölbten sich. »Wie aufregend. Hoffentlich hatten Sie’s in Ihren lebensechten Krimis nicht mit Morden oder psychotischen Bestien zu tun.«
»Himmel, nein!«, lachte ich. »Allerdings wurde tatsächlich vor ein paar Jahren eine Frau mit einem stumpfen Gegenstand getötet.«
»Erzählen Sie!«, bat Miss Beacham neugierig.
Mehr Ermunterung brauchte ich nicht, um mit einer Serie von Anekdoten loszulegen, die bis weit in den Nachmittag hinein gedauert hätten, wäre Schwester Willoughby nicht gekommen, um Miss Beacham zu einer Therapie abzuholen.
Die Unterbrechung brachte mich durcheinander. Miss Beachams Gesellschaft war so angenehm gewesen – ich hatte ganz vergessen, wo ich war, und dass ich mich mit einer todkranken Frau unterhielt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, eine verwandte Seele entdeckt zu haben, und brannte darauf, sie wieder zu besuchen. Kaum hatte ich das Radcliffe verlassen, lief ich schnurstracks in den Buchladen meiner Freundin und kaufte eine dicke Biografie von Disraeli, die ich Miss Beacham am nächsten Morgen überreichte.
»Sie brauchen mir nicht noch mehr Bücher zu bringen«, wehrte Miss Beacham ab, während sie die Biografie in ihren dünnen Händen wog. »Ich werde vollauf damit zufrieden sein, diesen Wälzer an den mir noch verbleibenden Tagen zu lesen.«
Spätestens am dritten Tag war mein Ruf, eine gute Zuhörerin zu sein, zerstört. Miss Beacham wirkte so interessiert an allem, was ich sagte, dass ich einfach immer weiterredete. Ich erzählte ihr von der Leidenschaft der Zwillinge für Pferde – und zeigte ihr die Porträts der Tiere, die die Jungs am Vorabend für sie gezeichnet hatten. Ich berichtete ihr von den jüngsten Ereignissen in Finch, darunter der spektakuläre Brand, der im Februar Mr Barlows Kamin zerstört hatte, und beschrieb ausführlich die bunte, zerlumpte Armee von Freunden, die ich in der St. Benedict’s Church gefunden hatte. Auch meiner neuen Freundin gab ich genügend Gelegenheit, von sich zu erzählen, aber ich drängte sie nicht. Meine Aufgabe war es, sie zu unterhalten, nicht zu verhören.
Erst bei meinem vierten Besuch ließ Miss Beacham ein paar Einzelheiten aus ihrem eigenen Leben in das Gespräch einfließen. Als ich erwähnte, dass Bill Anwalt war, vertraute sie mir an, dass sie neunundzwanzig Jahre lang als Anwaltsgehilfin in London gearbeitet hatte, ehe sie vor sechs Jahren nach Oxford gezogen war, um näher bei ihrem Bruder Kenneth zu sein. Als sie den Namen nannte, spitzte ich die Ohren – vor allem, weil ich ihn aufspüren und ihm gehörig die Meinung sagen wollte, was für ein mieser Kerl er war, dass er sich so gar nicht um seine Schwester kümmerte –, doch dann wich sie vom Thema ab und sprach von ihrer Begeisterung fürs Backen. Zwischendurch gab sie mir mit geschlossenen Augen aus dem Gedächtnis ihr Rezept für Rosinenbrot, das ich heimlich auf die Rückseite eines Lesezeichens kritzelte.
»Wie sehr ich meine Küche vermisse!«, gestand sie mir. »Das Abmessen und Mischen, den Duft von frischgebackenen Brotlaiben, der durch die ganze Wohnung zieht, den Anblick der Butter, die auf einer dicken warmen Scheibe zerfließt …« Sie seufzte.
»Was fehlt Ihnen sonst noch?«, fragte ich. »Gibt es irgendetwas in Ihrer Wohnung, das Sie hier bei sich haben wollen? Ich besorge es Ihnen mit dem größten Vergnügen.«
»Nein, nein, mir fehlt wirklich nichts.« Sie zögerte, und für einen kurzen Moment richtete sich ihr Blick nach innen. »Na ja, eines vielleicht …«
»Sagen Sie’s«, ermunterte ich sie.
Ihre Lippen kräuselten sich zu einem eigenartigen Lächeln. »Hamish«, flüsterte sie. »Ich vermisse Hamish.«
»Ihr Kater?«, riet ich. Schon hatte ich mir insgeheim geschworen, sämtliche Krankenhausvorschriften zu brechen und ihr das Tier zu bringen, wenn es tatsächlich das war, was Miss Beacham wollte. Aber wie sich herausstellte, hatte ich mich geirrt.
»Ich habe keine Katze«, antwortete Miss Beacham. »Meine Wohnung hat keinen Garten, verstehen Sie, und ich glaube nicht, dass eine Katze wirklich glücklich ist, wenn sie nicht raus ins Freie kann. Nein, ich habe keine Schoßtiere.«
»Wer ist dann …?«
In diesem Moment schwang die Tür auf, und Schwester Willoughby steckte den Kopf herein.
»Schnell, Lori«, zischte sie und winkte mich hektisch zu sich. »Sie haben die Besuchszeit schon überzogen, und die Stationsschwester ist im Anmarsch. Wenn sie Sie erwischt, reißt sie mir den Kopf ab – und Ihnen auch.«
»Fürs Wochenende bin ich ausgebucht«, erklärte ich Miss Beacham hastig. »Aber am Montag komme ich wieder.«
Ich beugte mich über sie und gab ihr einen sanften Kuss auf die Wange, dann jagte ich mit Höchstgeschwindigkeit aus dem Zimmer. Grinsend verließ ich das Gebäude, denn schon schwirrten mir Pläne durch den Kopf, wie ich meiner neuen Freundin am Montagmorgen eine nette Überraschung bereiten konnte. Es sollte die erste von einer ganzen Serie sein, dachte ich. Ich glaubte, ich hätte alle Zeit der Welt, um Miss Beacham besser kennenzulernen und in Erfahrung zu bringen, wer Hamish denn nun war.
Ich täuschte mich.
Kapitel 2
BESTENS GELAUNT KEHRTE ich am Montagmorgen ins Krankenhaus zurück. Einen großen Teil des Wochenendes hatte ich in meiner Küche verbracht, wo ich sieben Rosinenbrote nach Miss Beachams Rezept gebacken hatte, bis mir schließlich eines gelungen war, das ich für gut genug erachtete, um es ihr zu überreichen. Den makellosen goldenen Laib hatte ich nun dabei. Vor der Abfahrt hatte ich ihn sorgfältig in Alufolie eingeschlagen, das Ganze in ein Baumwolltuch verpackt und zum Schluss mit einem blassrosa Band verschnürt. Zwar bezweifelte ich, dass Miss Beacham das Brot würde essen können – sie war auf eine strenge Diät gesetzt worden –, doch ich hoffte, der Duft würde einen Anflug von heimischen Gefühlen in ihrem Krankenhauszimmer erzeugen.
Da Schwester Willoughby bei meiner Ankunft nicht auf der Station war, ging ich gleich weiter zu Miss Beachams Zimmer, ohne mich anzumelden. Vor der Tür blieb ich kurz stehen, um mein kleines Geschenk noch einmal zu überprüfen. Nervös wie ein Schulmädchen, das unbedingt einen guten Eindruck auf seine Lehrerin machen will, zupfte ich das Seidenband zurecht, dann trat ich ein.
»Guten Morgen, Miss Beacham!«, rief ich fröhlich. »Sie werden nie darauf kommen, was ich …« Ich geriet ins Stocken, dann verstummte ich ganz, während mein Verstand noch versuchte zu verarbeiten, was meine Augen sahen.
Es war nicht nur so, dass das Bett leer war. Es war schon öfter verwaist gewesen, wenn Miss Beacham gerade zu einer Untersuchung oder Behandlung gebracht worden war. Nein, diesmal war das Bett nicht nur leer – es fehlte einfach alles. Die sauberen weißen Laken, die Kissen, die leichte grüne Wolldecke waren verschwunden.
Auch die Infusionsständer waren fort, und die über dem Bett hängenden Überwachungsmonitore waren ausgeschaltet und an die Wand geschoben worden. Die Pferdebilder, die meine Söhne gezeichnet hatten, lagen nicht mehr auf dem Beistelltisch, und auch die Disraeli-Biografie fehlte. Das Zimmer roch nach Desinfektionsmitteln, als wäre es vor kurzem gereinigt worden.
»Miss Beacham?«, fragte ich kleinlaut.
Hinter mir ging die Tür auf.
»Da sind Sie ja.« Schwester Willoughby schloss die Tür und stellte sich neben mich. »Ich hatte gehofft, Sie abzufangen, aber dann gab es auf der Station einen Notfall.«
Ich sah der rothaarigen Schwester ins Gesicht. »Wo ist sie?«
»Es tut mir leid, Lori. Miss Beacham hat uns verlassen.«
Ich verstand, was sie meinte, weigerte mich aber, es zu glauben. »Sie ist heimgegangen, meinen Sie? Nach Hause, in ihre Wohnung? Aber das ist ja wunderbar! Sie müssen mir ihre Adresse geben, damit ich …«
»Nein, Lori, so hab ich das nicht gemeint.« Schwester Willoughby straffte die Schultern und erklärte mit fester Stimme: »Miss Beacham ist tot. Sie ist vor einer Stunde gestorben. Ich habe noch versucht, Sie in Ihrem Cottage zu erreichen, aber Annelise hat mir gesagt, dass Sie schon aufgebrochen waren. Und Ihr Handy …«
»… war ausgeschaltet«, murmelte ich benommen. »Bill mag es nicht, wenn ich beim Autofahren telefoniere. Beide Hände aufs Lenkrad und die Augen auf die Straße …« Ich sah zum leeren Bett hinüber und schaute gleich wieder weg.
»Ihr Zustand hatte sich abrupt verschlechtert«, sagte Schwester Willoughby sanft. »Wir hatten keine Möglichkeit, sie zu retten.«
Ich nickte. »War jemand bei ihr, als sie …?«
»Die Stationsschwester saß an ihrem Bett.« Schwester Willoughby hob beschwichtigend die Hand. »Und bevor Sie anfangen zu lamentieren, lassen Sie mich sagen, dass ich inbrünstig hoffe, jemanden wie unsere Stationsschwester bei mir zu haben, wenn mir mal die Stunde schlägt. Sie haben nur ihre autoritäre Seite kennengelernt, aber ich habe sie am Bett von sterbenden Patienten gesehen. Es gibt keine bessere Schwester.«
»Na gut«, gab ich mich geschlagen. Müde legte ich mir eine Hand an die Stirn. Ich fühlte mich verwirrt und wusste nicht so recht, was ich als Nächstes tun sollte. »Haben Sie ihren Bruder benachrichtigt?«
»Noch nicht«, seufzte die Schwester. »Wir konnten seine Adresse nicht ermitteln.«
»Aber er ist doch ihr nächster Angehöriger!«, rief ich. »Sein Name müsste irgendwo vermerkt sein.«
»Sollte er, ist er aber nicht.« Schwester Willoughby presste missbilligend die Lippen zusammen. »Leider ist Roberta Lewis von der Verwaltung nicht aufgefallen, dass das Formular unvollständig ausgefüllt war. Dass die Adresse fehlt, haben wir erst gemerkt, als wir heute früh nachgeschaut haben.«
Ich runzelte bestürzt die Stirn. »Wenn der Bruder unauffindbar ist, wer kümmert sich dann um die Beerdigung?«
»Es wird keine Beerdigung geben. Miss Beacham hat ihre Einäscherung verfügt. Die Anweisung liegt bei ihrem Anwalt.«
»Und ihre Asche?«, setzte ich nach. »Was geschieht damit?«
»Das weiß ich nicht, Lori. Aber ich werde es herausfinden.« Schwester Willoughby hielt etwas in die Höhe. Es dauerte einen Moment, bis ich begriff, dass es die Pferdebilder und die Biografie waren, die ich Miss Beacham geschenkt hatte. »Ich dachte mir, dass Sie das hier gerne wiederhätten.«
»Ja.« Ich nahm das Buch und die Zeichnungen entgegen und reichte der Schwester den in Tücher eingeschlagenen Brotlaib. »Das ist Rosinenbrot. Nach Miss Beachams Rezept gebacken. Ich wollte sie damit überraschen, aber jetzt …« Meine Stimme brach. Ich räusperte mich und holte tief Luft. »Möchten Sie es mit den anderen Schwestern teilen?«
»Aber gern.« Schwester Willoughby legte die mit Sommersprossen übersäte Stirn teilnahmsvoll in Falten. »Möchten Sie mit Father Bright sprechen? Er ist gerade auf der Station und kümmert sich um seine Schäfchen.«
Father Julian Bright war der katholische Priester, der das Heim der St. Benedict’s Church für obdachlose Männer leitete. Er kam jeden Tag ins Radcliffe, um jene Mitglieder seiner übel beleumdeten Herde aufzusuchen, die über Nacht eingeliefert wurden. Er war ein guter Freund und ein äußerst liebenswürdiger Mensch.
»Hat sich jemand verletzt?«, rief ich bestürzt. Schon befürchtete ich die Nachricht von einer neuerlichen Tragödie. »Ist es schlimm?«
»Big Al Layton ist in der Nacht gestürzt und hat sich den Kopf an einem Pflasterstein aufgeschlagen.« Schwester Willoughby brachte ein verschmitztes Grinsen zuwege. »Er war sternhagelvoll, aber die Stiche beim Nähen haben ihn schlagartig ernüchtert. Ich könnte mir vorstellen, dass er morgen zur Essenszeit wieder im Heim sein wird. Soll ich jetzt Father Bright zu Ihnen bringen? In einer Minute wäre er da.«
Ich starrte zur Tür hinaus. Ich wusste, dass Julian sofort kommen und genau das Richtige sagen würde, aber auch wissen würde, wann Schweigen angebracht war, doch in diesem Augenblick wollte ich einfach mit niemandem sprechen.
»Nein, danke«, sagte ich. »Ich will jetzt nur heimfahren.«
Noch einmal sah ich mich im Zimmer um, vermochte aber nicht die geringste Spur von meiner Freundin zu entdecken. Es war, als wäre jede Erinnerung an Miss Beacham restlos getilgt worden.
Ich rettete mich aus Oxford und lenkte meinen kanariengelben Range Rover wieder nach Hause. Der düstere Märztag spiegelte meine Stimmung wider. Unter tief hängenden Wolken erstreckten sich kahle Felder. Auf den skelettartigen Ästen blattloser Bäume drängten sich Krähenschwärme; ein nasskalter Ostwind fegte übers Land und brachte nicht einmal den blassesten Hoffnungsschimmer mit sich, der sein schroffes Gebaren gemildert hätte. Alles, was ich sah, schien in das einförmige Grau der Trauer gehüllt.
Mechanisch bewältigte ich die Kurven und Kreisverkehre; ohne nach links oder rechts zu schauen, fuhr ich durch die mir vertrauten Städte. Ich fühlte mich, als drückte mich eine riesige Hand nieder und machte mir das Atmen immer schwerer. Von den Patienten auf meiner Besucherliste war bisher noch kein einziger gestorben, und keiner hatte mir so viel bedeutet wie Miss Beacham. Es fiel mir schwer zu glauben, dass sie wirklich tot war.
Als ich in Finch ankam, war ich versucht, bei Bill im Büro vorbeizuschauen und mich ihm in die Arme zu werfen, ließ den Gedanken aber gleich wieder fallen – der Trost, den ich mir davon versprach, stand in keinem Verhältnis zu dem Risiko, dabei beobachtet zu werden. Meine Nachbarn waren, um es höflich auszudrücken, überaus wachsam. Stapfte ich mit verdrießlicher Miene über den Dorfplatz, würde sich mit Sicherheit jemand darüber Gedanken machen – und zwar laut und im Beisein eines Dritten, der gerade zufällig vorbeikam –, was mit mir nicht stimmte. Noch vor Sonnenuntergang wäre die Gerüchteküche am Brodeln, und ich würde von Leuten, die nur darauf brannten, mich zu bemitleiden, alles brühwarm erfahren: dass meine Scheidung von Bill bevorstand, welchen Skandal es in Bills Kanzlei gegeben hatte, dass die Zwillinge unter einer entsetzlichen Mandelentzündung litten oder es irgendeinen anderen Schicksalsschlag gegeben hatte, der nur in der blühenden Fantasie der auf Tratsch versessenen Dorfbewohner existierte. Um also zu vermeiden, dass ich derart malträtiert wurde, beschränkte ich mich darauf, einen sehnsüchtigen Blick auf die Glyzinie zu werfen, die sich um die Tür zu Bills Büro rankte, dann rumpelte ich über die Buckelbrücke weiter nach Hause.
Als ich an der Abzweigung zum Anscombe Manor vorbeikam, dem Herrenhaus aus dem vierzehnten Jahrhundert und Zuhause meiner besten Freundin, Emma Harris, überlegte ich kurz, ob ich ihr einen Besuch abstatten sollte, verzichtete dann aber darauf. Emma war Amerikanerin wie ich und hatte einen Engländer geheiratet, doch obwohl wir aus dem gleichen Land stammten, sprachen wir nicht immer dieselbe Sprache. Während bei mir alles über Gefühle lief, hatte Emma einen erschreckenden Hang, sich auf die Logik zu verlassen.
Wenn ich ihr erzählt hätte, dass ich über den Tod einer unheilbar kranken Frau bestürzt war, hätte sie mich garantiert völlig verdutzt angestarrt und mir geduldig erklärt, dass der Tod bei unheilbar Kranken nichts Ungewöhnliches war. Sie wäre durchaus liebevoll gewesen, aber den Trost, den ich brauchte, hätte sie mir nicht spenden können.
Außerdem stand Emma kurz davor, endlich einen lange gehegten Traum zu verwirklichen. Am Samstag sollte die Eröffnungsfeier des Anscombe Riding Centre stattfinden, einer kleinen Reitschule, die Emma mit Hilfe ihres Freundes und Stallmeisters Kit Smith führen wollte. Emma und Kit hatten ihr ganzes Herzblut in dieses Projekt gesteckt, und ich wollte ihre Begeisterung nicht mit meiner düsteren Stimmung trüben.
Für mich stand ohnehin schon fest, mit wem ich sprechen wollte, und ich wusste auch genau, wo ich diese Person finden würde. Auf der Kiesauffahrt vor dem Cottage angekommen, stellte ich den Motor ab, blieb aber noch einen Moment im Range Rover sitzen. Die Hände locker aufs Lenkrad gelegt, ließ ich den Blick langsam von den goldenen Steinmauern des Cottage hinauf zu seinem von Flechten überwachsenen Schieferdach wandern. Meine Gedanken weilten unterdessen bei der unbeschreiblichen Engländerin, die vor mir in diesem Haus gelebt hatte und es in einem gewissen Sinne auch jetzt noch bewohnte.
Dimity Westwood war die engste Freundin meiner verstorbenen Mutter gewesen. Die zwei hatten sich im Zweiten Weltkrieg in London kennengelernt, wo sie für ihr jeweiliges Land dienten, und hatten ihre Freundschaft bis lange nach Kriegsende und der Rückkehr meiner Mutter nach Amerika am Leben erhalten, indem sie einander Hunderte von Briefen schrieben.
Für meine Mutter wurden diese Briefe zu einer Zuflucht, einem privaten Bereich, in den sie sich retten konnte, wenn ihr die banalen Ärgernisse des Alltags über den Kopf wuchsen. Zeit ihres Lebens blieb diese Zuflucht das streng gehütete Geheimnis meiner Mutter. Auch mir erzählte sie nie davon, nur indirekt stellte sie mir ihre liebste Freundin als Tante Dimity, die furchterregende Heldin meiner Gutenachtgeschichten, vor.
Die Wahrheit erfuhr ich erst Jahre später, als sowohl meine Mutter als auch Dimity verstorben waren und Dimity Westwood mir das honigfarbene Cottage hinterließ, in dem sie aufgewachsen war, und mit ihm die wertvolle Korrespondenz mit meiner Mutter, ein beträchtliches Vermögen und ein sonderbares, in blaues Leder gebundenes Notizbuch.
Über dieses Notizbuch nun lernte ich Dimity Westwood kennen – nicht aufgrund von Dingen, die sie hineingeschrieben hatte, sondern weil sie es auch nach ihrem Tod weiterführte. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie sie das bewerkstelligte, aber ich glaube zu wissen, warum sie den Kontakt mit den Lebenden aufrechterhielt.
Die Liebe, die sie mit meiner Mutter verband, bestand auch zwischen ihr und mir. Die strenge Tante Dimity ließ sich nicht gefallen, dass irgendetwas, und schon gar nicht etwas so Windiges wie der Tod, dieses Band durchtrennte. Wenn jemand die Kompetenz hatte, mir in Trauerangelegenheiten einen Rat zu erteilen, sagte ich mir, dann Tante Dimity.
Der feuchte Wind zerrte an meinem Haar, als ich aus dem Rover stieg und bedrückt über den gefliesten Weg zum Haus ging. Ich schlug den Kragen meiner Wolljacke hoch, aber dann hatte ich auch schon die Tür erreicht. Ich öffnete sie und blieb lauschend auf der Schwelle stehen. Will und Rob waren bei ihrem Kindermädchen – der wunderbaren Annelise, die bei uns im Haus lebte –, und wenn mich meine Ohren nicht täuschten, waren sie gerade alle dabei, unter viel Gelächter eine Kartoffelsuppe mit Lauch zuzubereiten.
Da ich ihnen mit meinem langen Gesicht nicht die Freude verderben wollte, zog ich lautlos die Haustür zu, hängte meine Umhängetasche an den Kleiderhaken und huschte auf Zehenspitzen über den Flur ins Büro, wo ich die Tür leise hinter mir schloss. Nachdem ich die Lampen auf dem Kaminsims angeknipst hatte, deponierte ich zunächst die Pferdebilder und die Biografie auf dem alten Eichenschreibtisch vor dem mit Efeu zugewachsenen Fenster. Dann kniete ich mich vor den Kamin, in dem bereits Holzscheite aufeinandergeschichtet lagen und nur noch angezündet werden mussten. Die Kälte war mir vom Krankenhaus bis nach Hause gefolgt, und ich hoffte, das Feuer würde sie vertreiben. Als die Flammen die Scheite erfassten und das Feuer zu prasseln begann, stand ich auf und drehte mich mit einem müden Grinsen zu Reginald um, meinem kleinen rosa Stoffhasen, der in seiner eigenen Nische zwischen den Bücherregalen hockte.
Reginald wachte über mich, seit ich meinen ersten Atemzug getan hatte. In meiner ganzen Kindheit hatte ich ihm alles anvertraut, und ich sah keinen Grund, jetzt damit aufzuhören, nur weil ein paar Leute – meiner Meinung nach irrtümlich – glaubten, dass ich erwachsen geworden sei.
»Hallo, Reg«, begrüßte ich ihn und berührte den verblassten Traubensaftfleck an seiner Nase. »Hoffentlich war dein Tag lustiger als meiner.«
Eine Antwort erwartete ich nicht von ihm, doch ich entdeckte ein mattes Glimmern in seinen schwarzen Knopfaugen, dem ich entnahm, dass er mich zu einem gewissen Grad durchaus verstanden hatte. Ich streichelte seine rosa Stoffohren und griff dann nach dem blauen Notizbuch, mit dem ich mich in einem der beiden hohen Ledersessel vor dem Kamin niederließ. Mit einem tiefen Seufzer schlug ich es auf und starrte auf die leere Seite vor mir.
»Dimity«, sagte ich, »ich muss mit dir sprechen.«
Was ist passiert, Lori?
Mir schnürte sich die Kehle zusammen, als die altmodische Schreibschrift vor mir auftauchte, die Dimity in einer Zeit in der Dorfschule gelernt hatte, als Automobile noch eine seltene Kuriosität waren. Bis zu diesem Moment hatte ich zu sehr unter Schock gestanden, um zu weinen, aber jetzt begannen die Tränen zu fließen und brannten mir in den Augen.
Ich blinzelte heftig. »Es ist wegen Miss Beacham. Sie ist heute Morgen gestorben.«
Ach, mein liebes Kind, das tut mir wirklich leid. Ich weiß, wie gern du sie mochtest.
»Keine Ahnung, warum sie mir so viel bedeutet hat.« Ich schniefte. »Eigentlich ist das doch albern, oder? Wir haben schließlich nur ein paar Stunden miteinander verbracht, ein paar wenige mickrige …«
Das ist nicht albern, Lori. Du bist jemandem begegnet und hast dich ihm auf Anhieb verbunden gefühlt. In solchen Situationen ist Zeit ohne Belang.
»Genau das war es.« Ich nickte betrübt. »Ich war ihr auf Anhieb verbunden. Sie hatte etwas an sich, das mich berührt und nicht mehr losgelassen hat. Sie hatte ein Licht in den Augen, Dimity, einen Funken, der mich angezogen hat. Sie war klug und lustig und liebte Geschichte, und ich glaube, diese Helligkeit werde ich nie wiedersehen.«
Sie war schwer krank, nicht wahr?
»Sie war todkrank«, räumte ich ein. »Lucinda hat mir von Anfang an klar zu verstehen gegeben, dass Miss Beachams Genesungschancen gleich null sind, aber wahrscheinlich habe ich schlichtweg verdrängt, wie schlecht es ihr ging. Sie hat sich überhaupt nicht beklagt, Dimity. Sie hat kein einziges Mal über ihre Krankheit gesprochen. Nicht mal das Krankenhaus hat sie erwähnt. Da hab ich wohl … ganz vergessen, warum sie dort lag.«
Hast du je daran gedacht, dass du ihr auch deinerseits gestattet hast, das zu vergessen? Du bist keine Ärztin oder Schwester. Du bist nicht zu ihr gekommen, um ihr Blut abzunehmen oder noch mehr schlechte Nachrichten zu überbringen. Dein einziger Wunsch war es, ihr eine angenehme Gefährtin zu sein. Du hast ihr eine Chance gegeben, an etwas anderes als ihre eigene Sterblichkeit zu denken.
»Dass sie sterblich war, ist mir nie in den Sinn gekommen«, murmelte ich bedrückt. »Wenn ich ihr in die Augen schaute, hab ich keine sterbende Frau gesehen. Ich hab sie gesehen!«
Was für ein wunderbares Geschenk du ihr gemacht hast, Lori. Du hast sie daran erinnert, dass sie mehr war als nur eine Patientin, nämlich etwas Ganzes, eine vollständig ausgebildete Persönlichkeit mit Interessen und Leidenschaften, die nichts mit ihrer Krankheit zu tun hatten. Wenn sie dir in die Augen blickte und die ihren sich darin spiegelten, sah sie mehr als eine sterbende Frau: Sie sah sich selbst.
»Hoffentlich hast du recht«, seufzte ich. »Ich würde gern glauben, dass ich ihr irgendwie geholfen habe. Aber ich weiß ja so wenig über sie. Ich hätte so gern viel mehr über sie erfahren, aber dafür ist es jetzt zu spät.«
Hat ihr Bruder sie je besucht?
Jäh packte mich die Wut. »Nein!«, stieß ich hervor. »Die Stationsschwester saß bei ihr, als sie starb. Der liebe Kenneth hat es nicht für nötig befunden, auch nur einmal aufzukreuzen, und das Krankenhaus kann ihn nicht aufspüren, weil es seine gegenwärtige Anschrift nicht hat. Er weiß nicht mal, dass sie tot ist.«
Vielleicht ist er ja auch schon tot.
»Das bezweifle ich. Sie hat ihn als ihren nächsten Angehörigen genannt. Wenn er tot wäre, hätte sie seinen Namen bestimmt nicht eingetragen.«
Vielleicht waren sie einander fremd geworden.
»Dann hätte sich jemand anderes um sie Sorgen gemacht«, beharrte ich. »Eine Freundin oder eine Nachbarin … Sie lag zwei Wochen lang im Krankenhaus, Dimity, und ich war ihre einzige Besucherin. Es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke, wie allein sie war.«
Aber sie war ja nicht allein. Du warst bei ihr. Es muss für sie ein großer Trost gewesen sein zu wissen, dass du um sie trauern würdest.
»Ein feiner Trost.« Ich verzog den Mund zu einem freudlosen Grinsen. »Der einzige Mensch, der um sie trauert, bin ich, eine völlig Fremde.«
Dein Kummer zeigt mir deutlich, dass du keine Fremde mehr warst, Lori. Du warst Miss Beachams Freundin.
»Stimmt, das war ich.« Ich schluckte schwer. »Und sie wird mir schrecklich fehlen.« Es klingelte, und ich sah von dem blauen Notizbuch auf. »Ich mache jetzt besser Schluss, Dimity. Wenn Annelise zur Tür geht, sieht sie den Rover und fragt sich, wo ich stecke.«
Nur noch ein paar Anregungen, bevor du gehst, meine Liebe: Gönn dir unbedingt ein bisschen Selbstmitleid. Du hast guten Grund dazu. Du hast jemanden verloren, der dir viel bedeutete. Aber hab kein Mitleid mit Miss Beacham. Sie wusste, dass sie dem Tod nahe war, und hatte Zeit, sich darauf vorzubereiten. Auch wenn es dir schwerfällt, das zu verstehen, musst du mir einfach glauben, wenn ich dir sage, dass der Tod nicht das Schlimmste ist, was einen Menschen treffen kann. Ich spreche aus eigener Erfahrung.
Ich beobachtete, wie die eleganten, mit königsblauer Tinte geschriebenen Zeilen langsam verloschen, dann stellte ich das Notizbuch an seinen Platz auf dem Regal zurück, wischte mir mit dem Ärmel die Augen und trottete mit schweren Schritten über den Flur zur Haustür.
Annelise stand auf der obersten Stufe und plauderte freundschaftlich mit Terry Edmonds, dem uniformierten Kurier, der Bills Kanzlei in Finch regelmäßig juristische Schriftstücke zustellte. Annelise zog eine Augenbraue hoch, als sie mich bemerkte, sagte aber nichts.
Terry tippte sich an die Mütze. »Expresspost für dich, Lori«, sagte er und reichte mir ein Klemmbrett mitsamt einem Kugelschreiber. »Du brauchst nur noch zu unterschreiben, dann gehört es dir.«
»Mir?«, fragte ich, während ich meinen Namen hinkritzelte. »Nicht Bill?«
»Schau selbst.« Terry nahm das Klemmbrett zurück und händigte mir ein schmales Päckchen aus. Einen Moment später hatte er sich bereits wieder abgewandt und sprang zu seinem Lieferwagen. »Grüße Bill und die Zwillinge von mir!«, rief er mir noch über die Schulter hinweg zu.
»Mach ich, Terry!« Ich winkte dem davonbrausenden Wagen nach, dann drehte ich mich zu der verdächtig stillen Küche um. »Wo sind Rob und Will? Sie versuchen doch nicht wieder, ihr Mittagessen selbst zu kochen?«
Annelise verdrehte die Augen. »Nach dem Mordsspaß, den sie mit den Marmeladenbrötchen hatten? Nicht sehr wahrscheinlich. Sie spielen im Wintergarten mit der Modelleisenbahn, solange die Suppe köchelt.« Sie verstummte und sah zu, wie ich die Sendung, einen festen Umschlag, aufriss. Dann sagte sie leise: »Schwester Willoughby hat heute früh angerufen. Sie hat mir das mit deiner Freundin im Radcliffe erzählt. Soll ich dir die Jungs noch eine Weile vom Leib halten?«
Ihr Angebot war wirklich rücksichtsvoll, doch ich reagierte nicht. Meine ganze Aufmerksamkeit galt einem weißen Kuvert, das ich aus dem festen äußeren Umschlag gezogen hatte.
»Lori?«, fragte Annelise. »Was ist das?«
»Ein Brief«, antwortete ich benommen. »Ein Brief von Miss Beacham.«
Kapitel 3
ES WAR NICHT der erste Brief, den ich von einer Toten erhalten hatte – meine Mutter hatte mir ebenfalls einen hinterlassen, der erst nach ihrer Beisetzung geöffnet werden durfte –, aber ich hoffte von ganzem Herzen, dass das der letzte war. Das Zusammenleben mit zwei Fünfjährigen verschaffte mir ein vollkommen ausreichendes Maß an Panik und Schrecken. Mehr brauchte ich wirklich nicht.
»Miss Beacham?«, rief Annelise. »Ist das nicht …?«