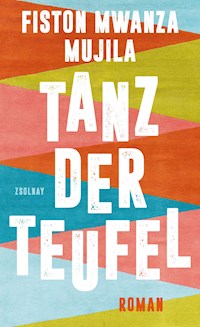
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Virtuos, schillernd und unerhört musikalisch: nach seinem gefeierten Debüt „Tram 83“ der neue Roman von Fiston Mwanza Mujila Im Grenzgebiet zwischen Angola und dem Kongo, in den Minen von Lunda Norte und im Zentrum von Lubumbashi tanzen Frauen ohne Alter, Diamantensucher, Gauner und Agenten aus aller Welt den „Tanz der Teufel“. Neben absurden Dialogen und einer Fülle von Erzählsträngen und Abschweifungen ist es vor allem die Musik, die den Rhythmus von Fiston Mwanza Mujilas neuem Roman vorgibt. Und die Ironie des Romans lässt die Auswirkungen von Kolonialisierung, Globalisierung, Raubbau und Bürgerkrieg nur noch deutlicher erscheinen. Mit seinem gefeierten Debüt „Tram 83“ hat Fiston Mwanza Mujila eine völlig neue Art von Roman erschaffen. Sein neues Buch ist noch schillernder, noch virtuoser und dabei noch politischer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Virtuos, schillernd und unerhört musikalisch: nach seinem gefeierten Debüt »Tram 83« der neue Roman von Fiston Mwanza Mujila Im Grenzgebiet zwischen Angola und dem Kongo, in den Minen von Lunda Norte und im Zentrum von Lubumbashi tanzen Frauen ohne Alter, Diamantensucher, Gauner und Agenten aus aller Welt den »Tanz der Teufel«. Neben absurden Dialogen und einer Fülle von Erzählsträngen und Abschweifungen ist es vor allem die Musik, die den Rhythmus von Fiston Mwanza Mujilas neuem Roman vorgibt. Und die Ironie des Romans lässt die Auswirkungen von Kolonialisierung, Globalisierung, Raubbau und Bürgerkrieg nur noch deutlicher erscheinen. Mit seinem gefeierten Debüt »Tram 83« hat Fiston Mwanza Mujila eine völlig neue Art von Roman erschaffen. Sein neues Buch ist noch schillernder, noch virtuoser und dabei noch politischer.
Fiston Mwanza Mujila
Tanz der Teufel
Roman
Aus dem Französischen von Katharina Meyer und Lena Müller
Paul Zsolnay Verlag
1
Das aufrührerische und unbeschreibliche Leben von Tshiamuena, auch — völlig zu Recht und post mortem — die Madonna der Minen von Cafunfo genannt, ungeachtet der Eifersucht gewisser Diamantenschürfer ohne Charisma, Ehrgeiz und Elan
Die Madonna war keine dieser Furien unter dem Einfluss von Alkohol oder anderem Gesöff ohne jedes Maß. Sie war keine Untergangsprophetin oder Seherin von irgendwelchen Unheilszenarien aus der Gosse. Sie machte keine Geschäfte mit Träumen, hinkenden Hoffnungen und Hirngespinsten, und ihr wisst ja, wohin dieser Krempel führt, wenn er euch die ganze Zeit um die Ohren fliegt. Die Penetranz, mit der die Spaßverderber an diesen Kleinigkeiten herummäkelten, kannten wir alle zur Genüge. Den ganzen Tag leierten sie dieselben Sprüche herunter, als hätten sie auf Erden nichts Besseres zu tun, als die Madonna schlechtzumachen — »Tshiamuena dies, Tshiamuena das; Tshiamuena hat Flügel, sehr große Flügel, und sobald es Nacht wird, widmet sie sich der Hexerei, fliegt meilenweit ohne einen einzigen Tropfen Treibstoff und belegt uns mit einem Fluch, sodass wir in der zweiten Welt keine Diamanten mehr finden.« Was hatten wir uns nicht schon alles anhören müssen? Nichtssagendes Gebrabbel, Kolportagen, Lügengeschichten, denn sobald es um Tshiamuena ging, spitzten alle die Ohren; jeder wurde zum Gelehrten, Universitätsprofessor, Soziologen, Sprachwissenschaftler und Ethnologen; jeder packte seine Küchentisch‑Philosophie aus, um ihr Tun und Lassen genauestens zu analysieren. Selbst hohle Nüsse fanden wieder Lust am Leben, waren inspiriert, voller Verve und gesprächig wie Politiker auf Wahlkampftour. Das Saufen kann man niemandem verbieten, aber dummes Geschwätz zu verbreiten, nur um jemanden in die Pfanne zu hauen, das überstieg doch den Verstand, erst recht, wenn es sich dabei um eine Autorität wie die Madonna handelte. Wie konnte es sein, dass Menschen — die ja ein Geschlechtsteil, einen Bauch, Arme, Beine und ein Gehirn hatten — den ganzen Tag damit zubrachten, auf den Rettungswagen zu feuern? Sie schoben ihr den Zusammenbruch des gesamten tropischen Afrika in die Schuhe: die Fehlgeburten und die fehlgeschlagenen Staatsstreiche, die Kriege, den Größenwahnsinn von Kaiser Bokassa … In einem fort stellten sie Spekulationen an, schwelgten in Verschwörungstheorien und setzten alles daran, Kausalzusammenhänge zwischen der Madonna — seligen Angedenkens — und jedem beliebigen Unglück aufzudecken, das die zairische Diaspora traf. Und immer wieder diese Gerüchte über Kannibalismus. Verkehrte Welt! Die Madonna, eine ausgemachte Hexe, die nach Fleisch und frischem Blut gierte? Selbst wenn man einen Menschen — aus plausiblem Grund — hasst, ist es absurd, ihm jeden Erdrutsch, Durchfall und sonstige schlimme Sachen in die Schuhe zu schieben … Sie hatten noch nicht mal ihren Rausch ausgeschlafen, die Zähne geputzt und den Hosenschlitz zugezogen, da zerrissen sie sich schon das Maul und wollten eine lebende Legende stürzen.
Dieses ganze Theater ist doch einfach erbärmlich. Merkwürdigerweise wurden die bösen Zungen umso lauter, je mehr von ihrer Energie und ihren Ersparnissen Tshiamuena allen zuführte. Wie man es auch dreht und wendet, Klatsch, Tratsch und üble Nachrede tun der Wahrheit keinen Abbruch: Tshiamuena war eine Grande Dame, eine außergewöhnliche Erscheinung, eine Mutter für viele von uns, eine Königin, eine Frau der Macht … Sie hatte nicht die Statur einer Opernsängerin, die Klasse einer Miss World oder das herrische Auftreten einer Herzogin, aber sie überwältigte und hypnotisierte uns, sobald sich unsere Blicke trafen. Man musste sie nur ansehen und wurde von einem epileptischen Anfall gepackt. Wir Zairer — größtenteils nach 1960 geboren — brachen in Tränen aus, wenn wir nur ein Schwätzchen mit ihr hielten.
Wenn Tshiamuena vom Schmuggel in den 1970ern gleich nach der Unabhängigkeit Angolas sprach, wagte keines der Männchen, sich aufzuplustern, um den Wahrheitsgehalt ihrer Worte in Frage zu stellen. Sie zählte ganze Ahnenreihen von Schürfern auf — Patrocinadores, Dona Moteurs, Lavadores, Taucher, Karimbeurs … Sie war nicht das Gedächtnis von Angola. Sie war Angola. Das andere Angola. Das Angola der Minen, des Geldes, der Klunker, der Erdrutsche, des diamantenhaltigen Kwango‑Flusses; das Angola, von dem jeder — ob geldgierig oder nicht — mindestens einmal im Leben träumt. Tshiamuena war über alle Machenschaften zwischen Zaire und Angola im Bilde, hatte das Kommen und Gehen der Zairer stets im Blick, wusste, wann dieser oder jener zum ersten Mal nach Angola gekommen war, über welchen Schleichweg und mit welchem Kapital in der Tasche … In den seltenen Momenten des Wahnsinns — wenn Tshiamuena sich in endlosen Tiraden verlor und ihre Augenlider flatterten — zählte sie die Toten auf; ganze Listen von jungen Leuten, alle aus Zaire, ums Leben gekommen bei der fieberhaften Suche nach schnellem Reichtum durch fremde — sprich: angolanische — Diamanten. Nie unterbrach ein Hickser, naives Gerede oder Gelächter ihren Erzählstrom — obwohl es in den Minen von Cafunfo von jungen Zairern wimmelte, die sich ohne ersichtlichen Grund kaputtlachten. In ihrem strahlenden Gesicht konnten alle ihre Grübchen bewundern.
Tshiamuena war geboren, um zu herrschen. Was für eine Frau! Mit erhobenen Armen, als wäre ein Gewehr auf sie gerichtet, wütete sie im Pizzicato; und wir, in unseren Lumpen, erstarrten zu Salzsäulen, bewegungslos, unempfindlich gegen Hitze und Kälte, gegen Hunger, gegen Müdigkeit, gegen die Angst vor einem drohenden Erdrutsch, und stopften uns voll mit ihren Erinnerungen, als wären es Sojabrötchen mit Butter. Tshiamuena delirierte, anders konnte man es nicht nennen, und unsereins labte sich an ihren Phantasien. Toxische und übertriebene Männlichkeit wurde im Keim erstickt. Ihre Worte berührten uns, flossen uns die Speiseröhre hinunter, walzten uns durchs Hirn und ließen uns ausgelaugt, völlig außer Atem zurück, wie nach einem üblen Pogrom oder nach tausend Jahren Arbeitslager. Ihre unkontrollierbare Müdigkeit, ihre Nervenzusammenbrüche, ihr Speichelfluss, ihr Erbrechen, ihr kurzfristiger Verlust von Sprache, Gehör und Geruch, ihr Zittern an Füßen und Kopf, ihre plötzliche Schläfrigkeit waren Wasser auf den Mühlen derer, die ihr vorwarfen, einer Sekte anzugehören und den Leuten das Schürferglück zu rauben, sodass sie nie das große Los ziehen würden, ohne dafür mindestens ein Familienmitglied zu opfern. Andächtiges Schweigen — das selbst die Soldaten der UNITA-Rebellion nicht brachen — beendete ihre Predigten. Dieses mächtige Schweigen wog schwerer als die vom Graben entkräfteten Körper oder die Verzweiflung, mit leeren Händen nach Kinshasa zurückzukehren. Die Stille war, zusammen mit ihrer krächzenden Stimme und der ungeheuren Selbstsicherheit, mit der sie daherredete, das tägliche Brot jener langen Nächte ohne Glühbirne, Öllampe, ohne lieben Gott.
»In den siebziger Jahren«, sagte sie mit trockener Kehle und dem leeren Blick einer Sterbenden oder einer plötzlichen Vollwaisen, »war Angola ein Paradies für opportunistische, unverfrorene und ins schnelle Geld verliebte Zairer. Alle Zairer aus Kinshasa und Kasaї, die alt genug waren, um in den Stand der Ehe zu treten und sich den Bauch vollzuschlagen, schworen auf Angola. Die portugiesischen Siedler hatten Kind und Kegel zusammengerafft und in aller Eile die Kolonie geräumt. Die UNITA von Dr. Jonas Savimbi und die MPLA von José Eduardo dos Santos, die gemeinsam für die Unabhängigkeit gekämpft hatten, lieferten sich eine nachträgliche Schlacht um das Machtmonopol. »Damals«, flüsterte Tshiamuena, ganz aufgelöst und den Tränen nahe, »verwandelte sich Angola in ein Sieb. Poröse Grenzen. Massenflucht in beide Richtungen. Zairer, nicht älter als ihr selbst, strömten zu Dutzenden, zu Hunderten ins Land, beladen mit allen möglichen Waren. Angola war von der Welt abgeschnitten. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ihnen die Dinge des täglichen Gebrauchs wie Waxstoffe, Zigaretten, Bier, Transistorradios, Konservenbüchsen, Gummistiefel, Zucker und Salz, Seife, Secondfoot-Klamotten aus der Hand gerissen wurden. Diese Produkte wurden mit Diamanten aufgewogen.«
Tshiamuena war eine hervorragende Erzählerin. Sie konnte dieselbe Geschichte fünfzigmal zum Besten geben. Und in jeder Fassung nahm sie eine andere Färbung an. Als lebendige und jahrhundertealte Augenzeugin dieses goldenen Zeitalters — Krieg ist die günstigste Gelegenheit, um Geschäfte zu machen, es gilt alles oder nichts, entweder ihr fahrt dicke Gewinne ein, oder sie ziehen euch das Fell über die Ohren — fand sie es bedauerlich, dass so mancher Zairer sich auf Kosten von Angola eine goldene Nase verdient hatte, und das, obwohl auch sie nicht wenig Klunker eingesackt hatte. Sie sagte, den Angolanern sei nicht nach Feiern zumute gewesen und somit auch nicht nach Diamanten. Sie zerfleischten sich gegenseitig, und die Diamanten lagen untätig herum.
Ach! Die Madonna, Tshiamuena, eine bemerkenswerte Frau! Alle Zairer, die sich in Angola ihre Sporen verdient hatten, hätten für sie ausgesagt, selbst mit einer Knarre am Kopf. Die Madonna der Minen von Cafunfo war einfach nicht aus demselben Fleisch wie wir, die wir jahrhundertelang durch die Schwemmminen von Angola geirrt waren. Sie war ein wunderbarer Mensch. Oase in der Kalahari-Wüste. Trinkwasser. Mutter Erde. Tempelhüterin. Eisenbahn im Dickicht unserer trüben Träume. Göttin des Fraßes. Der Zaire-Fluss im Kleinformat. Architektin unseres Verlangens nach Wohlstand. Älteste Tochter des Geldes und des Überflusses. Schutzheilige der zairischen Diamantenschürfer von Lunda Norte. Ach! Die Madonna! Kilometerlange Liebe im Dienste der zairischen Diaspora. Und als die diplomatische Vertretung der Republik Zaire in Angola aufgrund der Kriegshandlungen außer Betrieb war — geschlossen, verriegelt, verrammelt —, verkörperte die Madonna ganz allein die Botschaft von Zaire.
Zu dieser Zeit stand ein ganzes Gebiet der angolanischen Provinz — einschließlich Cafunfo — unter der Kontrolle der Rebellen, die die Abbaugenehmigungen mit eiserner Faust festhielten. Sie regulierten den Zugang zu den Minen bis ins Kleinste. Sie kassierten Kopeken für jeden eingesammelten Diamanten. Die Minen durften nur zu den vorgeschriebenen Zeiten betreten werden. Um in die Camps und die Minen zu dürfen, mussten die Schürfer eine Erlaubnis vorweisen, ansonsten drohten Prügel, bisweilen mit Todesfolge.
Zur Zeit dieser widrigen Umstände also trat die Madonna auf den Plan. Sie befreite die Gefangenen aus den Klauen der Rebellen, nutzte ihre Beziehungen, beginnend mit ihren angolanischen Ehemännern in chronologischer Reihenfolge — Mitterrand, Kiala, Augustino, José —, um ihnen die nötigen Papiere zu besorgen, kümmerte sich um die Kranken und die Verschütteten, verteilte Nahrungsmittel an die Bedürftigsten und unternahm jede Anstrengung, um die sterblichen Überreste all derer zurückzuführen, deren Familien die Reise nach Angola nicht auf sich nehmen konnten … Die Liste ihrer guten Taten ist so lang wie der Sambesi‑Fluss.
Man erzählte sich in Luanda und Lunda Norte, dass sie, als sie noch ein Winzling war, ihre Eltern vor einem Brandanschlag gerettet hatte. Und das war so: Die Küche brennt. Das Feuer breitet sich aus in Richtung Elternschlafzimmer. Aus ihrem Zimmer erkennt die Kleine die Gefahr. Sie schlägt Purzelbäume in ihrem Bett und schreit wie am Spieß, aber die Eltern schlafen tief und fest. Mit übermenschlicher Anstrengung klettert sie aus ihrer Wiege. Hier widersprechen sich die Versionen. Entweder krabbelt sie bis zum Bett der Eltern, die alarmiert von den Schreien aufwachen. Oder, noch extravaganter, sie beginnt zu weinen, ohne die Wiege zu verlassen, zuerst nur kleine Tränchen, dann Tränen vom Ausmaß des Flusses (Zaire), bis das Feuer gelöscht ist.
Alle, die aus Angola zurückkamen, völlig am Ende oder die Taschen voller Klunker, sprachen mit schnarrender Stimme, wenn sie die Madonna heraufbeschworen, vielleicht um ein Schluchzen zu unterdrücken. Alle waren sich einig, dass die Republik Zaire es Tshiamuena mit gleicher Münze zurückzahlen sollte. Gebt dem Cäsar, was des Cäsars ist. Gebt der Madonna der Minen von Cafunfo, was der Madonna der Minen von Cafunfo ist. Im Eifer des Gefechts waren sie nicht zimperlich. Sie verlangten, dass die Cabu‑Brücke ab sofort ihre Initialen tragen und auch der Boulevard Saio nach ihr benannt werden sollte und dass man auf der Place Victoire ein sieben Meter hohes Denkmal von ihr errichtete, in der linken Hand einen Einkaräter.
2
»Like Family« oder wie Molakisis Verschwinden seine Familie in helle Aufregung versetzt
Molakisi war abgehauen, ohne eine Anschrift zu hinterlassen, eine Postkarte zu schicken oder auch nur kurz anzurufen — »Liebe Eltern, ich mache Schluss mit meinem Getändel, den ständigen Beleidigungen und dem wiederholten Diebstahl.« Sein überstürztes und schlecht orchestriertes Verschwinden schürte die Konflikte und stiftete bei seinen Lieben große Verwirrung. Sein Vater hörte auf zu saufen und die Loslösung der Provinz zu fordern (Tata Mobokoli war für seine Exzesse bekannt). Wortreich brachte er seinen Verdruss zum Ausdruck:
»Es kann im Leben nicht nur darum gehen, sich abzuspalten«, jammerte er. »Gut, mein Sohn ist ein Kleinkrimineller, meinetwegen auch ein Ganove ohne rechten Glanz, aber er ist und bleibt mein Sohn. Ihr könnt nicht verlangen, dass ich mich freue, wenn ich nicht weiß, wo er haust, ob er genug zu essen hat und wie er klarkommt. Solche Mätzchen kennt man seit Babel; die Bälger sind starrsinnig wie ein Fluss. Der Fluss hat keine Nationalität. Folglich besitzt er weder Impfpass noch Ausweis. Ein Fluss durchquert ohne Vorwarnung das Land seiner Wahl. Welche Nationalität hat der Sambesi oder die Donau, die durch zehn Länder fließt? Der Fluss besitzt diese angeborene Frechheit: immerzu strömen und sich nach Lust und Laune durch die Gegend schlängeln. Es gibt Kinder, die machen es genauso. Sie wählen ihren Weg selbst: Vernunft oder im Extremfall eben Schmuggel. Ihr könnt machen, was ihr wollt, für Glück und Wohlergehen sorgen, gewissenhaft über ihre Erziehung wachen, sie mit Liebe überschütten, am Ende entscheidet das Balg doch selbst über seine Zukunft. Was soll ich denn machen? Habe ich mir etwas vorzuwerfen? Ich erwarte nicht, dass jetzt glückliche Zeiten anbrechen, aber ich finde es deplatziert, mich als gescheiterten Vater zu verurteilen.«
Tata Mobokoli schloss seine Tiraden fast immer mit den Worten:
»Die Kinder auf den Straßen von Lubumbashi und Kinshasa bilden eine eigene Rasse, die Rasse der Ausgestoßenen und Benachteiligten, was hat mein Nachwuchs da zu suchen? Wie viele Eltern haben nicht mindestens ein Kind, das abgehauen ist?«
Molakisis Schwestern drehten komplett durch. Es war schwer zu sagen, ob diese Widerspenstigkeit nicht einfach an einer schlecht verdauten Pubertät lag. Sie pöbelten gegen Ordnungskräfte, bedrängten Passanten, pissten unter freiem Himmel und lachten aus voller Kehle. Mama Mobokoli stand ihnen in nichts nach. Sie schwänzte die Erweckungskirche und verweigerte dem lieben Gott das Fasten und Beten, das ihr Hausfrauen-Dasein ausmachte. Viele erkannten in ihrem Verhalten wie auch in der Verzweiflung ihres Mannes eine Spur Zynismus. Sie waren am Boden zerstört, untröstlich, bis ins Mark erschüttert, und das, obwohl sie ihren Nachwuchs noch wenige Wochen zuvor als Knallkopf, Einzeller, feigen Schleimaal oder ähnlich unterirdisches Getier beschimpft hatten, sodass es in ihrer Gesellschaft schon unangenehm wurde, da entweder der eine oder die andere oder beide zusammen im Chor unablässig den Jungen schlechtmachten — und bei Molakisi bedauerlicherweise auf taube Ohren stießen. Damien und Ezechiel, der jüngere und der jüngste Bruder des Ausreißers, waren vielleicht die Einzigen, die sich nicht aus der Ruhe bringen ließen. Seit der Trottel weg war, stolzierten sie strahlend und mit geschwellter Brust in seinen Schuhen durch die Gegend.
Des einen Leid ist des anderen Freud. Als Sanza — ein Freund von Molakisi, der seit einiger Zeit bei der Familie wohnte — seine Matte ausrollen wollte, nahmen die beiden Spinner ihn beiseite.
»Mach dich vom Acker und komm bloß nicht wieder.«
»Hau ab und lass uns in Ruhe!«
Trotz sieben Jahren Altersunterschied hingen Damien und sein Brüderchen ständig zusammen und plapperten, wenn es drauf ankam, einander alles nach. Deshalb wurden sie auch die Siamesischen Zwillinge genannt.
»Die Pause ist zu Ende, Schluss mit der Kompradorenbourgeoisie«, verkündete Damien, während sein Bruder drohend einen Stuhl hob. Sanza fixierte die beiden Brüder. Seine linke Hand zitterte. Er hatte nicht wenig Lust, sie zu Brei zu schlagen. Weil er aber wusste, dass er wenig Aussicht auf Erfolg hatte, sammelte er seinen Kram zusammen — einen leeren Schulranzen, zwei Hosen, eine Strickjacke —, warf ihnen einen letzten grimmigen Blick zu und trat aus der Tür.
3
Sanza in einer Nacht ohne Fusel
Lubumbashi hatte kein Moos angesetzt. Wie früher, als die Bevölkerung beim Angelusläuten ins Stadtzentrum strömte, um sich als Kammerdiener, Ammen, Köche, Boys, Gärtner, Mechaniker, Maurer oder Laufburschen bei den Belgiern, Franzosen oder Amerikanern zu verdingen, und es am Ende des Tages wieder verließ, da sonst Gefängnis oder Prügel drohten, stiefelten die Einwohner von Kamalondo jeden gottgegebenen Tag über die Gleise, die die Vorstadt (oder das, was davon übrig war) und das Zentrum voneinander trennten, und beeilten sich, vor Anbruch der Dunkelheit ins traute Heim zurückzukehren — in Ermangelung einer fahrtüchtigen Karre, einer Fahrkarte oder aus Angst vor den kolossalen Staus. Alles konzentrierte sich auf die Altstadt. Taxifahrer, Büroangestellte, Händler, Schüler, Banker, Arbeitslose, Diebe — in der Vorstadt gab es nicht viel zu klauen, und außerdem machte es sich nicht gut, vom eigenen Nachbarn erwischt zu werden — kamen in Hochstimmung von der Arbeit. Die Scheinwerfer der Schrottkarren durchlöcherten den nicht elektrifizierten Himmel wie ein Feuerwerk. Auch Hühner, Schweine, Ziegen rannten in ihre Bettchen — einige Bewohner hielten Tiere. War es die Sehnsucht nach dem Landleben? Oder Geschäftssinn? Vielleicht beides. Also rannten auch die Tiere. Ausgelaugt von Sonne, Müdigkeit, Schlamm und Staub, dämmerten sie schon vor sich hin, träge und erholungsbedürftig, weil sie, die Rüssel stets in Alarmbereitschaft, den ganzen Tag draußen gewesen waren, sich vergnügt, gejagt, gedöst, im Müll gewühlt und — im Fall der Hunde und anderer Caniden — für nichts und wieder nichts gebellt hatten. Der Staub — der Fluss oder der Schlamm in Zeiten der Sintflut — mischte sich mit der pechschwarzen Nacht. Hupen in der afrikanischen Nacht. Hupen. Und wieder Hupen, das mit Gelächter, sarkastischen Bemerkungen oder Grimassen beantwortet wurde.
»Wie war der Tag?«
»Na ja, Zaire halt.«
»Und wie geht’s der Kleinen? Isst sie schon Brei?«
»Gut sehen Sie aus!«
»Eine schöne Schmonzette …«
»Die Zairer, wie man sie kennt und liebt!«
Die Leute winkten, erkundigten sich nach dem Zustand des Landes und grüßten einander.
Gedankenverloren stieg der junge Mann über die Gleise — den Massen entgegen, die sich wunderten, dass der Junge so spät noch in die umgekehrte Richtung lief —, trat auf die Avenue des Usines, ließ das Krankenhaus Jason Sendwe links liegen, ging am Marché Central vorbei und bog in die Avenue du Marechal Mobutu ein.
»Die Sache ist gebongt, ich schlafe vor der Post!«, überlegte der Junge.
Die Nacht hatte die ganze Provinz fest im Griff. Das Stadtzentrum war wie ausgestorben. Seine Bewohner verschanzt in ihren Behausungen wie in den alten Zeiten der Kolonie.
Alle Kinder, die von zu Hause ausrissen, exilierten sich erst einmal ins Zentrum, bis sie einen Beruf fanden — Schuhputzer, Taschendieb, Tellerwäscher in billigen Restaurants, Detektiv für betrogene Ehemänner und vernachlässigte Frauen, Docker im Hauptbahnhof, fliegender Händler für Säckchen, Sandalen und westafrikanische Secondhand-Boubous, Diamba‑Raucher, Hilfsmechaniker, öffentlicher Schläfer —, in den ersten Zug nach Mbuji-Mayi stiegen oder in einer Mine als Taucher oder Schürfer anheuerten.
Weil er den Weg nicht kannte, stolperte Sanza orientierungslos durch die Gassen. Er dachte sogar daran, umzukehren und klein beizugeben. Beim Gedanken an seine Eltern, die ihn wegen seiner monatelangen Abwesenheit fortjagen, vermöbeln oder schlimmer ausschimpfen würden als je zuvor, blieb er lieber an der frischen Luft — »Was soll ich zu Hause?«, versuchte er sich selbst zu überzeugen. »Meine Freiheit und meine Rechte lasse ich mir nicht nehmen.«
4
Als sich die Madonna noch in Angola aufhielt, war es Balsam für die Seele, Zairer zu sein
Die Madonna hatte zu einer langen Schmährede angesetzt (Lunda Norte von heute Nachmittag, heute Morgen oder auch heute Abend ist nicht mehr die wunderbare Provinz, als die wir Zairerinnen und Zairer sie kennengelernt haben, als wir gleich nach der Unabhängigkeit nach Angola kamen. Sie ist für immer im Schmieröl der Geschichte untergegangen und lässt sich nicht mehr blicken. Einen Rettungsanker gibt es nicht. Meine Brüder, uns stehen Jahrhunderte des Mangels, des Elends und des Unglücks bevor), als man ein Knarren hörte. Vor der Tür stand ein abgerissener junger Kerl, der so hässlich war, dass es schon auf zwei Kilometer Entfernung zu sehen war. Die ursprüngliche Farbe seiner Kleidung ließ sich nur erahnen. In seiner linken Hand trug er einen Koffer, der sich nicht schließen ließ und in dem sich Unterwäsche, zwei Hosen, Socken und eine Schere befanden. Der Jugendliche blinzelte, als würde er zum ersten Mal im Leben die Augen öffnen. Obwohl er völlig erschöpft war von der Corta Marta, einem Schleichweg, den die Schürfer und sonstigen Händler von oder nach Zaire benutzten, schien er fasziniert von dem Schauspiel, das sich ihm bot. Auf seinen spektakulären Ritten auf den Güterzügen, seinen Spritztouren durch die verwinkelten Straßen der Vergnügungsviertel von Kinshasa und seinen Besuchen in der Unterwelt der Provinz Kasaї hatte der Junge von dieser sagenumwobenen Frau gehört, aber als ewiger Zweifler hatte er ihre Wundertaten unterschätzt.
Tshiamuena, die ihn im Eifer des Gefechts gar nicht bemerkt hatte, beschwor mit ihrer tiefen, schmachtenden Klagestimme — mit Schreien garniert — immer noch das Schlaraffenland:
»Das Angola von damals, das Angola der Diamanten, die nie versiegen, das Angola des Glücks, wo es vor Klunkern nur so wimmelte, wo man sie sogar im Müll finden konnte, von wo die wenigen kühnen Zairer, die es wagten, ihre Nase in das Wespennest zu stecken, bis in die vierte Generation gesegnet zurückkehrten. Das war ganz zu Beginn des Krieges, als die Angolaner sich untereinander bekämpften und keine Zeit hatten, sich um ihre Klunker zu kümmern, und wir die Pioniere auf der Jagd nach angolanischen Diamanten waren. Das Angola, dem wir nach der Flucht der Portugiesen so nahegekommen waren, wird es nie mehr geben. Heute, und da wisst ihr mehr als jeder Hellseher, boykottiert die Erde uns mit ihren Diamanten und, was noch schlimmer ist, steigt die Zahl der Anwärter auf Reichtum beträchtlich, sodass man sich fragt, wer überhaupt noch in Zaire bleibt, wenn die gesamte Jugend Lunda Norte überschwemmt … Ach Angola, wenn du uns in deinen Krallen hältst!«
Der Junge nahm seinen Mut zusammen.
»Ich bin auf der Suche nach Tshiamuena«, stammelte er ohne vorzutreten.
Niemand aus der erlauchten Versammlung beachtete ihn. Das Geschwätz der Madonna war wie guter Wein. Zuerst wirst du fröhlich, wenn du ihn trinkst, dann reißt er dir den Boden unter den Füßen weg. Tshiamuena schrie sich heiser, und die Zairer und Zairerinnen (und ein paar handverlesene angolanische Staatsbürger) stimmten in die Beschwörungen mit ein. Sie berauschten sich daran.
Der Junge brach auf dem Boden zusammen. Die Schürfer waren so gebannt, dass keiner von ihnen es bemerkte, sich ärgerte, verblüfft aufschrie oder ihm zu Hilfe eilte. Sekunden, Minuten, Stunden verstrichen, bis Tshiamuena während einer ihrer Geschichten den Kopf hob und den leblosen Körper erblickte. Sie schrie:
»Da habt ihr das Angola von heute. Jemand ringt mit dem Tod, und ihr verschränkt die Arme!«
Wut, Trauer oder Erstaunen. Auf das Gebrüll der First Lady folgte ein allgemeines Durcheinander. Alle kamen näher und stürzten sich auf den Körper. Der eine wollte Erste Hilfe leisten, der andere Zweite, der Nächste lauthals den lieben Gott anflehen oder die Dämonen der Krankheit, der Unfälle und des Todes austreiben — »Geister der Finsternis, verlasst diesen Körper; ich befehle euch im Namen Jesu Christi, verschwindet!« —, damit der Junge wieder zu atmen begänne. Alle nutzten die Gelegenheit, um Tshiamuena zu beweisen, dass sie ein großes Herz besaßen. Der Zirkus um den Jungen machte sie aber nur noch wütender. Sie fühlte sich gekränkt, gedemütigt, tief getroffen und ihrer Menschlichkeit beraubt.
»Eles são todos mentirosos …«
Sie flüsterte einen Satz auf Portugiesisch. Diese Sprache gebrauchte sie nur, wenn es sich um einen Fall von höherer Gewalt handelte. Seit vorsintflutlichen Zeiten hatte man sie überhaupt nur bei zwei Gelegenheiten in dieser Sprache sprechen hören. Das letzte Mal, als Zeze, ein junger angolanischer Taucher, nicht wieder an die Oberfläche gekommen war. Sein Verschwinden hatte für helle Aufregung innerhalb der zairischen Diaspora in Lunda Norte gesorgt. Von Selbstmord, Auftragsmord, menschlichem oder Materialversagen bezüglich der fragwürdigen Beschaffenheit des Bootes, bis hin zu Bezichtigungen der Hexerei und der weißen Magie wurden alle Möglichkeiten erwogen. Um das hartnäckigste, am weitesten hergeholte, dümmste und unangebrachteste Gerede zu unterbinden, trommelte die Madonna alle zairischen Garimpeiros zusammen — einschließlich derer aus Kasaï, ihrer Heimatprovinz —, die im richtigen Alter waren, um anderen an den Kragen zu wollen oder sonstige Dummheiten zu machen, und geigte uns ihre vier Wahrheiten. So hatte ich sie noch nie erlebt. Sie schimpfte in lupenreinem Portugiesisch. Das Angola der Minen und seine (Bett-)Geheimnisse. Wo hatte sie bloß dieses wunderbare Angolanisch gelernt?
Zwei Hünen schafften den leblosen Körper zum anderen Ende des Raumes. Im Wechsel verpassten sie ihm Herzmassagen, ohne überzeugendes Ergebnis. Tshiamuena begann zu weinen. Ihre Vergangenheit als professionelles Klageweib machte sich bemerkbar. Große Tränen strömten über ihr Gesicht. Plötzlich hatte einer der Kerle eine geniale Idee.
»Ein feuchtes Tuch!«
Die Madonna verschwand, tauchte eine Sekunde später mit einem Handtuch wieder auf und kümmerte sich höchstpersönlich darum, dem Jungen die Stirn damit abzutupfen, der schon bald unter dem frenetischen Beifall der anderen zum Leben erwachte.
Die Madonna war eine Frau mit hohem moralischen Anspruch und zudem äußerst fürsorglich veranlagt. Wir alle hätten sie gerne als Ehefrau, Mutter, Großmutter, Schwägerin, Ahnfrau, Vorfahrin, Urahnin, Stammesgründerin, Matriarchin und so weiter gehabt. Ich kenne welche, die hätten alles dafür gegeben — sogar ein paar Karat Diamant —, um sie als Cousine dritten Grades zu bekommen, und das trotz ihrer Ermahnungen, die ans Lächerliche grenzten — »Franz, du hast seit Monaten nicht mehr geduscht, und dein Mundgeruch bringt die Leute ganz aus dem Konzept, wenn du mit ihnen sprichst!«
Tshiamuenas Gefühlslagen waren so wechselhaft, dass man nur mit Mühe erraten konnte, in welcher Stimmung sie gerade war; selbst, wenn sie glücklich war, zeterte sie herum, grüßte nicht und hielt den Zairern (männlichen und weiblichen Geschlechts) und den Angolanern bei jeder Gelegenheit eine Moralpredigt.
Als wir schon alle dachten, sie wäre gegangen, um sich ein bisschen zu entspannen, kreuzte sie mit einem Topf randvoll mit scharfen Bohnen und Süßkartoffeln wieder auf, dazu ein Emaillebecher, eine Kanne Saft, ein Löffel und sogar ein Tischtuch.
Eine Frau ihres Kalibers ruht sich nicht aus, wie soll man mit einer solchen Last auf den Schultern auch ein Nickerchen halten? Es galt, die sterblichen Überreste der zairischen Schürfer nach Kinshasa oder in die Provinz Kasaï zu repatriieren, unzählige Mäuler zu stopfen, die Gefangenen aus den Klauen der angolanischen Regierung oder der UNITA-Rebellen zu befreien, die Wunden oder schmerzenden Knochen der Opfer (von Erdrutschen) zu versorgen, Schlägereien und sonstige Generationenkonflikte zu schlichten, psychologischen Beistand für die Schwächsten und Portugiesisch- und Tschiluba‑Kurse für alle zu organisieren, Hochzeiten zu leiten, an Pocken oder Typhus Erkrankte zu heilen …
Wir ließen sie den ganzen Krempel alleine anschleppen. Aus Eifersucht. Womit verdiente dieses Kind, das aus wer weiß welchem Gestrüpp gekrochen kam, solch beinahe fürstliche Ehren? Der Junge leckte sich die Lippen, als er die Bohnen erspähte. Breitbeinig saß er da und mampfte, ohne den Topf aus den Augen zu lassen, als würde seine Suppe sich sonst in Luft auflösen. Er verschlang den letzten Bissen, wischte sich über den Mund und stand auf ohne das kleinste Zeichen der Dankbarkeit, um sich sonst wohin zu verpissen. Das Geschrei dämpfte seinen Eifer.
Jeden Abend wurden in ihrem Wohnzimmer Zusammenkünfte abgehalten. Junge und weniger junge zairische und angolanische Schürfer lehnten an Bänken, rauchten, diskutierten lautstark, spielten Karten und warben potenzielle Arbeitskollegen an. Zu jener Zeit waren die Minen von Cafunfo in der angolanischen Provinz Lunda Norte die ergiebigsten in ganz Zentralafrika. Die Zairer, die es dorthin zog, wurden in Rekordzeit reich. Dann kehrten sie zurück nach Kinshasa, zogen nach Libreville in Gabun oder gingen nach Europa und kamen erst zurück, wenn sie das ganze Geld verprasst hatten. Die Minen von Cafunfo standen auch in dem Ruf, ein riesiges Hospiz zu sein. Sie folgten einem Rhythmus von drei Erdrutschen pro Tag. Jedenfalls erforderte der Abbau massenhaft flexible Arbeitskräfte. Kam jemand bei einem Erdrutsch zu Tode, wurde er so schnell wie möglich begraben. Auf der Stelle wurden neue Schürfer rekrutiert. Alle neuen Kandidaten, die im Laufe des Tages ankamen, durchliefen dieses Ritual, um Zugang zu den Klunkern zu erhalten. Sie gaben Auskunft über ihre Person, beantworteten reihum die (teilweise erniedrigenden) Fragen der Hausherrin und die der anderen Schürfer, die in Scharen kamen, um dem Einstellungstest beizuwohnen. Wenn es einem Bewerber gelang, ein Schürferteam zu begeistern, wurde er in ihren Rennstall aufgenommen. Die Arbeit in einer Mine ist eine der gemeinschaftlichsten der Welt, jeder Rennstall bestand aus jungen und weniger jungen Leuten, Champions im Apnoetauchen, Froschmännern, Kasabuleurs oder Minentauchern, um die Klunker aus dem Kwango‑Fluss zu fischen; den Dona Moteurs, die das Schiff und die Tauchausrüstung stellten; den ausdauernden Schürfern oder Karimbeurs, um in den Tiefen zu hacken; den Mwetistes mit ihren kräftigen Armen, um die Kiesel aus dem Fluss zu ziehen, wenn der Taucher die Eimer randvoll gefüllt hatte; einem äußerst agilen Team, einem Infanterieregiment nicht unähnlich, um die Ware zum Fluss zu befördern, wo sie direkt von den Lavadores verlesen und gewogen wurde, um dann von denselben Lavadores oder anderen Mwetistes zu behelfsmäßigen Lagern gebracht zu werden; einem guten Sponsor oder Patrocinador, falls die Dona Moteur nicht reich genug war, um die Arbeitswerkzeuge zu stellen, die Fressalien, das Bier und die Zigaretten zu kaufen, eine Abbaugenehmigung bei den Truppen der UNITA zu erwirken, der Rebellion von Jonas Savimbi, die die Region von Cafunfo kontrollierte, wofür der Patrocinador im Gegenzug Prozente auf jeden geförderten Stein bekam. Die Kette der Kooperationen der Schürfer und ihrer Mitarbeiter spannte sich von Kinshasa und Bandundu über zahlreiche Unterhändler und Vermittler bis nach Antwerpen. Denn ein Diamant oder jeder beliebige Stein aus der angolanischen Provinz Lunda Norte oder aus Kasaï besaß nicht den geringsten Wert, solange er nicht auf dem internationalen Markt landete.
Die Madonna schlug vor — der Begriff ist nicht ganz richtig, sie bestimmte über euren Kopf hinweg und ohne Rücksicht auf die Gerüchteküche oder eventuelle üble Nachrede —, die Rubrik Gemischtes zu überspringen und gleich zum Einstellungsgespräch überzugehen. Sie beschloss, dem Neuling den Vortritt zu geben. Wir in der ersten Reihe hatten, dank einer Öllampe, die einmalige Gelegenheit, den Anblick des Jungen zu genießen. Das musste man gesehen haben. Ausweichender Blick. Eine Haltung wie ein Rheumakranker. Die Zähne seit Jahrzehnten nicht geputzt. Eine völlig verwaschene Hose. Das Wams ebenso. Zerknittertes Hemd. Ausgelatschte Schuhe, und zu allem Überfluss eine Boxernase. In der Mine erzählte man, dass Geld Hässlichkeit lindert, dass Unansehnlichkeit, wenn man ein armer Teufel und verlottert war und nicht genug zu beißen hatte, noch zunahm und sich ausbreitete. Tshiamuena sah das genauso, obschon sie versuchte, nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Von Natur aus missgestaltet, hatte der Junge sozusagen seinen eigenen Rekord übertroffen. Und Tshiamuena brach ohne erkennbares Motiv in lautes Lachen aus — das passierte höchstens einmal im Jahr. Um nicht blöd dazustehen, tat er es der Grande Dame gleich. Dieses hingeschluderte Verlegenheitslachen verlieh seinem Gesicht etwas Maskenhaftes. Tshiamuena waren, schon weil sie mitten unter uns lebte, ihre Rolle und der extravagante Spitzname, Madonna der Minen von Cafunfo, wie auf den Leib geschnitten. Jäh wurde sie ernst und schleuderte ihm die erste Frage ins Gesicht.
»Hast du auch einen Namen?«
»Ja …«
»Und der wäre?«
»Molakisi …«
»Und woher kommst du?«
»Aus Zaire.«
»Das ist uns klar.«
»Aus Lubumbashi. Ich habe auch in Kasaï und Kinshasa gelebt.«
»Tolle Erfolgsbilanz«, pfiff jemand im Raum.
Dieser Kommentar sorgte für unangebrachte Heiterkeit.
»Suchst du Arbeit?«
»Ja. Man hat mir gesagt, hier gibt’s Diamanten zu holen.«
Gelächter unter den Versammelten. Spott. Eine boshafte Bemerkung zu seiner Nase und seinem antiken Koffer.
»Dein Alter? Aber das natürliche, dein Geburtsalter, nicht das offizielle.«
Die Madonna hing am Alter und an allem, was damit zu tun hatte. Es war eins ihrer zahlreichen Lieblingsthemen — »Immerhin kann man nicht leben, ohne sein Alter zu kennen oder wenigstens irgendein Datum an den Haaren herbeizuziehen«, entschuldigte sie ihre Neugier.
»Im November werde ich sechzehn.«
Tshiamuena wurde ärgerlich:
»Und du willst mit sechzehn schon reich sein? Mit sechzehn! Sechzehn und schon ein Spießer, ist das nicht ein bisschen früh?«
Molakisi war empört.
»Denkst du, ich bin dein Schoßhund?«
Er hatte sich blamiert, indem er den braven Jungen gespielt hatte — was eigentlich gar nicht seine Art war: Zu seiner Zeit in Lubumbashi, Kinshasa und selbst in Kasaï war er als Schläger bekannt, der den Leuten bei der geringsten Kleinigkeit an die Gurgel ging. Die Madonna war sprachlos. Damit hatte sie nicht gerechnet.
»Als Nächstes verlangst du von mir die Zustimmung der Eltern. Du kennst mich nicht einmal und mischst dich schon in mein Leben ein …«
Pfiffe. Ein Militär zog seinen Revolver. Wütend trommelten die Schürfer auf die Bänke: Was fällt dir ein, in so einem Ton mit Tshiamuena zu sprechen? Hast du eigentlich schon mal in den Spiegel geschaut? Die Jugend von heute! Wir sind hier in Angola, ein bisschen Respekt für Tshiamuena, wenn ich bitten darf! Nimm das sofort zurück, Australopithecus! Du kannst ihr doch gar nicht das Wasser reichen … Du bist noch Jungfrau, hast von der Liebe keine Ahnung und ziehst über die Alten her? Geh erstmal eine Nummer schieben, dann treffen wir uns auf Augenhöhe. Ach! Diese Zairer des 20. Jahrhunderts …
Molakisi verwechselte die Mine mit der Straße. Er, der nichts als Schlägereien, Erpressung, Drohungen und fiese Tricks im Kopf hatte, war auf Leute gestoßen, die die gleichen Vorlieben pflegten. Er entschuldigte sich mit den Worten:
»Ich wollte dich nicht beleidigen …«
Die Madonna beschleunigte die Fragerunde. Die spöttischen Rufe, er möge doch nach Zaire zurückgehen, wurden lauter. Wie zu erwarten, war es erneut Tshiamuena, die dem jungen Mann zu Hilfe kam:
»Er ist noch ein Kind …«
»Ein Kind muss lernen, den Mund zu halten!«
»Wir haben die Schnauze voll von diesen Geizkrägen, die keinen Respekt für dich übrighaben.«
»Mir gefällt sein Gesicht nicht!«
»Diese Boxernase …«
Molakisi kam aus der Deckung:
»Ihr könnt mich nicht einschüchtern. Dafür müsst ihr schon mehr bieten als das bisschen Krach.«
Der Neffe von Zeze, Pedritto — der mit vierzig noch an den Nägeln kaute und am Daumen lutschte —, stürzte sich auf Molakisi, der seiner Faust nur knapp auswich. Agil wie eine Turnerin sprang Tshiamuena zwischen die Streithähne. Sichtlich verärgert über den Angriff auf den jungen Molakisi, richtete sie ein paar Worte auf Portugiesisch an Pedritto, bevor sie ihm befahl, sich vom Acker zu machen. Dieser versuchte noch, sie umzustimmen — »Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, das ist eigentlich gar nicht meine Art« —, aber Tshiamuena nahm, sehr zum Missfallen aller zairischen Garimpeiros, seine Entschuldigung nicht an.
Wie ein Haar in die Suppe fällst du in eine Mine ein, in der du niemanden kennst, ohne einen Cent in der Tasche, der ärmste aller Teufel — um in Pedrittos Worten zu sprechen —, versifft, ausgehungert und mickeriger als der Durchschnitt, und trotzdem gibt Tshiamuena dir eine Chance; sie liest dich auf, wacht über deine Gesundheit, als wärst du aus Porzellan, versorgt dich mit einem Bett, einem Kissen und einem Laken, Kost, sauberer Kleidung, und das alles ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten, und du scheffelst Geld und denkst nicht mal daran, deinen Anteil zurückzuzahlen, und am Ende schmeißt du sie weg wie eine Barbiepuppe.
5
Sanza, die Nacht und ihre ganze versandende Pracht
Das Stadtzentrum war wie eine ausgepresste Frucht. Die Arbeiter eilten zurück in die Vorstadt. Sanza rückte auf der Avenue des Usines vor. Drei Kinder seines Alters stolperten auf die Grand‑Place. Der Stämmigste war mit Kochutensilien behängt. Seine beiden Gesellen flankierten ihn, jeder mit einer Basttasche voller Essen. Selbstsicher kam er näher. Mit festem Schritt, die Arme locker am Körper, den Hals leicht gestreckt, den Kiefer angespannt wie ein Würdenträger, der die Truppen abschreitet. Seine Kumpel quasselten ohne Punkt und Komma. Sie schmierten ihm Honig ums Maul. Allem Anschein nach versuchten sie, ihm ein Lächeln oder seine Zustimmung zu entlocken. Sie ließen sich über den Tag aus, lachten lauthals, tobten vor Freude, fluchten … Routiniert in seiner Rolle als großer Manitu, zeigte der Kräftige wenig Begeisterung. Bei ihrem Anblick musste Sanza an Molakisis wiederholte Warnungen denken — ein richtiger Mann lacht nicht alle dreißig Sekunden. Das schadet der Männlichkeit. Der Stämmige machte hin und wieder einen Kommentar und wenn seine Kameraden laut losprusteten, betrachtete er sie herablassend, wie Insekten. Die Prozession überquerte die Avenue Mobutu, hielt vor der Post und legte, weiterhin in Hochstimmung, das Gepäck ab. Einen Steinwurf von Sanza entfernt. Er suchte Kontakt.
»Hallo Jungs.«
Sie ließen durchblicken, dass ihre Prioritäten woanders lagen:
»Er will uns provozieren.«
»Seine Fresse gefällt mir nicht.«
»Lubumbashi ist auch nicht mehr das, was es mal war. Alles voller Hinterwäldler.«
»Wie der aussieht …«





























