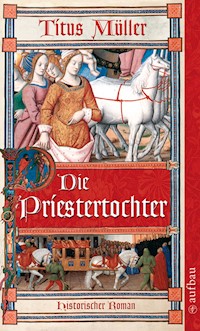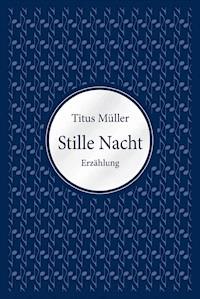9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Einer der spektakulärsten Stoffe des 20. Jahrhunderts – mitreißend erzählt
Für Nele Stern wird ein Lebenstraum wahr: Als Barfußtänzerin feiert sie ihren ersten Soloauftritt im renommiertesten Varieté ihrer Zeit, dem Berliner Wintergarten. Doch sie fällt beim Publikum als zu prüde durch. Da sie auch in Paris keine Auftrittsmöglichkeiten findet, beschließt sie, nach Amerika auszuwandern: Das Geld reicht gerade noch für eine Fahrt in der 3. Klasse der Titanic. Als sie sich an Bord des Luxusliners zu einem Diebstahl hinreißen lässt, lernt sie Matheus kennen, einen ebenso liebenswürdigen wie hypochondrischen Pastor aus Berlin. Er reist mit Frau und Kind, durchlebt aber offensichtlich gerade eine Ehekrise. Ungeniert flirtet seine Frau, die aus gutem Hause kommt und deren Vater der Hofbankier des deutschen Kaisers ist, mit einem jungen Engländer, der sich höchst verdächtig benimmt. Tatsächlich ist er ein Spion der britischen Krone, und er hat sich keineswegs zufällig auf die Frau des Pastors kapriziert, sondern will über sie an geheime Dokumente des Hofbankiers herankommen. Der Zusammenstoß der Titanic mit einem Eisberg stürzt die Reisenden in einen Mahlstrom aus Wasser und Eis – und setzt Liebe und Freundschaft einer weiteren Zerreißprobe aus. In diesem ebenso brillant recherchierten wie fesselnd erzählten Roman wirft Titus Müller ein neues Licht auf die Bedeutung der Titanic in der Zeit europäischer Aufrüstung und schildert einfühlsam Menschen am Scheideweg ihres Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 513
Ähnliche
Titus Müller
Tanz unter
Sternen
Titus Müller
Tanz unter
Sternen
Roman
Karl Blessing Verlag
1. Auflage
Copyright © 2011 by
Titus Müller und Karl Blessing Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Hauptmann und Kompanie Werbeagentur, Zürich
Satz: Leingärtner, Nabburg
ePub-ISBN 978-3-641-06443-3
www.blessing-verlag.de
Für Lena
I LÜGE
I
Lüge
1
Mondlicht spiegelte sich in den Pfützen am überschwemmtenTunnel der Untergrundbahn. Es roch nach feuchtem Zement. Der Mann mit den schwarzen Handschuhen lud acht Patronen in das Magazin seiner Pistole und schob es mit einem Ruck zurück in den Griff der Waffe. Er steckte die P08 in das verborgene Halfter an seinem Rücken.
Vor zwei Wochen war hier die Spree in den Tunnel eingebrochen, in dem Moment, als man Nord- und Südstrecke miteinander verband, und hatte die U-Bahn bis zum Potsdamer Platz überschwemmt. Ein neuer Wall war errichtet worden, um das Wasser aufzuhalten.
Der Mann stieg über Eisenbleche, Sandsäcke und Schaufeln. Er sah sich aufmerksam um, bevor er in den Schatten eines Bauwagens trat.
Ein zweiter Mann tauchte auf, klein, schmächtig, mit Drahtbrille. Der Zylinder auf seinem Kopf schimmerte im Sternenlicht. Der Mann trug einen feinen Gehrock und fluchte bei jedem Schritt. Seine Schuhe sanken im Schlamm ein. Verzweifelt sah er sich um.
»Guten Abend«, ertönte hinter ihm eine Stimme. Aus dem Schatten des Bauwagens löste sich eine Gestalt mit schwarzen Handschuhen.
»Musste es sein, dass wir uns auf dieser morastigen Baustelle treffen?«
»Durchaus.«
»Wer sind Sie, und warum wollten Sie mir am Telephon nicht Ihre Identität enthüllen?«
»Haben Sie den Artikel?«
Der kleine Mann kniff unwillig die Augen zusammen. Schließlich nahm er seine Tasche vor die Brust und zog einen Papierbogen heraus.
»In der Redaktion der Berliner Zeitung weiß man noch nichts von Ihren Recherchen?«, fragte der andere.
»Bisher nicht.«
»Geben Sie mir den Text.« Der Große streckte die Hand nach dem Papier aus.
Der Mann mit dem Seidenzylinder schüttelte den Kopf. »Erst will ich ein paar Antworten. Wieso sind Sie bereit, dreißig Mark für einen einfachen Artikel zu bezahlen? Und was stellen Sie damit an? Von welcher Redaktion sind Sie geschickt?«
»Das sage ich Ihnen, wenn ich den Artikel gesehen habe.«
Widerwillig reichte ihm der Journalist das Papier, und der Große zog eine Taschenlampe hervor, ein Ding aus Blech, das er mit einem Drehschalter entzündete. Er richtete den Lichtkegel auf das Blatt. Im Widerschein, der vom Papier ins Gesicht des Mannes fiel, traten feine Gesichtszüge hervor, das Antlitz eines Dandys, nur die Lippen waren blass und streng.
Deutsche Firmen statten größtes Dampfschiff der Welt aus
Die Innenausstattung der Titanic ist nahezu abgeschlossen. Britische Nationalisten überschlagen sich vor Stolz, aber ein Reporter der Berliner Zeitung enthüllt: Bevor der weltgrößte Dampfer am Mittwoch nächster Woche zu seiner Jungfernfahrt aufbricht, liefern deutsche Firmen Teile der luxuriösen Ausstattung. So stammen die Sportgeräte für den Gymnastikraum von der Firma Rossel, Schwarz & Co. AG aus Wiesbaden. Steinway’s Pianofortefabrik in Hamburg liefert fünf Flügel, jeweils 2,11 Meter lang, und drei Konzertklaviere für die Speisesäle und das Treppenhaus der ersten Klasse. Selbst bei ihrem Prestigeobjekt kommen die Engländer nicht ohne deutsche Hilfe aus.
Schon im Mai, gute vier Wochen nach der Titanic, läuft das deutsche Schiff Imperator vom Stapel. Spätestens in einem Jahr wird sein Innenausbau abgeschlossen sein. Dann löst es die Titanic als größten Dampfer der Welt ab. Der deutsche Flottenbau triumphiert.
Der Mann hob die Taschenlampe und blendete sein Gegenüber. »Haben Sie eine Abschrift Ihres Entwurfes zu Hause?«
Der Gefragte hielt sich den Unterarm vor die Augen. »Nehmen Sie die Lampe runter!«
»Haben Sie oder haben Sie nicht?«
»Nein.«
Er schaltete die Taschenlampe aus. Ruhig zog er die Pistole aus dem Halfter. »Knien Sie sich hin«, befahl er. Er richtete die Pistolenmündung auf den Journalisten.
»Sind Sie übergeschnappt?«
»Ich sagte: Knien Sie sich hin.«
Der Journalist ging in die Knie. Seine blassgestreifte Hose versank im Morast, an der Bügelfalte gluckerte schmutziges Wasser herauf. »Nehmen Sie den Artikel, nehmen Sie ihn einfach …«
Der Mann mit den dunklen Handschuhen setzte ihm die Mündung an die Schläfe und drückte ab. Es krachte. Vom Schuss wurde der Körper des Journalisten hingeworfen, in den Schlamm gestreckt. Sein Mörder drückte ihm die P08 in die rechte Hand und bog die Finger des Toten um den Griff der Waffe.
Er steckte sich den Artikel in die Jackentasche und ging.
*
Die Schiffswand riss. Wassermassen strömten hinein und spülten Matheus aus seinem Bett, das Meer packte ihn und zog ihn durch den Spalt hinaus in die Schwärze. Er sah das Schiff, es hing schief im Wasser. Ihn aber saugte das Meer gierig in die Tiefe, bald war der Schiffsrumpf nur noch ein entfernter heller Punkt, und um ihn herum herrschte Dunkelheit. Obwohl er verzweifelt versuchte, die Lippen geschlossen zu halten, drang das Salzwasser in seinen Mund ein, es jagte die Gurgel hinab und füllte die Lungen bis in den letzten Winkel mit Kälte. Er hielt es nicht mehr aus, er musste nach Luft schnappen. Da war keine Luft, nur das Meer, und während er zu atmen versuchte, drang es noch tiefer in ihn ein. Seine Glieder zuckten. Er wollte schreien und konnte es nicht, er wollte schwimmen, nach oben entkommen, er ruderte und strampelte. Anstatt aufwärts zu gelangen, sank er immer tiefer hinab.
Matheus riss die Augen auf. Er japste nach Luft, richtete sich im Bett auf. Nur ein Traum, es war nur ein Traum gewesen. Das Nachthemd klebte an seiner Haut, nass vom Meerwasser. Nein, es war durchgeschwitzt.
Cäcilie richtete sich ebenfalls im Bett auf. »Geht es dir nicht gut?«, fragte sie. »Hast du Fieber?«
»Ich hatte einen Albtraum. Ich bin ertrunken.«
»Das ist jetzt sechs Jahre her. Und du warst nicht mal im Wasser, ihr seid doch rechtzeitig gerettet worden von eurem Mittelmeerdampfer.«
Er ließ sich wieder auf den Rücken sinken. »Wir mussten die Schwimmwesten anziehen. Diese Angst kann ich nicht vergessen, die Angst zu ertrinken.«
»Euer Schiff war bloß leckgeschlagen. Ich fasse es nicht, dass du das dauernd aufbringst.«
Er schloss die Augen und sah das Wasser vor sich, eine dunkle, wogende Masse.
»Warum hast du solche Angst vor dem Tod?«, fragte Cäcilie und legte sich wieder hin. »Du glaubst an die Ewigkeit, du vertraust darauf, dass Gott dir eine Wohnung im Himmel geben wird, oder etwa nicht? Du bist Pastor, Matheus. Du bringst den Leuten bei, dass das irdische Leben nur die Theaterprobe ist.«
Das stimmte. Aber anstatt sich auf das ewige Leben zu freuen, fürchtete er sich davor zu sterben.
Er lag da und starrte in die Dunkelheit. Er hörte auf seine Atemzüge. Erstaunlich, dass da ein Herz in seiner Brust schlug, ein Muskel, der jahrzehntelang unermüdlich Blut durch die Adern pumpte. Tagsüber fütterte man den Körper mit Sardellenbrötchen, Schokolade oder Klößen, und der Körper machte daraus Hautzellen, Fingernägel, Knochen und Fleisch. Was für ein seltsamer Prozess! Wie konnte aus Schokolade lebendiges Fleisch werden?
Er wartete lange, um sicherzugehen, dass Cäcilie eingeschlafen war. Dann richtete er sich auf, tastete mit den Füßen nach den Pantoffeln, schlüpfte hinein und schlich durch den Flur ins Arbeitszimmer. Der kleine Ofen hatte den Raum überheizt. Stickige warme Luft legte sich auf seine Wangen, sie roch nach den Ledereinbänden seiner Bücher.
Durch das Fenster fiel Licht der elektrischen Straßenlaterne und färbte die Wände blau. Er kniete sich vor den Schreibtisch, sah noch einmal zur Tür und überzeugte sich, dass Cäcilie ihm nicht gefolgt war. Er zog die dritte Schublade auf. Unter einem Folioheft fischte er das Telegramm hervor. Er hielt es in den blauen Lichtschein.
Telegraphie des Deutschen Reichs
Amt Charlottenburg 1
Telegramm aus Chicago
Der Text darunter war in Englisch verfasst. Das Moody Bible Institute lud ihn nach Amerika ein, die Überfahrt werde bezahlt. Thank you for your inquiry, stand da. Den ganzen Tag, seit der Postbote da gewesen war, hatte er sich darüber gewundert. Er hatte sich dieser christlichen Vereinigung aus Chicago nie angeboten.
Die Fahrt über das Mittelmeer vor sechs Jahren sollte seine letzte Schiffsreise gewesen sein, das hatte er sich geschworen, als der leckgeschlagene Dampfer mit Schlagseite in den stürmischen Wellen hing und ihm der Rettungsgurt den Leib abschnürte. Schon der bloße Gedanke an ein Schiff ließ kalte Wogen an seinen Beinen herauflecken.
Im Flur ging das Licht an. Rasch legte er das Telegramm ins Schubfach und stand auf. Cäcilie erschien im Nachthemd an der Tür. »Was machst du da?«
Der Schreibtisch stand zwischen ihnen, sie konnte die Schubladen nicht sehen. Vielleicht hatte sie nichts bemerkt. Vorsichtig schob er mit dem Bein die Lade zu, während er nahe an den Schreibtisch herantrat. Er machte ein gequältes Gesicht. »Die Beerdigung am Donnerstag geht mir nicht aus dem Kopf. Was soll ich den Angehörigen sagen? Das Mädchen war erst sechzehn! Ich begreife ja selber nicht, wie Gott das zulassen konnte.« Er nahm den Predigtentwurf vom Schreibtisch und hob ihn hoch. »Ich schreibe fünf Sachen hin, und vier davon streiche ich wieder durch.«
»Komm, leg dich ins Bett«, sagte sie. »Es wird nicht besser, wenn du im Halbschlaf darüber brütest.«
2
Nele kauerte sich nieder und legte ihre flache Hand auf den Bühnenboden. Er roch nach Holz und »Vim«-Putzmittel, eine Mischung, die seltsamerweise ihren Appetit anregte: Hineinbeißen müsste man, in diese Bühne hineinbeißen! Eine Staubflocke flog über das Parkett. Nele fing sie auf. Natürlich, es war Dreck, aber der Dreck flüsterte von Weltruhm. Unter den fünfzig Berliner Varietés rangierte der Wintergarten ganz vorn. Hier gastierten Stars wie der Meisterhumorist Otto Reutter oder der Entfesselungskünstler Houdini.
Noch war der berühmte Sternenhimmel nicht entzündet. Die Vorbereitungen für den Abend liefen auf Hochtouren. Nele stieg von der Bühne hinunter und spazierte an ihren ehemaligen Kollegen vorbei, die Kisten mit Champagner und Wein aus dem Keller herbeischleppten und das Buffet aufbauten. »Braucht ihr Hilfe?«, fragte sie und fegte Krümel von der Tischdecke.
»Wir schaffen das schon«, sagte der Koch.
Hinter ihr raunte Peto: »Unsere Künstlerin hält sich für was Besseres«, und kniff sie in die Seite.
Nele sprang dem Koch in die Arme und lachte.
»Alles Gute für nachher«, sagte Peto. Sein aufgedunsenes Gesicht strahlte Wärme aus. »Wir sind stolz auf dich, Nele. Vergiss uns nicht, wenn du berühmt geworden bist, ja?«
»Erst mal muss heute der Auftritt gelingen.« Sie ging zu den Trampolinartisten, die in Bademänteln ihr Gerät überprüften, elf Schritte machte sie, und bei diesen elf Schritten verlor sie alles, was sie an fröhlicher Selbstsicherheit besessen hatte. Das war nicht mehr Bedienungspersonal – hier begann das Reich der Artisten und Künstler. Als Eindringling kam sie und behauptete, von nun an dazuzugehören. »Ich wünschte, ich könnte fliegen so wie ihr.«
Erich, der Ältere, sah sie an. »Nele, du kannst auch fliegen. Auf eine andere Art als wir, aber du fliegst. Lass dich nicht von Senta einschüchtern.«
»Manchmal frage ich mich –«
»Da kommt sie«, sagte der jüngere Artistenbruder. »Passt auf, was ihr redet.«
Falls Senta etwas gehört haben sollte, so ließ sie es sich nicht anmerken. Sie warf ihre schwarz gelockten Haare zurück und legte den Kopf schief wie ein kleines Mädchen, während sie die Hand nach Nele ausstreckte. »Komm noch mal kurz, ich habe ein paar Ratschläge für dich für heute Abend.«
Erich sah Nele eindringlich an.
Hab schon kapiert, dachte sie, ich soll nicht mitgehen. Sie blinzelte ihm verschwörerisch zu und ließ sich von Senta fortziehen.
»Wie fühlst du dich, wenn du an den Auftritt denkst?«, fragte Senta.
»Gut.«
»Vor Publikum ist es etwas anderes als in den Proben. Im ersten Moment wirst du dich an nichts erinnern. Ein furchtbarer Augenblick …«
»Bisher war’s nie so.«
»Doch nicht bei deiner Kaninchennummer.« Senta schnaubte verächtlich. »Da ging es um die Kaninchen und den Zauberer. Du warst bloß Gehilfin. Nachher bist du allein auf der Bühne, ist dir das bewusst?«
Sie versucht, mir Angst zu machen, dachte Nele. »Was rätst du mir?«
»Irgendwann fällt dir der Tanz wieder ein, das kommt schon. Hoffen wir, dass der schreckliche Moment nicht zu lange anhält.«
Wie dreist von ihr. Kein Wunder, dass sie Wert darauf gelegt hatte, allein mit ihr zu sprechen.
»Weißt du, Nele, was mir Sorgen macht? Du bist keine Künstlerin. Schon wie du läufst! Halt die Schultern gerade, bleib geschmeidig in der Hüfte! So geht das nicht. Dazu dieser bäurische Blick! Dein Körper spielt nicht. Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber als Künstlerin muss man Selbstbewusstsein haben. Eine Ausstrahlung, eine Faszination. Die kann man sich nicht durch Tanzunterricht aneignen. Du wirst es schwer haben.«
Nele wand sich aus ihrem Arm. »Das ist unverschämt, wie du hier mit mir redest.«
»Du tanzt ja ganz passabel«, sagte Senta, »das bestreite ich nicht. Was man einüben kann, hast du eingeübt. Ich will nur nicht, dass du enttäuscht bist nach dem Auftritt heute. Als erfahrene Tänzerin muss ich dir das sagen. Ich glaube nicht an deinen Erfolg.«
Wieder stach sie zu mit ihrem vergifteten Messer. Unwillkürlich fragte Nele sich: Was, wenn sie recht hat?
»Direktor Hundrich glaubt auch nicht, dass du besonders gut ankommen wirst«, setzte Senta nach.
»Unsinn! Er glaubt an mich, sonst hätte er mich nicht ins Programm genommen.«
»Schätzchen, was bezahlt er dir? An deinem Lohn kannst du schon sehen, dass er kaum mit einem Durchbruch rechnet. Aber spinn dich ruhig in deine Träume ein und bau weiter an deinen Luftschlössern!«
Nele blieb stehen. »Du versuchst mir Angst einzujagen, damit ich heute Abend versage«, zischte sie. »Dabei bist du es, die sich fürchtet, sonst wäre ich dir doch egal! Du zitterst, dass ich besser werden könnte als du.«
Senta lachte. Ihr ganzer Körper bäumte sich auf in diesem Lachen. »Besser als ich? Meine Liebe, da habe ich keine Befürchtungen.« Sie wischte sich Tränen aus den Augenwinkeln. »Ich mag es nur nicht, dass du mit deiner Stümperei ein schlechtes Licht auf den Solotanz wirfst. Er ist etwas Majestätisches, verstehst du? Aber nein, das verstehst du nicht. Ich muss zur Garderobe. Hals und Beinbruch, Nele.«
Im vorderen Teil der Bühne stellten sich Dutzende von Frauen in knappen Kostümen auf. Auf ein Zeichen des Direktors hin erscholl Musik. Licht flammte auf. Die Frauen kamen in wiegenden Schritten die Showtreppe hinunter, juchzten und präsentierten zum Cancan ihre zartbestrumpften Schenkel. Die Bewegungen der Tänzerinnen wurden rasender, ihre Wangen glühten.
Wie betäubt stand Nele davor und starrte auf die Bühne.
Der Direktor klatschte in die Hände. »Gut so«, rief er, »das genügt.« Er winkte den Frauen, sie sollten die Bühne verlassen. Dann wandte er sich Nele zu. »Das ist deine große Chance heute, Mädchen. Gib alles. Feg die Männer von den Stühlen.«
Sie nickte.
»Das ist noch nicht das Kostüm, oder?«
»Doch.« Das Kleid mit Rüschen, Federn und Pailletten hatte sie erst Montag gekauft. Mutter und sie würden sich deswegen einen Monat lang von Kartoffeln ernähren müssen. Auch den Tanzunterricht zahlte sie ja noch ab; bei der alten Meisterin Irene Sanden, die ihr das Tanzen beibrachte, war sie sechs Monate im Rückstand.
»Hast du nicht gesagt, es ist aus Seide?«
Seide war zu teuer gewesen. »Ich konnte leider nicht –«
»Zu spät, wir sind mitten im Schnelldurchlauf. Du bist dran. Du hast fünf Minuten.«
Nele stieg die seitliche Treppe hinauf. Heute Abend gehörte ihr für die Dauer eines Boleros die wichtigste Bühne Berlins. Jedes der Cancan-Mädchen würde sterben für eine solche Chance.
Sie musste nicht gleich so erfolgreich sein wie Senta und auf Tourneen durch Europa und Amerika reisen. Im Wintergarten wechselte alle vierzehn Tage das Programm. Wenn sie es schaffte, zwei Wochen lang das Publikum zu begeistern, konnte sie sich bereits einen Namen als Tänzerin machen. Eine Künstleragentur würde sie unter Vertrag nehmen und ihr weitere Auftritte verschaffen.
Direktor Hundrich gab ein Zeichen, und es erklang ihr Stück, der Bolero von Moritz Moszkowski. Sie zog die Schuhe aus. Ein Zugeständnis, das sie Hundrich hatte machen müssen, er versprach sich einiges davon, dass er sie im Programm als Barfußtänzerin bezeichnete. Der dicke Direktor hielt die Augen prüfend auf sie geheftet. Was, wenn er plötzlich der Meinung war, dass sie nicht gut genug war für seine Bühne?
Nele schloss die Augen. Sie lauschte auf die Musik, hob langsam ihr rechtes Bein in eine Arabesque, ging über zu einer Attitude, endete in einem Developpé. Sie stellte sich auf die Spitzen, ließ sich in einem Ausfallschritt nach vorne fallen, und ihre Arme kreisten in einem großen Port de bras über ihrem Kopf. Alles gelang ihr, sie war zufrieden. Sie drehte einige Châinés durch die Diagonale der Bühne, verharrte, sprang in kleinen Jetés zurück zur Mitte und drehte sich erneut. Sie blühte auf wie eine Rose. Ihre Brust und ihr schlanker Bauch hoben und senkten sich unter ihrem Atem. Noch ein Port de bras und anschließend einige Pirouetten.
Sie war gut, das merkte sie. Nicht mit Glück hatte sie das Engagement im Rahmen des Revue-Abends ergattert, sondern mit Können.
Hundrich klatschte und rief: »Deine Zeit ist um, andere müssen auch noch proben.« Abrupt erstarb die Musik. »Wo ist Franz, wo sind die Seelöwen? Und du, Nele, komm nochmal her.«
Sie richtete sich auf. Der Seelöwen-Dresseur brachte Wassereimer mit Fischen auf die Bühne. Balalaikaklänge drangen aus den hinteren Räumen, und Männergesang: Die russische Tanztruppe Samowar bereitete sich vor, deren Mitglieder Nele immer schöne Augen machten.
»Hör zu, Kind«, sagte Hundrich, kaum dass Nele von der Bühne hinuntergestiegen war, »ich habe dich als Barfußtänzerin angekündigt. Eine Ballerina brauche ich hier nicht. Deine Tanzdramaturgie ist zu kompliziert, verstehst du? Beim Varieté müssen wir mit starken Reizen arbeiten. Was du da machst, ist zu schwierig.«
»Sie haben mich doch in den Proben gesehen. Gefällt es Ihnen nicht mehr?« Dieses Zittern in ihr! Senta hatte es tatsächlich geschafft, sie zu verunsichern.
»Die Menschen wollen sich im Wintergarten amüsieren. Sie wollen Rausch, sie wollen Freude. Du musst mit deinen Reizen ihre Gier nach nackter Haut befriedigen.«
»Wie meinen Sie das?«
»Du hast alles, was ein Mädchen braucht, warum zeigst du es nicht?«
»Ich werde noch mehr üben. Und ich kann Seide anlegen, das wird den Männern gefallen.«
»Tu das. Arbeite an deinem Kostüm. Und denk daran: weniger Kunst, mehr Körper! Ich will deinen Po und deine Brust sehen.« Energisch riss er die Arme hoch und schrie in Richtung Bühne: »Wo sind die Seelöwen? Deine Zeit ist um, Franz, wir haben sechzehn Nummern heute Abend, es müssen sich noch elf andere warmmachen!«
Die Welt hinter dem Vorhang leuchtete und flimmerte nicht, sie war nüchtern. Was für die Zuschauer ein Zauber war, ein märchenhaftes Vergnügen, bedeutete für die Artisten Knochenarbeit. Das wusste Nele. In den Jahren als Gehilfin hatte sie Zeit gehabt, sich an den rauen Ton im Wintergarten zu gewöhnen, an den lüsternen Direktor, an die Ansprüche.
Heute aber tat ihr alles weh. Die Haut ihrer Seele fühlte sich wund an, durch die Anspannung war sie verletzlicher als sonst. Es war ihr großer Tag. Sie stand im Programm, zum ersten Mal war der Name Nele Stern an die Litfaßsäulen angeschlagen.
Für dich, Senta, dachte sie, werde ich besonders gut sein. Dein spöttisches Lachen wird dir im Halse stecken bleiben.
Wenn er gefragt wurde, wie Gott das Böse zulassen konnte, antwortete Matheus immer, die Menschen seien dafür selbst verantwortlich. Schließlich hatte Gott ihnen Willensfreiheit verliehen, und die wäre wertlos, wenn er nur gute Taten zuließ, die bösen aber jedes Mal verhinderte. Nur: Was konnte das Mädchen für ihre Diphtherie? Welcher Mensch trug die Schuld daran? Dass Gott Kriege zuließ und Schläge und Lügen, das verstand er. Warum aber verhinderte er nicht solche ungerechten Krankheiten?
Seufzend stand er auf und streckte sich. Sein Rücken schmerzte, und der Mund war trocken. Matheus ging in die Küche, goss sich Sinalco in ein Glas und trank. Die Limonade war teuer, und während er schluckte, litt er deswegen Gewissensbisse. In seiner Kindheit hatte es Limonade nur zu besonderen Anlässen gegeben. Um sich zu beruhigen, dachte er an die Mineralsalze und Fruchtsäuren, die seinem Körper gut taten, zumindest wenn man der Reklame glaubte.
Es war still in der Wohnung. Er trat in den Flur. Hatte er Samuel nicht erst vor einer Stunde zum Spielen nach draußen geschickt? Wieso hingen Jacke und Mütze an der Garderobe? Er sah in Samuels Zimmer. Der Siebenjährige kniete an seiner Sitzbank, ein Blatt Papier vor sich, und malte.
»Setz dich doch an den Tisch«, sagte Matheus. »Das ist bequemer.«
»Ja«, sagte Samuel. Er blieb, wo er war. Sein blasses Gesicht ließ ihn oft kränklich aussehen, die Haut war beinahe durchsichtig. Samuel war ein Träumer, ein stilles Kind, das man leicht übersah. Er war so unauffällig, dass Matheus befürchtete, ihn eines Tages in einem Geschäft in der Stadt zu vergessen und erst am nächsten Tag zu bemerken, dass er fehlte. Nicht, dass er ihn nicht liebte, nein, er liebte ihn sehr! Aber der Kleine forderte nichts, er war mit allem zufrieden, was er bekam.
Matheus ging zu ihm und streichelte ihm den Kopf. »Was malst du denn?«
»Das ist der Schnee, den eine Dampflok aufwirbelt. Wenn sie im Winter fährt.«
Auf dem Blatt sah man hellblaue Wolken, die Lok dahinter war mit wenigen Bleistiftstrichen angedeutet, sie ließ sich nur erahnen. »Das Bild ist dir gut gelungen, Samuel.« Andere Kinder malten Rennautomobile, sein Sohn malte Schneeflocken. »Wollen wir spielen?«
Ungläubig sah Samuel auf.
»Ich habe ein bisschen Zeit. Wie wäre es, wenn wir Mehl aus der Küche holen und es auf den Boden schütten, und dann fahren wir mit deiner Spielzeuglok hindurch?«
»Wir spielen Winter!« Samuel sprang auf und brachte die Mehldose ins Zimmer. Vorsichtig schütteten sie Häufchen auf den Boden. Der Junge holte die Blechlokomotive aus dem Spielzeugschrank, sie sah neu aus, ihre Oberfläche war frei von Kratzern, obwohl er sie schon zu Weihnachten bekommen hatte. Er spielte kaum mit ihr. Mehr als die Autos und Loks liebte Samuel die Kartons, in die sie verpackt waren. In den Schachteln mit dem zerdrückten Seidenpapier bewahrte er Murmeln, seltene Steine und Vogelfedern auf.
»Fahr kräftig hindurch«, sagte Matheus, »warte, ich puste, dann fliegt der Schnee!«
Samuel legte das Gesicht auf den Boden, um die Lok besser sehen zu können, und schickte sie durch die Mehlhaufen. Dabei pustete Matheus so sehr, dass Samuel sich aufrichten und die Augen schließen musste, weil ihm Mehl hineingeflogen war.
»Tut es weh?«, fragte Matheus besorgt.
Aber der Junge schüttelte den Kopf. Er zwinkerte einige Male, dann nahm er wieder die Lok.
Die Lok fuhr durch das ganze Zimmer. »Hier ist ein Fußgänger langgelaufen«, sagte Matheus, und drückte mit den Fingerspitzen feine Spuren in das Mehl.
»Und hier ist einer mit dem Fahrrad gefahren.« Samuel zog eine Linie.
Matheus griff noch mal in die Dose und streute eine Handvoll Mehl aus. »Jetzt schneit es die Spuren zu.«
»Wind kommt auf!«, rief Samuel und blies das Mehl über den Boden.
Sie lachten laut. Ihre Kleider waren weiß bestäubt.
Cäcilie erschien in der Tür und riss die Augen auf. »Ihr habt das ganze Mehl verschüttet!«
»Nur einen Teil«, sagte Matheus.
»Für solchen Unfug hast du Zeit! Und wenn ich dich mal brauche …«
»Ich spiele mit unserem Sohn.«
»Das kann ich sehen. Fragt sich nur, wer von euch das größere Kind ist. Seht zu, wie ihr das wieder sauber kriegt!« Sie warf die Tür mit lautem Knall zu.
Matheus sah Samuel an, der schaute zurück. Sie zuckten beide mit den Schultern. »Das war es wert«, sagte Matheus und grinste.
»Ich hole Kehrschaufel und Besen, Papa.«
Rasch war Samuel mit dem Versprochenen zurück, und sie fegten das Mehl auf. Etliches blieb in den Ritzen zwischen den Dielen hängen.
»Ich glaube, hier müssen wir nass wischen.«
»Nein, Papa, mich stört’s nicht.«
»Sicher.« Er lachte. »Aber ich kenne jemanden, den es stört.«
Cäcilie kam herein und fragte: »Gab es Post?«
»Nein, nichts.«
Sie zog hinter ihrem Rücken das Telegramm hervor: »Und was ist das hier? Warum lügst du mich an?«
Matheus schwieg. Eine Ader pochte an seinem Hals.
»Ich ertrage das nicht länger«, fauchte sie, »deine ständigen Schwindeleien!«
Er stand auf. »Mir bleibt ja nichts anderes übrig, als zu lügen. Du behandelst mich wie einen Verbrecher. Denkst du, das macht mir Spaß? Wieso schnüffelst du mir nach und durchsuchst den Schreibtisch?«
»Ach, jetzt bin ich es, ja, ich verstehe, ich bin schuld.« Sie funkelte ihn böse an.
»Es ist doch nichts passiert. Ich habe bloß ein Telegramm in die Schublade gelegt.«
Sie hielt es anklagend hoch. »Hältst du mich für dumm? Was bezweckst du damit, die Post vor mir zu verstecken?«
»Ich wusste, dass du ein Fass aufmachen würdest.«
»Das heißt, du willst die Einladung der Amerikaner ablehnen. Hinter meinem Rücken, weil du dich nicht traust, es mir zu sagen.«
»Wundert dich das?«
Der Zettel in Cäcilies Hand zitterte. Tränen sammelten sich in ihren Augen. »Ist es denn zu viel verlangt«, fragte sie leise, »dass du ehrlich zu mir bist und ab und an Zeit für mich hast?«
Er nahm einen tiefen Atemzug. »Nein«, sagte er. »Nein, ist es nicht.« Er trat auf sie zu und nahm sie in die Arme. »Cäcilie, verzeih.« Jetzt wirkte sie auf ihn so dünn, so schutzbedürftig. Ein Rest Zorn war noch in ihm, aber er verflog angesichts ihrer Schwäche.
»Mir tut es auch leid. Ich will nicht mit dir streiten.« Sie löste sich aus seiner Umarmung und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Dann wandte sie sich an ihren Sohn, der die ganze Zeit reglos dagestanden hatte. »Ach, Samuel, jetzt schau nicht so ernst. Wir vertragen uns ja schon wieder. Hast du Hunger?«
Der Kleine nickte.
»Komm, wir zwei decken den Tisch.« Sie nahm den Jungen mit hinaus.
Wenig später riefen sie zum Abendessen. Matheus wusch sich die Hände, bis sich durch das Schrubben die Haut rot färbte. Seit er von Bakterien gelesen hatte, war es ihm wichtig, dass keine an seinen Händen klebten, wenn er aß. Die Biester übertrugen schreckliche Krankheiten.
Unter den Nägeln putzte er mit einer Bürste den Schmutz weg. Bald schimmerten sie milchweiß auf den geröteten Fingerkuppen. Auch die Fingerzwischenräume seifte er ein und spülte sie unter dem Wasserstrahl aus.
»Habt ihr euch gründlich die Hände gewaschen?«, fragte er, als er sich an den Tisch setzte. Er wartete, bis beide bejaht hatten, und sah Samuel noch einmal streng an.
Der Junge hob seine Hände in die Höhe. »Kannst nachgucken!«
Matheus sprach das Gebet. Seine Hände brannten vom kräftigen Waschen. Er nahm Butter auf die Messerspitze und strich sie auf ein Brot. »Ist das nicht«, er zeigte mit dem Messer darauf, »dieser teure französische Käse?«
»Genieße ihn, wenn wir ihn schon einmal haben.«
»Du hast Geld von deinem Vater angenommen«, sagte er.
»Nein, habe ich nicht.«
Seit er sich damals in sie verliebt hatte, fürchtete er, ihren Ansprüchen nicht zu genügen. Wie könnte er auch! Cäcilie war die Tochter des kaiserlichen Schatullenverwalters Ludwig Delbrück. Ihr Vater war Mitinhaber des Bankhauses Delbrück, Schickler & Co., er saß im Aktionärsausschuss der Bank des Berliner Kassenvereins und in zahlreichen Aufsichtsräten, unter anderem bei der Friedrich Krupp AG – als Einziger, der nicht der Familie Krupp angehörte. Niemals konnte er, Matheus Singvogel, einfacher Baptistenpastor, dieser Frau ein Leben bieten, wie sie es von zu Hause kannte, mit Köchin, Dienstmädchen, Mercedes und Chauffeur, ganz abgesehen von Kleidern und gutem Essen.
»Mach dir nicht so viele Gedanken, Matheus.« Cäcilie legte ihm die Hand auf den Arm.
Samuel sagte kleinlaut: »Mir schmeckt der Käse nicht.«
»Du weißt einfach nicht, was gut ist.« Cäcilie seufzte. »Gib mir dein Brot. Du kannst dir ein neues machen.«
Matheus sah sich im Zimmer um und fragte sich zum hundertsten Mal, ob die Einrichtung nicht auf Cäcilie schäbig wirken musste: die quastenbesetzten Sessel, die Dattelpalme im großen Kübel, die gemusterte Tapete, die Kommode mit den drei Schubladen, Nussbaum furniert, wobei die mittlere Schublade bereits zerkratzt und angestoßen war. Sicher hatte Cäcilie sich ihr Leben anders vorgestellt.
»Das Telegramm geht mir nicht aus dem Kopf«, sagte sie. »Wir könnten kostenlos nach Amerika reisen!«
»Sie zahlen die Überfahrt«, sagte er. »Und dann? Wie kommen wir nach Chicago? Wo übernachten wir unterwegs? So eine Reise verschlingt Unsummen.«
»Denk an Samuel. Du kannst mit deinem Sohn nicht bloß Ausflüge in die brandenburgischen Kiefernwälder machen. Er muss auch mal etwas erleben.«
»Mir gefällt es hier gut«, beteuerte Samuel.
Cäcilie streichelte seinen Arm. »Wir streiten nicht, Liebling, hab keine Angst.« Sie wandte sich wieder Matheus zu. »Den tristen Alltag haben wir immer, und jetzt, wo sich uns eine Gelegenheit für ein Abenteuer bietet, willst du kneifen.«
»Ich kneife nicht. Ich habe eine Entscheidung getroffen, das ist alles.«
»Willst du nicht auch mal allem hier die lange Nase zeigen? Die Frauen fangen den Frühjahrsputz an, sie klopfen um die Wette ihre Teppiche, und gucken, wessen Wäscheleinen am schwersten behangen sind. Nur wir reisen fort und machen da nicht mit. Das wäre es doch!« Ihre Augen leuchteten. »Matheus, es gibt da ein neues Schiff, die Titanic. Das größte bewegliche Ding, das die Menschheit je gebaut hat, ein Hotel, das über das Meer fährt. Eine Reise auf diesem Schiff, das wäre traumhaft.«
Es klingelte an der Tür. Noch während er aufstand, verlangte Cäcilie von ihm, sich endlich einmal zu verweigern. »Für die anderen arbeitest du, ohne Geld zu verlangen«, sagte sie, »du verschenkst deine Arbeitskraft, und deine Familie? Sag Nein, egal, was sie von dir wollen!«
Als er öffnete, stand die Nachbarin im Treppenflur, im Kittelkleid, und sah ihn mit flehentlichem Blick an: »Herr Singvogel, meine Mutter dreht durch.«
»Ich bin gleich bei Ihnen.«
Sie ergriff seine Hand. »Ich danke Ihnen.« Ihre Finger waren weich und geschwollen, sie hatte vermutlich Wäsche gewaschen.
Kaum hatte er die Tür geschlossen, vernahm er auch schon Cäcilies vorwurfsvolle Stimme: »Habe ich gehört: Nein, ich habe keine Zeit?«
»Ich würde mich gern ausruhen«, sagte er, »ich bin müde. Aber ich kann der Nachbarin doch nicht sagen, dass sie die Sache mit ihrer Mutter allein bewältigen soll.«
»Du bist feige!« Cäcilie erschien in der Küchentür. Ihre Nasenflügel wölbten sich. »Du traust dich nicht, Nein zu sagen, weil du Angst hast, dass die Leute dich dann weniger lieben.«
»Das stimmt nicht.«
»O doch. Du hast Angst, dass sie nicht mehr das Idealbild ihres hoch geschätzten Pastors anbeten.«
Er schlüpfte aus den Pantoffeln und zog sich Straßenschuhe an. Seine alten Pantoffeln – Cäcilie hasste sie – hatten zwei Löcher vorn bei den Zehen, und waren keinesfalls für einen seelsorgerlichen Besuch bei der Nachbarin geeignet. »Ich bin gleich wieder da«, sagte er und verließ die Wohnung.
Im Treppenhaus war es kalt. Er schaltete das elektrische Licht ein. Dann drehte er den kleinen Griff der Klingel und ließ sie schrillen. »Ich bin es«, sagte er.
Die Nachbarin öffnete. »Kommen Sie herein.«
Er kannte die Wohnung bereits von mehreren Besuchen. Überall standen Figuren aus Porzellan herum, eine Büste von Beethoven, kleine Hunde, Gänse, der Kaiser, eine Schäferin. Nur der lackierte Tisch im Wohnzimmer war frei davon und die Konsole mit Spiegel, deren Seitenflügel aus geschliffenem Glas im Licht der Stehlampe glitzerten. Es roch nach Kohlsuppe und Urin.
»Frau Bodewell, was machen Sie für Sachen?« Matheus trat auf die Alte zu, die sich hinterm Sofa verkrochen hatte.
»Französische Soldaten«, erwiderte sie und riss die Augen auf. »Die wollen uns erschießen.«
Also ging es wieder um den Deutsch-Französischen Krieg. Sie war 1870 dabei gewesen, war dem Heer mit der Verwundetenpflege nach Frankreich gefolgt und hatte dafür sogar das preußische Verdienstkreuz für Frauen erhalten – aber was nützte ein schwarz emailliertes Kreuz am weißen Band, wenn man die Schreie der Sterbenden nicht vergessen konnte.
»Wir haben doch gewonnen in Sedan«, sagte er.
»Sie rächen sich. Mein Walter hat so viele von ihnen auf dem Gewissen. Sie wollen es uns heimzahlen.« Die Alte machte schauerliche Laute mit hohem Stimmchen, und sie begann, am ganzen Leib zu zittern.
»Im Ernst?« Er kroch ebenfalls hinter das Sofa, woraufhin ihm die Nachbarin einen verwirrten Blick zuwarf. Aber darum kümmerte er sich nicht, er kauerte sich nieder, spähte über die Sofakante und flüsterte: »Ja, da kommen sie, verstecken Sie sich, rasch!«
Behände ging die Alte in die Knie und duckte sich hinter die Sofalehne.
Matheus meldete: »Sie sehen uns nicht! Sie marschieren vorüber.« Er wartete, während neben ihm die Alte wimmerte. »Ja«, sagte er, »sie gehen vorbei. Jetzt sind sie verschwunden.« Er atmete laut hörbar auf.
Mutter Bodewell erhob sich und sah sich um. Ungestüm fiel sie ihm um den Hals. »Danke, Sie haben uns gerettet, Pastor Singvogel!« Sie juchzte laut. Speicheltropfen benetzten sein Ohr.
Er klopfte ihr auf den Rücken.
Als er in seine Wohnung zurückkehrte, räumte Cäcilie bereits den Tisch ab. Sie tat es mit fahrigen, zornigen Bewegungen.
»Ich war noch nicht fertig mit dem Essen«, sagte er.
»Wir schon.«
»Cäcilie, wie lange war ich fort, fünf Minuten? Mach deswegen nicht einen solchen Aufstand, hörst du?«
Sie räumte weiter den Tisch leer. »Das war unser Familienabendbrot. Du hast eine Frau und einen Sohn, auch wenn du das dauernd vergisst.«
3
Die vier Seelöwen schwammen zum Beckenrand, hoben die Köpfe aus dem Wasser und sahen ihrem Meister aus großen, dunklen Kinderaugen hinterher. Ihre Schnurrhaare tropften. Die glatten Leiber glänzten wie Onyx.
»Kannst du kurz auf meine Jungs aufpassen, Nele?«, fragte der Seelöwendresseur.
»Aber beeile dich, ich bin gleich dran! Hören sie denn überhaupt auf mich?«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!