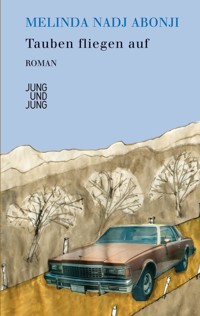
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung u. Jung
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine ungarische Familie aus Serbien in der Schweiz. Ein schwungvoll und gewitzt erzählter Roman aus der Mitte Europas, der 2010 den Deutschen Buchpreis erhielt.Es ist ein schokoladenbrauner Chevrolet mit Schweizer Kennzeichen, mit dem sie zur allgemeinen Überraschung ins Dorf einfahren, und die Dorfstraße ist wirklich nicht gemacht für einen solchen Wagen. Sie, das ist die Familie Kocsis, und das Dorf liegt in der Vojvodina im Norden Serbiens, dort, wo die ungarische Minderheit lebt, zu der auch diese Familie gehört.Oder, richtiger, gehörte. Denn sie sind vor etlichen Jahren schon ausgewandert in die Schweiz, erst der Vater und dann, sobald es erlaubt war, auch die Mutter mit den beiden Töchtern, Nomi und Ildiko, und Ildiko ist es, die das hier alles erzählt. So auch den Besuch im Dorf, der dann nicht der einzige bleibt, Hochzeiten und Tod rufen sie jedesmal wieder zurück ins Dorf, wo Mamika und all die anderen Verwandten leben, solange sie leben.Zuhause ist die Familie Kocsis also in der Schweiz, aber es ist ein schwieriges Zuhause, von Heimat gar nicht zu reden, obwohl sie doch die Cafeteria betreiben und obwohl die Kinder dort aufgewachsen sind. Die Eltern haben es immerhin geschafft, aber die Schweiz schafft manchmal die Töchter, Ildiko vor allem, sie sind zwar dort angekommen, aber nicht immer angenommen. Es genügt schon, den Streitigkeiten ihrer Angestellten aus den verschiedenen ehemals jugoslawischen Republiken zuzuhören, um sich nicht mehr zu wundern über ein seltsames Europa, das einander nicht wahrnehmen will. Bleiben da wirklich nur die Liebe und der Rückzug ins angeblich private Leben?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tauben fliegen auf
Die Arbeit an diesem Buch wurde durchdie Direktion der Justiz und des Innerndes Kantons Zürich,die Pro Helvetia unddas Grenzgänger-Stipendium derRobert Bosch Stiftung gefördert.
9. Auflage
© 2011 Jung und Jung, Salzburg und WienAlle Rechte vorbehaltenDruck: CPI Moravia Books, PohoreliceISBN 978-3-902497-78-9
MELINDA NADJ ABONJI
Tauben fliegen auf
Roman
Inhalt
Titos Sommer
Die Familie Kocsis
Grenzpolizisten, Trauerweiden
Wörter wie
Himmlisch
Welten
Juli
Dalibor
Wir
Real big
Mamika und Papuci
Die Liebe. Das Meer. Der Fluss
Hände in der Luft
November
Titos Sommer
Als wir nun endlich mit unserem amerikanischen Wagen einfahren, einem tiefbraunen Chevrolet, schokoladefarben, könnte man sagen, brennt die Sonne unbarmherzig auf die Kleinstadt, hat die Sonne die Schatten der Häuser und Bäume beinahe restlos aufgefressen, zur Mittagszeit also fahren wir ein, recken unsere Hälse, um zu sehen, ob alles noch da ist, ob alles noch so ist wie im letzen Sommer und all die Jahre zuvor.
Wir fahren ein, gleiten durch die mit majestätischen Pappeln gesäumte Strasse, die Allee, welche die Kleinstadt vorankündigt, und ich habe es nie jemandem gesagt, dass mich diese zum Himmel strebenden Bäume in einen schwindelerregenden Zustand versetzen, einen Zustand, der mich mit Matteo kurzschliesst (der Taumel, dem ich verfalle, als Matteo und ich uns endlos im Kreis drehen, auf der schönsten Lichtung des Dorfwaldes, innig, seine Stirn auf meiner, später dann Matteos Zunge, die eigenartig kühl ist, seine schwarzen Körperhaare, die sich so an seine Haut schmiegen, als wären sie ihrer hellen Schönheit völlig ergeben).
Als wir an den Pappeln vorbeifahren, mir dieses Flirren den Verstand raubt, unser schokoladefarbenes Schiff geräuschlos von einem Baum zum nächsten gleitet, dazwischen die Luft der Ebene, die sichtbar wird, ich kann sie sehen, die Luft, die jetzt stillsteht, weil die Sonne so erbarmungslos ist, da sagt mein Vater zur Klimaanlage hin, immer noch alles genau gleich, mit kleiner Stimme sagt er, hat sich nichts verändert, gar nichts.
Ich frage mich, ob sich mein Vater eine Truppe von professionellen Gärtnern wünscht, die zumindest die Äste zurechtstutzen – dem Wildwuchs Zivilisation entgegensetzen! – oder die mit effizienten Maschinen die die Kleinstadt vorankündigenden Pappeln fällen, ein für allemal! (Und wir würden auf einem dieser Strünke sitzen, mit unseren Blicken die Ebene, die sich mit Mittagshitze vollgesaugt hat, beherrschen, und mein Vater, der sogar einen Strunk besteigen müsste, sich einmal um die eigene Achse drehen würde, um dann mit der bitteren Stimme eines Menschen, der spät, aber besser spät als nie!, Recht bekommt, zu sagen: Endlich sind diese verdammten, staubigen Bäume weg.)
Niemand weiss, was mir diese Bäume bedeuten, die Luft zwischen den Bäumen, die man genau sehen kann, und nirgends sind die Bäume so verheissungsvoll wie hier, wo die Ebene ihnen Platz lässt, und ich wünsche mir auch diesmal stehenzubleiben, mich an einen dieser Stämme zu lehnen, meinen Blick zu heben, mich von den raschen, kleinen Bewegungen der Blätter verführen zu lassen, und ich bitte meinen Vater auch diesmal nicht anzuhalten, weil ich auf die Frage „warum“ keine Antwort wüsste, weil ich vieles erzählen müsste, ganz bestimmt aber von Matteo, um zu erklären, warum ich ausgerechnet hier anhalten will, so kurz vor dem Ziel.
Unser Wagen, wie von einer geheimen Kraft gezogen, fast immun gegen die Unebenheiten der Strasse, fährt also weiter, und bevor wir endgültig ankommen, haben wir noch ein weiteres Mal ein „hat sich nichts verändert“ zu passieren, muss die Zivilisation noch einen Rückschlag, heisst einen Stillstand hinnehmen, und wir Kinder drücken linkerhand unsere Gesichter gegen die Scheibe, die erstaunlich kühl ist, sehen mit ungläubigen Augen Menschen, die in einem Berg von Müll leben, hat sich nichts verändert, sagt mein Vater, Hütten aus Wellblech, Gummi, zerzauste Kinder, die zwischen Autowracks und Haushaltsmüll spielen, als gäbe es nichts Normaleres, was ist mit den Scherben, will ich fragen, mit der Nacht, die einbricht, wenn die Schatten sich bewegen, wenn all die Dinge, die in einem heillosen Durcheinander daliegen, lebendig werden? Und ich vergesse in einem winzigen Augenblick die Pappeln, Matteo, das Flirren, den Chevrolet, und die schwarze Nacht der Ebene umhüllt mich mit ihrer ganzen zerstörerischen Kraft, und ich höre sie nicht, die Lieder der Zigeuner, die vielbeschworenen, bewunderten, ich sehe nur die gierigen Schatten im Dunkeln, von keiner Strassenlaterne vertrieben.
Und mein Vater schielt aus dem Fenster, schüttelt den Kopf, hustet seinen trockenen Husten, er fährt so langsam, dass man meinen könnte, er werde unseren Wagen in wenigen Augenblicken zum Stillstand bringen, schaut euch das an, sagt er und klopft mit dem Zeigefinger gegen das Seitenfenster (ich erinnere mich an ein Feuer, dessen Rauch sich verirrt), ich, die die schmutzstarren Gesichter aufnimmt, die scharfen Blicke, die Lumpen, Fetzen, das über den Müllbergen zitternde Licht, ich verlängere meinen Blick, als müsste ich das alles verstehen, diese Bilder von Menschen, die keine Matratzen haben, Betten schon gar nicht, sich deswegen nachts vielleicht in die Erde eingraben, in die tiefschwarze Ebene, die jetzt, im Sommer, von Sonnenblumen nur so strotzt, sich im Winter dann so preisgibt, dass man sich ihrer erbarmt, Erde, nichts als Erde, die im Winter von einem zentnerschweren Himmel erdrückt wird, die, wenn der Himmel sie in Ruhe lässt, zu einem Meer wird, windstill.
Ich habe es nie jemandem gesagt, aber ich liebe diese Ebene, die sich zu einem trostlosen Strich verdünnt, nichts, das sie einem schenkt; vollkommen allein in dieser Ebene, von der du nichts wollen kannst, auf die du dich höchstens legen kannst, mit ausgebreiteten Armen, und das ist der Schutz, den sie dir gewährt.
Wenn ich gesagt hätte, dass ich Matteo liebe (einen Sizilianer, der ein paar Wochen vor den Sommerferien in unsere Klasse hereingeplatzt ist, ciao, sono Matteo de Rosa! und sofort bei allen, ausser beim Lehrer, beliebt war), dann hätten mich womöglich die meisten verstanden, aber wie sagt man, dass man eine Ebene liebt, die Pappeln, staubig, gleichgültig, stolz, und die Luft dazwischen? Im Sommer, wenn die Ebene um ein Stockwerk gewachsen ist, Sonnenblumen-, Mais- und Weizenfelder, wo du nur hinblickst, und man erzählt, dass immer wieder Menschen in den endlosen Feldern verschwinden, wenn du nicht aufpasst, packt dich die Ebene und frisst dich auf, sagt man, und ich glaube nicht daran, ich glaube, dass die Ebene ein Meer ist, mit eigenen Gesetzen.
Diese armen Dinger, sagt meine Mutter, als würden wir fernsehen, und statt dass wir den Sender wechseln, fahren wir vorbei, fahren wir weiter in unserer Kühlbox, die eine Stange Geld gekostet hat, uns so breit macht, als würde die Strasse uns gehören, und mein Vater dreht das Radio an, damit die Musik das Niedrige in einen tänzerischen Takt verwandelt, den Klumpfuss der Wirklichkeit augenblicklich heilt: Komm hierhin, geh nicht dorthin, komm hierhin, mein Herzchen, und gib mir ein Küsschen …
Mit einem Geräusch, das nicht der Rede wert ist, fahren wir über die Gleise, am schiefen, rostigen Schild vorbei, das seit Ewigkeiten den Namen der Kleinstadt tragen muss, wir sind da, sagt meine Schwester Nomi, zeigt zum Friedhof, in dem eine auffallende Ungerechtigkeit herrscht, Gräber, um die sich niemand kümmert, einfache, von Unkraut überwucherte, kaum mehr erkennbare Holzkreuze, Jahreszahlen, Buchstaben, die fast nicht zu entziffern sind, wir sind da, sagt Nomi, und in ihren Augen zeigt sich die Angst, irgendwann in den nächsten Tagen den Friedhof besuchen zu müssen, hilflos an Gräbern zu stehen, sich für die Tränen der Eltern zu schämen, auch weinen zu wollen, sich vorzustellen, dass da unten im Sarg der Grossvater väterlicherseits liegt, die Grossmutter mütterlicherseits, die wir, Nomi und ich, nie kennengelernt haben, Grossonkel und Grosstanten, die Hände, die einem in solchen Momenten immer im Weg sind, das Wetter, das in solchen Momenten immer unpassend ist, würde man weinen, wüsste man wenigstens, wohin mit den Händen; Gladiolen und zarte Rosen neben Gräbern, die mit Steinplatten bedeckt sind, die Toten, deren Namen in Stein eingraviert sind, leserlich bleiben für die Nachwelt, die Steinplatten, die ich nicht mag, weil sie die Erde der Ebene erdrücken, die darunterliegenden Seelen am Fortfliegen hindern.
Unsere Familie mütterlicherseits und väterlicherseits, die unter Steinplatten begraben liegt, schlimmstenfalls fehlen die Blumen, die gelben und rosaroten Rosen, die Gladiolen, aber die Gräber, mit Steinplatten überdeckt, verwahrlosen nicht, auch wenn sie niemand besucht, auch nicht an Allerheiligen, nicht einmal an Allerheiligen, sagt meine Mutter, wenn irgendeine Cousine sie anruft, ihr mit gepresster Stimme mitteilt, dass ausser ihr niemand auf dem Friedhof war, um ein Lämpchen für die Verstorbenen anzuzünden, wenigstens verwahrlosen die Gräber nicht, sagt meine Mutter dann, und in diesem Satz steckt die tiefe Trauer eines Lebens, das sich nicht einmal um die Toten kümmern kann, weil sie zu weit weg sind, um ihnen wenigstens einmal im Jahr, an Allerheiligen, Blumen hinzustellen.
Weil sich der Tod selten ankündigt, sind wir also fast nie da, wenn jemand unserer Familie in der Vojvodina stirbt, und wenn uns Tante Manci oder Onkel Móric anrufen, weil sie die Einzigen sind, die ein Telefon haben, um uns zu sagen, dass es leider ein Tag der schlechten Nachricht sei, dann wird es merkwürdig still in unserem Wohnzimmer, möglicherweise gäbe es irgendwas über den Tod zu erzählen, wenn wir da wären, wo alle unsere Verwandten leben, zumindest würden wir zuhören, was man sich über den Verstorbenen erzählt, und wir wären sicher berührt, wenn Mamika, die mit ihrer Stimme den verborgensten Winkel jeder Seele erreicht, ein Lied singt, aber weil wir nicht da sind, wo die Menschen drei Tage lang Abschied nehmen, bevor sie die sterblichen Überreste, wie man sagt, der Erde überlassen, weil wir nur das Telefon haben, eine entfernte Stimme, die bezeugt, dass etwas Unwiderrufliches geschehen ist, bewegen wir uns an diesem Tag der schlechten Nachricht wie Geister, wir vermeiden es sogar, uns mit Blicken zu berühren, und ich erinnere mich, dass Vater die gelben Chrysanthemen, die Mutter auf den Wohnzimmertisch gestellt hat, mit einem heftigen Schwung in den Mülleimer wirft, an einem Tag im Oktober 1979, als wir die Nachricht bekommen haben, dass Vaters geliebte Grosstante gestorben ist. Keine Totenblumen, sagt Vater mit rotem Hinterkopf und der Fernbedienung in der Hand, ich und Nomi, die die Chrysanthemen seither die verbotenen Blumen nennen, weil wir sie nicht mehr auf den Tisch stellen dürfen, und wenn wir dann den Friedhof in unserer Heimat aufsuchen, die Gräber unserer Verstorbenen mit Blumen schmücken, sicher nie mit Chrysanthemen, auch wenn es Herbst ist, dann sind wir zu spät gekommen, denke ich, dann sind wir ein zweites Mal allein mit unserer Trauer.
Und wir ahnten damals nicht, dass in wenigen Jahren die Grabsteine umgestossen, die Granitplatten zerpickelt, die Blumen geköpft werden würden, weil es im Krieg eben nicht reicht, die Lebenden zu töten, und hätten wir es geahnt, hätten wir vermutlich am Grab unserer Verstorbenen die Köpfe gesenkt, darum gebeten, dass unser leiser Singsang sich zu einem magischen Schutz verdichtet, damit die Toten in ihrer ewigen Ruhe, wie man sagt, nicht gestört würden, aber wir hätten auch darum bitten können, dass die Regenwürmer, die Engerlinge, die Springschwänze, die Tausendfüssler und Käfer aller Art nicht durch die plötzliche Lichtveränderung wild durcheinanderkrabbeln und -kriechen, um dann, nach dieser Störung, endlich wieder ins schützende Dunkel zu flüchten.
Unser brandneuer Chevrolet biegt links ab, in die Hajduk Stankova, zeichnet eine elegante Kurve, bevor mein Vater abbremsen muss, weil die Strasse nicht geteert ist, eingetrockneter Dreck mit einer dünnen Staubschicht, die unseren Chevrolet zu einem bepuderten Unding macht, die Zivilisation, auch hier zum Stillstand gebracht.
Wir sind da, sage ich, unser Wagen steht vor der Einfahrt, einem Wall aus ausgetrockneten, verzogenen Holzbrettern, vielleicht zwei Meter hoch, drei Meter breit, der neugierigen Blicken mehr als nur einen verheissungsvollen Spalt bietet, mein Vater stellt den Motor ab, wir blinzeln zum kleinen, weissen Haus, zur Einfahrt gehörend, von der Sonne grell ausgeleuchtet, das Haus von Mamika, der Mutter meines Vaters, für mich der Prototyp eines Hauses, das die ersten und tiefsten Geheimnisse birgt, und wir bleiben einen langen Moment sitzen, bevor Vater das Einfahrtstor öffnet, unser Chevrolet langsam in den Innenhof rollt, ein kurzes Hupen die Hühner und Enten aufscheucht.
Gott hat euch gebracht, Mamika, die nicht lächelt, die nicht weint, die diesen Satz mit der ihr eigenen zarten Stimme sagt, uns einzeln die Wangen streichelt, auch meinem Vater, ihrem Kind, Gottes Gunst, die uns in ihr Wohnzimmer, das gleichzeitig ihr Schlafzimmer ist, führt, seine Gnade, die uns Traubisoda, Tonic, Apa Cola und zwischendurch ein Schnäpschen serviert, Papst Johannes Paul II., der uns wie immer in Form eines farbigen Bildchens anlächelt, und ich, die in ängstlicher Genauigkeit das Zimmer inspiziert, mit einem Blick die Kredenz, den Haussegen, die Flickenteppiche sucht, hoffe, dass alles noch so ist wie früher, weil ich, wenn ich an den Ort meiner frühen Kindheit zurückkehre, nichts so sehr fürchte wie die Veränderung: Das Erkennen der immergleichen Gegenstände, die mich vor der Angst schützt, als Fremde in dieser Welt dazustehen, von Mamikas Leben ausgeschlossen zu sein, ich muss, so schnell es geht, zum Innenhof zurück, um meine ängstlichen Inspektionen fortzusetzen: Alles noch da? Die zwei Drahtgitter Silos, in denen Mais gelagert wird und sich die frechen Mäuse tummeln, der blaue Ziehbrunnen, der für mich immer ein Wesen gewesen ist (ein Zwerg? ein undefinierbares Tier?), die Rosen und Nachtviolen, für die meine Mutter schwärmt, deren Duft einem nachts den Kopf verdrehen kann, die Pflastersteine, auf denen im Sommer die Pisse verdampft, auf die das Blut der Hühner spritzt, denen Mamika gekonnt die Hälse durchschneidet, von denen die Hühner soeben noch zermahlene Maiskörner gepickt haben. Alles noch da?, frage ich mich insgeheim, und warum mich in diesen ersten Momenten des Ankommens diese spezifische Unruhe ergreift und dass ich mit diesem unangenehmen Gefühl nicht allein bin, sondern Nomi genauso davon befallen ist, aber anders damit umgeht, das habe ich erst viel später verstanden.
Und nachdem ich den Innenhof inspiziert habe, den Hühnerstall, das Plumpsklo, den Miststock, den Garten und natürlich den Dachboden – der die schönsten aller Geheimnisse preisgibt –, muss ich rasch wieder die morsche Leiter hinabsteigen, aufpassen, dass ich keines dieser leuchtenden Mittagsblümchen zertrete, die in den Zwischenräumen der Pflastersteine wachsen, ich muss, so schnell es eben geht, zum Tor zurück, die Klinke runterdrücken, meinen Kopf rausstrecken, um zu sehen, ob sie noch da ist, die Irre mit den zerzausten Haaren, mit ihren Augen, die alles glauben und alles vergessen, die fragen, bevor der Mund es tut, hast du etwas für mich?, etwas kleines Süsses?, für mein Herz, ein Zückerchen? Ich muss sehen, ob Juli noch da ist, die ein Kindskopf geblieben ist, so sagt man, obwohl sie schon längstens Brüste hat und zottige Haare unter den Achseln, Juli, die ein paar Steinwürfe weiter weg gegen die Hausmauer lehnt oder auf einem Klappstuhl sitzt, dem Tag nichts weiter antut, als ihn zu betrachten, Juli, bist du da? Die Irre, vor der wir Kinder uns fürchten, die wir endlos verspotten, Juli, die wir lieben, weil sie uns alles glaubt und Dinge erzählt, die nach einer fremden Welt riechen (he, Nomi und Ildikó, sagt Juli, ihr habt eine Schwester, ja ja ja, ich weiss das, sie ist wunderschön, ja ja ja, und Juli kichert, ich weiss das, seht mal her, und Juli zeigt auf die grossen, orangen Blumen ihres Kleides, das sind meine Augen, ja ja …).
Traubi! sagen Nomi und ich aus einem Mund, als wir uns die Hände gewaschen haben, uns an Mamikas gedeckten Tisch setzen und die Fläschchen auf einem Plastiktablett bereitstehen, Traubisoda! So heisst das Zaubergetränk unserer Heimat, ein schlankes Fläschchen ohne Etikette, auf dem die weissen Buchstaben auf grünem Glas leuchten, Mamika, die jede Menge Traubi für uns gekauft hat, nur für euch!, und natürlich sind Nomi und ich verwöhnte Westgören, die sich darüber lustig machen, dass die im Osten versuchen, Coca-Cola zu imitieren und dabei nichts weiter als eine braune, ungeniessbare Brühe namens Apa Cola zustande bringen (Apa Cola, was für ein bescheuerter Name!), aber Traubi lieben wir, wir lieben Traubi so sehr, dass wir uns überlegen, ob wir ein paar Fläschchen mit nach Hause, in die Schweiz, nehmen sollen, um unseren Freundinnen zu zeigen, dass es bei uns, in unserer Heimat, etwas gibt, das unglaublich gut schmeckt – doch bis jetzt haben wir es nicht getan.
Mamika, die Hühnergulasch mit Nockerln auftischt, Paniertes vom Schwein mit frittierten Kartoffeln und Kürbisgemüse, an der Sonne gesäuerte Gurken und Tomatensalat mit roten Zwiebeln, Mamika, die uns erlaubt hat, soviel Traubi wie wir wollen zu trinken, und für ein Mal dürfen wir während dem Essen aufstehen, um uns an Mamikas weicher Haut satt zu küssen, wir drücken uns von links und von rechts in die Wärme ihres Kleides, und nur Mamika nervt uns nicht, wenn sie sagt, dass wir beide bestimmt zwei Fingerbreit gewachsen seien, meine grossen Mädchen, sagt sie, und bald seid ihr junge Frauen! Nomi und ich, wir legen nacheinander unsere Hände auf Mamikas Haarknoten, weil das so weich und angenehm ist, das geflochtene Haar auf der Handinnenfläche, und ich, die sich in diesem Sommer schon so fühlt, als wären die Beine zu lang, die Hände zu gross, immer irgendetwas am eigenen Körper, das nicht mehr stimmt, bin also sicher mehr als zwei Fingerbreit gewachsen, und trotzdem bin ich noch weit entfernt von der Welt der Erwachsenen, das merke ich vor allem, wenn Mutter und Vater anfangen, von unserem Leben in der Schweiz zu erzählen, von der Arbeit in unserem Geschäft, WÄSCHEREI, GLÄTTEREI, BÜGLEREI, steht auf einem schwarz-weissen Schild, und Vater malt vor Mamikas Augen Buchstaben in die Luft und Zahlen, wieviel ein gebügeltes Hemd kostet, ein Tischtuch, ein Unterhemd, wieviel Rabatt es gibt, wenn jemand gleich zehn Hemden bringt, und Mutter beschreibt, was für komplizierte Stoffe die Reichen haben, das müssen die Finger erst mal lernen, wie man das Bügeleisen über diese Stoffe führen muss, bei so einem Preis darf kein Fältchen zu sehen sein, sagt sie, und ich, die mit einem Ohr meinen Eltern zuhört, unterhalte mich fast lautlos mit Nomi darüber, wie unsere Freundinnen auf unser Traubisoda reagieren würden, Betty sagt bestimmt, nicht schlecht, aber nichts Besonderes!, und Claudia dreht das Fläschchen wahrscheinlich hin und her und sagt dann gar nichts oder zuckt bloss mit den Schultern, es ist ja nicht einfach, etwas zuzugeben, meint Nomi, ja stimmt!, es ist nicht fair, wenn wir unsere Freundinnen zum Lügen zwingen, so unsere Überlegung, wir schwärmen lieber von Traubisoda und warten auf den Tag, wo es viel berühmter sein wird als alles andere, berühmter sogar als Coca-Cola, ja klar!, und Nomi schenkt uns nochmals nach, Vater und Mutter, die inzwischen erzählen, dass wir auch ausliefern, die gebügelte Wäsche in grossen Körben, meistens abends, in die Häuser unserer Kunden bringen, natürlich kostet das extra, wenn wir da in die Hügel hinaufkurven, die wohnen ja lieber oben, die Reichen, sagt Vater und lacht, und während er noch von den Hunden erzählt, die ihn beim Ausliefern schon angefallen oder fast angefallen haben, denke ich daran, wie wir uns im Keller, da, wo zwei Waschmaschinen stehen, Weichspüler, Waschmittel und Spezialseifen, unzählige Plastikkörbe in allen Grössen und Farben, Stoffsäcke mit Wäscheklammern und ausserdem ein Büffet mit Geschirr, Gewürzen und einer Kochplatte, wie wir uns an den kleinen Holztisch setzen, den Vater auf der Strasse gefunden hat, und wir da, wo es immer kalt ist und die frisch gewaschene Wäsche hängt, zu Mittag essen, schweigend, weil Vater es nicht mag, wenn wir während dem Essen reden. Nomi und ich, wir messen, wenn wir ungestört sind, die unförmigsten Unterhosen mit unseren Fingern aus, stellen uns vor, wie oft unsere Schenkel und Hintern da hinein passen, in diese Fallschirme!, die Reichen müssen auch aufs Klo, und manchmal sind sie sogar richtig fett, sagen wir kichernd, aber ich schäme mich, wenn die betreffende Person ihr Wäschepaket abholt, ich ihr beim Einkassieren in die Augen schauen muss, und das weiss niemand, nicht einmal Nomi.
Das klingt nach harter Arbeit, sagt Mamika, schneidet Brot, eine fingerdicke Scheibe, die sie Vater hinhält. Aber wir verdienen, und keiner schreibt mir irgendetwas vor, antwortet er, zeigt seine Zähne und füllt sein Gläschen wieder auf, erzählen Sie doch, Mamika, müssen Sie sich immer noch anstellen für dieses lächerliche Brot, mitten in der Nacht, jetzt, wo der König aller Partisanen endlich tot ist?, oder können Sie jetzt Brot kaufen, am Nachmittag oder irgendwann …?
Und Vater wird gleich von den Grundunterschieden zwischen Ost und West zu reden anfangen, von den grundsätzlichsten Unterschieden, die es im Universum überhaupt geben kann, und sich dabei ein Schnäpschen nach dem anderen in den Hals werfen, die selbst gebrannte Birne von Onkel Móric, jetzt, in diesem Jahr, wo der Genosse Josip Broz Tito gestorben ist und sich bewahrheiten wird, was alle, zumindest die Intelligenten, schon längstens wissen, dass es mehrere Generationen dauern wird, bis sich die sozialistische Misswirtschaft erholen wird, wenn überhaupt! (und das alles und noch viel mehr haben wir schon während unserer Reise erfahren), als Vater schon richtig in Fahrt kommen will, sagt Nomi ganz unerwartet, mit der unnachgiebig grellen Stimme, mit der sie sonst um Süssigkeiten bettelt, ich will, dass Mamika jetzt mit mir redet, ich will, dass Mamika jetzt erzählt. Und sie fragt Grossmutter, wie viele Junge die Schweine haben, fragt nach den Gänsen, Hühnern, ob wir später Eier holen können, sie will wissen, ob Mamika den Enten immer noch das Maul stopft, ob Juli immer noch für sie auf dem Markt einkauft, und der Garten von Herrn Szalma, wie sieht der aus? Und Nomi hängt sich an Mamikas Hals, redet und redet immer weiter, so dass Mutter über ihr hitziges Gesicht fährt und sagt, wir sind ja gerade erst angekommen, du hast noch ein paar Tage Zeit, um Mamika auszufragen.
Aber ich will jetzt alles wissen, sagt Nomi, ich will jetzt alles ganz genau wissen, sagt sie nochmals und drückt sich an Mamikas Wange, sie weint fast, ihre Stimme überschlägt sich, und Mutter schüttelt verständnislos den Kopf, und Vater sagt, nach so einer Fahrt habe ich keine Lust, mir dieses Geplärre anzuhören, und seine Hand saust auf die Tischplatte, und weil da keine Fliege ist, zucken wir alle zusammen, ausser Grossmutter, und sie sagt mit ruhiger Stimme: Herzlich willkommen in meinem Haus! Herzlich willkommen mit allem, was ihr mit euch bringt, mein lieber Miklós!, also, ich mache mit Nomi und Ildikó einen kleinen Rundgang, und du, ruh dich in der Zwischenzeit aus, dann gibt’s Nachtisch!
Der weiche Singsang meiner Grossmutter, das nächtliche Gequake der Frösche, die Schweine, wenn sie aus ihren Schweinchenaugen blinzeln, das aufgeregte Gegacker eines Huhnes, bevor es geschlachtet wird, die Nachtviolen und Aprikosenrosen, derbe Flüche, die unerbittliche Sommersonne und dazu der Geruch nach gedünsteten Zwiebeln, mein strenger Onkel Móric, der plötzlich aufsteht und tanzt. Die Atmosphäre meiner Kindheit.
So habe ich nach langem Überlegen geantwortet, als mich Jahre später ein Freund gefragt hat, was denn Heimat für mich bedeute, und wesentliche Dinge sind mir in dem Moment gar nicht eingefallen. Erstens das relativ unbekannte, aber eigentlich weltbeste Getränk namens Traubisoda, das bestimmt auch von Papst Johannes Paul II. gesegnet worden ist und ich so fraglos mit Heimat verbinde, dass ich es zu nennen vergessen habe. Und zweitens etwas, das sich nicht so leicht auf einen Begriff bringen lässt, die Erinnerung nämlich an Nomi, wie sie mit ihrer Quengelei Vater und Mutter nervte, damals, im Sommer 1980, als sie, kurz nachdem wir angekommen waren, alles von Mamika wissen wollte, nicht nur alles, sondern sofort alles; die Quengelei meiner Schwester, so verstand ich plötzlich, war vergleichbar mit meinen geheimen, rasend schnell durchgeführten Inspektionen: weil wir beide die Angst hatten, nichts mehr mit unserer Heimat zu tun zu haben, wollten wir die Zeit einholen, in der wir nicht da gewesen waren, und in diesem Wettrennen waren wir unsäglich erleichtert, wenn wir uns an ganz banalen, alltäglichen Dingen orientieren konnten, dem Spaltblock, der glücklicherweise immer noch an derselben Stelle steht, nämlich beim Schweinestall, in der Nähe des Plumpsklos, Mamika, die sich in der Zwischenzeit keine Kühe angeschafft hat oder Fasane, sondern immer noch mit ihren Schweinen, Hühnern, Gänsen und Enten lebt, dem winzigen Taubenschlag, den wir unverändert auf dem Dachboden vorfinden – und von Mamika wissen wir, dass sie die Tauben nur unserer Mutter zuliebe hält, weil sie Grossmutters Taubensuppe über alles liebt und sich jedes Jahr wie ein Kind, wie sie selbst sagt, auf sie freut – wir sind froh, als wir auf unserem Rundgang mit Mamika sehen, dass sie ihren Gemüsegarten nicht in einen Blumengarten verwandelt hat und dass der Pflaumenbaum da steht, wo er all die Jahre zuvor auch schon gestanden hat, neben dem Maislager, und ein Teil der Früchte fällt in den Garten und der andere auf die Pflastersteine, wo sie innerhalb kürzester Zeit den Ameisen, Käfern, Wespen, den immer blöd rumpickenden Hühnern zum Opfer fallen. Als Mamika uns ihre Welt zeigt, beim Holzzaun, der an den Hühnerstall grenzt, stehen bleibt und sagt, ja, der Innenhof von Herrn Szalma ist immer noch genauso vergammelt, seht es euch selbst an!, als wir durch den fingerbreiten Spalt des Zaunes spähen, die riesigen Kürbisköpfe sehen, die an etlichen Stellen schon aufgeplatzt sind, das Unkraut, das die schönen Rosen verdrängt, als wir Mamika sagen hören, sie könne diesen liebenswürdigen Herrn Szalma nicht verstehen, dass er jedes Jahr sein Haus mit neuer Farbe weisse, aber seinen Garten so verkommen lasse, schaut nur, wie sich das Efeu über die Beerenhecken frisst!, da sind Nomi und ich beruhigt, weil sich unsere Heimat nie verändern darf und wenn, dann nur ganz geringfügig (und mit achtzehn, wenn wir volljährig sind, würden wir zurückkommen, unter Mamikas warme, dicke Bettdecke kriechen, und wir würden davon träumen, dass wir ein paar Jahre weg gewesen sind, in der Schweiz).
Ja, endlich sind wir da, nach unserem Rundgang merken wir, dass wir wirklich angekommen sind, dass wir jetzt da sind, wo unsere Grossmutter ihr Leben verbringt, Mamika, die uns übrigens zweimal an Ostern und einmal an Weihnachten in der Schweiz besucht hat, ansonsten ein einziges Mal im Ausland war, nämlich in Rom, um dem Papst die Hand zu küssen, und Mamika lachte in den Mundwinkeln, als sie uns von ihrer beschwerlichen Busreise zu ihrem geliebten Papst erzählte, von Rom, das ihr so unendlich gross vorkam, dass sie sich ständig an ihrem Stock oder an ihrer Freundin festhalten musste. Meine grossen, kleinen Mädchen, sagt Mamika, als wir uns bei ihr einhängen, uns langsam auf unser Auto zu bewegen, weil Vater gerufen hat, wir sollen ihm beim Ausladen helfen, und erst, als wir unseren voll bepackten Chevrolet plündern, unsere Taschen und Koffer neben den Ziehbrunnen stellen, fällt mir auf, dass die Hitze fast unverändert ist, obwohl es schon längstens Nachmittag geworden ist.
Was für ein Automobil!, sagt Mamika und legt die Hände hinter ihrem Rücken ineinander, dass du mit so einem Ding überhaupt fahren kannst, Miklós, siehst du überhaupt, wo’s vorne und hinten aufhört? In Amerika fährt jeder so ein Ding, antwortet Vater, Tatsache!, meint er, als Mamika ihn mit erhobenen Augenbrauen anschaut, kommen Sie, setzen Sie sich rein, und Vater öffnet die Tür zum Beifahrersitz, fährt über das helle Sitzleder, ist noch angenehmer, als im Bett zu schlafen, und Vater zündet sich eine Zigarette an, Mamika zögert, sagt, ich bin zu grau für so etwas Modernes, und Mutter meint, morgen sei auch noch ein Tag, aber Vater fasst Mamika schon an den Händen, hält sie sanft und sicher, als sie sich bückt, sich hineinsetzt, ihre Beine hebt, um dann auf dem breiten Leder Platz zu nehmen. Vater, der mit einem eleganten Schwung die Tür des Beifahrersitzes schliesst, und Nomi und ich, wir haben uns auf unsere Koffer gesetzt, wir sehen zu, wie Mamika durch die Frontscheibe blickt, zu lächeln versucht, Vater, der sich schon ans Steuerrad gesetzt hat und Mamika jetzt sicher alles erklärt, die automatische Gangschaltung, die Fenster, die auf Knopfdruck reagieren, die Klimaanlage, den Komfort, ein Wort, das Vater falsch betont, aber gern gebraucht.
Nomi, Mutter und ich wissen, dass wir in den nächsten Tagen noch oft ähnliche Spektakel erleben werden, und wenn wir übermorgen bei Onkel Móric vorfahren, um die Hochzeit seines Sohnes Nándor zu feiern, werden sich die Männer in ihren festlichen Anzügen innerhalb kürzester Zeit um unseren Chevrolet versammeln, als wären sie gekommen, um dem Wagen die Ehre zu erweisen und nicht dem Brautpaar; wir sehen sie schon, die Männer, wie sie mit langsamen, denkwürdigen Schritten den Wagen umkreisen, sein glänzendes Metall streicheln, weil jede kleine Berührung damit Glück bringen muss, und irgendeiner, nein, nicht irgendeiner, sondern Nándor, der Bräutigam, darf dann die Kühlerhaube öffnen, die Handlung vollführen, die endlich das Kernstück preisgeben wird, den Motor!, und Vater wird ihn starten, und die Männer werden sich bei laufendem Motor unterhalten, sie werden reden, reden, reden, rauchen und auf die wichtigen Einzelheiten zeigen, die es eben braucht, damit es ein Ganzes gibt, ein schönes Ganzes, das nicht nur rollt oder fährt, sondern eben auch ein perfektes Fahrgefühl bietet.
So oder ähnlich wird es ablaufen, und Mutter, Nomi, ich, unsere Tanten und Cousinen, wir werden ein bisschen abseits stehen, auf die Männer zeigen, uns im erlaubten Rahmen über die Ausdauer und Ernsthaftigkeit, mit der sich die Männer der Technik widmen, lustig machen, in solchen Momenten sind wir tatsächlich nichts anderes als blöde Hühner, die ständig gackern, um davon abzulenken, wovor es uns allen graut, dass nämlich das einmütige Schwärmen plötzlich in einen Streit ausartet, weil einer womöglich behauptet, das sozialistische System habe trotz allem seine Vorteile, wir blöde Hühner wissen, dass es einen einzigen Satz braucht, und plötzlich sehen die Hälse der Männer wüst und nackt aus: Ja ja, eine gute Idee, der Kommunismus, auf dem Papier …! Und der Kapitalismus! die Ausbeutung von Menschen durch Menschen …! Wir Plaudertaschen wissen, dass es ein winziger Sprung ist von der Technik zur Politik, von einer Faust zu einem Kiefer – und wenn die Männer ins Politische kippen, dann ist es so, wie wenn man zu kochen anfängt, und man weiss von Anfang an, aus irgendeinem Grund, dass das Essen misslingen wird, zuviel Salz, zu wenig Paprika, angebrannt, ganz egal, das Politische bringt Gift, so Mamika.
In Mamikas Innenhof sieht der Chevrolet irgendwie weltfremd aus, denke ich, als Mutter ihre Hände auf unsere Schultern legt, Nomi und ich auf das Ende des Schauspiels warten, ein Käuzchen, das irgendwo auf einem Baum hockt und uns mit seinem schüchternen Ruf begleitet, wir können unser Gepäck ja schon reintragen, sagt Mutter, ihr wisst ja, das kann länger dauern, und sie packt zwei Taschen, marschiert los, Richtung Haus, aber Nomi und ich, wir bleiben auf unseren Koffern sitzen, streifen unsere Schuhe ab, und die Steine sind so heiss, dass wir sie nur mit den Zehenspitzen antippen können, wahnsinnig heiss, sagt Nomi, ja!, und wir schielen zum Chevrolet, zu unserem Vater, der hinter dem Steuerrad hantiert, seine Schneidezähne, die immer wieder scharf hinter der Frontscheibe aufblitzen, und erst später, als wir uns an diese merkwürdige Szene erinnern, wissen wir, warum wir damals auf unseren Koffern sitzengeblieben sind, obwohl es uns unangenehm war zuzusehen, wie hilflos Mamika ihren Kopf drehte, zu Vater und dann wieder zu uns schaute, ihr schwarzes Kopftuch, das ihr tief in die Stirn gerutscht war; wir wären bestimmt rasch aufgestanden, um nicht allzu lange über Mamikas Hilflosigkeit irritiert zu sein, aber Vater, unser Vater?, sah trotz seiner Zigarette, seinem undurchdringlichen Schnauz, seinen goldenen Zähnen, seinen Furchen auf Stirn und Wangen, unser Vater sah mit einem Mal um Jahre jünger aus, ein Junge, der mit der hellen Begeisterung eines Kindes seiner Mutter von seiner neuen Errungenschaft erzählt und von ihr ganz dringend ein zärtliches Lob, eine Anerkennung will (und Mamika wird es ihm geben, das Dringende, Notwendige, obwohl sie sich völlig fehl am Platz vorkommt, wird sie merken, was er von ihr braucht) – Nomi und ich, wir bleiben sitzen, weil wir diesem Jungen möglichst lange zuschauen wollen, so lange, dass wir ihn nie mehr vergessen.
Weil Onkel Móric’ und Tante Mancis Haus von Klapperkisten, Trabbis, Škodas, Ladas, Yugos umzingelt ist, können wir nicht vorfahren, müssen wir, weil wir zu spät sind, in eine kleine Seitenstrasse einbiegen, wir müssen wieder einmal auf- und abschaukeln, unsere neuen Festtagskleider, die bei jeder kleinsten Bewegung knistern, und Vater brummelt, weil ihn alles nervös macht, das Knistern, diese blöde gyík utca, Eidechsenstrasse, in der womöglich unser Wagen geklaut wird, die Sonne, die durch die Scheibe blendet, das Brautpaar wird uns heute wegschmelzen, sagt er, und wir lachen, Mamika, Mutter, Nomi und ich, aber Vater nicht, er lockert seinen Krawattenknopf, als er den Motor abstellt und mit dem Taschentuch über seine Stirn und das Steuerrad fährt, und Vater schwitzt nicht nur, weil es heiss ist, sondern weil ihm gestern Abend aufgefallen ist, dass das Brautpaar, Nándor und Valéria, exakt drei Monate nach Titos Tod heiratet, am 4. 8. 1980!, und Vater musste diesen Umstand reichlich begiessen. Zufall, sagt Mutter, und wir sitzen um Mamikas Küchentisch, Nomi und ich essen Palatschinken, während Mamika erzählt, wieviel Geflügel schon Tage im voraus geschlachtet worden sei, und ausserdem ein Schwein, ein Kalb, zwei Lämmer, die vielen Eimer, in denen das Blut aufgefangen worden sei, wie viele Kilo Paprika mit Hackfleisch gefüllt worden seien, dass Tante Manci ihren berühmt berüchtigten Geiz vergessen, für die Hochzeit ihres Sohnes die Vorratskammer gnadenlos geplündert habe, und Mamika sagt, dass zweihundertfünfzig Gäste erwartet würden, dann kommen bestimmt dreihundert, meint Mutter, und als sich die Erwachsenen darüber unterhalten, dass eine Hochzeit eben die Eltern des Brautpaares ruiniere, das gehöre dazu, zu einem richtigen Fest!, als Mamika erzählt, es gebe mindestens fünf verschiedene Fleischgerichte, Eintöpfe, Gebratenes, und das Lamm werde direkt im Hof grilliert, da schlägt Vater sich gegen die Stirn, mein Gott, ruft er, warum ist mir das nicht früher aufgefallen?, mein Neffe heiratet an einem historischen Datum, und Nomi hat noch ein Stück Palatschinke im Mund, als sie fragt, ein historisches Datum, was ist das? Vater holt endlos lange aus, merkt gar nicht, dass er sein Wasserglas mit Schnaps füllt, hör doch auf, unterbricht Mutter ihn irgendwann, purer Zufall, dass die Hochzeit an diesem Datum stattfindet, du solltest doch wissen, wie lange im Voraus man so ein Fest planen muss. Zufall, vielleicht, antwortet Vater, aber ein schöner Zufall, ich jedenfalls werde dem Brautpaar gratulieren, dass es an diesem historischen Datum heiratet, und Vater kippt den Schnaps mit einem heftigen Schwung in den Hals, stellt das Glas auf den Tisch zurück, füllt sofort wieder nach, schaut uns an, ärgert sich wahrscheinlich über unsere ratlosen Gesichter, sicher nervt ihn Mutter, die sagt, dass er das mit der Gratulation besser bleiben lassen solle, und Nomi und ich teilen uns die letzte Palatschinke, Zimt und Zucker, das sind die Besten, sagt Nomi und schaut mich fragend an, Schokolade mit Baumnüssen, antworte ich, Zimt!, so Nomi, Zucker!, antworte ich, lecker! Ohne uns abzusprechen, spielen Nomi und ich eines unserer Wortspiele, wir spielen uns Wörter zu, die sich entweder am Wortanfang oder am Wortende reimen, locker!, wir spielen, weil wir ahnen, was jetzt kommt, Loch!, und Mamika macht mit, Koch!, frech!, so Nomi, aber Vater ist schon im Bunker, in seinem Bunker, wie Nomi und ich es nennen, er schiebt seinen Unterkiefer hin und her, zeigt seine goldenen Vorderzähne, die in solchen Momenten immer einen frisch geschliffenen Glanz haben, ein paar Mal ist es uns gelungen, Vater abzulenken, frisch!, aber diesmal nicht. Er ignoriert uns, streckt sein Schnapsglas so in die Luft, als trage er eine lodernde Fackel in der Hand, auf Nándors Hochzeit!, ruft er, auf den 4. 8. 1980!, und Vater kippt den Schnaps, stellt das Glas dann knallend auf die Tischplatte zurück, wollt ihr nicht mit mir anstossen, fragt er, ist die Hochzeit meines Neffen nicht Grund genug, um wenigstens ein Schnäpschen mit mir zu trinken?
Nomi und ich sind verstummt, wir rutschen auf unseren Stühlen hin und her, wir tun beide dasselbe, nämlich nach einem geeigneten Grund suchen, um aufzustehen, um nicht mitzuerleben, wie Vater in seinem Bunker hockt, niemanden mehr an sich ranlässt, ich muss mal, sagt Nomi, ich gehe mit, und Nomi und ich fassen uns rasch an unseren Fingern, Mutter, die uns mit einem dringenden Blick zum Bleiben bittet, aber wir wollen nicht, wir sind schon fast draussen, als wir Mamika noch mit ruhiger Stimme sagen hören, weisst du was, ich werde heute Abend für dich beten, dass du an Nándors Hochzeit nicht ersäufst!, und als wir dann in Mamikas Garten durch die Spalten der Holzzäune in die Innenhöfe der benachbarten Häuser spähen, fragt mich Nomi, was meinst du, wie lange wird es dauern?
Nein, es wird keine Stunde dauern, dann wird die Schnapsflasche leer sein und Vaters Kopf auf der Tischplatte liegen, alle Beschwörungen und Flüche werden sich mit dem Obstgeist vermischt haben, und Vater wird im Tiefschlaf verschwunden und traumlos glücklich sein, Mutter jedenfalls glaubt, dass Vater sich mit seinen Schnapsexzessen von seinen Albträumen befreit, was für Albträume?, so fragten Nomi und ich, nachdem Vater sich an einem Silvesterabend noch vor Mitternacht fast bis zur Bewusstlosigkeit betrunken hatte. Wegen früher, antwortete Mutter, wegen der Geschichte. Wie, was für eine Geschichte?, und Mutter stockte, als hätten wir eine von jenen schwer zu beantwortenden Fragen gestellt, die Kinder stellen: Was ist hinter der Sonne? Warum haben wir keinen Fluss in unserem Garten? Die Kommunisten haben sein Leben zerstört, sagte Mutter in einem Tonfall, den wir noch nie bei ihr gehört hatten, aber das wird euch Vater irgendwann selbst erzählen, wenn ihr grösser seid. Grösser, wann ist das? Irgendwann, wenn der richtige Zeitpunkt da ist, in ein paar Jahren, wenn ihr das Ganze besser verstehen könnt.
Wir steigen aus unserem Wagen, Nomi und ich hängen uns bei Mamika ein, Mutter bei Vater, und unsere Absätze klappern auf den Pflastersteinen, unsere Kleider knistern nicht mehr, sondern rauschen in der heissen Luft, es ist so heiss, dass ich zu Nomi sage, schau mal, der Himmel ist weiss, aber irgendwie schmutzig weiss, antwortet Nomi, und wir passen uns Mamikas langsamen, gleichmässigen Schritten an, und als wir um die Ecke biegen, schaut Vater mit einem schrägen Blick zu uns, sagt, dass das Empfangskomitee uns bereits erwarte, Juli, die vor Onkel Móric’ und Tante Mancis Haus steht, uns zuwinkt, ja, unsere Julika will auch etwas von der Hochzeit haben, sagt Mamika und winkt zurück. Ist sie auch eingeladen, fragen Nomi und ich, und Mamika lacht, Julika ist zu jedem Fest eingeladen oder anders gesagt, es wäre kein gutes Zeichen, wenn sie bei einer Hochzeit fehlen würde, trotzdem darf sie nicht rein, ins Zelt, und obwohl wir nicht verstehen, was Mamika genau meint, fragen wir nicht weiter, und Juli, die so lange mit beiden Armen winkt, bis wir nur noch wenige Schritte von ihr entfernt sind, panni néni, panni néni!, ruft Juli Mamika zu, ich habe eine Nelke bekommen, sehen Sie nur, eine rote Nelke!, und Mamika begrüsst Juli zärtlich, fährt ihr über die speckige Wange, sagt, du siehst hübsch aus, meine Julika, Grossmutter sagt tatsächlich, richtig festlich siehst du aus!, und Nomi und ich, wir schauen uns an, weil Mamika das wirklich ernst meint, wir haben ziemlich sicher auch ein schlechtes Gewissen, weil wir uns bereits in einer für alle anderen unhörbaren Sprache, die nur Geschwister miteinander teilen, darüber verständigt haben, wie lächerlich Juli aussieht mit ihrem schief hängenden Trägerkleid, ihren frisch abgeschnittenen Fransen, die trostlose rote Blume, die hinter ihrem Ohr steckt, aber als Juli plötzlich mit einem Satz ganz nah vor Nomi und mir steht, sie sich an keine Anstandsregel hält, als sie in unsere erschrockenen Gesichter hinein sagt, ich bin die heimliche Braut!, mit einer Miene, die mich in ihrer Feierlichkeit und Ernsthaftigkeit an die Heiligenbildchen erinnert, die Mamika in ihrer Kredenz aufbewahrt, als Juli ihre Nelkenblüte hinter dem Ohr hervorzieht und flüstert, seht nur, das ist mein kleiner, verschlafener Trauzeuge, und wir beide müssen dringend bald etwas essen, da finde ich Juli nicht mehr lächerlich, sondern unbegreiflich komisch und beängstigend. Ihr bringt uns doch bald etwas zu essen, ja?, von allem ein bisschen!, ruft sie uns nach, als wir die Tür zu Onkel Móric’ und Tante Mancis Haus hinter uns zuziehen.
Nándor und Valéria, ein wirkliches Fest in einer flimmernden Hitze, und das Fest hat eigentlich schon morgens begonnen, in Mamikas Wohn- und Schlafzimmer, als wir unsere neuen Festtagskleider aus dem Seidenpapier wickeln und auf Grossmutters Betten auslegen; Nomi, Mutter und ich, wir haben uns stundenlang vor Spiegeln gedreht, wir haben uns einen Nachmittag lang von zierlichen Damen beraten lassen, ob wir mit unserem Geschmack richtig liegen, und wir haben uns davon überzeugen lassen, dass man Kleider in ihrer Gesamtheit beurteilen muss, wir haben uns Kleider gekauft, damit wir bei der Hochzeit unseres Cousins von hinten genauso schön aussehen wie von vorn, und für Mamika hat Mutter ein schwarzes Kleid mit einem dezenten Muster ausgesucht, Mamika, die seit dem Tod von Papuci, ihrem Mann, nie etwas anderes getragen hat als Schwarz oder Dunkelblau, aber nie irgendetwas mit Muster. Meint ihr, ich kann das tragen?, fragt sie und fährt behutsam mit ihrer Hand über den Stoff, und Mutter hilft Mamika aus ihrem Alltagskleid, ihr sollt nicht immer soviel Geld ausgeben für mich, sagt Mamika, als Mutter ihr noch, nachdem sie ihr den Reissverschluss hochgezogen und den Kragen glatt gestrichen hat, beiläufig eine Tasche in die Hand legt. Ich finde, Sie sehen wunderschön aus, sagt Nomi, und das Muster ist ja nur ganz ganz winzig.
Nándor und Valéria, die Erinnerung an ein kochendes Hochzeitszelt, das im Innenhof von Tante Manci und Onkel Móric aufgestellt worden ist, das wir Kinder am Tag vor der Hochzeit mit Krepppapier und roten Nelken schmücken, Nomi und ich, die etwas unbeholfen am Tisch sitzen, uns in Papierrollen verwickeln, uns von unserer sehr ernsthaften Cou-Cousine zeigen lassen müssen, wie es geht, die einfachste Sache der Welt! Lujza, die mit ihren kurzen Fingern (schwitzende Wurstfinger, sagen wir, auf Schweizerdeutsch) die Papierrollen so rasch übereinanderlegt, als müssten wir nicht nur das Zelt, sondern den ganzen Innenhof samt Haus dekorieren, ich finde es erstaunlich, dass ihr so was nicht auf die Reihe kriegt, sagt Lujza, ohne uns anzuschauen, ich dachte, ehrlich gesagt, dass ihr im Westen alles könnt, und natürlich lästern Nomi und ich auf Schweizerdeutsch weiter über sie, über ihre Flaschenbodenbrille und ihre naive Freude, dass sie die Schleppe der Braut mittragen darf, bei uns gibt’s gar kein Krepppapier mehr, sage ich laut, und Nomi und ich zwinkern uns zu, drücken unsere Knie gegeneinander, dann könnt ihr ja gar kein Zelt dekorieren, sagt Lujza und zieht das ineinandergefaltete Papier auseinander, zeigt uns, indem sie den Kopf nach hinten wirft, die rot-grün-weisse Girlande, Lujza, die die Leiter hinauffliegt, die Girlande mit flinken Handbewegungen am Zelt befestigt, das wird ein rauschendes Fest, sag ich euch, eine Hochzeit, von der man noch lange reden wird, und sie zeigt auf das Zelt, das fast fertig geschmückt ist, die Papiergirlanden, die in allen Farben in der Luft hängen, rote Nelken, die wir zu einem Herz geflochten haben und mit ausgewählten Heiligenbildchen da befestigt haben, wo das Brautpaar morgen sitzen wird; und fast schäme ich mich für Lujza, dass sie wegen dem bisschen Papier- und Blumenschmuck so stolz und aufgeregt ist, sie kennt eben die wirkliche Aufregung nicht, Jungs mit richtig sitzenden, modischen Jeans, halsbrecherische Achterbahnen, sie tut mir leid, dass sie wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben ein richtiges Schaufenster gesehen hat.
Ich, die nach immer neuen Sachen sucht, die Lujza in ihrer Naivität entlarven, setze mich mit Nomi etwas abseits hin, als Onkel Móric mit ein paar Männern die Lichterketten montieren, wir schauen zu, wie die Männer hängen, umhängen, weil Lujza wieder Bescheid weiss, aber als wir das fertig geschmückte, beleuchtete Zelt sehen, die langen, mit weissen Tischtüchern gedeckten Tische, die vielen Gläser und Teller, die zu Fächern gefalteten Servietten, sind wir doch sprachlos, dass es nicht primitiv, sondern festlich aussieht.
Und wir?, wie sehen wir denn aus, als wir vor dem Zelt stehen, vom Brautführer begrüsst werden, das grasgrüne, knöchellange Kleid von Mutter, Nomi, die für die 50er Jahre schwärmt und ein rosarotes Tüllkleid trägt, Vater, der in einem Anzug, so finde ich jedenfalls, immer sehr elegant und ernst aussieht, ein hellgrauer Anzug, ein weisses Hemd und eine in drei Farben schillernde Krawatte, und ich trage einen knielangen, eng anliegenden, weissen Jupe, eine hellblaue Bluse, die die Schultern freilässt (und wenn ich nicht wüsste, dass ihr es seid, hätte ich euch nicht erkannt, sagte Mamika, als wir uns umgezogen haben), als wir so vor dem Zelt stehen, der Brautführer irgendwas von wegen weit gereist sind sie, sagt, vergisst die Hochzeitsgesellschaft, weiterzuessen, Suppenlöffel bleiben in der Luft, an Brotbissen wird nicht mehr gekaut, und einen Moment lang kommt es mir so vor, als müssten wir rückwärts wieder raus, damit alles seinen gewohnten Lauf nehmen kann, ohne uns – aber schon im nächsten Moment werden wir lachend zu Tisch gebeten, geben uns Tante Manci und Onkel Móric schmatzende Küsse, das Brautpaar, das uns umarmt, die Hände drückt, beteuert, dass sie sich freuen, von so weit her!, für uns, für unseren Tag!
Und schon haben wir eine dampfende Suppe vor uns, eine Hühnersuppe mit beeindruckenden Fettaugen, Füssen, Herzen, Lebern, und derjenige, der das Hirn kriegt, wird so gescheit sein wie Einstein!, so ruft man sich zu; gelbe Bohnensuppe mit Essig und Sauerrahm, grüne Erbsensuppe mit Taubenfleisch, die alle grossartig finden, Tante Manci, die das Geheimnis ihres Süppchens nicht preisgibt, aber soviel verrat ich euch, bei mir kommt nur ganz junges Taubenfleisch rein!, und natürlich die Fischsuppe mit ganzen Karpfenköpfen, die in der Sommerküche in einem Kessel vor sich hinköchelt.
Und weiter geht’s mit leichten Fleischgerichten: knusprig gebratene Hühner und frittierte Kartoffeln, hauchdünn geklopfte, panierte Schweineschnitzel mit Petersilienkartoffeln, und die Musiker singen, und alle singen mit, wir treffen uns bald, wir treffen uns bald in einem andern Land … Kalbfleisch mit frischen Champignons, dazu Sauerrahm und Knödel, hört auf, ruft jemand, sonst können wir nicht mehr in die Kirche, dann müsst ihr die Trauung abblasen! Trotzdem wird noch fasírt aufgetragen, weil Tante Mancis Hackfleischgerichte unwiderstehlich sind – wir essen beim Mittagessen schon so viel, dass Nomi schwört, sie werde den ganzen Tag nichts mehr essen können, wart’s ab, meint Mamika lachend, das Fest hat erst gerade angefangen!





























