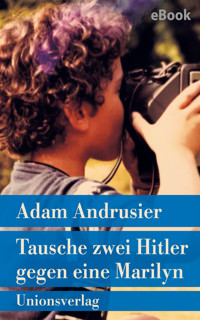
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Schon wieder die Nazis?«, fragt Adams Mutter, wenn der Vater bereits beim Frühstück einen leidenschaftlichen Vortrag über die Verbrechen des Dritten Reichs hält. Oder im Skiurlaub dem deutschen Ehepaar stolz seine Postkartensammlung zerstörter Synagogen präsentiert. Dass er die Familie dann auch noch regelmäßig zum Israelischen Volkstanz schleift, bringt nicht nur die Mutter zur Verzweiflung. Adam jedoch weiß sich zu retten: Eine echte Berühmtheit zieht in ihren Londoner Vorort, und Adam ergattert ein Autogramm. Bald schreibt er von Sinatra bis Mandela alles an, was Rang und Namen hat, und verfällt einer Leidenschaft, die alles andere in den Schatten stellt. Eine Komödie mit Widerhaken über das Erwachsenwerden, jüdischen Familienirrwitz und das unbedingte Verlangen nach Freiheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch
Während Adams Vater die Familie mit seiner Begeisterung für Israelischen Volkstanz in die Verzweiflung treibt, weiß Adam sich zu retten: Er ergattert das Autogramm einer echten Berühmtheit und verfällt bald einer glühenden Sammelleidenschaft. Eine Komödie mit Widerhaken über das Erwachsenwerden, jüdischen Familienirrwitz und das Verlangen nach Freiheit.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Adam Andrusier (*1974), Autor und Autographenhändler, studierte Musik und Kreatives Schreiben. Seine Leidenschaft für das Sammeln von und Handeln mit Autogrammen ist die Grundlage seines Romandebüts und inspirierte Zadie Smiths Roman Der Autogrammhändler. Er lebt mit Frau und Kind in London.
Zur Webseite von Adam Andrusier.
Dirk van Gunsteren (*1953) studierte Amerikanistik und übersetzt u. a. Jonathan Safran Foer, Colum McCann, Thomas Pynchon, Philip Roth, T. C. Boyle und Oliver Sacks. 2007 erhielt er den Heinrich-Maria-Ledig-Rowohlt-Preis.
Zur Webseite von Dirk van Gunsteren.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Hardcover, Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Adam Andrusier
Tausche zwei Hitler gegen eine Marilyn
Roman
Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren
E-Book-Ausgabe
Mit einem Bonus-Dokument im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die Originalausgabe erschien 2021 bei der Headline Publishing Group, London.
Lektorat: Patricia Reimann
Originaltitel: Two Hitlers and a Marilyn
© by Adam Andrusier Writing Ltd 2021
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Adam Andrusier
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31136-7
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 17.05.2024, 23:44h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
TAUSCHE ZWEI HITLER GEGEN EINE MARILYN
Ronnie BarkerBig DaddySinatraClint EastwoodLiz TaylorGarboRay CharlesMiles DavisNelson MandelaRichard GereBoris JelzinSteve ReichSalman RushdieHarry SecombeBeißerMarilynElvisHitlerMonica LewinskyEpilogDanksagungNachweiseMehr über dieses Buch
Adam Andrusier: »Sammeln ist der Impuls, die Welt auf eine bestimmte Weise zu organisieren.«
Über Adam Andrusier
Über Dirk van Gunsteren
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema England
Vorbemerkung des Autors
Einige Einzelheiten dieser Geschichte wurden verändert, darunter Namen und Aussehen von Personen sowie Daten, Orte und Ereignisse.
Ronnie Barker
Das Wunderbare an einem zweideutigen Witz ist,dass er nur eins bedeuten kann.
RONNIE BARKER
Mein Vater war der hinter der Kamera. Ein Auge zugekniffen, ein halbes Lächeln, der Rest seines Gesichts hinter der Kodak verborgen. Bei jeder Gelegenheit knipste er wie ein Paparazzo ein Foto nach dem anderen. Die Bilder waren verwackelt oder zeigten Menschen in seltsamen Übergängen von einem Gesichtsausdruck zum anderen, doch sein Enthusiasmus war nicht zu bremsen. Wenn er pro Tag zwanzig Schnappschüsse machte – eine eher zurückhaltende Schätzung –, dann müssen es allein in den Achtzigern dreiundsiebzigtausend Fotos gewesen sein.
»Willst du nicht lieber wirklich was erleben, anstatt immer nur zu dokumentieren?«, fragte Mum ihn.
»Ich erlebe ja was«, widersprach Dad. »Und gleichzeitig dokumentiere ich es.«
Mein Vater hatte eine Vorliebe für ein bestimmtes Motiv: meine Mutter, meine Schwester und ich, freudlos aufgereiht.
»Na kommt schon«, rief er, »macht ein fröhliches Gesicht.«
»Wir versuchen’s. Aber es ist nicht so leicht.«
Wir bleckten die Zähne vor Triptychen, auf venezianischen Gondeln und neben Schildern, die Besucher irgendwo willkommen hießen.
»Du bist ein Fantast«, sagte Mum. »Keiner wird sich all diese Fotos ansehen.«
»Ich werde sie mir ansehen. Ich will das alles dokumentieren!«
In Wirklichkeit sah mein Vater sich meist seine Postkartensammlung an: Synagogen, die von den Nazis zerstört worden waren. Wenn meine Schwester Ruth und ich morgens unser Müsli aßen, hörten wir detaillierte Schilderungen der Reichspogromnacht, gespeist aus der umfangreichen Bibliothek meines Vaters über Hitler, das Dritte Reich und den Völkermord. Unsere Twister-Spiele unterbrach er mit der Information darüber, wie viele in Treblinka ermordet worden waren. An den Wochenenden ging er in sein Arbeitszimmer, wo er mit einer auf dem Schreibtisch montierten Kamera seine Synagogen-Postkarten fotografierte. Die Kamera hatte er sich zum vierzigsten Geburtstag geschenkt. Er lud Freunde ein, mit ihm hinaufzugehen und sie sich anzusehen. »Sehr gut, Adrian«, hörte man sie sagen. »Es ist schön, wenn man ein Hobby hat.«
Ich fragte ihn, warum er Synagogen sammelte, wo wir doch kaum je in die Pinner United Synagogue gingen.
»Wegen der Kontinuität«, sagte er knapp. »Diese Gebäude wurden von Hitler zerstört, und die wenigen, die noch stehen, sind jetzt Bibliotheken oder Sporthallen oder Kinos. Es ist wichtig, das zu dokumentieren.«
»Schon wieder die Nazis«, rief meine Mutter aus der Küche. »Kannst du nicht mal damit aufhören? Er ist erst zehn.«
Eines Tages machte mein Vater sich über eine Schachtel voller Familienfotos her und schnitt mit einer Schere unsere Gesichter aus. Anschließend suchte er in Büchern nach Fotos berühmter Menschen, überklebte ihre Gesichter mit unseren und fotografierte sie mit seiner Spezialkamera. So wurden aus Rudolf Nurejew und Margot Fonteyn Mum und Dad. Aus Fred Astaire und Ginger Rogers wurden ich und meine Schwester. Der Matrose und die junge Frau, die am Ende des Zweiten Weltkriegs auf dem Times Square von ihm geküsst wird, verwandelten sich in Dads Buchhalter und seine Frau. Wir gingen am Arbeitszimmer vorbei und hörten die Kamera klicken und Dad lachen, als wäre er der komischste Mensch der Welt. Er ließ die Filme in einem Fotogeschäft in der Nachbarschaft seines Büros entwickeln und kam mit einem Stapel großer hochglänzender Abzüge nach Hause, die er uns wie ein Zauberer einen nach dem anderen vorlegte.
»Das ist völlig verdreht«, sagte Mum und sah mich, den Zehnjährigen, ratlos an. »Warum tut man so was?«
»Ach, das ist doch nur ein Spaß«, sagte Dad. »Wie findet ihr das hier?«
Meine Schwester und ich als US-Marines, die in Iwo Jima die amerikanische Flagge aufstellten.
»Und das?«
Michael Rose, der Partner meines Vaters, hielt in Nürnberg eine Rede.
»Und das hier nehme ich mir als Nächstes vor!«
Dad legte sein wertvollstes Stück auf den Tisch, ein signiertes Foto von Danny Kaye als Hans Christian Andersen, das er auf einem seiner Postkartenmärkte gekauft hatte. »Mit besten Grüßen, Danny Kaye« stand da, mit Tinte geschrieben. Mein Vater verehrte Danny Kaye und liebte es, sich mit uns seine Filme anzusehen. Kaye geriet immer in missliche Situationen: Er musste völlig unvorbereitet auf einer Bühne ein Ballett tanzen oder so tun, als wäre er Ire, oder durch den Wagen wildfremder Leute kriechen, um auf die andere Straßenseite zu gelangen. Er hatte eine alberne Sprechweise und war den Leuten peinlich – genau wie mein Vater. Ich mochte Danny Kaye, hatte aber auch Mitleid mit ihm, weil er immer ein derartiger Schmock war.
»Und das werde ich draufkleben.«
Dad legte sein eigenes ausgeschnittenes Gesicht – mit einem falschen chassidischen Bart – auf das von Danny Kaye.
»Ich glaube, du brauchst Hilfe«, sagte Mum.
*
Als ich das erste Mal jemanden um ein Autogramm bat, war ich selbst überrascht – es war ein seltsamer Zufall. Ich war zehn und bei Adam Brichto, meinem besten Freund. Er wohnte am Amberley Close in einem Haus, vor dem einige Säulen standen wie vor dem Eingang eines römischen Bades. Unser Haus war von oben bis unten mit einem dicken braunen Teppich bewachsen, aber das der Brichtos war weiß, und alles sah immer so aus, als hätte Astrid, das Au-pair-Mädchen, das ständig staubsaugte oder Wäsche zusammenlegte, es gerade geputzt. Adams Vater war Rabbi der Liberalen Gemeinde und hatte ein Arbeitszimmer zur Straße hin, das wir nicht betreten durften. Bei den Brichtos war es immer still und friedlich. Adams Vater blieb für sich. Er sammelte nichts, er bat einen nicht, sich Fotos anzusehen, und er machte keine SS-Offiziere nach.
Meistens spielten Adam und ich Murmeln. Wir fingen in seinem Zimmer an und arbeiteten uns von dort durch den Rest des Hauses, bis wir von Adams Mutter oder Astrid sanft getadelt wurden. Einmal, als Rabbi Brichto ausgegangen war und Adams Mutter telefonierte, konnten wir nicht widerstehen, unser Murmelspiel bis zu seinem Arbeitszimmer auszudehnen. Unsere Murmeln blieben vor der Tür liegen. Wir öffneten sie.
Im Arbeitszimmer meines Vaters lagen überall Bücher und Papiere herum, es roch muffig und sah laut Mum aus wie Dresden nach der Bombardierung. Im Arbeitszimmer von Adams Vater dagegen standen deckenhohe weiße Regale an den Wänden, voll mit akkurat ausgerichteten Büchern. Auf dem riesigen Schreibtisch in der Mitte waren silberne Bilderrahmen mit Fotos, auf denen der Rabbi bei offiziellen Anlässen neben wichtig wirkenden Menschen zu sehen war. Auf einem davon stand er lachend neben der aktuellen Premierministerin. Ich untersuchte es genau, um festzustellen, ob Adams Vater vielleicht sein eigenes Gesicht darauf geklebt hatte.
»Dein Vater kennt Maggie Thatcher?«, fragte ich.
»Ja, er wurde ihr mal vorgestellt«, sagte Adams Mum, die gerade in der Tür erschien. »Er kennt einige berühmte Leute.«
Adams Mutter war nicht verärgert, weil wir uns ins Arbeitszimmer ihres Mannes geschlichen hatten. Sie war freundlich, hübsch und schlank. Sie nannte mich »Adam A« und ihren eigenen Sohn »Adam B«. Als Adam sich weigerte, Gemüse zu essen, tat sie, als wäre sie völlig verzweifelt, und brachte uns beide zum Lachen. »Aber wenn du es nicht wenigstens probierst, Adam B, werde ich sehr traurig sein«, sagte sie mit übertrieben weinerlicher Stimme. »Du bist gemein zu mir! Warum bist du nur so gemein, Adam B?« Ständig trocknete sie sich die Haare oder machte sich zurecht, um auszugehen. Wenn beim Abendessen das Telefon läutete, nahm sie, bevor sie zum Hörer griff, einen ihrer Ohrringe ab, und dann folgte ein langes Gespräch, in dessen Verlauf sie viel lachte und mit ihrer Freundin den neuesten Klatsch austauschte. Als ich Mum auf dem Heimweg davon erzählte, sagte sie, das gehöre sich nicht; wenn man beim Abendessen angerufen werde, müsse man sagen, man werde später zurückrufen.
»Hat Adam B dir erzählt, dass Ronnie Barker hier um die Ecke wohnt?«, fragte Adams Mutter.
Unglaublich. Meine Familie tat gewöhnlich nicht, was alle taten, aber samstags abends setzten wir uns wie alle vor den Fernseher und sahen uns The Two Ronnies an. Selbst meinen Großeltern gefiel das. »Dieser Ronnie Barker«, sagte mein Großvater mit seinem tschechischen Akzent und hob den Finger, »der hat was im Kopf. Sehr schlau.« Dass jemand, der so berühmt war wie Ronnie Barker, ganz in der Nähe von Adam Brichto lebte, fühlte sich fast unheimlich an, wie ein sehr seltsamer Glücksfall.
»Gleich über die Straße, in der Moss Lane«, sagte Adams Mutter.
Als sie hinausgegangen war, fragte ich Adam: »Wohnt Ronnie Barker wirklich hier um die Ecke, oder war das ein Witz?«
»Nein, es stimmt«, sagte Adam. »Komm, vielleicht kriegen wir ihn zu sehen.«
Wir sagten Adams Mutter, dass wir vor dem Haus Fußball spielen wollten. Sie machte in der Küche einen Salat und sagte, das sei in Ordnung, aber wir sollten vorsichtig sein. Wir schlugen die Haustür zu, schlichen zum Ende der Amberley Close und bogen nach rechts in die Moss Lane ab.
»Wird deine Mutter nicht nach uns schauen und merken, dass wir weg sind?«, fragte ich und dachte daran, dass meine Mutter in diesem Fall einen Herzanfall bekäme.
»Nein, wird sie nicht«, sagte Adam. »Sie wird telefonieren.«
»Aber weißt du überhaupt, welches Haus es ist?«
Ich war vor Aufregung ein bisschen außer Atem, als wir die von Bäumen gesäumte Moss Lane entlangliefen, vorbei an der roten Telefonzelle und der Bank.
»Es ist das an der Ecke, mit den vielen Bäumen.«
Wir überquerten die Straße, und Adam verlangsamte seine Schritte.
»Hier. Das ist es«, sagte er.
Wir standen an einem schulterhohen Zaun, der von einer als Sichtschutz dienenden Hecke überragt wurde. Als wir die Zweige auseinanderbogen, sahen wir im Erkerfenster den Hinterkopf eines alten Mannes. Er saß in einem Sessel und sprach mit einem anderen Mann, der einige Meter entfernt stand. Dann wandte er den Kopf zur Seite.
»Mein Gott, ich glaube, das ist er!«, rief ich.
»Er ist es! Ja, er ist es!«, rief Adam.
Aber irgendwas stimmte nicht. Der Mann, der einen grauen Pullover trug, wirkte müde. Sein Gesicht war ernst und ungeduldig. Er lachte nicht, und er brachte auch den anderen Mann nicht zum Lachen.
»Bist du sicher?«, fragte ich Adam.
Ich musterte den Mann eingehend und versuchte, ihn mit dem zur Deckung zu bringen, der an den Wochenenden in unserem Fernseher zu sehen war. Der Mann im Fernseher war herzlich und großzügig, aber dieser da trug nicht mal die typische Brille, die in der Tricksequenz des Vorspanns wie rasend rotierte.
»Das muss er sein«, sagte Adam B und spähte angestrengt.
»Komm, wir klopfen an die Tür«, schlug ich vor.
»Ja, gute Idee.«
Wir betätigten den schweren Türklopfer und sahen einander an wie Bankräuber. Eigentlich konnten wir nicht glauben, dass wir es wirklich getan hatten. Das Glas im Fenster der Tür war geriffelt, sodass man kein Gesicht erkennen konnte, nur eine sich nähernde Gestalt. Ich hielt den Atem an. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
Die Tür schwang auf, aber da stand nicht Ronnie Barker, sondern eine Frau. Sie sah uns verblüfft an.
»Wohnt hier Ronnie Barker?«, platzte Adam B heraus.
»Ja«, sagte die Frau.
»Können wir ihn sprechen?«
»Tut mir leid«, sagte die Frau, »aber er empfängt keine Leute an der Tür.«
In diesem Augenblick fiel mir aus irgendeinem Grund Dads Foto von Danny Kaye mit der schön geschwungenen, in Tinte ausgeführten Unterschrift ein.
»Aber wir wollen ihn nur um ein Autogramm bitten«, sagte ich.
»Tut mir leid. Nicht an der Tür. Unmöglich. Warum schreibt ihr ihm nicht?«
Ich versuchte, an der Frau vorbeizusehen für den Fall, dass Ronnie Barker in die Eingangshalle trat und seine Politik änderte, doch schon war die Tür wieder geschlossen. »Na ja«, sagte ich zu Adam B, als wir zu seinem Haus zurückgingen, »wenigstens haben wir ihn gesehen.«
»Ja, aber er sah komisch aus«, sagte Adam. »Überhaupt nicht berühmt.«
Abends erzählte ich meiner Mutter davon und rechnete mit Fragen: Warum hatte uns kein Erwachsener begleitet, und war das nicht gefährlich gewesen? Stattdessen sagte sie: »Ach, mir gefällt Ronnie Barker. Er ist sehr intelligent. Du solltest tun, was die Frau gesagt hat: Schreib ihm einen Brief. Schreib ihm, wie sehr dir seine Sendung gefällt.«
Also brachte ich es zu Papier. Wenn ich den Mann schon nicht persönlich kennenlernen konnte, wollte ich wenigstens etwas Schriftliches von ihm.
Lieber Ronnie Barker,
ich war einer der Jungen, die heute an Ihre Tür geklopft haben. Könnten Sie mir bitte ein Autogramm von Ihnen schicken? Ich würde es so gern haben. Ich finde, Sie sind einer der witzigsten und intelligentesten Menschen im Fernsehen. Meine ganze Familie sieht jeden Samstag Ihre Sendung.
Mit hoffnungsvollen Grüßen
Adam Andrusier
Mum warf den Umschlag am nächsten Tag in den Briefkasten.
Am Abend schob ich eine Betamax-Kassette mit einer Episode von The Two Ronnies in den Videorekorder. Während ich die albernen Sketche sah, dachte ich an meinen Brief und spürte zwischen Ronnie Barker und mir eine besondere Verbindung, die mich von meinen Eltern und meiner Schwester unterschied. Es war, als gehörte er jetzt mir – nicht mehr ihnen oder dem ganzen Land. Ich hatte das überwältigende Gefühl, dass ich etwas Erstaunliches in Gang gesetzt hatte.
Der Briefträger kam jeden Tag zur selben Zeit, nämlich um acht, kurz bevor ich zur Schule musste. Während mein Vater vor dem Spiegel an der Garderobe energisch seine Korkenzieherlocken bürstete und meine Schwester ihre Locken im Badezimmer föhnte, stellte ich mich ans Erkerfenster und hielt Ausschau nach einem roten Fleck: der Schultertasche des Briefträgers, der gleich am Ende unserer Straße auftauchen würde. Ich duckte mich, während er sich Haus für Haus vorarbeitete und schließlich zu unserem kam. Die Klappe am Briefschlitz klickte, und ich rannte zur Tür und sah die Rechnungen und langweiligen Briefe durch, die allesamt für meine blöden Eltern waren. Jeden Tag dasselbe, jeden Tag nichts.
Am vierten Tag klickte die Klappe, und ein handschriftlich an mich adressierter Umschlag fiel durch den Schlitz. Es war der, in dem ich meinen Brief an Ronnie Barker geschickt hatte; jemand hatte seine Adresse durchgestrichen und durch meine ersetzt. Ich riss ihn auf, und ein kleines Farbfoto fiel auf den braunen Teppich. Ich hob es auf und drehte und wendete es im Licht, wie mein Vater es mit seinen Spezialfotos machte. Es zeigte Ronnie Barker mit seiner typischen Brille, verrückt grinsend, genau wie im Fernsehen. Darauf war mit schwarzer Tinte geschrieben: »Für Adam, mit besten Wünschen, Ronnie Barker«.
»Ach, das ist ja wirklich nett von ihm«, sagte Mum. »Wenn man bedenkt, dass du einfach an seine Tür geklopft hast.«
»Erstaunlich«, sagte mein Vater und blinzelte, war aber nicht bei der Sache.
»Bist du nicht überrascht, dass er mir ein Foto geschickt hat?«, fragte ich ihn.
Ich wollte, dass er mich ansah, aber er kramte hektisch in seiner Aktentasche.
»Entschuldige«, sagte er, »aber das musst du dir unbedingt ansehen.«
Er zog das große Foto von Danny Kaye als Hans Christian Andersen aus der Aktentasche, doch anstelle des Gesichts von Danny Kaye war nicht, wie erwartet, das von Dad, sondern meins.
»Na, wie findest du das?«, sagte Dad und verkniff sich ein Lachen.
Eine leichte Übelkeit befiel mich. Ich zwang mich zu einem Lächeln. Mein einmontiertes Gesicht grinste gezwungen zurück. Ich wusste genau, wo dieses Foto entstanden war: unter dem Arc de Triomphe, bei fünfunddreißig Grad im Schatten. Wir hatten jeglichen Lebenswillen verloren, doch mein Vater hatte ein Bild nach dem anderen geknipst. »Noch eins! Da drüben. Noch eins. Ich will das dokumentieren!«
Big Daddy
Nach einer Weile wurde ich sehr wütend.Das Verlangen, mich zu wehren,wurde überwältigend.
BIG DADDY
Die ganzen Achtzigerjahre hindurch litt mein Vater an chronischer Sechzigerjahre-Manie. Die Profumo-Affäre, Yoko Onos verhängnisvolles Erscheinen und der frühe Tod von Eddie Cochran gehörten zu den großen Themen seines Lebens. Er sprach ständig von dieser Zeit. »Wisst ihr noch …?«, fragte er seine Freunde. Unsere Partys standen unter Themen aus den Sechzigern, und immer gab es ein Rock-’n’-Roll-Quiz.
Mit unserem Betamax-Rekorder nahm mein Vater alles auf, was über diese Zeit im Fernsehen kam, unter anderem die mehrteilige Dokumentation History of Rock ’n’ Roll, die sich die ganze Familie ansah. Dad machte erläuternde Anmerkungen. An den Wochenenden legte er Musik aus den Sechzigern auf und machte zuckende Gesten in Richtung meiner Mutter. Wenn unsere Eltern tanzten, verzogen meine Schwester und ich das Gesicht und verdrehten die Augen. Dad fuhr sich mit einer Hand durch die Locken, strich mit der anderen über seinen mickrigen Bauch und bewegte sich, als wäre er ein Huhn.
Im Volvo, auf dem Weg zur Schule, kam er besonders in Fahrt. Er zwang uns, seine Lieblingssongs aus der Hitparade zu hören, und strich mir über die Wange. »Gefällt dir das, Adam Doobie-Doobie-Doobs?«, fragte er. Ich nickte und schob eine meiner eigenen Kassetten mit den Eurythmics oder Prince oder dem »Free Nelson Mandela«-Konzert ein, aber davon wollte Dad nichts wissen.
»Nicht mein Ding«, sagte er und drückte die Eject-Taste.
Dann fummelte er eine von seinen Kassetten heraus und schob sie ins Tape Deck, und gleich darauf kam aus den Lautsprechern eine stotternde Stimme, die irgendwas von einem hübschen Mädchen namens Peggy Sue sang. Dad wippte mit dem Kinn.
»Buddy Holly ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. So tragisch. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen.«
In Verkehrsstaus in Kenton hörten meine Schwester und ich Vorträge über die Kubakrise, den Sechstagekrieg und Kennedys Ermordung. Außerdem erfuhren wir, wie arm Dads Familie gewesen war, dass er auf dem Wohnzimmersofa geschlafen hatte und dass sie einmal sogar zwangsgeräumt worden waren. Und jetzt – ja-haa! – fuhr er einen Volvo 760 mit elektrischem Schiebedach und Sitzen, die warm wurden, wenn man auf den roten Knopf drückte. Wir fuhren mit heruntergekurbelten Fenstern den Hendon Way hinunter und beschallten die Umgebung mit »Love Potion Number Nine«.
»Wohin sollen wir dieses Jahr in den Sommerferien fahren, Doobs?«, fragte Dad.
»Nach Kalifornien!«
Ich dachte an die Pappfiguren von Charles und Diana auf der Hutablage unseres Mietwagens und an die Leute, die gesagt hatten: »Mein Gott – was für ein Akzent!« oder: »Und wie ist der Londoner Nebel in letzter Zeit?«, Einer hatte wissen wollen, ob wir Patrick Macnee aus Mit Schirm, Charme und Melone kannten. »Nicht persönlich, aber wir wissen, wer er ist«, hatte Dad gesagt und mit dem Zeigefinger gefuchtelt. Dann die Bootsfahrt in Disneyland, wo am Ufer singende und tanzende Gestalten verschiedener Nationalitäten gestanden hatten. Meine Schwester und ich hatten uns gefühlt wie ein König und seine Königin bei der Besichtigung ihres Reichs. »Es ist eine Welt voller Lachen, eine Welt voller Tränen, es ist ja doch eine kleine Welt«, hatten unsere Untertanen gesungen.
Als wir durch den Kreisverkehr am Northwick Park fuhren, lachte Dad und sagte: »Du möchtest da noch mal hin?«
»Ja! Machen wir das?«
»Mal sehen.«
Ich schloss die Augen, hörte die Musik und hatte das Gefühl, dass ich Anteil an Dads neuem, luxuriösem Lebensstil hatte und von jetzt an alles immer prima sein würde – solange nur Yoko Ono nicht auftauchte und alles den Bach runterging.
*
Mein Vater war Finanzberater und vermittelte Lebensversicherungen, was bedeutete, dass er den Leuten verriet, wie sie gegen ihren Tod wetten konnten. Er konnte zwar nicht machen, dass man nicht starb, aber er konnte den finanziellen Schaden mindern, sofern es einem nichts ausmachte, dass man bei der Auszahlung der Summe bereits tot war. »Ich weiß nur«, sagte er, »dass ich eine Menge Briefe von Witwen kriege, die mir danken, weil ich ihren verstorbenen Mann so gut beraten habe.«
Sein Büro war in der Regent Street, über einem Juweliergeschäft. In den Schulferien verbrachte ich dort immer wieder mal einen Tag. Dad kam rein und schwenkte einen Stapel Postkarten mit nicht mehr existierenden Synagogen. Er strich den Sekretärinnen über die Wange, erzählte einen schlechten Witz über einen Engländer, einen Iren und einen Schotten und wandte sich dann an seine Hauptsekretärin Trisha: »Würden Sie bitte Tee machen, Bubbles?« Sie riss die Augen auf, als er ihr ebenfalls über die Wange strich. Ich nickte ihr hinter seinem Rücken aufmunternd zu: Sei stark, Trisha – wir stehen das gemeinsam durch.
Worauf er sich umdrehte und auch mir über die Wange strich, als wäre ich ein Hamster, während Trisha wissend nickte.
»Das ist mein Sohn«, verkündete Dad seinen Angestellten. »Mein Sohn!«
»Das wissen wir, Adrian«, sagten sie. »Wir kennen ihn ja.«
An den Wänden seines Büros hingen zahlreiche ausgeblichene Cartoons, in denen Witze über das Sterben gemacht wurden, auf dem Schreibtisch lagen Papiere und verschiedene Taschenrechner herum, und außerdem stand da ein Bilderrahmen mit gesprungenem Glas und einem Foto von Dad als Charlton Heston in seiner Rolle als Moses, der die Tafeln mit den Zehn Geboten in Empfang nimmt. Was einem aber am meisten ins Auge sprang, waren die Akten. Sie waren in Großbuchstaben mit den Namen der Klienten beschriftet und stapelten sich überall: auf dem Boden, den Fensterbrettern und den Stühlen, auch auf dem, der eigentlich für Klienten bestimmt war. Wenn das Arbeitszimmer meines Vaters zu Hause an Dresden nach der Bombardierung erinnerte, dann beschwor sein Büro die Staubwüste von Hiroshima herauf.
»Wo ist die Akte Howard Spiegel?«, rief Dad.
»Vielleicht ist sie unter denen hier.« Die verzweifelt wirkende Trisha erschien mit einem Stapel weiterer Akten.
»Sie ist nicht da!«, rief Dad und setzte seine fieberhafte Suche fort. »Ah – schon gut, Bubbles. Ich hab sie.«
In den Ferien einen Tag in seinem Büro zu verbringen, wurde mir als »Spaß« verkauft, doch sobald wir es betraten, vergaß er, dass ich existierte. Ich war mir selbst überlassen, während er sich in seinem Chefsessel hin und her drehte oder mit großer Gebärde Dokumente unterschrieb. Ich fand, dass meine Schwester Ruth es besser hatte: Sie saß gemütlich in unserem Wohnzimmer und las Dickens, während meine Mutter um sie herum staubsaugte.
Manchmal erschien ein geschniegelter Klient zu einem Termin, lächelte, schüttelte Dad die Hand und sagte: »Wie geht’s, Adrian?« Dad erzählte denselben Witz, den er vorher den Sekretärinnen erzählt hatte, zeigte dann auf mich und sagte: »Das ist mein Sohn.« Ich lächelte kurz, und dann verschwanden sie in Dads Büro. Wenige Sekunden später drückte er auf eine Taste an seinem Telefon und sagte: »Bubbles, könnten Sie mir bitte einen aktuellen Überblick über Mr Goldfarbs Lebensversicherung geben?« Ich sah, wie sie beim Klang seiner Stimme die Augen verdrehte und dann in sein Büro ging, auf dem Gesicht ein Lächeln, als würde sie für eins seiner Fotos posieren.
Dad musste Trisha von der Ronnie-Barker-Sache erzählt haben, denn sie hatte eine Idee, wie ich an weitere Autogramme kommen konnte. Sie ging die Anzeigen im Evening Standard durch, um zu sehen, welche Schauspieler in welchem Theater auftraten.
»Du kannst ihnen schreiben und den Brief an die Adresse des Theaters schicken«, sagte sie.
»Aber können Sie mir sagen, welche davon wirklich berühmt sind?«
»Du bist der Sohn vom Boss«, sagte Trisha und zwinkerte mir zu. »Ich werde mein Bestes tun.«
Wir wurden bald von Dads Stimme unterbrochen, die irgendetwas von dauerhafter und vollständiger Berufsunfähigkeit rief, und Trisha sagte: »Tut mir leid, Schätzchen, dein Vater braucht mich«, und verschwand. Danach setzte sie sich wieder an ihren Tisch und schrieb hundert Wörter pro Minute; dabei trug sie Kopfhörer, damit sie die aufgezeichnete Stimme meines Vaters hören konnte. Manchmal schüttelte sie die Hände aus. Ich schrieb inzwischen mit der Hand einen Brief nach dem anderen an Schauspieler, von denen ich noch nie gehört hatte. Im Grunde langweilte ich mich zu Tode. Trisha tippte, und mein Vater sprach noch mehr Briefe auf sein Diktiergerät. Punkt. Neuer Absatz.
Zur Mittagszeit fiel Dad ein, dass es mich gab. Er streckte den Kopf durch die Tür seines Büros und grinste. »Na, Adam Doobie-Doobs? Lust auf einen Spaziergang zur Carnaby Street, mein Sohn?«
Wir schlenderten durch die Regent Street, und er sagte, wie gut es sei, sein Büro mitten in der City zu haben. Und eines Tages würde ich ja vielleicht in die Firma eintreten, oder?
»Nicht mein Ding.«
»Na ja, du bist noch jung, Doobs. Bis dahin ist noch eine Menge Zeit. Wer weiß, was für eine Laufbahn du mal einschlagen wirst? Ich hätte, ehrlich gesagt, auch was ganz anderes werden können als Versicherungsmakler. Ich wäre zum Beispiel ein sehr guter Filmregisseur geworden.«
In der Carnaby Street schüttelte er den Kopf über T-Shirts mit Hitlers Gesicht – »World Tour 1939–1945« – und runzelte die Stirn beim Anblick der Punks mit hohen Schnürstiefeln, Piercings und kreischbunten spitzen Frisuren.
»Die erinnern mich an Toyah«, sagte ich und dachte an das gruselig orangerote Haar, das ich in Top of the Pops gesehen hatte.
»An wen?«
»Toyah, Dad. Kennst du sie nicht? Sie ist ein berühmter Popstar.«
»Ach, ich interessiere mich nicht für Popmusik«, sagte Dad. »Aber da fällt mir ein: Hast du mal von einer Band namens Thompson Twins gehört?«
»Die Thompson Twins? Na klar.«
»Tja, Tony Smith, ein Buchhalter, mit dem ich befreundet bin, kommt nächste Woche mit ihnen vorbei und stellt mich ihnen vor, für den Fall, dass sie eine Versicherung wollen. Ich könnte sie um ihre Autogramme bitten. Ich würde dir gern helfen, eine Sammlung aufzubauen.«
»Wirklich? Das wäre toll!«
Ich vergaß die Sache mit den Thompson Twins, weil ich so damit beschäftigt war, an Schauspieler zu schreiben, von denen ich noch nie gehört hatte. Ich schrieb an Leute, die Alan Bates hießen, Ben Kingsley, Michael Gambon, Helen Mirren, Antony Sher oder Bonnie Langford. Ich schrieb so viele Briefe, dass ich wie Trisha einen Krampf in der Hand kriegte und innehalten musste, um meine Finger zu massieren.
»Ich hab dir was mitgebracht«, sagte Dad eines Abends.
Aus einer Plastiktüte zog er eine bunte Schallplatte. Auf dem Cover waren die Thompson Twins aus verschiedenen Perspektiven dargestellt, wie Figuren in einer Dr.-Seuss-Geschichte, und jeder hatte mit silbriger Tinte unterschrieben und persönliche Worte an mich hinzugefügt.
»Wow! Danke.«
Ich konnte nicht glauben, dass mein Vater diese Leute kannte und dass sie für mich unterschrieben hatten. Ich starrte auf die Schrift – »Alles Gute« und »Viel Spaß« –, als wären es uralte Runen, die erst entziffert werden mussten.
»Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es drei sind«, sagte Dad. »Keine Ahnung, warum sie sich als Zwillinge bezeichnen.«
Die Autogramme waren nicht nur eine aufregende Ergänzung meiner noch kleinen Sammlung, es war auch meine erste Schallplatte, und ich hörte sie die ganze Zeit. Ich achtete genau auf die Klavierakkorde, den rumpelnden Bass und die mit Hall unterlegten Kastagnetten der Einleitung, bevor der Gesang begann: »Hold me now, warm my heart, stay with me, let loving start«. Ich hatte keine Ahnung, worum es ging, aber das machte nichts. Die Frau mit dem kahl rasierten Schädel sei die Freundin von dem mit dem braunen Stachelhaar, erklärte Dad, und ich fragte mich, ob die beiden vielleicht eine gemeinsame Rentenversicherung abgeschlossen hatten. Der mit dem schwarzen Stachelhaar interessierte sich vermutlich für eine Krankenzusatzversicherung.
»Sie mochten mich«, sagte Dad.
Wenig später kam mein Vater mit erstaunlichen Neuigkeiten nach Hause. Die Thompson Twins mochten ihn tatsächlich, denn sie hatten ihn und meine Mutter zu einer Party auf dem Land eingeladen.
»Ich komme nicht mit«, sagte Mum. »Ich habe keine Lust, die Frau des Versicherungsmaklers zu sein.«
»Ach, komm schon, Lo-lo. Es wird bestimmt schön.«
»Kannst du mir Autogramme mitbringen?«, rief ich. »Es werden doch jede Menge Popstars da sein.«
»Ja, wahrscheinlich«, sagte Dad. »Ich werde es versuchen.«
*
Als der Abend der Party näher rückte, entwarf ich einen genauen Plan, der im Grunde darauf hinauslief, dass mein Vater sich durch die Menge der Partygäste arbeiten und jeden wichtigen Menschen um ein Autogramm bitten musste. Ich gab ihm Tipps, wie er sich in eine Unterhaltung zwischen Berühmtheiten einschalten konnte.
»Enttäusch mich nicht«, sagte ich.
Es schien ungerecht, dass Mum und Dad in ihrem Volvo zu einer Popstar-Party auf dem Land fahren durften, während Ruth und ich mit dem Babysitter Monopoly spielen und die Saturday Show sehen mussten, wo Big Daddy den ebenso großen Giant Haystacks im Wrestlingring verprügelte, gefolgt von 3-2-1, wo die Kandidaten es mit einem als Mülltonne verkleideten Roboter zu tun bekamen. Aber ich ging an jenem Abend ohne Murren zu Bett, denn ich konnte es kaum erwarten, am nächsten Morgen aufzuwachen und zu sehen, was mein Vater mir mitgebracht hatte.
»Es war unglaublich«, sagte Dad. »Es gab Jongleure und Zauberer und Liliputaner, die Drinks serviert haben, und ein Feuerwerk und lauter so Zeug. Ich glaube, ich habe noch nie ein so großes Haus gesehen. Mummy fand es übertrieben, aber mir hat es gefallen.«
»Und wer war alles da? Welche Popstars?«
»Einer hieß George. Mit Nachnamen.«
»Etwa Boy George?«, keuchte ich. »Hast du sein Autogramm?«
»Ja, genau – Boy George. Und Lionel Richie war auch da. Und eine Mädchenband.«
»Welche?« In Gedanken sortierte ich all diese neuen Autogramme bereits in mein Sammelalbum ein.
Dad rief Mum, die noch im Bett lag, zu: »Anna, wie hieß noch mal diese Mädchenband?«
»Bananarama«, rief Mum zurück.
Jetzt kam sogar meine Schwester, einen Charlotte-Brontë-Roman in der Hand, aus ihrem Zimmer.
»Bananarama?«, kreischten wir.
»Die kenne ich nicht«, sagte Dad.
»Also, hast du mir Autogramme mitgebracht? Zeig sie mir – bitte!«
»Ach, es tut mir leid«, sagte Dad traurig. »Ich hab’s nicht geschafft. Ich hab versucht, an Lionel Richie ranzukommen, aber es war einfach unmöglich. Ich war mir auch nicht sicher, wer Boy George war. Und einmal stand ich zwar direkt neben den Bananaramas, aber ich habe erst später erfahren, wer sie waren. Tony Smith hat’s mir gesagt, der Buchhalter der Thompson Twins.«
Ich war am Boden zerstört. Eine erstklassige Gelegenheit – und mein Vater hatte es versiebt. Ich stellte mir vor, wie er sich auf der Party mit langweiligen Buchhaltern über Rentenpläne und Yoko Ono unterhalten hatte, während ringsum wild gefeiert wurde. Ich verstand nicht, warum er sich nicht ein bisschen mehr angestrengt hatte. Und als ich mir jetzt meinen Vater auf der Party der Thompson Twins vorstellte, kam er mir anders vor. Kleiner.
*
Nicht viel später, während eines einwöchigen Urlaubs in Südfrankreich, machte ich die persönliche Bekanntschaft des berühmtesten Menschen aller Zeiten. Ruth und ich schwammen im Swimmingpool, als ich einen riesigen Mann bemerkte, der auf einem der Balkone energische Übungen machte. Er war dick und blond, und sein Kopf wippte auf und ab. Er sah wahnsinnig stark aus. Und er kam mir bekannt vor. Als er eine Pause machte, fiel es mir ein.
»Oh mein Gott!«, rief ich. »Das ist Big Daddy!«
Wir starrten eine Weile hinauf, aber er ging wieder in sein Zimmer und verschwand. Er sah noch viel stärker aus als im Fernsehen, und ich fragte mich, wie mein Vater in einem Kampf mit ihm abschneiden würde. Big Daddy würde ihn vermutlich einfach in der Mitte durchbrechen.
Meine Mutter schlug vor, ich solle einen Bogen Hotel-Briefpapier und einen Stift bereithalten für den Fall, dass Big Daddy an den Pool kam. Etwas später erschien er tatsächlich. Er wirkte riesig und war wirklich sehr dick und hatte den Gang eines Titanen. Sein Bizeps war mindestens dreimal so groß wie der meines Vaters, und die enorme Badehose spannte sich über der gewaltigen Wölbung seines Bauches. Als er ins Wasser ging, gab es eine Welle, als wäre er ein Nilpferd. Ich hielt Papier und Stift bereit und war sehr aufgeregt bei dem Gedanken, dass ich in wenigen Augenblicken diesen Megastar ansprechen würde … Ich wollte nicht wie mein Vater auf der Party der Thompson Twins sein. Ich musste es schaffen.
Schließlich war der Wrestler genug geschwommen und stieg langsam aus dem Pool.
»Sind Sie Big Daddy?«, fragte ich ihn.
»Zur Buße für meine Sünden«, sagte er und lächelte. »Wie heißt du?«
»Adam. Kann ich Ihr Autogramm haben?«
»Klar. Ich nehme deinen Rücken als Unterlage.«
Ich drehte mich um, und der riesige Mann legte das Papier auf meinen Rücken und schrieb etwas darauf. Dann sagte er: »Bitte sehr.«
Er hatte geschrieben: »Für Adam von Big Daddy.«
Ich rannte zu meinen Eltern zurück und schwenkte dabei das Papier, als wäre es ein goldenes Wonka-Ticket.
»Seht ihr?«, sagte ich und versuchte, den Blick meines Vaters aufzufangen. »So macht man das!«
»Wunderbar«, sagte Mum und sah von ihrem lateinischen Kreuzworträtsel auf. »Gut gemacht!«
»Ich hab ein paar Fotos geschossen«, sagte Dad und tätschelte die Kamera, die neben ihm lag. »Mein Gott, der Mann ist gigantisch. Wenn er nicht aufpasst, wird er einen Herzanfall kriegen.«
»Vielleicht solltest du ihm eine Lebensversicherung verkaufen«, sagte Mum leise.
Dad rückte seinen schlanken, sehnigen Körper auf dem Liegestuhl zurecht und lächelte in die Sonne. »Da fällt mir ein Witz ein: Wie nennt man eine Frau, die immer weiß, wo ihr Mann ist?«
»Keine Ahnung«, sagten wir.
»Witwe.«
Dad grinste und klopfte mit der flachen Hand auf seine nackte Brust.
»Den Witz habe ich schon mindestens hundertmal gehört«, sagte Mum.
»Zu meiner Zeit ging es ja mehr ums Boxen«, fuhr Dad fort, als würde er die Frage eines Interviewers beantworten. »Henry Cooper gegen Muhammad Ali 1963 – was für ein Kampf! An Wrestlingkämpfe kann ich mich eigentlich gar nicht erinnern.«
Ich versuchte, meinen Vater auszublenden, indem ich mich auf die Handschrift und die Worte auf dem Papier konzentrierte.
»Ach ja, Doobs«, sagte Dad, wandte sich zu mir und senkte die Stimme, »du weißt ja, dass Big Daddy gar nicht sein richtiger Name ist, oder? Eigentlich heißt er Shirley Crabtree. Shirley! Ist das zu glauben?«
»Tja«, sagte ich, »fast so schlimm wie Adrian.«
»Adrian ist doch nicht schlimm, oder?« Dad schien plötzlich besorgt und setzte sich halb auf.
»Es ist nicht der allerbeste Name«, sagte Mum.
Aber Big Daddy war nicht Shirley Crabtree. Er war Big Daddy. Er sah aus wie Big Daddy, er benahm sich wie Big Daddy, und er hatte seinen Namen auf mein Stück Papier geschrieben. Ich hatte es geschafft, eine Verbindung zwischen unserer Welt und dem Paralleluniversum herzustellen, in dem all die Berühmtheiten lebten, und das wollte ich mir von meinem Vater nicht kaputtmachen lassen. Und ganz bestimmt wollte ich nicht auf einem Bürosessel enden, wo ich mich hin und her drehte, irgendwas ins Diktiergerät sprach, sinnlose Briefe verschickte und Sachen sagte, bei denen die Sekretärinnen die Augen verdrehten. Während des restlichen Urlaubs dachte ich immer wieder an diese zufällige Begegnung am Pool. Und ich wusste, wenn wir wieder zu Hause waren und Dad sich mal wieder an den Sechzigern festgebissen hatte und »California Dreamin’« leiser stellte, um uns zu sagen, Mama Cass sei an einem Schinkensandwich erstickt, dann würde ich jetzt eine eigene Geschichte haben, die ich eines Tages meinen Kindern erzählen könnte – eine Geschichte aus den Achtzigern.
Sinatra
Es ist seltsam, aber ich habe das Gefühl, dass die Welt, in der wir leben, von uns verlangt,dass wir uns in ein Muster fügen, das ihr entsprichtund letztlich nur ein Abklatsch von ihr ist.
FRANK SINATRA
Als Adam Brichtos schlecht geworfener Dartpfeil die Synagoge von Esztergom durchbohrte, verbannte mein Vater uns in die Garage. Er hängte die Scheibe zwischen Kisten voll Geschirr, Kerzenleuchtern und wertlosen Töpfen auf.
»So, jetzt könnt ihr euch austoben«, knurrte er und machte sich an die Reparatur seiner geschändeten Synagoge.
Adam und ich warfen ein paar Zweier und Dreier und verfehlten erneut das Brett. Einer der Pfeile landete in einem Müllsack in der Ecke. Als Adam B ihn holen wollte, entdeckte er einige der größten je gedruckten Brüste, Schwänze und Arschbacken.
»Mein Gott, was ist das denn?«, rief er und hielt ein Foto hoch, auf dem eine Frau ihre riesigen Brüste neben ihre Wangen hob, sodass sie aussahen wie zwei monströse Ohrringe.
Ich wollte sehen, was ihn so aufgeregt machte.
»Warum sitzt die Krankenschwester auf dem Gesicht von dem Patienten?«, fragte ich.
Wir blätterten in einer sehr farbigen Zeitschrift namens Barely Eighteen. Ich selbst war zwar kaum elf, aber ziemlich sicher, dass so etwas nicht zur üblichen Behandlung von Kranken gehörte.
»Irre«, sagte Adam kichernd. »Bei manchen gibt’s auch eine Geschichte – hier.«
Wir lasen gemeinsam und taten unser Bestes, uns auf die Handlung zu konzentrieren. Eine war echt spannend, da ging es um zwei Frauen – Freja und Laura –, die von zwei wildfremden Männern eingeladen wurden und einen wunderschönen Tag in den Tivoli Gardens verbrachten, bevor sie in Frejas Wohnung zurückkehrten und sich in den nächsten drei Stunden »von Björn und Sven so oft ficken ließen, dass der Saft an ihren Beinen hinunterlief, auf ihre Höschen tropfte und alles mit klebriger Schmiere überzog«.
»Mann«, sagte Adam B und blätterte in einem roten Büchlein. »Sieh dir das an. Zwei Männer pinkeln der Frau in den Mund!«
»Ui«, sagte ich. »Und das macht ihr Spaß?«
»Sie sieht jedenfalls ziemlich zufrieden aus.«
»Das ist bestimmt gespielt«, sagte ich. »Aber die hier ist echt. Sieh mal.«
Eine Frau in mittleren Jahren grinste wie eine Lotteriegewinnerin, während eine andere eine Gurke in sie hineinschob.
»Du hast recht«, sagte Adam B. »Die ist begeistert.«
»Schnell, pack das wieder ein«, sagte ich. »Da kommt meine Mum.«
In den nächsten sechs Monaten gingen Adam B und ich jedes Mal, wenn er mich besuchte, in die Garage, um Dartpfeile zu suchen und auf Fotos von Orgien, Analstöpseln und gemischten Doppeln zu starren. Als Frejas und Lauras Tivoli-Eskapaden begannen, uns zu langweilen, entdeckten wir andere Geschichten. Zum Beispiel die von einer Nonne, deren Beichte binnen Kurzem zu einem Dreier mit ihrem Beichtvater und dem Chorleiter führte.
»Gespielt«, sagte Adam B und zeigte auf die seltsam geblähten Nasenflügel der Nonne.
»Ich weiß nicht«, sagte ich. »Fifty-fifty. Ihre Augen lächeln.«
Ich wusste nicht genau, warum wir uns diese Bilder ansehen wollten, und war zurückhaltend, nicht zuletzt, weil diese Frauen Dinge taten, die meine Mutter missbilligt hätte. Sie missbilligte sogar, wenn sich Leute im Fernsehen küssten. »Was mich daran stört, ist, dass sie nur so tun«, sagte sie dann. »Sie sind eben Schauspieler.« Dad zuckte die Schultern und widersprach: »Das kann man nicht wissen. Vielleicht gefällt es ihnen.« Aber meine Mutter schaltete auf ein anderes Programm um. Wenn sie nicht wollte, dass Dad küssenden Paaren zusah, würde sie, nahm ich an, erst recht nicht wollen, dass er sich Fotos von Frauen ansah, die schwarze Penisse vermaßen.
Ich kam zu dem Schluss, dass mein Vater das Vertrauen meiner Mutter missbrauchte und gegen ihre Regeln verstieß. Wie ein Amateurdetektiv begann ich, ihn zu beobachten und nach anderen Anzeichen für Heimlichkeiten zu suchen. Er bewahrte die Reserve-Glühbirnen in der Garage auf? Wem wollte er was vormachen? Ich registrierte das Zucken seiner Schultern, wenn im Autoradio Sexual Healing lief. Ich durchsuchte seinen Nachttisch und hielt Schokoriegelverpackungen gegen das Licht, um zu sehen, ob da vielleicht geheime Nachrichten von Pornostars standen. Aber neben der Detektivarbeit fand ich Zeit, in der Garage an der Dartscheibe zu üben.
*
Mitte der Achtzigerjahre war ich die Theaterschauspieler leid. Gelegentlich machte man mir andere Vorschläge: Ich solle doch an Jimmy Savile im Stoke Mandeville Hospital oder an Rolf Harris im Norfolk and Norwich Hospital schreiben, wo sie kranke Kinder aufmunterten. Rolf schickte mir eine Zeichnung, die ihn als Känguru darstellte, und von Jimmy bekam ich einen netten Brief, in dem er das S in seinem Namen als Dollarzeichen schrieb. Diese Erfolge waren schön, aber ich wollte mein Netz weiter spannen. Das Problem war: Wie sollte ich an Adressen kommen? Ich konnte ja nicht darauf warten, dass mir die Berühmtheiten an einem Swimmingpool in Südfrankreich über den Weg liefen.
Eines Tages hatte Dad eine Idee. Er verschwand in seinem Arbeitszimmer und kehrte, nachdem er ächzend und stöhnend Papier umgeschichtet hatte, mit einer farbig illustrierten Broschüre zurück. Ich zuckte zusammen: Das Cover sah aus wie das von Color Climax. Es war allerdings eine »Beverly Hills Star-Karte«.
»Die hatte ich ganz vergessen«, sagte er strahlend. »Könnte nützlich sein.«
Sie war mehr als nützlich, denn sie war mit kleinen Sternen versehen, die einem genau verrieten, wo die alten Stars wohnten. Mir fiel ein, dass wir sie bei unserem Urlaub in Kalifornien benutzt hatten. Wir hatten die sorgsam gestutzten Hecken vor Gene Kellys Haus gesehen und einen Mann in einem Overall, der bei den Spielbergs eine Topfpflanze abgeliefert hatte. Bis auf eine abgerissene Ecke war alles da, und jetzt wusste ich, wo ich meine Berühmtheiten finden konnte.





























