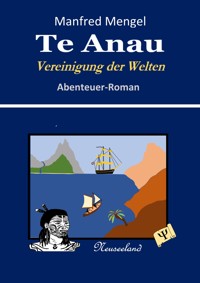
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manfred Mengel
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Abenteuer-Roman: Anfang des 19. Jahrhunderts gerät ein junger Matrose eines Walfangschiffs alleine auf der Südinsel Neuseelands in die Hände kriegerischer Maori. Es ist das erste Zusammentreffen eines Weißen mit den Ureinwohnern. Bald mit einer Maorifreundin zusammen kämpft er ums Überleben und den Frieden in dieser Region am anderen Ende der Welt. Dieser Roman ist eine Hommage an die Natur, die Liebe und dem Respekt der Kulturen untereinander. Er verschafft dem Leser auf spannende Weise einen tiefen Einblick in die interessante Kultur der Maori.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Manfred Mengel
Vereinigung der Welten
Abenteuer-Roman
»Die Glückseligkeit des Lebens bemisst sich in der Anzahl der selbsterfahrenen Tode.«
Manfred Mengel
Copyright ©2019 by Manfred MengelAlle Rechte vorbehalten.Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form(wie Fotografie, Abschrift, Übersetzung oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors reproduziert oder mittels elektronischerSysteme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
3. vollständig überarbeitete Auflage 2024
Manfred Mengel
c/o AutorenServices.de
Birkenallee 24
36037 Fulda
email: [email protected]
Den Urvölkern des Pazifiks
Götter erschufen unser Land aus dem Meer und formten es zu den gebirgigen Inseln.
Dann führten sie uns auf langen gefährlichen Seefahrten von der Mitte des Pazifiks an die Küsten jener Inseln, weit weg vom Sitz unserer Urahnen.
Kupe, der erste unserer Vorfahren, der diesen heiligen Boden betrat, kehrte wieder in unsere alte Heimat zurück und verbreitete dort seine Entdeckung.
Nach ihm folgten ganze Sippschaften in ihren riesigen Kanus. Sie gründeten die unterschiedlichen Stämme an zahlreichen Orten der beiden großen Inseln.
Mehr als zwanzig Generationen lebten mittlerweile hier, seit das Eintreffen der Weißen für immer unsere Geschichte verändern sollte.
Te Anau
INHALT
1 – Überlebenskampf im Pazifik
2 – Einsamkeit der Insel
3 – Gefangennahme und Maori Kämpfe
4 – Auferstanden vom Schafott
5 – Im Maori Dorf
6 – Die Jugend im Waisenhaus
7 – Erste Liebe mit Hindernissen
8 – Kriegstanz der Maori
9 – Die Zeit des Krieges
10 – Tätowiert für die Elitetruppe
11 – In den Bergen mit Tokānuku
12 – Das Neujahrsfest
13 – Odyssee mit Geliebter
14 – Schrumpfköpfe über dem Feuer
15 – Aus der Höhle ins offene Meer
16 – Heldentod eines Häuptlings
17 – Die Weissagung des Hohepriesters
18 – In der Höhle des Löwen
19 – Entführung aus dem Paradies
20 – Die Navy und der Kampf um den Frieden
21 – Die Fügung der Götter Rangi und Papa
Nachtrag
Über den Autor
1 – Überlebenskampf im Pazifik
D
as eiskalte Wasser des Pazifiks umschlang mich bis zum Hals und lähmte meine Atmung. Mit dem unerwarteten Sturz ins Meer hatte sich meine Lunge schlagartig zusammengeschnürt, wie ich es bisher noch nicht kannte. Mein Körper nahm die Kälte schnell an und wurde, angefangen von den Beinen bis hin zur Schulter, immer regungsloser. Nur meine Angst vor dem Tod und meine große Wut ließen mich noch gegen diese Starre ankämpfen. Schon saugte meine gesamte Kleidung blitzschnell das umgebende Nass auf. Hemd, Hose, Socken samt den Schuhen zogen mich erbarmungslos mit nach unten. Weg von der Oberfläche, die das Leben bedeutete. Ich sah die kleinen Fische neugierig um mich herumschwimmen. Sie feierten wohl schon ihren Sieg, denn es war ihr Revier. Ein Mensch mit nichts als seinem Körper und den Kleidern hatte in dieser Meereswüste, hunderte, ja vielleicht tausende Meilen von einer Küste entfernt, nichts verloren. Unter mir lauerten schon die größeren Raubfische, bereit, um sich an meinem frischen Fleisch zu sättigen. Was war geschehen?
In der Schaluppe, das kleine Beiboot unseres zweimastigen Walfangschoners namens Hyperion, hatte ich mich gerade nach einem Tau im Meer gebückt, was der dreckige Smith, einer der drei verbliebenen Matrosen, sofort ausnutzte und mir einen kräftigen Tritt in meinen Rücken verpasste. Das Meer verschluckte meinen Aufschrei. Als ich wieder auftauchte und sah, wie sich das Boot immer weiter entfernte, rannen mir Tränen der Wut über meine Wangen. Jetzt hätte ich gerne mit dem feigen Smith um mein Leben gekämpft, doch er ließ mir keine Chance. Ich hörte noch wie Smith den Kollegen zuschrie: »Auf, das ist jetzt unsere Chance! Los, rudert mit voller Kraft!« Morris hatte auf ihn gehört. Sie schafften es gemeinsam in der Schaluppe schnell einen großen Abstand zu mir herzustellen, und ich sah ein, dass ich sie im Schwimmen nie mehr einholen konnte. Schon gar nicht bei dieser Eiseskälte und in meinen Kleidern.
Mit beiden, Smith und Morris, verband ich schon vorher ein paar üble Erinnerungen auf meiner weiten Seereise auf der Hyperion durch den Pazifik. Das Schicksal hatte es daher bei der Auswahl unserer Besatzung wirklich nicht gut mit mir gemeint. Smith war klein, recht beleibt und hatte vom vielen Saufen des Rums ein stark aufgedunsenes rundliches Gesicht, insgesamt eine wirklich abstoßende Erscheinung. Seine wenigen, fettigen Locken verdeckten oft die Augen, wenn er sie nicht von Zeit zu Zeit mit einer zuckenden Kopfbewegung zur Seite schlug. Er besaß wirklich nur ein einziges Hemd. Früher musste es mal weiß gewesen sein. Jetzt ekelte einen der Anblick der dunklen, schmierigen Flecken darauf. Die Löcher und Risse darin und in seiner Hose taten ihr übriges. Morris dagegen, unser Harpunier, besaß eine wahrhaft stattliche Statur. Das erwartete man auch von Jemandem, der zum tiefen Einstechen der spitzen Harpune in die dicke, fette Walhaut bärenstarke Kräfte benötigte. Er war groß und kräftig, bis zu den Zehenspitzen, mit einem kantigen Gesicht. Sein Körper mit den Maßen eines Herkules besaß leider einen bedeutenden Makel: Die Natur hatte ihn nur mit dem Verstand eines Grundschulkindes ausgestattet, was aber auf der Hyperion unter den anderen Matrosen nicht besonders auffiel und überhaupt niemanden störte. Eine dicke Narbe zog sich an seiner linken Backe entlang bis zum Ohr, als ehrenhaftes Zeichen eines mutigen Kampfes gegen einen Pottwal. Nachdem er seine Harpune einst in den Schädel dieses Wals gerammt hatte, hätte dieser fast die Schaluppe samt Besatzung mit wütenden Wellenbewegungen zum Kentern gebracht. Morris war dabei aus dem Gleichgewicht geraten und zu Boden gefallen. Das am Mast vertäute Harpunenseil hatte seinen Kopf am Boden eingequetscht und streifte dann mit der Zugkraft des Wales zwischen Backe und Ohr entlang. Die tiefe Narbe in seiner Kopfhaut machte ihn auf der Hyperion und sogar in manchen der Häfen, die wir anliefen, legendär.
Ängstlich zitternd schaute ich dem Boot hinterher, wie meine einzige Rettung mit diesen beiden und Anderson immer weiter von mir forttrieb. Anderson war unser Steuermann und stammte aus Dänemark. Groß und schlank achtete er stets auf sein Äußeres, wie eine saubere Kleidung und ein gepflegtes Gesicht. Auf der Hyperion war er bei der Mannschaft für seine Korrektheit bekannt. Als Kommandant dieses Beiboots hatte er seine Leute immer voll im Griff. Bisher zumindest. Er handelte stets entschlossen und manchmal hart, auch sich selbst gegenüber. Aber wenn es darauf ankam, konnte er auch mit einer durchdachten Diplomatie alle überzeugen. Die benötigte er manchmal, um seine Ziele gegenüber dem Kapitän und den anderen Offizieren durchzusetzen, und eines Tages, so hoffte er zumindest, würde er selbst in den Rang eines Kapitäns aufsteigen. Das Zeug dafür hatte er jedenfalls.
Als Letztes sah ich dann, was ich kaum glauben konnte, wie die Schaluppe urplötzlich eine Wende vollzog. Was sollte das? Wollten sie sich einen Spaß daraus machen und mir zuschauen, wie ich langsam aber sicher vor ihren Augen absoff? Ich sah, wie sich nun alle hektisch auf der Schaluppe bewegten und sich heftig stritten. Anderson konnte in dem Tumult schließlich die Ruderpinne an sich reißen und damit auch die Macht über das Boot. Als ich sah, wie er direkten Kurs auf mich nahm, sprang mein Herz vor Freude. Schließlich warf er mir das rettende Tau zu und gemeinsam schafften wir es, meinen Körper dem kalten, düsteren Nass mit seinen gefräßigen Kreaturen, zu entreißen. Ich verdankte Anderson nun mein Leben! Er wusste wohl, dass er selber nach mir als nächster über Bord gehen würde und im Kampf gegen Smith und Morris brauchte er einen Partner, der ihm dafür zur Not zur Seite stand. Smith und Morris konnten aber vorerst nicht auf seine Navigationskenntnisse verzichten, zumindest nicht ohne Land vor ihren Augen zu sehen. Und so gewährten sie ihm widerwillig meine Rettung. Den restlichen Tag segelten wir alle, in tiefem Schweigen und gegenseitigem Hass vereint, weiter, jeglichen Blickkontakt meidend.
Es hatte alles schon mit einem Drama begonnen: Der fünfte Mann unseres kleinen Walfangboots, unser erster Harpunier, war zuvor das Opfer eines wütenden Wals geworden. Vielleicht wollte die Natur so unsere unersättliche Gier nach diesen Meeresriesen rächen, denn nach dem Schleudern seiner Harpune in dessen Speckschicht hatte die Gischt einer hohen Fontäne uns allen unerwartet ins Gesicht geblasen und als der Wal dann dicht am Boot vor uns auftauchte waren wir darauf nicht vorbereitet. Im schaukelnden Boot wurde unser unglücklicher Kollege vor unseren Augen im Schlepptau der Harpune mit in die Tiefe des Meeres gerissen. Wir hatten noch seinen verzweifelten Aufschrei vernommen und waren schockiert. Morris hatte sich als Erster gefasst, schrie wild ins offene Meer heraus: »Kolleeegeee! Wo bleibst du?«, und wandte sich hoffnungsvoll zu uns: »Irgendwo muss er wieder auftauchen. Sucht alles ab!« Von da an starrten wir auf jeden Fleck in der Nähe unseres Bootes, als wollten wir ihn Kraft unserer Augen dem Meer wieder entziehen. Vergeblich. Er tauchte nicht wieder auf. Erst in weiter Ferne erspähten wir dann den Wal noch einmal, wie sich die Masse mit seiner Beute am Rücken majestätisch langsam aus dem Wasser hob, um gleich darauf für immer unseren Blicken zu entschwinden.
Dann kam der Wirbelsturm, wie es ihn nur in diesen Breitengraden gibt, über uns hereingebrochen und wütete viele Stunden. Dieser Zyklon hatte uns alle gemeinsam überrascht. Die Wucht an rauer See war selbst uns erfahrenen Seemännern bisher unbekannt und trieb uns unumkehrbar von der Hyperion immer weiter weg. Uns blieb keine Zeit darüber zu trauern, denn den ganzen Tag und die Nacht mussten wir gegen unser Untergehen ankämpfen. Mit den restlichen Tauen, die nicht über Bord gegangen waren, befestigten wir unsere Leiber am Mast, schlugen die gerefften Segel als Schutz vor dem niederprasselnden Regen über unsere Köpfe und versuchten gleichzeitig so viel Wasser, wie möglich aus der Schaluppe zu schöpfen, um nicht mit einer der hohen Wellen umzukippen und unterzugehen. »Hart backbord! Pullt um euer Leben! Refft ein Stück das Segel!« Anderson erteilte anfangs noch Kommandos für das Steuerruder und Segel, denn er wollte in der Nähe der Hyperion bleiben. Es war aussichtslos. Recht bald sahen wir ein, dass die Kraft des Zyklons jede Art der Navigation ausschloss. Von nun an war jeder einzig vom Drang ums Überleben getrieben. Wir klammerten uns an allem fest, was in unserer Nähe war, wie Mast, Sitze, Ruderpinne und Reling. Mit der anderen Hand und Eimern schöpften wir unermüdlich das mit jeder hohen Welle eindringende Wasser aus dem Boot. So kämpften wir noch die ganze Nacht durch, bis wir am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang endlich dem Toben des wilden Zyklons entronnen waren und das Meer sich wieder von seiner sanften Seite zeigte. Danach übergaben wir uns unserer Erschöpfung und wurden erst später von Anderson mit salzigem Schöpfwasser, das er über unsere Köpfe goss, wieder zum Leben erweckt.
Er war es auch, der uns jetzt organisierte und uns unsere hoffnungslose Lage erklärte: »Glaubt nicht daran, dass der liebe Gott unseren Kapitän von der Hyperion zu uns schicken wird! Die werden mit sich selbst beschäftigt sein, wenn unser Mutterschiff nicht sowieso schon mit dem Zyklon gesunken ist. Es ist hoffentlich jedem klar«, und dabei schaute er uns allen nacheinander tief in die Augen, »unser Weniges an Proviant wird ab jetzt streng rationiert!«
An Bord gab es nur etwas Schiffszwieback, um die Mannschaft auch auf längeren Fangeinsätzen zu sättigen. Anderson nahm diesen sofort an sich. In den Segeltüchern hing noch verbliebenes Regenwasser. Unser Steuermann Anderson hatte nicht verhindern können, dass dieses kostbare Nass von uns direkt nach unserem Erwachen schnell und gierig ausgetrunken worden war. Jeder hatte dabei die anderen belauert, um auch den letzten Tropfen noch, nur für sich selbst zu erhaschen. Das kostbare Süßwasser sollte vor dem Verdunsten gerettet werden. Wir hätten gut daran getan, es in unseren Eimern zu sammeln und zu rationieren, doch unser purer Überlebenstrieb hatte uns keine Zeit gelassen, darüber nachzudenken. In unserem Boot lagerten noch zwei dreiviertel volle Flaschen schottischer Whisky, die Smith und Morris gehörten. Smith hatte eine davon in die Hand genommen und sich zu uns gewandt: »Dass mir keiner auf die Idee kommt, davon zu probieren! Hol euch der Teufel! Derjenige wird von den Haien zerhackt werden, das schwör ich!« Der flüssige Stoff bedeutete beiden jetzt mehr als alles andere in der Welt und jedem war fortan klar: Ein Kampf auf Leben und Tod würde bald, früher oder später, aber unausweichlich um alles Ess- und Trinkbare auf unserer Schaluppe entbrennen, mit den besten Karten für Smith und Morris. Besaßen sie doch alleine jeder ein scharfes Messer, eigentlich nur für den Notfall, um das Harpunenseil bei Bedarf vom Mast zu befreien. Nun konnten diese unseren Kampf um das wenig verbliebene Trinkwasser entscheiden. In einer teuflischen Eingebung hatte Smith dann unverblümt vorgeschlagen: »Es gibt nichts mehr zu trinken und zu essen. Und? Was heißt das nun? Klar, wir sind zu viele hier auf dem Boot. Einer muss weg. Denjenigen, der am wenigsten für unser Vorwärtskommen beiträgt, müssen wir über Bord schmeißen oder auffressen.« Bei diesen Worten stockte mir der Atem, denn ich hatte sofort gewusst, wen er damit meinte. Ich, Robin, war mit meinen sechzehn Jahren ohnehin für ihn überflüssig. Daher hatte er auch nicht lange gezögert, als er mir diesen fiesen Tritt von hinten verpasste.
Anderson wollte uns wieder zusammenbringen: »Leute, es bleibt uns nichts anderes übrig als bis zur nächsten Insel durchzuhalten. Die Suche nach Land ist unsere einzige Überlebenschance und das liegt im Osten, ich weiß es, glaubt mir.« Er schaute dabei in diese Richtung, als könnte er jetzt schon Land sehen. »Dorthin segeln wir! Und wenn der Wind nicht mitspielt, müssen wir uns eben abwechseln beim Rudern.« Smith verfiel gleich in seinen Galgenhumor: »Machen wir Captain. Sicher doch. Ein paar Ruderschläge und schon sind wir an Land. Ich hör schon die Lieder aus der Hafenbar zu uns rüber schallen.« Aber keiner war jetzt in der Stimmung, darüber zu lachen. Wir hielten uns alle an die Vorgabe von Anderson, denn niemand von uns konnte auch nur annähernd so navigieren wie er als Steuermann. Zum Glück hatte er erst vor Kurzem mit dem Kapitän den Kurs der Hyperion durchgeplant, sodass er die Seekarten jetzt noch vage in Erinnerung hatte. Dann versuchte er uns Mut zu machen: »Wenn der Wind günstig steht, schaffen wir es in einigen Tagen, an der Küste Neuseelands zu landen. Mit etwas Glück begegnen wir dort den Robbenfängern, die uns aufsammeln und mitnehmen. Dann treffen wir unseren Kapitän im Hafen von Sydney wieder. Wie der wohl schauen wird!« Anderson hatte uns damit eine Vision gegeben, die jeden Einzelnen von uns anspornte, den bevorstehenden Kampf gemeinsam fortzusetzen. Es war Morris, der sich bisher nie um unsere Route kümmerte und meistens der Letzte war, der wusste, welchen Hafen wir gerade ansteuerten. Er erzählte immer jedem, dass er es gar nicht vorher wissen wolle, da seine Freude umso größer wäre, wenn der Schoner dann plötzlich in den Hafen mit den vielen Kneipen einlaufen würde. Jetzt packte ihn aber die Neugierde: »Captain, gibt es dort gescheiten Whisky? Erzähl uns, tanzen die Frauen dort genauso nackt, wie bei den ersten Menschen auf Erden?«
Für ihn ging es nur darum, dieses Paradies so schnell wie möglich zu erreichen. Aber Anderson wusste es mit mir zusammen besser. Den meisten Seefahrern waren die Reiseberichte von Captain James Cook bekannt. Knapp ein halbes Jahrhundert zuvor war er mit seiner Mannschaft hier in den südlichen Pazifik gesegelt, auf der Suche nach dem großen Südkontinent, der Terra Australis Incognita. Auf seinen Entdeckungsreisen umsegelte Cook auch Neuseeland und es gelang ihm dabei der Nachweis, dass dieses Land aus zwei größeren Inseln bestand, einer im Norden und einer im Süden. Damals schon hatte Cook dort Kontakt mit den Einheimischen an der Küste, die sich selbst »Maori« nannten. Die Berichte von ihm und nachfolgenden Seefahrern über die Eingeborenen waren bis ins heutige Jahr 1811 aber recht zwiespältig. Einige sahen die Maori als blutrünstige Menschenfresser, während andere wiederum von einem friedlichen Zusammentreffen und Handel mit ihnen berichteten. Oft schwärmten die Seeleute von ihren eingetauschten Kunstschätzen und Kuriositäten, wie den abgetrennten tätowierten Schädel eines Maorikriegers, den riesigen fantasievollen Holzschnitzereien und dem grünen Steinschmuck. Alles mühevoll angefertigt in den Dörfern des Urwalds. All diese Kunstschätze waren mittlerweile nach Europa verschifft und dienten dort den Museen der Hauptstädte als exquisite Schaustücke der Wilden aus der Neuen Welt. Die ersten Zusammentreffen der Weißen mit den Maori waren immer von der Angst geprägt, plötzlich überfallen zu werden. Daher setzten die Kapitäne ihre Matrosen in ständige Schussbereitschaft und holten sich durch Kanonenschüsse immer wieder mal den gewünschten Respekt der Einheimischen ein.
Wir mussten also mit dem Schlimmsten rechnen, falls wir das Land mit der langgezogenen Küstenlinie im Osten überhaupt jemals erreichten. Anderson rüttelte nun bei Smith und Morris an ihrem Glauben von dem bevorstehenden Paradies: »Schön wär´s, Morris. Glaub mir, dieses Glück der tanzenden Frauen wirst du dir hart erkämpfen müssen. Aber statt Paradies wartet wohl eher die Hölle auf dich! Die Eingeborenen werden dir nämlich eins über den Schädel hauen, bevor du überhaupt einen Blick auf etwas Weibliches wagen kannst!« Und so fing daraufhin jeder an, sich darüber Gedanken zu machen, was wir im Ernstfall im Kampf als Waffe benutzen konnten. Wenn wir es recht betrachteten, hatten wir eigentlich kaum etwas Brauchbares für unsere Verteidigung zur Verfügung. Am geeignetsten dafür waren noch die drei verbliebenen Harpunen und vielleicht konnten wir auch noch die Ruderblätter als Keulen nutzen. Die scharfe Lanze war leider im nächtlichen Sturm mit einer der hohen Wellen über Bord gegangen. Damit hätte unser Steuermann eigentlich den ermatteten, harpunierten Wal töten sollen, indem er dessen hüftbreite Hauptschlagader durchtrennte. Nur Smith und Morris besaßen, wie bereits erwähnt, jeweils noch ein kleines Messer. Smith mischte sich sogleich in das Gespräch ein: »Schaut mal!«, und hielt sein Messer hoch, »der Schneide ist es egal, zwischen welchen Rippen sie hineingestoßen wird, ob weißer oder brauner Körper!« Damit war klar, diese Waffen gaben Smith und Morris jetzt schon viel Macht und dies bedeutete hier nichts weniger als ihre Hoheit im Kampf ums Überleben auf unserer Schaluppe.
Anderson entgegnete ihm sofort: »Die Messer werden euch die Bäuche nicht füllen! Wir werden alle krepieren, wenn wir uns nicht was zu essen aus dem Meer holen. Ohne Fisch keine Insel, keine Frauen, kein Whisky! Kapiert?« Unser Hunger vertrieb uns bald alle Gedanken über die Kämpfe mit den Einheimischen. Anderson teilte den Schiffszwieback gerecht unter uns auf. Er würde aber nicht lange reichen. Nun drehten sich unsere Gespräche nur noch darum, wie wir die Fische aus dem Meer angelten. Morris überlegte nicht lange. Er klemmte die Spitze einer Harpune in die Ruderdolle und bog sie mit seiner ungebändigten Kraft zu einem Angelhaken zurecht. Mit etwas Zwieback als Köder schwenkte er die Harpune im Meer und wollte die Fische mit Worten anlocken: »Na auf, kommt schon! Ich hab was Leckeres für euch.« Es dauerte nicht lange und plötzlich zappelte es an der Harpunenspitze im Wasser hin und her. Morris begann zu strahlen. Ein Schwarm kleiner Fische nagte in Sekundenschnelle den Köder ab. Kein einziger Fisch verfing sich am Haken. Morris spuckte ins Wasser. Als ob die Fische ihn noch verhöhnten, stürzten sie sich sogleich auf diesen Speichelfleck, umringten ihn und schnappten gierig danach, bis Morris sie mit einem wütenden Hieb seiner Harpune verscheuchte. Unsere Hoffnung auf ein längeres Überleben auf dem Boot schwand.
Anderson reagierte: »Seht ihr, wie die Fische mit unserem Angelhaken spielen und sich noch an unserer Fütterung erfreuen? So geht´s nicht weiter. Wir brauchen ein Netz. Ich will die Biester auf unserem Boot nach Luft japsen sehen.« Dann ergriff er ein dickes Tau, hielt es hoch: »Etwas Arbeit braucht es schon. Wir schneiden das hier auf und machen dünne Seile daraus.« Einen ganzen Tag lang ließen wir dann das Netz zu Wasser, lockten die Fische an und holten es wieder schnell ein. Wir schafften es aber gerade mal einen einzigen handgroßen Fisch einzufangen. Dies war Smith gelungen, der dabei vor Glück zu tanzen anfing. Wir freuten uns wie Kinder und ließen den Fisch vor unseren Augen noch lange im Netz zappeln, bis ihn Morris schließlich mit einem gezielten Messerstich unter dem Kopf von seinem Leiden befreite. Anderson dachte an eine gerechte Teilung: »Hey Smith, Glück gehabt«, dann wandte er sich an Morris: »Gib mal unser Futter her, ich werde es verteilen.« Doch hier galt nun das Recht des Stärkeren. Morris machte sich nicht mal die Mühe ihm zu antworten. Er drehte nur das Messer um, sodass dessen Schneide direkt auf Anderson zeigte. Ihre Aufteilung sah dann so aus, dass für Anderson nur noch der Kopf übrigblieb, während ich als letzter die spärlichen Reste an den Gräten noch abnagte. Unsere Chance, auch nur wenige Tage auf diese Weise zu überleben, war sehr gering. Wir mussten schnellstens die Küste erreichen.
Beim Rudern wechselte ich mich mit den anderen ab, doch die Kommentare von Morris nervten: »Junge, wie ein kleines Mädchen ziehst du am Riemen. Hau dich doch mal richtig rein! Merkst wohl nicht, dass wir uns im Kreis bewegen, nur weil du meinen Schlägen nicht nachkommst!« Solches oder Ähnliches musste ich mir jedes Mal anhören, weshalb ich viel lieber unter den Kommandos von Anderson arbeitete, von Zeit zu Zeit das Segel übernahm und es nach seiner Anweisung den ständig wechselnden Windrichtungen anpasste. Während uns tagsüber die Sonne die Richtung wies, orientierten wir uns nachts an der markanten Sternformation des Kreuz des Südens um den östlichen Kurs zu halten.
Auf der Hyperion hatte ich für den Koch und die Mannschaft gedient. Smith und Morris hatten mich dabei schikaniert, wo sie nur konnten. Meine Arbeit wurde des Öfteren für irgendwelche Drecksachen in ihrer Kajüte unter Deck missbraucht. Ich kannte schon die Wirkung des Rums oder Whiskys auf sie und fürchtete diese. Sie hielten mich dann mit meinen blonden Locken und blauen Augen jedes Mal für eine Meeresjungfrau und versuchten mich zu entkleiden, um mir etwas Ekliges, Warmes in meinen Allerwertesten zu schieben. Nur mit Mühe konnte ich ihnen entkommen, natürlich immer unter dem Gelächter der übrigen Mannschaft, die diesen Spaß gerne in Vollendung gesehen hätte. Meine Verteidigung hatte darin bestanden, mich zunächst widerstandslos zu ergeben. Dann sammelte ich meine Kräfte und befreite mich urplötzlich mit einer geschickten Drehung aus der Umklammerung von einem der beiden. Danach hieß es, so schnell wie möglich nach oben an Deck rennen und weiter die Wanten zum Ausguck im Masttopp hinaufklettern, wo ich solange ausharrte, bis deren Rausch vorüber war. Trotz ihres Hochgefühls wussten beide nur zu gut, dass die wackligen Netze in der Höhe für sie den Sturz ins Verderben gebracht hätten. Nur dies konnte ihre Gier nach jungem Fleisch noch zügeln. Unsere Schaluppe war nur knapp sechs Meter lang. Es gab keinerlei Fluchtwege. Ich musste mir etwas einfallen lassen und packte das Übel bei der Wurzel. Während Smith und Morris die rohen Stücke des Fischs gierig verschlangen, erspähte ich im Rücken der beiden ihre beiden Whiskyflaschen. Ich setzte mich neben sie und ergriff vorsichtig, ohne hinzuschauen, eine Flasche nach der anderen, während ich die beiden ständig im Auge behielt. Ein großer Teil des hochprozentigen Inhalts floss daraufhin unbemerkt ins Meer. Es war die Voraussetzung, überhaupt eine Chance auf ein glückliches Ende unserer gemeinsamen Fahrt zu haben. Hätte einer der beiden mich erwischt, wäre ich mit ihren Messern in Stücke zerfetzt worden.
Nach zwei weiteren Tagen auf See, in denen wir unseren gegenseitigen Hass kaum noch unterdrücken konnten, sahen wir Delfine um unser Boot herumtollen, die uns eine ganze Weile folgten. Dann entdeckten wir vom Meer glatt geschliffene Baumstämme und dieser Anblick versetzte uns in eine freudige Erregung, hofften wir nämlich, dass das Holz von einer nahen Küste stammte.
Mit dem Hunger nahmen auch die Feindseligkeiten zu. Am Morgen des dritten Tages, nachdem Smith seinen letzten Schluck vom Whisky getrunken hatte, wurde er über das Versiegen dieser Quelle so wütend, dass er alle wüst beschimpfte. Er ließ sein Messer vor sich springen und hätte bestimmt mich oder Anderson damit erwischt, wenn nicht Morris plötzlich aufgeregt aufgesprungen wäre: »Hey, schaut mal, da, ganz hinten!« Dann zeigte er mit seiner Harpune genau nach Osten. »Seht ihr den schwarzen Streifen?« Wir strengten uns an und konnten tatsächlich einen schwarzen Fleck in weiter Ferne ausmachen, der sich nach und nach vergrößerte. Jetzt packte uns die Aufregung und Smith schrie: »Wenn das keine Insel ist, dann soll mich der Teufel holen!« Dann schaute er zu mir rüber: »Glück gehabt Kleiner.«
Die vor uns aus dem Meer auftauchende Landmasse musste die von James Cook beschriebene Ostküste Neuseelands sein. Unsere betrübte Stimmung schlug in Euphorie um. Immer deutlicher ragten die einzelnen Berge einer langen Gebirgskette hervor. Anderson erkannte das Massiv als Teil der Südinsel Neuseelands. Sofort überboten wir uns gegenseitig im Pullen der Ruder, auch wenn es unsere letzten Kräfte kostete. Immer höher türmten sich vor unseren Augen die alpin anmutenden Bergspitzen auf, und mittendrin schimmerten türkisblau zwei Gletscher, die sich von den hohen Bergen bis in den grünen Urwald hinunterzogen. Ein breiter Urwaldgürtel zwischen Gebirge und Küste leuchtete intensiv Grün.
Anderson holte uns aus dem Staunen zurück: »Stoppt! Bevor wir anlanden, lasst uns erst die Gegend nach Wilden ausspähen.« Wir suchten daraufhin jeden Winkel nach etwas ab, das sich bewegte: Eingeborene auf der Jagd oder in Vorbereitung auf unsere Ankunft, aber auch nach möglichen Beutetieren.
Smith antwortete nach einiger Zeit: »Nichts dergleichen zu entdecken. Reinste Natur, wie sie Gott einst erschaffen hat.« Er hatte wieder seine gute Laune gefunden: »Wo bleiben die braun gebrannten, nackten Mädchen in ihren Kanus, die auf uns so lange warten mussten?« Anderson kühlte dessen Gelüste gleich ab: »Die schicken sie immer vor, um die Kerle dann mit ihren Keulen zu erschlagen und anschließend zu verspeisen!«
Nur die Küstenvögel zeugten jetzt davon, dass auch diese Insel vor uns bevölkert war. Anderson dachte weiter: »Seht ihr, wie nah die Gletscher sind. Es sollte doch mit dem Teufel zugehen, würden sie nicht Schmelzwasser zu uns bringen. Da! Seht ihr? Dahinten gibt es einen Durchbruch am Sandstrand. Darauf steuern wir zu!« Als wir dahinter am Strand eine Lagune sahen, ruderten wir mit letzter Kraft, bis wir endlich dort anlandeten und uns erschöpft in den weichen Sand fallen ließen. Wie lange war es her, festen Boden zu spüren, einen der nicht ständig schaukelte? Ich hatte ein Gefühl, dem Schaufelrad einer ständig sich unrund drehenden Mühle entronnen zu sein und schwebte fortan auf einer weichen Wolke, es genießend, wie dieses angenehme Gefühl von meinem Körper immer mehr Besitz nahm.
Eine Weile genossen wir diese Ruhe, kraftlos und fast in Trance, ehe Anderson dies abrupt beendete: »Seid mal ruhig!« Wir lauschten jetzt alle gespannt. »Hört ihr das?« Ein Geräusch wie plätscherndes Wasser drang zu uns. Die Quelle musste nur ein paar hundert Meter nördlich liegen. Mit einem Schlag waren unsere Schwäche und Müdigkeit verflogen und wir rannten dorthin, wo ein kleiner Bach, aus den Bergen kommend in die Lagune mündete. Er brachte uns das lang ersehnte Süßwasser. Mitten in dieses flache Rinnsal hinein ließen wir unsere erschlafften Körper fallen und schöpften mit den bloßen Händen gierig das Nass, bis wir uns gesättigt zur Seite rollten.
Plötzlich horchten wir auf. Aus der Ferne gab es vereinzelte Rufe oder Schreie. Unmöglich, diese Geräusche einem Menschen oder Tier zuzuordnen, aber sie machten uns Angst. Anderson versuchte zu beruhigen: »Bestimmt Vogelgetier! Nichts als irgendwelche fliegenden Viecher. Weiß der Teufel welche Arten es hier gibt und wie die schreien.« Nach einer Stunde unruhigen Rastens kehrten wir, einer nach dem anderen, zu unserem Boot zurück und machten es uns vor unserer Schaluppe auf einem der angeschwemmten, kahlweißen Baumstämme bequem.
Dann erklärte uns Anderson unser Dilemma: »Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können ein vorbeisegelndes Walfangschiff mit einem Feuer auf uns aufmerksam machen und mit viel Glück werden wir gesehen und aufgesammelt. Allerdings werden die Eingeborenen unsere Zeichen als erstes entdecken. Und glaubt mir, sie werden uns, als weiße Ankömmlinge vom Meer, bestimmt nicht wie Götter empfangen und in Sänften in ihr Dorf tragen. Im Gegenteil. Ich fürchte, sie wollen unser fremdartiges Fleisch allzu gerne kosten. Das will keiner, oder?« Für einen Moment herrschte betretenes Schweigen, bevor er fortfuhr: »Die Alternative, unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, ist nicht weniger gefährlich, denn dazu müssen wir uns quer durch die ganze Insel bis hin zur Ostküste zu den Robbenfängern durchschlagen. Vielleicht haben sie dort sogar schon erste Siedlungen errichtet. Denkt an die Matrosen in Batavia.« Mit diesen Worten keimte bei uns allen etwas Hoffnung auf und wir erinnerten uns wieder daran:
Mit der Hyperion hatten wir zwei Wochen in Batavia vor Anker gelegen, um Waren auszutauschen und unser Schiff aufzutanken. Dort trafen wir dann auf die Robbenfänger. Sie erzählten von ihrer reichen Beute vor der Ostküste im Süden Neuseelands und dass sich einige ihrer Kollegen während der Sommermonate dort regelmäßig aufhielten. Wir glaubten ihnen aber erst, als wir vor unseren Augen tausende, gestapelte Robbenfelle bestaunen konnten, die von ihren Schiffen für den Verkauf verladen wurden. Den fetten Gewinn davon investierten sie in Rum sowie in die schlüpfrigen Frauen der umliegenden Hafenbars. Mit diesen Seeleuten kamen wir leicht ins Gespräch und erfuhren, dass sie bei ihrem Raubzug an der Ostküste Neuseelands selbst kaum Kontakt zu den Einheimischen hatten, und diesen mieden, da ihr Verhalten nur schwer zu berechnen wäre.
Es war ohnehin eigentlich undenkbar, die Insel von West nach Ost zu durchqueren, ohne immer wieder auf verschiedene Maori Stämme zu stoßen, wo wir jedes Mal um unser Leben kämpfen müssten. Daher wandte ich mich an alle: »Die Hyperion muss selber durch den Zyklon einigen Schaden erlitten haben. Wahrscheinlich ist deren Takelage beschädigt. Sie wird daher, wie wir, die nächstgelegene Insel mit dem gleichen östlichen Kurs ansteuern. Ich denke, unsere Leute werden dann von den beiden Gletschern vor uns genauso angezogen, wie wir es wurden. Vielleicht ankern sie sogar hier vor unserer Lagune!«
Mehr im Glauben an das Gute, als in realistischer Betrachtung, nahmen alle bereitwillig diese Vorstellung an, und wir richteten uns darauf ein, einige Tage auf das Eintreffen der Hyperion zu warten. Dann würden wir in aller Eile unsere Schaluppe wieder startklar machen und uns dem Schiff schnell nähern. Aber wir mussten uns und unser Boot in der Zwischenzeit vor den Maori verbergen. Es war jetzt unsere einzige Chance, ihnen noch zu entkommen.
Mittlerweile hatten wir die Schaluppe abgetakelt und mit vereinten Kräften vom Lagunenstrand weg in den direkt angrenzenden Dschungel gezogen, wo wir sie landeinwärts kippten. Ohne die bärenstarken Kräfte von Morris wäre uns dies kaum gelungen. Den freiliegenden Bootsrumpf tarnten wir mit Ästen und Farnblättern. Landseitig versteckten wir den offenen Bauch des Bootes mit losen Baumstämmen und Blättern und bauten einen kleinen Eingang dazwischen. Dann richteten wir uns unsere Schlafplätze im Boot, der Enge trotzend, so angenehm wie möglich ein.
Abends teilten wir dann einen gefangenen Fisch. Gerecht sah anders aus. Wie zuvor nahmen sich Smith und Morris den größten Teil. Morris rechtfertigte sich: »Was wollt ihr? Ohne mich würdet ihr jetzt immer noch auf dem Meer treiben. Außerdem, wer hat das Boot denn umgekippt?« Dann hob er die Arme und spannte sie für uns alle sichtbar an: »Diese Muskeln brauchen jede Menge Futter! Tut mir wirklich leid, wenn ihr dafür etwas weniger bekommt. Oder wollt ihr etwa diese Kraftpakete verärgern?« Die seltsamen Töne von vorhin hallten immer noch in uns nach. Keiner wollte nun einen Streit mit Morris ausfechten. Doch seine Strafe folgte aus der Natur, betraf uns aber alle gleichermaßen. Wie von Sinnen schlugen wir um uns und auf unseren Körper: Myriaden von Mücken, denen wir nun schutzlos ausgeliefert waren. Mit nachlassendem Wind gingen sie auf unsere Körper los und hatten lange nicht mehr eine solche Beute an warmem Blut gemacht. Ich erinnerte mich daran, wie schon James Cook diese Mücken als die »bösartigsten Tiere auf Erden« beschrieb. Zum Schutz rieben wir unsere Haut dick mit Lehm ein und umhüllten unseren Kopf, die Hände und Beine, so gut es ging, denn ansonsten mussten wir uns den Mücken überlassen. Morris hatte es von uns am übelsten erwischt. Ein Stich über seinem rechten Auge war so stark angeschwollen, dass er daraus nur noch blinzelte und aussah wie ein angeschlagener Boxer. Vor ihm auf dem Boden des Bootes lagen an die fünfzig, schwarze, kleine Pünktchen: Erschlagene Moskitos, die er von seiner Haut am ganzen Körper abgelöst hatte, um sie dort zu sammeln. Befriedigt starrte er immer wieder auf den Haufen, um sich davon abzulenken, dass die dreifache Menge an roten Einstichen nun jeden freien Fleck seiner Haut zierte. Unsere Freude war unbeschreiblich, als diese Biester mit einziehender Dunkelheit wieder abzogen.
Eine dichte Wolkenschicht zog über uns auf. Zuvor hatte die absinkende Sonne die leuchtend grüne Farbe des Urwalds ermatten lassen. Nun umschloss uns eine bedrohliche Dunkelheit. Wir erschraken: Die seltsamen Rufe waren plötzlich wieder da, diesmal deutlich näher. Ängstlich wanderten unsere Blicke von einem zum anderen. Jeder ergriff eine Waffe. Die Geräusche wiederholten sich in anderen Stimmlagen immer wieder. Wir befürchteten, umzingelt zu werden. Noch klammerten wir uns an die Hoffnung, dass sie uns noch nicht entdeckt hatten und sich vielleicht durch die Laute bei ihrer nächtlichen Jagd untereinander abstimmen wollten. Schlimmstenfalls aber hatten sie unser Anlanden an die Küste ihres Landes schon lange bemerkt und waren gerade davor, unser Lager zu erstürmen. Smith und Morris hielten ihre Messer schon kampfbereit, während Anderson und ich jeweils eine der Harpunen umklammerten. Morris nahm zusätzlich eine Harpune. Wir verständigten uns nur mit Handzeichen und hielten bis in die frühen Morgenstunden abwechselnd Wache, obwohl niemand auch nur ein Auge in dieser Nacht zudrückte. Wie sehr sehnten wir uns nach dem gleichmäßigen Schaukeln unserer Schlafkojen und dem beständigen Knarren der Schiffsplanken auf der Hyperion zurück. Die Nacht kam und ging. Wir waren noch am Leben.
Am Morgen hatten wir alle großen Hunger. Anderson ergriff das Wort: »Uns bleibt nichts anderes übrig die Umgebung nach Essen hier zu erkunden. Ich schlag vor, unser Jüngster, Robin, bleibt beim Boot und hält nach der Hyperion Ausschau. Morris und Smith, ihr schnappt euch eure Waffen und geht mit mir. Wir laufen am Bach entlang aufwärts, sodass uns Robin sofort findet, sollte unsere geliebte Hyperion hier vorbeisegeln.«
Allein zu sein gefiel mir jetzt gar nicht. Ich hatte von Anfang an kein gutes Gefühl dabei. Aber es blieb mir nichts anderes übrig, als zuzustimmen und »lasst mir noch etwas vom Futter übrig!« ihnen hinter her zu rufen. Dann richtete ich mir meinen Aussichtsplatz am Strand ein. Das Meer wogte sanft hin und her und zeigte sich von seiner langweiligsten Seite. Meine Augen begannen schon zu ermüden, als ich unwillkürlich erschrak: Schreie aus dem Urwald ließen mich innerlich zusammenfahren. Was war passiert und woher kamen diese Laute? Einige davon waren mir wohlbekannte Stimmen. Aber es mischten sich auch tiefer klingende, fremdartige dazwischen. Pure Angst ergriff mich. Ich rannte schnell dem Bach folgend in die Richtung der Schreie und versteckte mich dann so gut es ging hinter Palmen. Von der Küste aus verlief der Bach immer weiter ansteigend bis hin zu einer kleinen Lichtung. Dort ergriff mich das pure Entsetzen! Beim Anblick bekam ich einen Schock, der mich in eine Starre versetzte: Anderson, Smith und Morris standen einer Gruppe von fünf Maori Kriegern gegenüber. Die fremdartigen Eingeborenen waren alle vom Hals abwärts am ganzen Körper furchteinflößend tätowiert, schwangen erregt ihre Speere und Schlagkeulen und näherten sich Smith mit wütenden Gesten. Sie zeigten mit ihren Speeren auf den Bach, kurz danach in die Umgebung, sowie den Himmel und untermalten ihre Gebärden mit einem Geschrei an unverständlichen Worten. Ich hegte keinen Zweifel über ihr Verhalten: Sie wollten Smith ein Vergehen klar machen. Für einen kurzen Moment überlegte ich jetzt, aus meiner Deckung heraus zu erscheinen. Vielleicht konnte ich die Situation noch retten und die Einheimischen beruhigen. Mit demütigen Gesten sowie Geschenken, unserer Kleidung, den Waffen, eben das, was wir anzubieten hatten. Danach hätten wir uns zurückgezogen, in der Hoffnung, noch mal ungeschoren davonzukommen. Die Entscheidung zum Kampf war aber schon gefallen. Morris war in seiner Panik über die vorrückenden Maori seinem Kampfinstinkt erlegen. Er schwang seine Harpune in Richtung des Wütendsten der Maori Krieger und traf ihn an der Schulter. Die Wucht der Harpune riss diesen sogleich zu Boden. Morris hatte aber in seiner Einfalt nicht bedacht, dass dieser Angriff nicht einem Wal galt, der anschließend verfolgt wurde, um ihn dann chancenlos zugrunde zu richten. Jetzt hatte er einen kampferprobten Krieger verletzt, der auch seinen eigenen Tod mutig in Kauf nahm.
Der getroffene Maori zog die Harpune unter sichtbaren Schmerzen aus seiner Schulter, während sich die anderen Vier mit ihren Speeren und Keulen sogleich auf meine Gefährten stürzten. Morris und Anderson konnten zunächst beide in entgegengesetzte Richtungen flüchten, wobei Morris den Bach überquerte. Smith wurde rasch ein Opfer seines Vergehens, dessen Art mir erst viel später klar werden sollte. Die Krieger hatten ihn mit mehreren Keulen derart malträtiert, dass er bald tot am südlichen Ufer des Baches lang gestreckt liegen blieb, von den wütenden Hieben arg verunstaltet. Währenddessen hatten die übrigen Maori die Verfolgung von Anderson aufgenommen, ihn zu Boden gestürzt und den sich windenden Körper mit kurzen gezielten Speerhieben in den Brustbereich und Rücken schnell getötet. Ich erwartete nun, sie würden auch Morris jagen, denn er hatte ja den Kampf begonnen. Aber kein Krieger machte auch nur einen Schritt auf die nördliche Seite des Baches, dort, wo Morris unentwegt weiter um sein Leben rannte. Jetzt musste eigentlich ich als Nächstes an die Reihe kommen. In meinem Versteck fühlte ich mich wie ein vor Angst zitterndes Kaninchen, das von einer mächtigen Schlange zunächst gewittert, dann langsam aber sicher umzingelt wird, bevor der Zubiss erfolgt. Und wirklich. Die Krieger suchten die Gegend um sich herum nach weiteren weißen Eindringlingen ab. Noch ein paar Meter weiter und sie würden mich entdecken. Doch dann besannen sie sich zu meinem Glück auf ihre Wunden, fingen an, sie zu verarzten und sich um den verletzten Krieger zu kümmern. Ich sah, wie sie sich gegenseitig eine grüne, breiige Masse auf ihre blutenden Stellen rieben. Dies nutzte ich und floh so leise wie nur möglich zurück zum Strand, trank unterwegs vom Bach noch hastig und rannte in das Versteck, zur Schaluppe.
2 – Einsamkeit der Insel
M
eine Kameraden waren alle tot, außer Morris. Der Schock darüber lastete schwer auf mir. Immer wieder schwirrten die Bilder des erschlagenen Smith und des erstochenen Anderson in meinem Kopf herum. Mit Anderson war auch unser Vordenker verstorben. Er hatte ein Auge für die Situation und immer die richtige Idee parat. Gerade um ihn tat es mir besonders leid, denn ich wusste, dass er, wäre er alleine gewesen, mit seiner diplomatischen Art einen friedlicheren Ausgang unserer ersten Begegnung mit den Maori hätte erzielen können. Dann fragte ich mich, was Morris auf seiner Flucht zu erwarten hatte. Würden sie ihn jagen oder könnte er sich unbemerkt hierher zum Boot durchschlagen? Schlimmstenfalls würde er dadurch die wütende Meute direkt zu mir führen. Ich konnte es nach wie vor nicht begreifen, dass der einfach zu überquerende Bach, wie eine Art Mauer, die Maori Krieger daran gehindert hatte, ihn zu verfolgen und wie die anderen Kameraden zu erledigen. Wenn man auf der anderen Seite des Baches vor ihnen sicher war, sollte ich dann nicht auch versuchen, in diese Richtung zu verschwinden. Vielleicht konnte ich Morris dort noch antreffen.
Aber ein anderer Gedanke ließ mich dies sofort wieder verwerfen: Warteten dort vielleicht grausame Ungeheuer oder gar gierige Menschenfresser, vor denen sich selbst die todesmutigen Maori Krieger fürchten mussten? Von beiden hatte ich schon mal in den Hafenkneipen von Sydney gehört. Unter den Seefahrern dieses Teils des Pazifiks gab es Gerüchte von einem Riesenadler, dessen Spannweite seiner Flügel so lang wie zwei ausgestreckte Menschen wären. Sein Jagdrevier lag auf der ganzen Weite von den Bergen bis in die Täler. Dieser Adler würde einzelne Menschen im Sturzflug vom Himmel aus angreifen. Seine mächtigen Klauen verkrallten sich dabei in dessen Körper und sein kräftiger Schnabel zerhackte den so Überraschten den Schädel, um dann mit dem leblosen Körper davonzufliegen. Dem Ungeheuer war nur schwer beizukommen, da seine riesigen Nester gut geschützt in den felsigen Regionen der nahen Berge lagen. Waren die Maori aus Schutz vor dieser Bestie deshalb nur nachts unterwegs?
Das andere Gerücht um die Menschenfresser war mir damals sogar noch glaubhafter vorgekommen. Der schon erwähnte Captain James Cook hatte auf seiner zweiten Weltreise im Queen Charlotte Sound im Norden der Südinsel aufgrund eines Sturms das Schwesterschiff, die Adventure, verpasst. Diese hatte dort vor Anker liegend einen Trupp zur Nahrungsbeschaffung an Land geschickt, der aber nicht, wie vereinbart, zurückkehrte. Eine daraufhin ausgesandte Erkundungseinheit fand dann an Land ein Bild des Grauens vor: Überall auf dem Boden lagen abgetrennte Hände und Füße, die noch dem einen oder anderen Matrosen zuzuordnen waren, teilweise am Feuer geröstet. Hunde fraßen sich an den Eingeweiden der Getöteten satt. Ich versuchte mich dadurch etwas zu beruhigen, dass diese Berichte aus den Logbuchaufzeichnungen von der Adventure bisher eine der wenigen Quellen über den Kannibalismus in diesem Teil des Pazifiks waren. Außerdem gab der Bericht an, dass der ausgesandte Trupp bei der Suche nach Nahrung vermutlich eine zeremonielle Feierlichkeit der Maori gestört hatte, denn es waren ungewöhnlich viele Maori zu dieser Zeit dort versammelt gewesen.
All diese Gedanken geisterten nun in meinem Kopf herum, führten aber zu keiner Antwort auf die Frage, was jetzt weiter geschehen sollte. Für eine kurze Zeit konnten sie meinen fortwährend nagenden Hunger übertönen, aber irgendwann musste ich wohl oder übel mein Versteck verlassen um mir Früchte oder Beeren zu suchen. Ich nahm meine zwei Eimer, ging damit zum Bach und überquerte diesen in nördlicher Richtung in der Hoffnung, nun in dem geschützten Bereich zu sein, den die Maori nicht betreten würden. Ein Gemisch aus Palmen und mir unbekannten Nadel- und Laubbäumen sowie Sträucher umgab mich. Mein Hunger zwang mich nun von allen Früchten zu kosten. Zu meiner Freude entdeckte ich einen Strauch mit roten Beeren, die saftig und süß schmeckten.
Ein Geräusch um mich herum ließ mich aufhorchen. Mittlerweile war ich sehr sensibel beim Herausfiltern der unbekannten Laute: Einem »Krääää« folgte das »Tuiiii, tuiiii« und endete mit einem lang gezogenen »Iiiiaaaooouuu«. Eine Mischung aus Rabengekrächze, Kükengequieke und dem Gejaule junger Hunde. Dann entdeckte ich die Quelle dieser Geräusche: Eine merkwürdige schwarze Vogelart mit einem lustigen weißen Federbüschel am Hals, dazu noch einem leicht nach unten gekrümmtem Schnabel. Wenn der Vogel nicht gerade an den Palmenfrüchten pickte, erzeugte er immer wieder diesen lauten, sehr eigentümlichen, melodischen Klang. Ich hatte sofort meine Freude daran und versuchte, dieses Geräusch zu imitieren, aber schließlich besann ich mich wieder auf das Sammeln der Beeren und kehrte mit zwei vollen Eimern in mein Versteck zurück. Die lästigen Mücken verschwanden, als hätten sie den kommenden Regenschauer vorausgeahnt. Der Niederschlag kam mit einer Heftigkeit, wie ich sie selbst im Sturm auf dem Ozean selten erlebt hatte, doch im umgekippten Boot blieb ich trocken und konnte zum ersten Mal seit Langem meinen Hunger mit den gesammelten Beeren stillen. Danach dachte ich wieder an meine missliche Lage, horchte von Zeit zu Zeit auf die sonderbaren Laute, die das monotone Prasseln des Regens auf die Bootswand übertönten. Von nun an wollte ich mein Versteck nicht so einfach verlassen.
Seit der Ankunft hatte ich immer wieder stundenlang auf das Meer gestarrt in der Hoffnung, die Hyperion irgendwo am Horizont zu entdecken. Außer den vielen schwarzen Punkten, die sich jedes Mal zu meiner Enttäuschung nach ein paar Sekunden in den weit entfernten Wellen auflösten, konnte ich nichts entdecken und meine Suche blieb erfolglos. Ich war danach immer wie in Trance ermattet. Auch ein Fernglas hätte mir nicht weitergeholfen. Es hätte mir nur dieselben, täuschenden schwarzen Flecken in dann eben weiterer Entfernung als Trugbilder vor meine Augen geführt. Mir fiel es schwer, unter diesen Umständen meine Situation noch nüchtern zu betrachten, aber, auch wenn es mir Kopfschmerzen bereitete, ich musste mich von meiner Vorstellung verabschieden, dass die Hyperion gerade auf der Suche nach uns die Küste absegelte. Es gab etwas, was mich bei diesem Gedanken noch mehr schmerzte: Ja selbst wenn meine Wunschvorstellung eintreffen würde, allein wäre es unmöglich gewesen, die Schaluppe vom Strand zu ziehen und wieder startklar zu machen, um der Hyperion entgegen zu segeln.
Dagegen hatte ich eine andere Hoffnung noch nicht aufgegeben: Einen Tag noch wollte ich auf die Rückkehr von Morris warten. In der Kombination seiner Kräfte mit meinem Verstand hätten wir den Versuch wagen können, mit der Schaluppe von diesem Ort zur Ostküste und den dortigen Robbenfängern zu segeln. In dieser Hoffnung schlief ich ein. Nachts wurde ich wieder ein paar Mal von den mir schon bekannten Vogellauten geweckt und schlief unruhig bis zum nächsten Morgen.
Den nächsten Tag verbrachte ich mit ähnlichen Tätigkeiten, wie tags zuvor: Beeren sammeln, Wasser holen, Horizont absuchen und bei alldem auf jeden Laut achten. Der Tag brachte wieder Angst und Trauer: Morris kam nicht. Noch eine Nacht wollte ich auf ihn warten. Dabei zog mein ganzes Leben in Gedanken noch mal an mir vorbei, so, als wollte sich meine Seele auf meinen baldigen Tod vorbereiten. Auf dem großen Walfänger, dessen Kapitän mich einst im Hafen von Batavia anheuerte, hatte ich hart arbeiten müssen. Abgesehen von den erwähnten Eskapaden von Smith und Morris, verstand ich mich mit allen Matrosen und Offizieren der Hyperion recht gut. Meine Arbeit als Hilfsjunge in der Schiffsküche und überall sonst war unter ihnen angesehen. Ab und zu durfte ich sogar den Steuermännern und dem Kapitän bei ihrer Arbeit über die Schulter sehen, denn ich war begierig darauf, das Navigieren mit Karte, Kompass und Sextant zu erlernen. Die seemännischen Begriffe und Regeln hatte ich schon auf dem Handelsschiff gelernt, das mich nach Batavia gebracht hatte.
Das Jagen eines Wales war jedes Mal ein Abenteuer für sich und an das grausame Töten hatte ich mich wohl oder übel gewöhnen müssen. Gefährlich war es allemal. Auf dem Fangboot, der kleinen wackligen Schaluppe, konnte man sich bei der Annäherung an einen Wal nie richtig sicher fühlen. Ich war daher froh, nicht immer zur Besatzung eines der drei Fangboote der Hyperion zu gehören, die für das Harpunieren des Wals zuständig waren. Das Schicksal wollte es aber, dass ich beim letzten Mal mit in ein Fangboot beordert wurde, weil der ansonsten dafür vorgesehene Matrose kurzfristig Magenprobleme hatte und mit bleichem Gesicht über der Reling hing. Eigentlich hätte noch ein weiterer Matrose an Bord sein müssen, damit wir zu je zweien an beiden Seiten neben dem Harpunier rudern konnten. Das Meer war jedoch so ruhig, dass stattdessen unser Harpunier mitruderte, denn weitere Matrosen wollte man lieber für die spätere Arbeit nach der Jagd schonen. Warum hatte ich so ein Pech? Warum musste ausgerechnet ich an dem stürmischen Tag mit auf das Fangboot? Wollte das Schicksal mich hier einsam zugrunde gehen sehen? Ich hätte jetzt alles dafür gegeben, wie der seekranke Matrose, noch auf der Hyperion weilen zu können, trotz der vielen Arbeiten an Deck, die mich immer angeekelt hatten. Nach dem gezielten Töten des ermüdeten Wals mit der Lanze wurde der Wal ans Mutterschiff beigeholt. Dann trennte man seinen Kopf ab und zog dessen Speckschichten einer nach der anderen ab. Der Gestank dabei tat sein Übriges, aber es nützte nichts, denn ich musste immer beim Abspecken des Wals mit dem Walspaten mit anpacken, was sich manchmal über einige Tage hinziehen konnte. Damals wusste ich, diesen Gestank an fettigem Walfleisch würde ich nie vergessen. Das Walfleisch wurde noch an Deck der Hyperion im Schmelzofen erhitzt, um daraus das kostbare Öl zu gewinnen, mit dem die Lampen in den wohlhabenderen Häusern der Heimat brannten. Konnten die adeligen Lords überhaupt ahnen, auf welch gefährliche und abenteuerliche Weise sie zu der Beleuchtung in ihren Villen kamen? Meine anderen beiden Segeltouren von Liverpool über Kapstadt nach Bombay und von dort mit dem Handelsschiff nach Batavia waren fast langweilig zu nennen, wäre unser Schiff nicht einst von Piraten südlich der Landmasse von Sumatra verfolgt worden. Wir hatten damals alle um unser Leben segeln müssen, um nicht von fünf dieser kleineren Schiffe umzingelt und gekapert zu werden. Im günstigsten Fall wären wir versklavt worden, ansonsten hätten uns die Haie auf der offenen See erwartet. Auf meiner ersten Schiffsreise nach Bombay konnte ich mich noch mit einem weiteren Matrosen aus meiner Heimatstadt Liverpool anfreunden. Er hatte mir von seiner Arbeit in jungen Jahren in den Kohlerevieren auf der Halbinsel zwischen Dee und Mursay erzählt und wir beide genossen nun die Freiheit, beim Segeln über die Weltmeere nicht in einer der stickigen Fabriken oder Minen in unserer Heimat schuften zu müssen, und dachten mit Freude an die Abenteuer, die in der Weite des Pazifiks noch auf uns warten würden.
Konnte hier nun alles schon ein jähes Ende finden? Hatte ich mich deshalb überall in den fernen Meeren durchgekämpft und zuletzt gemeinsam mit den Kameraden sogar den Pazifik besiegt, nur um mich von Maori Kriegern abschlachten zu lassen und von den Mücken zerfressen zu werden? Der Überlebensinstinkt wollte sich diesem Schicksal noch nicht ergeben. Zumindest nicht kampflos. In diese Gedanken versunken schlief ich ein.
In der Nacht offenbarte sich mir ein seltsamer Traum: Ich schwimme einsam im offenen Meer. Überall wohin ich auch schaue befindet sich eine endlose Weite bis hin zum Horizont, wie inmitten einer Wüste. Dann plötzlich nähern sich große Kanus mit vielen Menschen in einer Reihe hintereinander sitzend. Dunkelhäutige Frauen und Männer, alle nackt. Langsam und gleichmäßig bewegen sich ihre Arme beim Rudern. Sie umzingeln mich bedrohlich, während ich hektisch nach einer Fluchtmöglichkeit suche. Vergeblich. Dann richten alle ihr Paddel auf mich. Ich ergreife das Holz einer jungen Frau, um mich daran aus dem Wasser ins Boot zu ziehen. Die Einheimischen bilden mit ihren Paddeln ein Dach über unser Boot.
Jetzt erkenne ich, dass einige ihrer Paddel eine tropfenförmige, abgeflachte Gestalt haben und grün sind, wie die Waffen der Maori Krieger, die meine Kameraden erschlagen hatten. Vier von diesen grünen Ruderhölzern liegen flach auf den Brettern des Bodens in alle Richtungen weisend vor mir. Ich liege auf dem Bauch in deren Mitte und strecke meine Arme und Beine aus, sodass jedes dieser Paddel mit einem Fuß oder einer Hand von mir berührt wird. Die grünen Paddel verändern daraufhin ihre Form. Sie wölben sich an der äußeren Rundung nach oben, ähnlich den riesigen Blättern der Palme, deren Beeren ich tags zuvor abgeerntet hatte. In der Mitte der vier gewölbten Paddel, die nun wie eine riesige grüne Blüte aussieht, bin jetzt nicht mehr ich zu sehen. Stattdessen erscheint dort das Gesicht der jungen Frau, an deren Paddel ich mich hochgezogen hatte.
Ich erwachte inmitten der Nacht mit einem merkwürdigen Gefühl im Bauch. Wie hatte ich den Traum zu deuten? Ich blieb noch lange wach, aber diesmal ohne die Angst und die Trauer, die mich zuvor quälte. Im Morgengrauen traute mich mein Versteck zu verlassen. Die Sonne wanderte über das Gebirge im Osten, um bald wieder im Zenit zu stehen. Sie verdrängte letztendlich den weiten, dunklen Schatten und ließ den Urwald wieder in seinem leuchtenden Grün erstrahlen. Meist lag eine lang gezogene Kette kleiner weißer Wolken vor den höheren Gipfeln der Bergkette, die wir in nahezu voller Länge schon bei der Annäherung vom Meer aus bewundert hatten.
Mit leerem Blick starrte ich auf das offene Meer hinaus. Alle Gefühle in mir waren schon erloschen. War das ein großes Segelboot in der Ferne, das sich vor mir langsam am Horizont von links nach rechts bewegte? Die Sehnsucht danach hatte mich bereits verlassen. Mein Blick blieb leer. In diesem Zustand musste ich wohl einige Stunden zugebracht haben. Dann dachte ich plötzlich an Morris. Ich würde ihn niemals wieder antreffen. Ich konnte für ihn nur hoffen, dass er keinen qualvollen Tod erleiden musste und alles schnell für ihn vorüberging. Als Nächstes überkamen mich Gedanken des Freitods: Jetzt auf das offene Meer hinaus zu schwimmen, mich mit den Wellen treiben zu lassen, solange, bis ich nicht mehr weiterkönnte. Damit wollte ich mich meinem merkwürdigen Traum hingeben, an den ich immer noch denken musste. Ein sanftes Ende meines unglücklichen Daseins hier, das Abtauchen im ermatteten Zustand inmitten des unendlichen Ozeans, fast wie im Schlaf. Aber es gab etwas, das mich davor abhielt: Die Angst, dort inmitten des Pazifiks, von plötzlich aufkeimenden Überlebensinstinkten getrieben, aus diesem Tagtraum zu erwachen und dann, verbittert über mich selbst, qualvoll zu ertrinken. Der Gedanke daran brachte mich wieder in die Welt zurück. Ich starrte weiter auf das Meer, aber diesmal wie ein Gefangener, der sehnsüchtig aus seiner Zelle heraus auf eine Straße schaut, die zum Horizont führt. Dorthin, wo ihn eine Kutsche wieder zurück in das pralle Leben führen könnte.
Dann kam mir etwas ganz anderes in den Sinn und je mehr ich darüber nachdachte, desto reeller formte sich dieser Gedanke zu meiner letzten verbliebenen Möglichkeit: Ich könnte mich den Maori Kriegern kampflos ausliefern! Vielleicht verschonten sie mein Leben und nahmen mich als Sklave mit in ihr Dorf. Falls sie schon von ihrer Jagd gesättigt wären, würde mein Fleisch sie vielleicht weniger interessieren, als meine Arbeitskraft und auf diese Weise konnte ich zumindest noch am Leben bleiben. Ein letztes Mal aß ich mich an den Beeren in Gedanken an eine Henkersmahlzeit satt und saugte das Wasser aus dem Bach in solchen Mengen auf, als ob ich vorhätte, gleich einem Kamel, eine riesige Wüste zu durchschreiten. Dann machte ich mich auf den Weg entlang des Baches ins Landesinnere und kam wieder zu der Stelle, wo wir die Maori Krieger angetroffen und sich die Kämpfe abgespielt hatten. Aber was war geschehen? Ungläubig schaute ich mich um, denn es war wirklich seltsam. Die Leichen von Smith und Anderson waren fort! Ich suchte den ganzen Platz ab und achtete dabei auf jedes noch so kleine Detail am Boden. Es gab auf dieser Lichtung überhaupt nichts mehr, was auf einen Kampf hätte hindeuten können: keine Fußabdrücke oder Einstichstellen der Speere im Boden, keine Kleiderfetzen, keine Haar- oder Hautteile. Selbst die Blutspuren, dort, wo meine Kameraden verstarben, waren weg. Als wäre der ganze Bereich mit größter Sorgfalt davon gereinigt worden. Auch im Bach schaute ich gründlich nach. Mir kam es vor, als hätte man dort Steine an ihre ursprüngliche Stelle wieder zurückgesetzt, die sich beim Kampf unter den Tritten und Stürzen verschoben hatten. Jetzt lagen die Steine wieder auf den vom Wasser freigewaschenen kleinen Sandinseln, so wie seit Urzeiten.
Zweifel an meinen Verstand begannen an mir zu nagen. Hatte mir meine Erinnerung einen Streich gespielt? War das Gemetzel meiner Kameraden nur ein schrecklicher Tagtraum von mir gewesen? Vielleicht war ich mittlerweile durch die äußeren Umstände, meine Isolation, Hunger und Durst, um meine Besinnung gekommen. Außerdem konnten einige der gegessenen Beeren bei mir eine halluzinogene Wirkung ausgelöst haben. Und was war mit meinem Zeitgefühl. Stimmte es überhaupt noch? Wie lange war ich überhaupt schon hier? Tage oder sogar schon Jahre? Ich begann an allem zu zweifeln: War ich wirklich mit anderen Matrosen hierher gesegelt? Smith, Morris und Anderson entstammten vielleicht nur meiner Erinnerung an die Hyperion. In meiner langwährenden Isolation hatte ich mir eine Gemeinschaft auf dieser Insel so sehr gewünscht, dass mir meine Sinne das Beisammensein mit diesen Kollegen nur vorgespielt hatten. Die Geschichte mit Anderson, Smith und Morris auf der Schaluppe bis zur Küste hierher entstammte meiner puren Fantasie. Auch die Maori mit ihren nächtlichen Rufen waren nur ein Produkt meiner Einbildungskraft. Ein ähnliches Gefühl im Bauch, wie nach dem komischen Traum der letzten Nacht, überkam mich. Ich dachte an die Erzählungen Defoes über Robinson Crusoe. Wie dieser in den vielen Jahren seiner Isolation damit zu kämpfen hatte, bei geistig normaler Besinnung zu bleiben und wie er sich dazu mit immer neuen für ihn nützlichen Projekten auf seiner Insel beschäftigte. Es gab einige Berichte von Schiffbrüchigen oder ausgesetzten Sträflingen, die während ihrer Isolation auf einer einsamen Insel in den Wahn getrieben wurden. Bei ihrer Rettung, einige Jahre später, war kaum noch etwas Menschliches an ihnen zu erkennen und sie benahmen sich wie wilde, scheue Tiere, die kaum wieder in die zivilisierte Gesellschaft zurückfanden.
Während ich auf diese Weise weiter an mir zweifelte, entdeckte ich einen kleinen Pfad am anderen Ende der Lichtung und folgte diesem, in Gedanken versunken, immer weiter weg von der Küste. Nur der Weg war jetzt mein Ziel. Ich wollte in meinem Wahn einfach laufen, egal wohin, immer weiter und weiter, nur weg von diesem verrückten Ort, bis mich etwas aus diesem Traum riss: lose, braunweiß-gestreifte Federn. Dieser Fund im Gebüsch seitlich des Pfades warf mich urplötzlich wieder in die Gegenwart zurück. Auf einem Baumstumpf lagen dutzende davon verstreut herum. So, wie nach dem Rupfen eines Vogels für die Zubereitung einer Mahlzeit. Im matschigen Boden daneben erblickte ich aufgeregt Fußspuren. Es mussten mehrere Personen dort gewesen sein. Meine Erinnerung hatte mich nicht betrogen und mit dem Verrücktwerden konnte noch gewartet werden.
Ab jetzt lief ich angespannt mit höchster Aufmerksamkeit weiter auf dem Pfad. Ich wollte sie antreffen, auch wenn ich dafür einen solchen Mut aufbringen musste, wie noch nie in meinem Leben zuvor. Um mein friedliches Kommen zu signalisieren oder vielleicht auch nur um meine Angst zu überwinden, sang ich Seemannslieder: die ersten drei Strophen von »All for me grog«. Jetzt hätte ich wirklich einen Schluck Grog gebrauchen können. Nach jeder Strophe wiederholte ich pfeifend die Melodie und lauschte gleichzeitig, ob sich im Gebüsch um mich herum etwas tat. Dann sah ich in der Ferne, wie der Pfad an einem kleinen Tümpel vorbeiführte und plötzlich, dieser Anblick brachte mir meine äußerste Anspannung zurück, sah ich die Maori Krieger. Es waren fünf an der Zahl. Alle saßen am Boden, gerade damit beschäftigt ihre Jagdbeute in Bündeln an Stöcke zu binden. Offenbar hatten sie mich noch nicht bemerkt. Ich zögerte. Jetzt konnte ich noch unbemerkt umkehren, zum Strand laufen und auf ein Schiff warten. Aber meine Entscheidung stand unumkehrbar. Als ich mich ihnen singend und pfeifend weiter näherte, stand einer von ihnen auf. Ich stoppte. Wir sahen uns beide für einen kurzen Moment an, ungläubig über das, was es zu sehen gab. Dann rief er hektisch den anderen Kriegern etwas zu und im Nu waren sie in verschiedene Richtungen laufend verschwunden. Langsam ging ich weiter zum Tümpel in dem Gefühl, von allen Seiten, wie bei einer Tierhatz, aufgelauert zu werden. Von Zeit zu Zeit hörte ich ein Geraschel ihrer Schritte beim Durchschreiten des Gebüschs, jedes Mal aus einer anderen Richtung. Als diese Geräusche mir sehr nahe vorkamen, setzte ich mich mitten auf dem Pfad in den Schneidersitz, legte meine Hände auf die Knie und übergab mich meinem Schicksal.
Die Maori hatten dies genau beobachtet und waren darüber verwundert. Plötzlich kam ein Speer auf mich zugeflogen, den einer von ihnen aus der Deckung heraus auf mich abgeworfen hatte. Das Wurfgeschoss hätte mein schnelles Ende bedeuten können. Es blieb einen Meter entfernt rechts neben mir im Boden stecken. Ich zuckte dabei instinktiv zusammen, hielt aber an der Haltung, meiner Todesangst trotzend, fest. Dann sah ich, wie ein zweiter Speer auf mich geworfen wurde. Diesmal vielleicht genauer, direkt auf meinen Körper gezielt. Ich fühlte schon, wie der Speer meine Brust zwischen den Rippen bis zum Rücken durchbohrte und wie er mich auf den Boden presste. Der Speer flog auf mich zu und blieb in ähnlicher Entfernung von mir, wie der erste stecken, nur diesmal auf der anderen Seite. Ein dritter Speer, der mich in der Mitte der beiden anderen direkt getroffen hätte, folgte nicht mehr. Äußerlich ungerührt, bebte mein Herz vor Aufregung als Zeichen, dass ich noch lebte. Die nächsten Sekunden würden über mein Leben oder den Tod entscheiden. Schon kamen die Krieger von allen Seiten auf mich zu gerannt, warfen mich auf den Bauch, banden mir meine Hände hinter dem Rücken zusammen und redeten in mir unverständlichen Worten auf mich ein. Immer wieder rief ich mit gezwungen ruhiger Stimme so etwas wie: »Nehmt mich





























