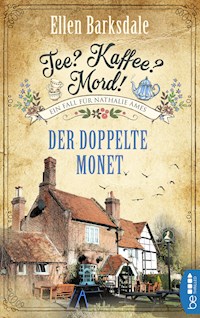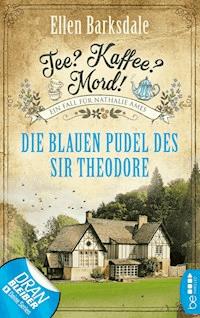Tee? Kaffee? Mord! Der doppelte Monet / Die letzten Worte des Ian O'Shelley E-Book
Ellen Barksdale
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die gesammelten Fälle von Nathalie Ames
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Cottages, englische Rosen und sanft geschwungene Hügel - das ist Earlsraven. Mittendrin liegt das gemütliche Café "Black Feather", das die junge Nathalie Ames völlig unerwartet von ihrer Tante erbt - und deren geheimes Doppelleben gleich mit! Gemeinsam mit der Köchin Louise, einer ehemaligen Agentin der britischen Krone, führt Nathalie nicht nur das Café, sondern löst die seltsamen Verbrechen im Ort. Begleiten Sie Nathalie und Louise bei ihren ersten zwei Fällen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
DER DOPPELTE MONET
Prolog
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Epilog
Intermezzo
DIE LETZTEN WORTE DES IAN O'SHELLEY
Prolog
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Über die Autorin
Geboren wurde Ellen Barksdale im englischen Seebad Brighton, wo ihre Eltern eine kleine Pension betrieben. Von Kindheit an war sie eine Leseratte und begann auch schon früh, sich für Krimis zu interessieren. Ihre ersten Krimierfahrungen sammelte sie mit den Maigret-Romanen von Georges Simenon. Nach dem jahrelangen Lesen von Krimis beschloss sie, selbst unter die Autorinnen zu gehen. »Tee? Kaffee? Mord!« ist ihre erste Krimireihe.
Ellen Barksdale
Tee? Kaffee?Mord!
DER DOPPELTE MONETDIE LETZTEN WORTE DES IAN O‘SHELLEY
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von Motiven von © shutterstock/SJ Travel Photo and Video, © Mary Ro/Shutterstock, © Mary Ro/Shutterstock, © mubus7/Shutterstock
E-Book-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7325-9460-3
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Ellen Barksdale
Tee? Kaffee?Mord!
DER DOPPELTE MONET
Prolog, in dem Cecily Beresford in ihrem Haus in Earlsraven um den Schlaf gebracht wird
»Was?«
Es war die vierte Nacht in Folge, in der Cecily Beresford aus dem Schlaf hochschreckte, weil eine Stimme ihr etwas zugeflüstert hatte. Sie saß kerzengerade im Bett und sah in die dunkle Nacht, dabei hielt sie eine Hand auf ihre Brust gedrückt, um ihr hastig schlagendes Herz zu beruhigen.
Warum nur immer wieder diese Stimme? Und warum sagte sie ihr so etwas? Warum konnte die Stimme sie nicht in Ruhe lassen?
Eigentlich war die Antwort darauf ganz simpel: Weil sie recht hatte. Und weil etwas Unrechtes geschehen war. Doch sie wusste auch, dass sich dieses Unrecht womöglich gar nicht rückgängig machen ließ. Wie sollte sie es beweisen? Es war aussichtslos, und womöglich war genau das der Grund, dass sie nachts immer wieder aufwachte. Nicht, weil die Gerechtigkeit siegen sollte, sondern diese Gerechtigkeit sie verspotten wollte.
Cecily Beresford schlug die Flanelldecke zur Seite und setzte sich auf die Bettkante, dann atmete sie erst ein paar Mal durch, ehe sie aufstand. Das alte Bett knarzte bei jeder Bewegung, aber das hatte es schon zu Zeiten ihrer Großmutter Eugenie getan – und so wie ihre Ahnin nahm auch Cecily längst keine Notiz mehr davon, welche Geräusche der massive Holzrahmen oder die Sprungfedern von sich gaben.
Der März war zwar sonnig, aber die Sonne besaß nur wenig Kraft, und dementsprechend kühl war es nachts, daher wollte sie auf ihre flauschige Decke nicht verzichten. Cecily griff nach dem Bademantel, der auf dem Stuhl gleich neben dem Bett lag, zog ihn an und verließ das Schlafzimmer.
Sie ging durch den kurzen Flur, den Strahl der kleinen Taschenlampe auf den Boden gerichtet. Für eine Frau Mitte achtzig war sie noch sehr flink auf den Beinen und bei klarem Verstand, aber sie achtete auch darauf, dass sie nicht übermütig wurde. Ein falscher Schritt, und sie würde die nächsten Wochen wegen eines komplizierten Beinbruchs im Krankenhaus verbringen müssen.
Ihre vorausschauende Art hatte auch bewirkt, dass sie schon vor Jahren ihr früheres Arbeitszimmer im Erdgeschoss in ein Schlafzimmer verwandelt hatte, weil sie dann nicht unbedingt jeden Tag die Treppe benutzen musste. Im ersten Stock stand nun der alte Jugendstilschreibtisch, in den Aktenschränken waren alle wichtigen Dokumente untergebracht. Dort gab es auch noch das Handarbeits- und das Malzimmer, beide ursprünglich als Kinderzimmer genutzt. Nichts davon benötigte sie täglich, und mit der Verlegung des Schlafzimmers war die große Gefahr gebannt, aus irgendeinem Anlass noch im Halbschlaf zur Haustür eilen zu müssen und dabei auf der Treppe ins Stolpern zu geraten.
Im Wohnzimmer bog sie nach rechts und blieb vor der alten Anrichte stehen. Ihr Blick wanderte ein Stück weit über das Möbelstück und verharrte dort.
Nach nicht mal einer halben Minute schüttelte sie den Kopf und flüsterte ängstlich: »Das ist er nicht. Das ist er nicht ...«
Schließlich kehrte sie ins Schlafzimmer zurück und legte sich wieder hin. Sie wusste, so bald würde sie nicht einschlafen können, ganz so wie in den vergangenen drei Nächten auch. Wie lange sollte das noch so weitergehen?
Cecily Beresford ließ den Kopf aufs Kissen sinken und schloss die Augen. Irgendwann würde der Schlaf schon übermächtig werden.
Irgendwann ...
Erstes Kapitel, in dem Nathalie überraschend einen Brief erhält, der ihr Leben auf den Kopf stellt
Liverpool,ein paar Tage nach dem nächtlichen Vorfall in Earlsraven
»Mr Cresnick, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Bruder ums Leben gekommen ist«, sagte der Inspector mit betretener Miene.
»Stuart? Reden Sie etwa von Stuart?«, fragte Cresnick erschrocken. »Er ist mein einziger Bruder!«
»Es tut mir leid, Mr Cresnick.«
»Was ist passiert?« Cresnicks Frau kam zur Tür und sah verwundert zwischen ihrem Mann und dem Polizeibeamten hin und her.
»Der Inspector ist gekommen, um mir zu sagen, dass mein Bruder tot ist«, erklärte Cresnick in einem Tonfall, als würde er etwas wiederholen, was ihn gar nicht betraf.
»Stuart? Redet er etwa von Stuart?«, wollte sie wissen.
Cresnick nickte.
»Er war dein einziger Bruder!«
»Das habe ich dem Inspector auch schon gesagt«, antwortete ihr Mann.
Mrs Cresnick drehte sich zu dem Polizisten um. »Stuart war sein einziger Bruder, müssen Sie wissen.«
Der Inspector nickte. »Ihr Mann erwähnte es ber...«
»Jetzt reicht’s mir aber«, stöhnte Nathalie und schaltete den Fernseher aus. »Wenn die weiter so einen Blödsinn reden, wird der Mörder vor Langeweile eingehen, bevor er verhaftet werden kann.«
Glenn schüttelte den Kopf. »Und trotzdem schalten jede Woche drei Millionen Menschen ein, um sich das anzusehen.« Er strich sich über den Bart. »Und was machen wir jetzt? Wir wollten doch den Abend gemütlich vor dem Fernseher verbringen.«
Nathalie drehte sich zu ihm um und lächelte ihn verschmitzt an. »Jetzt sag bloß, du weißt nicht, wie wir den Abend verbringen können, wenn im Fernsehen nichts Vernünftiges läuft.«
Er lachte leise. »So war das nicht gemeint. Da habe ich schon ein paar Ideen, aber ich musste heute so viele Kisten schleppen, dass ich, ehrlich gesagt, froh bin, wenn ich einfach auf der Couch rumhängen kann, ohne auch nur einen Finger zu rühren.«
»Ja, ich weiß«, erwiderte Nathalie verständnisvoll. »Ich bin selbst auch total erledigt. Aber es war ja auch eine ›geniale‹ Idee von deinem Bruder, uns um drei Uhr nachmittags um Hilfe zu bitten, damit sein Lagerraum bis sechs Uhr leer geräumt wird.«
»Vor allem, wo er das schon seit einem halben Jahr wusste.« Er verzog verlegen den Mund. »Tut mir leid, dass ich dich dazu überredet habe. Ich hätte ihm sagen müssen, dass er zusehen soll, wie er den Kram allein da rausschafft. Aber lass uns lieber das Thema wechseln, sonst werde ich noch richtig sauer.«
Nathalie dachte kurz nach. »Ich weiß, was wir machen können. Ich schenke jedem von uns ein Glas Wein ein, und dann nehme ich mir den Stapel Post vor, den ich heute aus dem Briefkasten geholt habe. Und du setzt dich einfach zu mir und unterhältst mich ein bisschen. Wie klingt das?«
»Hm«, machte Glenn und fuhr gespielt begeistert fort: »Au jaaa, das wird bestimmt raaaasend interessant werden.« Er ließ einen tiefen Seufzer folgen. »Aber meinetwegen.«
»Dann mal los!«, erwiderte sie gut gelaunt und stand von der Couch auf, um zum Sekretär zu gehen, auf dem die Umschläge gestapelt lagen. Sie brachte die Post zum Tisch, dann ging sie in die Küche und kam mit zwei Gläsern Wein zurück. Nachdem sie sich wieder zu Glenn gesetzt hatte, begann sie, den Stapel zu sichten. »Werbung, mehr Werbung, noch mehr Werbung, Telefonrechnung, andere Werbung, Stromrechnung, Lottowerbung, Werbung vom ... was ist das? Ein Notar? Stewart Richard Orson III. Kenn ich nicht.«
»Aber anscheinend kennt er dich«, sagte Glenn und nahm ihr den Brief aus der Hand. »Das ist irgendwas Offizielles. Ein Einschreiben.«
Nathalie fuhr sich durch ihre kurzen dunkelblonden Haare und zog die Augenbrauen zusammen. »Den muss ich dann ja wohl aufmachen.«
»Das wäre sicher nicht verkehrt«, stimmte Glenn ihr zu und gab Nathalie den Brief zurück.
»Also gut.« Sie setzte den Brieföffner an und schnitt den Umschlag auf, nahm das Schreiben heraus und begann zu lesen.
»Nach deinen ›Ohs‹ und ›Huchs‹ zu urteilen, ist es wohl etwas Wichtiges?«
Sie faltete das Blatt zusammen und schob es zurück in den Umschlag. »Es geht um das Testament meiner Tante Henrietta.«
»Die vor zwei Wochen gestorben ist?«
Nathalie nickte. »Ja, genau. Offenbar soll ich irgendwas erben, und der Notar will mich deshalb sprechen.«
»Das ist aber schön«, befand Glenn.
Wieder nickte sie, war dabei aber den Tränen nah. »Lieber wäre es mir schon, wenn es noch keinen Anlass gäbe, mir etwas zu vererben.«
Glenn drückte Nathalie an sich, schließlich wischte sie sich flüchtig über die Augen und murmelte: »Schon gut, es geht wieder.«
»Was könnte sie dir denn vererbt haben?«, fragte Glenn nach einer Weile. »Vielleicht besaß sie ja eine von diesen schrecklichen Riesenkerzen. Du weißt schon, diese monströsen Klötze, die so aussehen, als hätte sie jemand aus einer Kirche irgendwo in Italien mitgehen lassen. So eine Abscheulichkeit mit betenden Händen oder Heiligengesichtern oder so. Oder noch so einen Klotz von Schrank.« Er zeigte auf den Wandschrank, den Nathalies Eltern ihr überlassen hatten, gleich nachdem sie hier eingezogen war. Der Schrank war genauso aus der Mode wie fast alles in ihrer Wohnung, aber trotzdem liebte Nathalie jedes einzelne Möbelstück, weil es eine Geschichte erzählte, die nicht aus der Zeile »Ich kam in einem schwedischen Möbelhaus zur Welt, und stehe zusammengeschraubt hier rum« bestand. Jeder aus ihrer Verwandtschaft und ihrem Freundeskreis hatte ihr etwas geschenkt, das bereits ein paar Jahre auf dem Buckel hatte, das aber zu schade und noch viel zu gut erhalten war, um auf dem Sperrmüll zu landen. Der dunkelgrüne Ohrensessel, der rechts von der Couch stand, war ein Geschenk von Tante Henrietta gewesen und war schnell ihr Lieblingsplatz geworden. Wenn Nathalie allein war, saß sie fast immer dort, entweder, um ein Buch zu lesen, oder, um im Winter, in eine Decke eingehüllt, einen heißen Kakao zu trinken. Manchmal verbrachte sie sogar die halbe Nacht in diesem Sessel, wenn sie abends vor dem Fernseher einschlief. Beeindruckend an diesem breiten, weichen Riesen war, dass Natalie sogar nach einer ganzen Nacht in Schieflage ohne Schmerzen aufwachte.
Glenn war von dieser Einrichtung aus zweiter Hand nicht ganz so begeistert wie sie. Das hatte sie ihm beim ersten Besuch in ihrer Wohnung anmerken können, auch wenn er nichts dazu gesagt hatte. Sie war sich nicht sicher, ob das noch zu einem Problem werden würde, wenn sie in ihrer Beziehung einen Schritt weitergehen und zusammenziehen wollten. Darüber geredet hatten sie, aber noch gab es nicht mal ein ungefähres Datum, und damit konnte sie auch ganz gut leben. Im Moment war sie mit dieser Beziehung zufrieden, so, wie sie war. Sie ließ sich weder von der Cosmopolitan noch von irgendeiner anderen Zeitschrift einreden, nach wie vielen Wochen oder Monaten ihre Beziehung einen bestimmten Status erreicht haben musste, wenn sie nicht zum Scheitern verurteilt sein sollte. Keine Beziehung der Welt lief nach einem festgelegten Fahrplan ab, es sei denn, man war ein Promi und musste den Erwartungen seiner Fans gerecht werden. Aber das hatte dann sowieso mit der Realität nichts mehr zu tun.
Im wahren Leben entwickelten sich die Dinge in ihrem eigenen Tempo, und das konnte manchmal bedeuten, dass man jemanden kennenlernte und ihn drei Tage später heiratete – aber es war auch möglich, dass man ein Leben lang mit diesem Jemand zusammenblieb, ohne je den Wunsch nach Heirat zu verspüren.
»Warum sollte sie mir eine hässliche Kerze vererben?«, griff Nathalie Glenns letzte Bemerkung auf.
»Ganz einfach. Als ich zwölf war, hat mir meine Großtante so ein Ding geschenkt. Das Trauma wirkt bis heute nach.« Glenn wartete Nathalies Reaktion gar nicht erst ab, sondern fragte: »Gab es irgendetwas, das dir besonders am Herzen gelegen hat? Irgendein ... ein Ring oder etwas in der Art?«
»Nein. Wenn schon, dann würde ich eher auf ihre Krimisammlung tippen, weil sie weiß, wie sehr ich die geliebt und verschlungen habe.«
»Oh, das würde bedeuten, dass du ein Paket mit den gesammelten Werken von Agatha Christie in Empfang nehmen darfst«, sagte er.
»Da irrst du dich, mein Lieber. Wenn, dann ist es ihre Sammlung Maigret-Krimis. Die haben ihr immer besonders gut gefallen«, betonte Nathalie. »Allein schon, weil Kommissar Maigret ziemlich natürlich wirkt. Meine Tante hielt Poirot immer für einen aufgeblasenen Schnösel.«
»Aber immerhin sind sie beide Franzosen«, warf Glenn auf gut Glück ein, wurde aber sofort eines Besseren belehrt.
»Maigret ist Franzose, aber der Schöpfer der Figur kommt aus Belgien. Poirot ist Belgier, aber die Autorin ...«
»... ist Engländerin«, führte er den Satz zu Ende. »Das ist schon ein bisschen verwirrend.« Er verdrehte die Augen. »Wieso eigentlich nur Krimis? Warum hast du von ihr nichts anderes zu lesen bekommen?«
»Tante Henrietta hat immer gesagt, dass Lesen und vor allem das Lesen von Krimis den analytischen Teil des Gehirns fördert.«
»Dann bist du der lebende Beweis dafür, dass sie recht hatte. Sonst wärst du heute vielleicht keine Statistikerin und hättest nicht einen so guten Posten bei deiner Werbeagentur.« Er schaute auf seine Armbanduhr. »Wann will der Notar dich sehen?«
»Ich soll so bald wie möglich einen Termin vereinbaren«, antwortete sie und hielt den Brief so, dass ihr Freund die erwähnte Passage lesen konnte. »Morgen früh rufe ich ihn an, dann weiß ich hoffentlich bald mehr.«
Glenn nickte und stand auf. »Okay, dann werde ich mich jetzt auf den Heimweg begeben.«
»Jetzt schon?«, fragte sie und griff nach seiner Hand, um noch einen Moment seine Nähe zu genießen.
»Morgen früh will dieser Heizungsmonteur zwischen sieben und acht nach dem Heizkörper im Bad sehen«, erklärte er. »Du weißt, ich würde lieber hier übernachten, aber wenn ich mir vorstelle, wie früh ich dann aufstehen muss, um auch garantiert um sieben Uhr zu Hause zu sein, dann kann ich gleich wach bleiben.« Nach einer kurzen Pause fügte er zögerlich an: »Natürlich hätten wir solche Probleme nicht, wenn du zu mir ziehen würdest ...«
Nathalie atmete seufzend durch. »Ich weiß. Aber ich liebe nun mal meine kleine gemütliche Wohnung und ... na ja ...«
»So ungemütlich ist meine Wohnung nun auch wieder nicht«, wandte er ein.
»Du weißt, ich mag diese Fensterfront nicht. Nur Glas von oben bis unten und von Wand zu Wand, und dann dieses alberne Verbot eurer Eigentümervertretung, kein Sideboard und kein Regal und kein gar nichts ans Fenster zu stellen, nur weil die ›Ästhetik‹ verletzt wird.«
»Es heißt ja, dass der Architekt das Haus im nächsten oder übernächsten Jahr verkaufen will«, sagte er beschwichtigend. »Wenn er raus ist, werden die anderen nicht länger zu jedem seiner skurrilen Vorschläge Ja sagen. Dann wird sich einiges ändern, das kannst du mir glauben.«
Nathalie lächelte ihn an. »Wollen wir’s hoffen. Ich habe nämlich auch keine Lust, dass das mit dem Übernachten ständig so weitergeht. Und dass einer von uns abends doch noch nach Hause fahren muss – so wie du jetzt.«
»Vielleicht kann ich ja auch in den sauren Apfel beißen und meine Wohnung verkaufen, und dann suchen wir uns ganz woanders in der Stadt etwas, das für dich gemütlich genug und für mich immer noch nüchtern genug ist, um kein Problem damit zu haben«, schlug er grinsend vor.
Nathalie lächelte ihn an, schlang die Arme um seinen Hals und gab ihm einen Kuss. »Das ist doch mal ein Vorschlag, der sich sehen lassen kann. Wehe, du machst einen Rückzieher«, warnte sie ihn, und ihre Augen leuchteten schelmisch.
Glenn sah ihr tief in die Augen. »Würde mir nicht im Traum einfallen«, sagte er und erwiderte den Kuss, dann stand er auf und nahm seine Sachen an sich.
Nachdem er gegangen war, räumte Nathalie die Briefe zusammen, legte die wichtige Post auf den Sekretär neben der Tür und brachte die Werbung in die Küche, wo sie im dreigeteilten Abfalleimer im Fach für Altpapier landete. Sie ging ins Badezimmer, um sich die Zähne zu putzen und zu duschen.
Als sie sich abtrocknete, betrachtete sie sich im Spiegelschrank über dem Waschbecken. Ja, diese neue Frisur stand ihr gut, fand sie. Bis vor Kurzem hatte sie die Haare noch schulterlang getragen, aber irgendwie nie genug Volumen in die Frisur bekommen, um wirklich zufrieden mit ihrem Aussehen zu sein. Durch die fast glatt herunterhängenden dunkelblonden Haare hatte ihr Gesicht viel schmäler gewirkt, was wiederum ihre Nase viel zu groß hatte erscheinen lassen. Dank ihrer neuen Pixie-Frisur wurde der Blick nicht automatisch auf ihre Nase gelenkt, sondern mehr auf ihre vollen Lippen und vor allem auf ihren schlanken, langen Hals, den sie als junges Mädchen gehasst hatte. Er war bereits in die Höhe geschossen, als der Rest ihres Körpers noch lange kein Interesse daran gezeigt hatte, an Länge zuzulegen.
»Giraffe« war einige Jahre lang ihr Spitzname gewesen – bis der Rest ihres Körpers endlich nachzog, wobei vor allem ihr Busen besonderen Eifer an den Tag gelegt hatte. Dadurch war sie für die Jungs mit einem Mal sehr interessant geworden, aber die »Giraffe« hatte sie keinem von ihnen verzeihen können, und so war ihnen allen eine Abfuhr gewiss gewesen.
Sicher, Glenns Blick bei ihrer ersten Begegnung hatte auch ihrem Ausschnitt gegolten, aber der war an jenem Abend auch deutlich zu tief geraten gewesen, weil sich unbemerkt zwei Knöpfe ihrer Bluse verabschiedet hatten. Sie konnte ihm seinen Blick also nicht verübeln, zumal er sich nicht zu einer anzüglichen Bemerkung hatte hinreißen lassen, sondern im Gegenzug sein Hemd aufgeknöpft und ihr seine muskulöse Brust mit den Worten »Jetzt sind wir quitt« präsentiert hatte. Damit war das Eis gebrochen gewesen, und sie waren sich nähergekommen und schließlich ein Paar geworden.
Eigentlich erstaunlich, da er zumindest äußerlich so gar nicht ihr Typ war. Zumindest hatte sie das geglaubt, doch bei ihren Versuchen, Argumente gegen eine Beziehung mit Glenn zu finden, hatte sie irgendwann einsehen müssen, dass sie eigentlich nicht so recht wusste, wer ihr Typ war. Glenn bediente mit seinen nach hinten gekämmten, gegelten schwarzen Haaren und dem Dreitagebart eigentlich diverse Klischees, die für einen oberflächlichen, eitlen Mann sprachen. Aber die Art, wie er über diese Klischees und damit über sich selbst lachen konnte, war ein deutlicher Beweis dafür, dass er eigentlich ganz anders war. Sie hatte ihn in der gemeinsamen Zeit als aufmerksamen, liebevollen Mann erlebt, der ihr nicht aus Berechnung jeden Wunsch von den Augen ablas – oder weil er jeden Gefallen in Sex umrechnete und entsprechende Erwartungen an sie hatte. Nein, er tat diese Dinge für sie, weil er es wollte, ganz ohne Hintergedanken.
Nathalie zog ihr Nachthemd an, verließ das Badezimmer und machte eine letzte Runde durch die Wohnung, um sich zu vergewissern, dass Türen und Fenster geschlossen und alle elektrischen Geräte ausgeschaltet waren. Nachdem sie sich ins Bett gelegt hatte, ließ sie den Tag mit Glenn Revue passieren.
Etwas ließ sie nicht einschlafen. Etwas, das sie nicht näher bestimmen konnte. Es hatte mit ... es hatte mit Glenn zu tun? Sie stutzte, weil ihr ein solcher Gedanke durch den Kopf ging. Was hatte er denn getan? Hatte er etwas falsch gemacht? Nachdenklich schüttelte sie den Kopf. Es hing mit irgendetwas zusammen, was er an diesem Abend gesagt oder nicht gesagt hatte. Hm, das war nicht so einfach, schließlich gab es unendlich viel, was er nicht gesagt hatte. Nein, das stimmte so auch nicht. Es musste um eine Sache gehen, über die sie heute Abend geredet hatten. Es war ... es war ... ja, genau ... es ging um die Sache mit der Wohnung.
Es war ihr schon einmal sauer aufgestoßen, aber auch damals hatte sie vergessen, ihn darauf anzusprechen. Seit davon die Rede war, dass sie doch zusammenziehen sollten, hieß es immer nur, sie möge doch zu ihm ziehen. Dass er vielleicht auch zu ihr hätte ziehen können, davon hatte er noch nie gesprochen.
Ja, natürlich war seine Wohnung größer als ihre, aber sie war so ungemütlich, dass sie morgens kaum schnell genug das Weite suchen konnte, wenn sie bei ihm übernachtete.
Zugegeben, er machte es genauso, wenn er die Nacht bei ihr verbrachte, aber dann fühlte sie sich zumindest da wohl, wo sie war. Außerdem wusste er, wie unbehaglich ihr in seinen vier Wänden zumute war, weil sie so kühl und nüchtern wirkten. Trotzdem wollte er sie bei sich haben.
Mit einem Mal hatte sie das Gefühl, dass sich die Sache mit der Wohnung noch zu einem echten Problem auswachsen würde. Sie atmete ein paar Mal tief durch und schloss die Augen. Vielleicht lösten sich ja alle Probleme, wenn sie nur lange genug die Augen zukniff.
Zwei Tage später
Es war kurz nach drei am Nachmittag. Nathalie saß in einer der vielen Liverpooler Starbucks-Filialen und wartete auf Glenn. Von ihrem Platz aus konnte sie schräg gegenüber den Cavern Club sehen, der mit dem echten Cavern Club und den ersten Auftritten der Beatles außer dem Namen nichts gemein hatte. Das aber kümmerte die Touristen nicht, die ihre Kameras und Smartphones auf die Tür gerichtet hielten, als wären McCartney und Kollegen genau da früher ein- und ausgegangen.
Wäre nicht diese Pilgerstätte in Sichtweise gewesen, hätte Nathalie theoretisch in jeder anderen Starbucks-Filiale irgendwo auf der Welt sitzen können. Ihr fehlte das kleine Café gleich um die Ecke, das vor über einem Jahr seine Pforten hatte schließen müssen, weil die Betreiberin keinen Gewinn mehr gemacht hatte. Nathalie sowie einige andere waren bis zum letzten Tag treue Stammgäste geblieben, doch es hatte nicht gereicht. Vielleicht hätte die alte Miss Tuckham ihren Kaffee in Pappbechern zum Mitnehmen anbieten sollen, vielleicht hätte sie statt schwarzem Kaffee siebenunddreißig verschiedene Variationen kredenzen sollen, bei denen Kaffee nur eine von vielen Zutaten war – und vielleicht hätte sie auf ihre köstlichen Buttercremetorten verzichten und stattdessen Donuts, Muffins und Co. anbieten sollen. Vielleicht. Aber vielleicht hätte sie dann damit tatsächlich ihre Seele verkauft, so wie sie es immer gesagt hatte. Das Ende ihres Cafés nach dreiundvierzig erfolgreichen Jahren hatte Miss Tuckham nur um wenige Monate überlebt.
Sollte nächste Woche diese Starbucks-Filiale schließen, würde es keinen Menschen kümmern, weil mindestens drei andere Filialen keine fünf Gehminuten von hier entfernt waren. Lieber hätte Nathalie diese unpersönliche Kette gemieden, aber woanders gab es nun mal keinen guten Kaffee.
»Ist hier noch frei?«, fragte jemand mit einer Stimme, die an Kermit den Frosch erinnerte. Als sie sich umdrehte, grinste Glenn sie breit an.
Lachend zeigte sie auf den Platz ihr gegenüber. »Nur, wenn du aufhörst, so zu reden.«
»Lässt sich einrichten«, sagte er und setzte sich hin. »Was trinkst du da?« Er zeigte auf ihre Tasse.
»Kaffee. Schwarz. Ohne alles.«
Glenn stutzte. »Darf man hier so was überhaupt bestellen? Oder sind die Automaten kaputt?«
»Nein, ich ... ich wollte mich nur einstimmen«, antwortete sie.
»Einstimmen? Worauf denn?«, fragte er verwundert.
»Auf das einfache Leben.«
»Ich glaube, du musst schon ein bisschen mehr erzählen, wenn ich dir folgen können soll.«
Nathalie nickte. »Das hatte ich auch vor. Ich wollte dich nur erst mal ein bisschen neugierig machen.« Sie trank einen Schluck von ihrem Kaffee, während Glenn eine der vielen Spezialitäten des Hauses bestellte und die Kellnerin anwies, fettarme Milch aufzuschäumen und alles an echtem Zucker durch Süßstoff zu ersetzen. Dann drehte er sich mit seinem Stuhl wieder Nathalie zu, und sie fragte: »Du weißt doch, dass Tante Henrietta in Earlsraven dieses Lokal besaß, diese Kombination aus Pub, Imbiss, Pension und Café?«
»Ja«, bestätigte er. »Du hast davon erzählt, und wir wollten immer mal zusammen hinfahren, aber irgendwie hat das nie geklappt.«
»Leider«, sagte sie nachdenklich, da ihr zum ersten Mal bewusst wurde, dass sie ihre Tante nicht mehr in ihrem Lokal besucht hatte, seit sie Glenn kannte. Gesehen hatten sie sich nur, wenn Henrietta Nathalies Eltern besuchte, weil sie Zeit mit ihrer Schwester verbringen wollte. Aber die paar Male in den letzten gut zwei Jahren, bei denen sie Glenn vorgeschlagen hatte, einen Ausflug nach Earlsraven zu unternehmen, war immer irgendetwas dazwischengekommen – mal etwas Berufliches, mal Freikarten für irgendein Konzert. Und jetzt ... jetzt war es zu spät, denn jetzt würde Glenn keine Gelegenheit mehr bekommen, ihre Tante kennenzulernen.
»Was ist mit dem Pub? Oder Café?«, fragte er.
»Du wirst es nicht glauben«, redete sie weiter. »Tante Henrietta hat mir das Black Feather vermacht.«
»Was? Ist das dein Ernst?«, rief Glenn ungläubig.
»Ich konnte es im ersten Moment selbst nicht fassen.«
»Und ... und ... was wirst du machen? Nimmst du das Erbe an?«, hakte er nach. »Oder hast du es etwa schon angenommen? Das hast du nicht getan, oder? Bei solchen Objekten muss man sich erst mal ein Bild machen, wie die finanzielle Situation aussieht. Du kannst dir nicht ein Erbe aufbürden, auf dem eventuell ein paar Hunderttausend Pfund Schulden lasten. Oder das komplett saniert werden muss. Oder das auf einer alten Giftmülldeponie steht und nächste Woche vom Bulldozer plattgemacht wird. Oder ...«
»Langsam, Glenn«, fiel sie ihm ins Wort. »Ich habe das Erbe natürlich nicht sofort angenommen ...«
»Gut, sehr gut.«
»... aber ich habe es auch nicht sofort ausgeschlagen.«
»Okay.«
»Ich weiß Bescheid«, fuhr Nathalie fort. »Ich weiß, dass man ein Erbe erst einmal darauf prüft, ob es überhaupt irgendetwas abwirft oder ob man gleichzeitig eine millionenschwere Schadenersatzklage miterbt, die gegen einen entschieden wird. Ich habe studiert, ich kann Bilanzen und Steuererklärungen lesen und verstehen, Glenn.« Ungewollt wurde ihr Tonfall ein wenig ärgerlich.
Glenn sah sie erstaunt. »Schatz, das war nicht gegen dich gerichtet. Das ... das war ein Reflex. Seit damals ein guter Freund von mir gedankenlos ein Erbe angenommen und am Ende seine eigene Firma verloren hat, weil er auf einmal Schulden über Schulden am Hals hatte, reagiere ich etwas allergisch, wenn ich das Wort Erbe höre.«
»Keine Angst, ich habe nicht angenommen«, wiederholte sie. »Mr Orson ...«
»... der III. ...«, warf Glenn ein.
Sie nickte kurz. »... hat mir erklärt, dass im Black Feather noch ein Umschlag liegt, in dem die Bedingungen aufgelistet sind, die ich erfüllen muss, wenn ich das Lokal übernehmen will.«
»Hm? Warum kannst du das nicht sofort erfahren?«, wunderte er sich und nickte der Bedienung zu, die ihm ein kleines Kaffeekunstwerk hinstellte.
Nathalie konnte nur mit den Schultern zucken und damit die Geste nachahmen, mit der der Notar auf genau diese Frage reagiert hatte. Er selbst war zwar auch im Besitz eines zweiten Umschlags, aber den durfte er wiederum erst öffnen, wenn sie zum Black Feather gefahren war und den dort deponierten Umschlag abgeholt und geöffnet zu ihm gebracht hatte.
»Ich weiß es nicht, aber ich vermute, das ist so was wie ein persönliches Abschiedsgeschenk. Seit sie damals das Black Feather übernommen hatte, haben wir uns nicht mehr ganz so oft gesehen, aber davor hat sie mit mir von klein auf solche Spielchen getrieben – na ja, es waren keine Spiele im eigentlichen Sinn, es waren eher kleine Rätsel und Denkaufgaben, um mein Gehirn rotieren zu lassen. Du weißt schon, solche Aufgaben, bei denen man dreimal um die Ecke denken muss.«
Glenn lehnte sich nach hinten und verdrehte die Augen. »Oh Gott, du meinst solche Geschichten, bei denen dir erzählt wird, wie viele Leute an jedem Bahnhof ein- und aussteigen, und wenn du alles fleißig mitgerechnet hast, kommt dann die Frage, wie oft der Zug angehalten hat, richtig?«
»Ja, zum Einstieg so was, aber dann wurde das Niveau um ein Vielfaches gesteigert.« Sie trank ihren Kaffee aus und schob die Tasse weg. »Auf jeden Fall muss ich nach Earlsraven, damit ich weiß, was für Bedingungen das sind.«
»Kannst du nicht da anrufen und darum bitten, dass dir jemand den Umschlag schickt?«, schlug er vor.
»Geht nicht«, verneinte sie. »Ich muss den Empfang quittieren, und dann wird meine Unterschrift zum Notar gefaxt.«
Einen Moment lang dachte Glenn angestrengt nach. »Man könnte dir die Quittung rüberfaxen, du unterschreibst und faxt sie zurück, und dann wird sie von da aus an den Notar geschickt. Dann kann dir der Umschlag zugesandt werden, und du kannst dich ganz in Ruhe mit dem Inhalt befassen.«
Sie schüttelte den Kopf. »Glenn, ich will hinfahren. Ich suche nicht nach irgendwelchen Ausflüchten, um mir den Weg dahin zu ersparen. Das Black Feather war seit Jahren das Ein und Alles meiner Tante. Wenn sie es ausgerechnet mir vermacht, aber nicht meinen Eltern, dann ist das Mindeste, was ich im Gegenzug tun kann, hinzufahren, es mir anzusehen und mir den Umschlag aushändigen zu lassen. Außerdem liegt Earlsraven nicht am Ende der Welt. Wir haben keine tagelange Fahrt vor uns.«
»Schon okay, Nathalie.« Beschwichtigend hob er die Hände. »Ich will dich nicht davon abhalten, zum Lokal zu fahren und herauszufinden, was es mit diesen Bedingungen auf sich hat. Ich hatte nur eben den Eindruck, dass du lieber nicht hinwillst. Du warst so ..., ich weiß nicht so recht ... Es kam mir so vor, als würde dir nur kein brauchbares Argument gegen eine Fahrt zum Black Feather einfallen.«
Die Kellnerin kam an den Tisch und wollte Kaffee nachfüllen, aber Nathalie lehnte dankend ab und hielt vorsorglich eine Hand über die Tasse. So gern sie auch herkam, um einen guten Kaffee zu genießen, so wenig hatte sie für die Methoden übrig, mit denen versucht wurde, den Umsatz in die Höhe zu treiben. Dazu gehörte auch dieses unaufgeforderte Nachfüllen einer leeren Tasse mit schwarzem Kaffee, ganz ohne Rücksicht darauf, welche Sorte man zuvor getrunken hatte, und vor allem ohne einen Hinweis darauf, dass man für diesen »Nachschlag« fast zwei Pfund bezahlen sollte. Sie war sich nicht sicher, ob das überhaupt den unzähligen Vorschriften entsprach, die jemand zweifellos beachten musste, wenn er eine Starbucks-Filiale führen wollte. Hätte sie ein eigenes Café, würde sie niemals ... Moment mal, sie hatte ja ein Café. Jedenfalls so gut wie.
Zugegeben, da waren noch diese Bedingungen, die mit dem Erbe verknüpft waren, aber wie schlimm konnten die schon sein? Ihre Tante würde bestimmt nicht von ihr verlangen, dass sie den Dorfältesten heiratete und ihm vier Kinder schenkte. Und sie würde auch sicher nicht irgendwelche extremen Leistungen wie die Durchquerung des Ärmelkanals von ihr fordern.
Nein, das würden irgendwelche ganz harmlosen Dinge sein, zum Beispiel, dass sie niemals die Senfmarke wechseln durfte oder dass sie drei bestimmte Gerichte unbedingt auf die Speisekarte nehmen sollte.
»Was hältst du davon, wenn wir am Samstag hinfahren?«, fragte Nathalie spontan.
»Du meinst den nächsten Samstag? Den in ... drei Tagen?«
»Ja, den meine ich.« Bis vor dreißig Sekunden hatten sie für das Wochenende noch keine Pläne geschmiedet, und es musste ja schon mit dem Teufel zugehen, wenn in den nächsten fünf Sekunden noch etwas auftauchen sollte. Oder in zehn Sekunden. Oder in zwanzig und mehr. So lange brauchte Glenn, um auf ihre Frage zu antworten. Nach einer scheinbaren Ewigkeit nickte er schließlich.
»Okay, können wir machen«, erklärte er und nickte noch einmal bekräftigend. »Schwebt dir eine bestimmte Uhrzeit vor?«
Nathalie verzog den Mund. »Früh. Vielleicht gegen acht Uhr? Ungefähr drei Stunden werden wir für die Strecke brauchen, dann sind wir mit einer Pause spätestens gegen Mittag da. Auf diese Weise kann ich mir auch gleich ein Bild davon machen, wie viel Gäste zur Mittagszeit da hingehen.«
»Alles klar, dann statten wir am Samstag deinem Möglicherweise-Erbe einen Besuch ab«, stimmte er ihr zu. »Das wird bestimmt unterhaltsam werden.«
»Das will ich hoffen«, gab sie etwas ernster zurück. »Es würde mir gar nicht passen, wenn ich da aufkreuze, den ganzen Laden unter die Lupe nehme und feststelle, dass ich ihn sofort schließen und alle Angestellten entlassen muss, weil die ganze Bude schon längst hoffnungslos in den roten Zahlen steckt.«
»Ich glaube nicht, dass das die Überraschung ist, die deine Tante für dich vorgesehen hat«, beteuerte Glenn.
»Ich glaube es ja auch nicht«, entgegnete Nathalie. »Sie hätte bestimmt nicht das Lokal so viele Jahre lang erfolgreich geführt, nur um drei Tage vor ihrem Tod die Überschuldung zu bemerken. Da bin ich mir völlig sicher. Aber es widerstrebt mir, mich einfach auf das zu verlassen, was die Logik sagt. Weißt du, es ist nicht so, als wollte ich meiner Tante etwas unterstellen. Aber was soll ich tun, wenn ich das Erbe blindlings annehme, und am nächsten Tag stellt sich irgendein Igor oder ein Mister Chang bei mir vor, um mir zu enthüllen, dass die Russen- oder die Chinesenmafia so nett war, meiner Tante mit ... sagen wir mal ... dreißigtausend Pfund unter die Arme zu greifen, um das überschuldete Lokal zu retten?«
»Warum sollte irgendeine Mafia so etwas tun?«, fragte Glenn verdutzt. »Die haben doch Besseres zu tun.«
»Vielleicht haben sie es auf das Grundstück abgesehen«, sagte sie. »Vielleicht wollen die Jungs da ein Luxushotel hinsetzen. Du weißt, die Mafia ist kein gemeinnütziger Verein, die verfolgt nur eigene Interessen. Die leihen meiner Tante das Geld, sie geht darauf ein, und nach vier Raten heißt es auf einmal: ›Wir müssen unser Geld morgen zurückbekommen, sonst gehört uns dieses hübsche kleine Häuschen.‹«
»Theoretisch wäre das wohl möglich«, räumte er ein. »Aber ich glaube, deine Tante hätte noch ganz schnell ihr Testament geändert, um dich vor so etwas zu bewahren.«
»Wie gesagt, ich will es hoffen«, wiederholte Nathalie. »Aber du weißt ja: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.«
Zweites Kapitel, in dem Nathalie ein Wiedersehen mit der Vergangenheit erlebt
»Da vorn ist es«, sagte Glenn und warf einen Blick auf die Uhr im Armaturenbrett. »Kurz vor halb zwölf. Das geht ja noch. Damit sind wir knapp unter drei Stunden geblieben.«
»Aber auch nur, weil uns heute kein Berufsverkehr in die Quere kommen konnte«, erwiderte Nathalie. »Unter der Woche würde das wohl nicht klappen.«
Sie waren zum größten Teil über die Autobahn gefahren, die zu beiden Seiten von Bürobauten gesäumt wurde. Dort, wo früher Kleingärten gehegt und gepflegt worden und kleine Handwerksbetriebe zu Hause gewesen waren, wo Fabriken gestanden hatten, gab es nun kaum noch etwas anderes als kühle, kantige Klötze aus Stahl und Glas. Sie sahen sich zum Verwechseln ähnlich und unterschieden sich auch inhaltlich nicht sehr voneinander, siedelten sich in den Neubauten doch fast nur Unternehmen an, die in irgendeiner Weise mit dem Internet zu tun hatten. Unternehmen, deren Mitarbeiter sich besonders fortschrittlich und umweltbewusst gaben, indem sie E-Bikes, Segways oder Elektroautos fuhren.
Der Anblick dieser Bauten stimmte Nathalie jedes Mal aufs Neue melancholisch. Sie war offen für neue technische Entwicklungen, das war gar keine Frage. Und doch hing sie auch an alten, lieb gewonnenen Dingen – und wenn es nur die Autowerkstatt um die Ecke war, in der auf engstem Raum jeder fahrbare Untersatz instand gesetzt wurde, ohne dass man dafür ein Vermögen ausgeben musste. Dass sie in einer solchen Werkstatt nicht von einer modisch gekleideten Empfangsdame mit einem Cappuccino und einem kleinen Teller Feingebäck empfangen wurde, sondern von einem Mann mit rotem Gesicht und zerzaustem Haar, mit Overall und ölverschmierten Händen, das machte ihr nichts aus. Alles war besser als diese durchkonzipierten Erlebniswelten, bei denen eine Reklamation mit einem aufgesetzten Lächeln entgegengenommen, dann aber ohne jede Reaktion zu den Akten gelegt wurde.
Erst als sie nur noch gut fünfzig Meilen bis zu ihrem Ziel zu fahren gehabt hatten, hatte sich die Kulisse links und rechts der Straße spürbar verändert. Sie waren auf eine gut ausgebaute Landstraße übergewechselt, die auf einigen Abschnitten, ähnlich wie eine Autobahn, vierspurig ausgebaut und aus Sicherheitsgründen mit einer Mittelleitplanke versehen worden war.
Zu beiden Seiten erstreckte sich die vertraute und geliebte Landschaft aus sanften grünen Hügeln und Wäldern. Hier und da grasten auf den weitläufigen Wiesen Schafherden, die auf die große Entfernung nur als gräulich-weißes Gewusel zu erkennen waren.
Die Region rund um Earlsraven, die offiziell den wenig reizvollen Namen Dead Crows Yard trug, war, aus nördlicher Richtung kommend, so etwas wie das Vorzimmer von Cornwall, nur dass hier alles ein wenig urtümlicher wirkte, nicht so auf Hochglanz poliert wie Cornwall selbst. Natürlich konnte der Landstrich nichts dafür, aber auf Nathalie wirkte die bei Touristen in aller Welt so beliebte Ecke Englands weitestgehend uninteressant. Hätte sie nur ein paar Beispiele dafür liefern müssen, was die beiden Regionen so gravierend voneinander unterschied, wäre sie jegliche Antwort schuldig geblieben. Etwas Greifbares gab es nicht zu nennen, und sie konnte ihre persönliche Abneigung gegen Cornwall nur damit erklären, dass sie es nie gemocht hatte, dass alle Welt dorthin fuhr, um Urlaub zu machen, dabei aber Earlsraven und die vielen anderen Ortschaften links liegen ließ.
Der besondere Reiz dieser hügeligen Landschaft lag für Nathalie darin, dass man immer das Gefühl von Ruhe und Abgeschiedenheit hatte, auch wenn das nächste Dorf gleich hinter der Hügelkuppe lag, die einem auf angenehme Weise die Sicht versperrte. Wenn man mit dem Auto oder auch nur mit dem Fahrrad unterwegs war, konnte man den Nachbarort innerhalb von wenigen Minuten erreichen, und selbst zu Fuß waren die meisten Strecken nicht sehr lang, wenn man ausgiebige Spaziergänge gewöhnt war. Man befand sich also nie wirklich am Ende der Welt, aber wenn man wollte, konnte man sich so fühlen.
Sie fuhren an dem wenig schmucken Ortsschild von Earlsraven vorbei.
»Hm«, machte sie. »Hier erwartet man eigentlich ein uraltes Holzschild mit verschnörkelten Buchstaben, das an zwei kurzen Ketten aufgehängt ist und leise knarrt, wenn es von einer Windböe bewegt wird.«
Glenn schüttelte leicht den Kopf und grinste vor sich hin. »Solche Gedanken würde ich eigentlich nicht von einer Frau erwarten, deren Fachgebiet Statistik ist.«
Sie zog eine Augenbraue hoch und ließ den Anflug eines Lächelns erkennen. »Und welche würdest du erwarten?«
»Na, du weißt schon«, erklärte er. »Eine Auflistung, wie viele Leute hier leben, wie alt sie im Durchschnitt werden, wie das Pro-Kopf-Einkommen ist und so weiter. Die nüchternen Fakten halt.«
Nathalie lachte. »Das ist mein Beruf, aber du weißt, dass ich den im Büro lasse, wenn ich Feierabend mache.«
»Nicht so ganz«, erwiderte Glenn.
»Wie meinst du das?«, fragte sie verwundert und ein wenig erschrocken. Sie war sich sicher gewesen, dass sie zu Hause nicht viel von ihrer Arbeit erzählte.
Glenn lächelte sie verschmitzt an. »Ich weiß, das ist dir nicht bewusst, aber es gibt Tage, an denen kaum ein Satz vergeht, den du nicht mit ›statistisch gesehen ...‹ beginnst.« Er zwinkerte ihr zu. »Ist nicht als Kritik gemeint, Liebes, und du sollst dir das auch nicht zu Herzen nehmen. Ich will damit nur sagen, dass du deinen Job schon mit Leib und Seele machst.«
»Na ja, das stimmt«, pflichtete sie ihm bei. »Aber das war mir gar nicht bewusst.« Sie schüttelte flüchtig den Kopf und beschloss, künftig trotzdem darauf zu achten, diese Formulierung zu vermeiden. Auch wenn sich Glenn nicht daran störte, tat sie es doch umso mehr.
Sie zeigte nach vorn. »Da, wo die Straße einen Knick nach rechts macht, musst du scharf links abbiegen.«
Sie folgten der leichten Rechtskurve, bis Glenn den kleinen Wegweiser entdeckte, der auf das »Dorfzentrum« aufmerksam machte. Während er Gas wegnahm, fiel sein Blick auf eine lang gestreckte Parkbucht gleich hinter der Abzweigung, und dann sah er auch das Schild »Parken nur für Gäste des Black Feather«.
»Aber da ist doch ...«, begann er und stellte den Blinker wieder ab.
»Ja, das schon, aber du musst hier abbiegen«, fiel Nathalie ihm nachdrücklich ins Wort, da sich die Abzweigung unerbittlich näherte und sie zu schnell sein würden, um in die enge Straße abbiegen zu können. »Ich kenn mich hier aus!«
Irritiert sah Glenn sie kurz an, dann musste er härter abbremsen als gewollt, da er sonst tatsächlich die Abzweigung verpasst hätte. Nathalie klammerte sich am Griff über der Beifahrertür fest, damit sie nicht gegen Glenn rutschen und ihn beim Lenken behindern konnte.
»Himmel, das ist ja fast so, als würde man in eine Haarnadelkurve fahren«, brummte er.
»Wo wolltest du hin?«, fragte sie verwundert. »Ich hatte doch gesagt, dass du hier einbiegen sollst. Warum hast du wieder Gas gegeben?«
»Weil wir genau vor dem Black Feather abgebogen sind«, erwiderte er. »Zwanzig Meter weiter hätte ich auf den Parkplatz abbiegen können. Ich weiß nicht, warum wir hier lang fahren sollen. Hier ist doch überhaupt nichts.«
Tatsächlich war nichts zu sehen, zumindest nichts außer meterhohen Hecken, die so dicht waren, dass man auf keiner Seite der schmalen Straße erkennen konnte, was sich dahinter verbarg.
»Glenn, ich weiß, wie wir fahren müssen«, versicherte Nathalie ihrem Freund geduldig. »Ich war hier schon ein paar Mal.«
»Aber da vorn war doch der Parkplatz ...«, beharrte er.
»Das ist der Parkplatz auf der Pub-Seite, von dem aus kannst du nur wieder auf deine Fahrbahn zurückkehren. Du kannst da nicht wenden, weil die Stelle zu unübersichtlich ist. Das heißt, du musst an Earlsraven vorbeifahren und der Straße noch wer weiß wie viele Meilen folgen, bevor es eine Gelegenheit gibt, um zu wenden. Da geht es nur noch mit Kurven weiter, bei denen du bis zum letzten Moment nicht sehen kannst, ob da jemand entgegenkommt.« Sie machte eine Geste hin zu der schmalen Straße, die durch die hohen Hecken heute noch genauso beengend auf sie wirkte wie bei ihrem ersten Besuch im Black Feather vor vielen, vielen Jahren.
»Dann ist das nur der Parkplatz für Durchreisende?«
Sie nickte.
»Und was machen die Leute, die aus der Gegenrichtung kommen und anhalten wollen? Die können doch auch nicht wenden, und selbst wenn, müssten sie anschließend in die falsche Richtung weiterfahren.«
»Die parken auf der gegenüberliegenden Seite und gelangen über eine Holzbrücke zum Black Feather.«
»Eine Brücke?« Er stieß einen anerkennenden Pfiff aus. »Der Laden muss ja eine wahre Goldgrube sein. Da kannst du dir das beste Kaufangebot herauspicken.«
»Sofern ich überhaupt verkaufen will«, gab sie zurück und merkte, dass Glenn angesichts ihrer Antwort stutzte. Aber was er in diesem Moment eigentlich erwidern wollte, sollte sie nicht erfahren, da ihnen aus der nächsten Kurve wie aus dem Nichts ein Linienbus entgegengeschossen kam, der ihren Freund zu einem hastigen Ausweichmanöver zwang. Dabei geriet sein Range Rover mit den linken Rändern auf den Grünstreifen am Fahrbahnrand. Wütend und doch erleichtert, dass nichts passiert war, schimpfte Glenn dem Bus hinterher.
Sie fuhren weiter. Zur Linken zweigte eine Straße ab, und mit ihr endete auch die hohe Hecke. Der Blick wurde freigegeben auf einen gemütlichen kleinen Marktplatz mit einer Handvoll Verkaufsständen. Eingerahmt wurde der Platz von einem Karree aus Bäumen, die vor vielen Jahrzehnten gepflanzt worden sein mussten. Zumindest erweckten die imposanten Gewächse diesen Eindruck, die zum Teil die Sicht auf die malerischen Häuser zu drei Seiten des Platzes verdeckten. Im Vorbeifahren konnte Nathalie den Metzger, die Boutique und den Pub erkennen.
Dann musste sie sich auch schon wieder auf die Straße konzentrieren und sagte zu Glenn: »Da drüben musst du rechts abbiegen.«
»Ich weiß«, murmelte er und grinste sie flüchtig an. »Mir ist das Schild nicht entgangen, das uns den Weg weist.«
Tatsächlich befand sich vor der flachen Mauer, die den Garten des Eckhauses umgab, eine in Schwarz gehaltene Tafel, auf die mit einer feinen weißen Linie die Konturen einer Feder gezeichnet waren, darunter stand in einem unauffälligen Beige-Ton der Name »Black Feather« geschrieben.
Die Straße, die zum Lokal führte, war ungewöhnlich breit, was auch Glenn auffiel. »Seltsam«, murmelte er. »Das müsste doch eigentlich genau so eine Gasse sein wie die beiden linken Abzweigungen.«
»Das war es auch mal«, entgegnete Nathalie. »Aber dann kamen immer mehr Gäste zum Lokal, und dadurch entstand hier ein solches Chaos, dass Tante Henrietta den Hausbesitzern auf beiden Seiten jeweils einen Streifen von einem Meter Breite abgekauft hat, um der Gemeinde zu ermöglichen, hier eine zweite Fahrspur einzurichten.«
Während sie sich dem Ende der Seitenstraße näherten, konnte Glenn nur ungläubig dreinschauen. »Und das ... das haben ... das haben alle mitgemacht? Oder haben die Anwohner den Preis noch schnell in die Höhe getrieben?«
»Soweit ich weiß, ist das alles friedlich und einvernehmlich abgelaufen«, sagte sie. »Auf dem Umweg über die Gemeinde profitieren ja auch alle von den Steuereinnahmen des Lokals. Hätten sie damals nicht der Verbreiterung zugestimmt, wäre es in der Straße hier regelmäßig zum Verkehrsinfarkt gekommen. Wer zweimal in so etwas gerät, der wird nicht versuchen, ein drittes Mal das Black Feather anzusteuern, sondern ein anderes Ziel wählen.«
»Kann ich gut verstehen«, pflichtete Glenn ihr bei. »Das spricht aber doch auch dafür, dass das Lokal bestens laufen muss. Sonst hätte sie nicht so viel Geld ausgeben können.«
»Stimmt schon, Glenn, aber ein Geschäft kann nach außen hin den Eindruck machen, dass da alles bestens läuft, während im Hintergrund immer neue Kredite aufgenommen werden, um bestehende Schulden zu tilgen. So was kann lange Zeit gut gehen, und auf einmal kommt der große Knall, und es ist Schluss.«
»Warum bist du so pessimistisch?«, fragte er.
»Ich bin nur realistisch«, betonte sie. »Ich sage nicht, dass alles ganz übel ausgehen wird. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht.«
Oder kam da mal wieder die Statistikerin in ihr durch? Nathalie beschloss, dass das in diesem Fall vielleicht nicht das Schlechteste war. Entzückt sah sie aus dem Fenster und bewunderte einmal mehr diese grandiosen und bis ins Detail liebevoll gestalteten Gärten, die sie noch von früheren Besuchen her kannte. Zu gern hätte sie sich genauer umgesehen und sich die Namen der zahlreichen Blumen nennen lassen, die mal wild durcheinander, mal nach Farben sortiert blühten. Bislang war so etwas nie möglich gewesen, da ihre Besuche – ob bereits allein oder noch gemeinsam mit ihren Eltern – immer Henrietta gegolten hatten, aber nicht den wildfremden Menschen, die links und rechts von ihr wohnten.
Sie kamen am Ende der Straße an und fanden den Parkplatz, an den eine Wiese und dann die Terrasse angrenzten. Dahinter erhob sich fast majestätisch das eigentliche Gasthaus, ein lang gestrecktes Fachwerkhaus, das in seinem ursprünglichen Zustand belassen worden war: Weiß verputzte Flächen wurden eingerahmt von schwarz gestrichenen Holzbalken, die in einem komplexen Muster angeordnet waren, das sich über die ganze Fassade, vom Erdgeschoss bis in den zweiten Stock, erstreckte. Fast willkürlich waren Fenster überall dort eingesetzt worden, wo das Geflecht aus Balken es zuließ. Beim Anblick hätten vermutlich viele jüngere Architekten die Augen entsetzt abgewandt, dabei war es gerade diese Individualität, die den Charme eines solchen Bauwerks ausmachte.
Obenauf saß ein spitz zulaufendes Satteldach mit dunkelgrauen Schindeln und einer ganzen Batterie an Schornsteinen, die an ein Hexenhäuschen aus einem Kinderbuch erinnerte. Links vom Hauptgebäude befand sich der verschachtelte Anbau, der über die Jahrzehnte hinweg immer wieder mal erweitert worden war, um Platz im Haus zu schaffen. In diesem Wirrwarr, das einem unwissenden Betrachter wie wahllos aufeinandergestapelte riesige Kartons vorkommen musste, befanden sich unter anderem die Wohnung ihrer Tante sowie ausgelagerte Teile der Küche und der Backstube, da die vorhandenen Räumlichkeiten längst nicht mehr ausreichten, um der Besucherscharen Herr zu werden.
Nathalie wusste, auch diese Tatsache sprach dafür, dass das Black Feather auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken konnte und es eigentlich mit keinerlei Risiko verbunden sein dürfte, das Lokal zu übernehmen. Andererseits hielt sie sich auch vor Augen, dass schon weltweit arbeitende Konzerne plötzlich gestrauchelt waren, bei denen niemand auch nur einen Penny auf einen baldigen Konkurs gewettet hätte.
Nein, ihr Entschluss stand fest, und daran würde sich auch nichts ändern. Sie würde dieses Erbe auf Herz und Nieren prüfen, um Gewissheit zu haben, dass sie die richtige Entscheidung traf. Eine überhastete Zusage konnte schließlich zur Folge haben, dass sie für den Rest ihres Lebens Schulden abzahlen durfte, die sie nie angehäuft hatte.
Nathalie betrachtete versonnen das Gebäude. Sie hatte es geliebt, seit sie als kleines Mädchen die Ferien bei ihrer Tante verbracht hatte. Jetzt war dieser Traum zum Greifen nahe, aber sie würde sich noch zurückhalten müssen. Ein paar Tage noch, und dann wusste sie, ob sie hierbleiben oder nach Liverpool zurückkehren würde.
»Der Laden scheint ja von selbst zu laufen«, merkte Glenn an, nachdem sie ausgestiegen waren. »Wenn man den Trubel hier sieht, möchte man gar nicht glauben, dass deine Tante tatsächlich tot ist.«
»Tante Henrietta hatte ein gutes Gespür, was Geschäftliches anging«, bestätigte Nathalie und drückte die Wagentür zu. In dem Moment flog eine Amsel meckernd an ihr vorbei und landete auf der niedrigen Hecke, die vor den Stellplätzen verlief. Dort blieb sie sitzen, zuckte mit den Flügeln und beschwerte sich lautstark über irgendetwas. Nathalie betrachtete den hübschen schwarzen Vogel mit dem leuchtend orangefarbenen Schnabel.
»Was ist das? Ein Minirabe?«, fragte Glenn amüsiert.
Nathalie drehte sich verdutzt um. »Ernsthaft?«
Er zuckte mit den Schultern. »Raben sind doch schwarz.«
Sie schüttelte den Kopf. »Glenn, hast du noch nie eine Amsel gesehen?«
»Ist das eine?«, fragte er zögerlich und verzog den Mund. »Na, jedenfalls freut sie sich offenbar, dich zu sehen.«
»Sie freut sich nicht«, betonte Nathalie. »Sie regt sich über etwas auf. Bestimmt schleicht hier irgendwo eine Katze rum.«
»Aha«, machte er und schien zu warten, dass Nathalie noch irgendetwas sagte.
Dazu war sie allerdings zu verdutzt, weil sie gedacht hätte, dass Glenn sich mit Tieren zumindest ein wenig auskannte. Andererseits war er in der Stadt aufgewachsen, und im Urlaub waren seine Eltern früher mit ihm ans Meer gefahren. Am Strand und im Wasser war er da allenfalls ein paar Möwen begegnet, woher sollte er also eine Amsel kennen? Obwohl ... die Amsel war nun sicher kein Exot unter den heimischen Vögeln.
Für Nathalie genügte ein Blick, und sie wusste bei der Mehrzahl der Vögel, wen sie da vor sich hatte. Als Kind hatte sie viel Erfahrung sammeln können, da ihre Eltern gleich neben einer Tierarztpraxis gewohnt hatten. Jedes Jahr im Frühling, wenn die Brutzeit angefangen hatte, kamen Dutzende von Leuten in die Praxis, um aus dem Nest gefallene Vögel abzugeben, die sie irgendwo am Straßenrand gefunden und mitgenommen hatten, um sie vor den unzähligen Gefahren zu bewahren.
Von klein auf war Nathalie mit großem Eifer ans Werk gegangen, um reihenweise junge Spatzen, Meisen, Amseln und unzählige andere Arten mit Aufzuchtfutter, Brei, Eigelb und toten Insekten zu füttern. Anfangs hatte sie das nur gemacht, wenn sie nach dem Unterricht in die Praxis hinüberging, aber nach einer Weile hatten sich ihre Eltern einverstanden erklärt, dass Nathalie die kaum gefiederten Pflegekinder mit nach Hause nahm, um sich besser um sie kümmern zu können.
Es war ein zeitraubende Arbeit gewesen, und sie hatte deshalb oft auf gemeinsame Unternehmungen mit ihren Freundinnen verzichten müssen, aber sie stand noch heute dazu, dass jeder gerettete Vogel, der später in die Freiheit entlassen werden konnte, dieses vergleichsweise unbedeutende Opfer wert gewesen war.
Seit sie allein lebte und ihre Wohnung näher an der Innenstadt lag, hatte sie zum einen keine Zeit mehr, rund um die Uhr einen Jungvogel zu versorgen, zum anderen gab es in der Umgebung so wenige Bäume, dass sie schon seit einer Ewigkeit keinen Vogel mehr gefunden hatte. Sollte es doch einmal vorkommen, konnte sie heutzutage wenigstens über das Internet schnell eine Pflegestelle finden.
Sie gingen weiter, immer noch verfolgt vom Zetern der Amsel, aber eine Katze konnte Nathalie auf Anhieb nirgends entdecken.
Als sie die ersten Tische hinter sich gelassen hatten und Nathalie sich ein Bild von deren Anordnung und von den Wegen vom Lokal auf die Terrasse gemacht hatte, musste sie sich zusammenreißen, keine der beiden Bedienungen anzusprechen. Sie war hier nicht die Chefin – jedenfalls noch nicht –, aber der kurze Blick auf die Abläufe hatte sie erkennen lassen, dass die jungen Frauen eigentlich mehr umherliefen als erforderlich. Ein, zwei kleine Änderungen würden ihnen die Arbeit spürbar erleichtern.
Hey, du bist hier nicht im Büro, ermahnte sie sich lautlos, aber es half nichts. Sie war noch nicht mal richtig angekommen und machte sich schon Gedanken darüber, wie sich die Arbeitsabläufe optimieren ließen.
Natürlich konnte das Black Feather mit Café und Pub im Erdgeschoss und Fremdenzimmern im ersten und zweiten Stock den modernen Hotels keine ernsthafte Konkurrenz machen, dafür war alles viel zu altmodisch und zu beengt, aber gerade das machte für viele Reisende den besonderen Reiz aus, sonst hätte die Pension nicht einen solchen Zulauf verbuchen können. Hier gab es auf den Zimmern einen Lichtschalter, eine Steckdose und im Winter einen Dreierstecker für einen mobilen Heizkörper, und das war dann auch schon alles. Kein Fernseher, kein Telefon, kein Zugang zum Internet. Dafür Blümchentapeten, natürlich leicht angegilbt, knarzende Betten, schwere dunkle Möbel, versehen mit kunstvollen Schnitzereien und Einlegearbeiten, Deckenlampen aus elfenbeinfarbenem Milchglas, die nur trübes Licht verbreiten konnten, und verschossene Teppiche auf dem nackten Holzboden, der kaum einen Schritt unkommentiert ließ.
Das Einzige, was störte, war der Funkmast auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Entweder war es dem Landwirt egal gewesen, wie sehr der Mast auf seiner Weide die Landschaft verschandelte, oder er hatte so dringend das Geld benötigt, dass er einen solchen Schandfleck in Kauf nahm. Vielleicht aber hatte die Telefongesellschaft ja auch ein besonders großzügiges Angebot vorgelegt, denn ohne den Mast wäre vermutlich in ganz Earlsraven und Umgebung kein Handyempfang möglich gewesen.
Und doch: Es musste dieses Urtümliche, dieses Einfache sein, das sogar Autofahrer auf der Durchreise dazu verleitete, in Earlsraven anzuhalten und im Black Feather Rast zu machen oder sogar über Nacht zu bleiben.
Unwillkürlich fragte sich Nathalie, ob es überhaupt möglich war, irgendwelche Neuerungen einzuführen, ohne die bisherige Kundschaft zu verprellen. Interessant wäre auch eine statistische Auswertung, wie groß der Anteil der Stammkunden war und wie die Altersstruktur sich darstellte. Welche Gruppe fühlte sich vom Black Feather besonders angesprochen, welche überhaupt nicht? Und wie ... »Schluss jetzt«, murmelte sie, als ihr auffiel, in welche Richtung ihre Gedanken mit ihr davongaloppieren wollten.
»Hast du was gesagt?«, fragte Glenn, der neben ihr stand und das Gebäude betrachtete.
»Wie? Oh, nein, nein, nicht so wichtig«, sagte sie. »Meine Gedanken hatten sich nur selbstständig gemacht.«
»Okay«, meinte er und deutete auf das Haus. »Es sieht wirklich gut aus. Ich glaube, es ist völlig egal, aus welchem Winkel man das Gebäude fotografiert, die Kaufinteressenten werden so oder so Schlange stehen.«
»Falls ich verkaufe«, wandte sie sofort ein. »Lass mich erst mal herausfinden, welche Bedingungen ich laut Testament noch erfüllen soll. Danach sehen wir weiter. Wenn das völlig absurde Forderungen sind, werde ich ablehnen und das Erbe ausschlagen.«
»Du hast doch gesagt, dass deine Tante dir am ehesten irgendein Um-drei-Ecken-Rätsel hinterlassen haben dürfte, das du lösen sollst«, hielt Glenn dagegen. »Mal bloß nicht den Teufel an die Wand.«