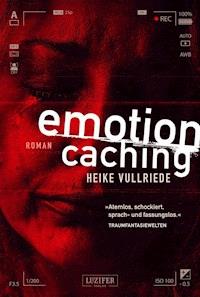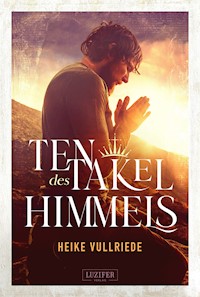
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Jan Torberg ist ein arroganter einsamer Mistkerl. Nach dem Selbstmord seines Vaters erbt er viel Geld und ein Marketingunternehmen. Doch weder die Firma noch das Geld interessieren ihn. Viel spannender findet er die »Kirche des Lichts«, in der seine Eltern zu seiner Überraschung in den letzten Jahren ihres Lebens Mitglied waren. Als er deren charismatischen Anführer kennenlernt, gerät er immer tiefer in einen gefährlichen Sog aus Vergötterung und Gewalt. Heike Vullriede, die mit ihren Romanen immer wieder ganz bewusst provokante oder unpopuläre Themen anschneidet, beleuchtet in »Tentakel des Himmels« die Strukturen und nicht selten auch persönlichkeitsverändernden Mechanismen innerhalb von Sekten und Kulten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tentakel des Himmels
Impressum
Deutsche Erstausgabe Copyright Gesamtausgabe © 2022 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Lektorat: Manfred Enderle
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2022) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-655-9
Sie lesen gern spannende Bücher? Dann folgen Sie dem LUZIFER Verlag aufFacebook | Twitter | Pinterest
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Im Grunde wusste er um die Aussichtslosigkeit seiner Flucht. Kai war nicht naiv genug, es zu leugnen. Der Gedanke an eine mögliche Rettung schuf eine dünnhäutige Verzweiflungsblase in seinem überlebenshungrigen Hirn – der Instinkt eines Primaten, eines Fluchttieres – das eigene Fleisch war zu retten, um jeden Preis. Trotz dieser Erkenntnis fuhr er weiter in die Dunkelheit hinein. Weil man es nicht wahrhaben will, weil man eben doch hofft, entgegen jeder Vernunft. Dabei hätte er es sich so einfach machen können: Stehenbleiben, aussteigen, auf der Straße die Arme ausbreiten, und sich erschießen lassen … oder was sie sonst mit ihm vorhatten. Dann wäre es schnell vorbei gewesen und er hätte seine Ruhe gehabt – endlose Ruhe. Aber nein, er fuhr immer weiter, mit dem Reisepass in der Innentasche seiner Jacke.
Dabei verdiente er nicht einmal die heißbegehrte Rettung, auch das wusste er. Gäbe es eine übernatürliche Gerechtigkeit, die nur annähernd an menschliche Vorstellungen heranreichte, würde sie ihn niemals so davonkommen lassen. Egal, wie bitter er seine Untaten jetzt bereute.
Ein weiteres Mal huschten Kais Augen auf das Abbild im Rückspiegel über ihm. Die Scheinwerfer eines nachfolgenden Wagens, die ihm eben noch Schweißausbrüche bereitet hatten, als wären sie die bösen Augen eines seelenfressenden Dämons, folgten ihm seit der letzten Kreuzung nicht mehr. Wenig erleichtert atmete er auf. Jetzt also noch nicht. Noch hatte er sein Leben.
Er überlegte, ob er Gott dafür danken müsste. Verächtlich schnaubte er vor sich hin. Gott? Ha! Mit einem Ruck legte er den nächsten Gang ein. Immer, wenn er an Gott dachte, sah er den sehr menschlichen Rücken eines großen, weiß gekleideten Mannes vor sich, der sich von einer Schar aufopferungsvoller Jünger anbeten ließ – diesen scheinheiligen Scheißkerl, von dem er sich hatte einwickeln lassen und für den er gelogen, betrogen und sogar gemordet hatte. Ja, er war ein Mörder – ein hinterhältiger Mörder. Einer, der andere verfolgt und ihnen das Leben genommen hatte. Einer, der jetzt selbst auf der Flucht war, vor noch skrupelloseren und grausameren Mördern, als er es war. Immerhin, in diesem abgründigen Sumpf aus Ausbeutung, Korruption und Gewalt gab es schlimmere Menschen als ihn. Das stimmte ihn versöhnlich, auch wenn ihm ein irdischer Richter das vermutlich nicht angerechnet hätte.
Die Tankanzeige meldete Reserve. Das hieß, er musste unausweichlich die abgelegene Landstraße verlassen, auf der er sich versteckter wähnte; von der er hoffte, dass sie ihn dort nicht suchen würden. So viele Umwege zum Flughafen konnten sie unmöglich einplanen. Im Display blinkte es bereits. Warten half nichts, er musste sich beeilen. Welche Tankstelle hatte um diese Uhrzeit und in dieser öden Gegend überhaupt geöffnet? Für einen Moment überlegte er, ob er den Wagen im angrenzenden Wald stehen lassen und in einer einsamen Pension des nächsten Kaffs unterschlüpfen sollte. Wahrscheinlich würden sie ihn so nah gar nicht vermuten. Von dort aus würde er Lara irgendwann wiedersehen können. Lara, die er zurücklassen musste, im Schoß der falschen Kirche. Die er nicht mitnehmen konnte auf seine Flucht, weil sie ihm niemals geglaubt hätte. Also hatte er ihr alles verschwiegen. Niemand gab ihm das Recht, ihr ideales Weltbild zu zerstören, indem er ihr die Wahrheit angetan hätte, über all die falschen Weisheiten und Versprechungen … und über sich. Ihr junges Leben war ohnehin schon verdorben. Er sollte sie in Ruhe lassen. Mochte sie glauben, was sie wollte. Manchmal war es besser, die Wahrheit nicht zu sagen.
Vor ihm tauchte wieder eine größere Kreuzung auf. Kai verwarf den Gedanken, in einem Dorf zu übernachten, und bog ab in Richtung Bundesstraße.
Er fuhr noch lange durch die Nacht, bis er die nächste Tankstelle ansteuerte – schwitzend, übermüdet und doch aufgekratzt – gerade rechtzeitig, bevor der Balken der Tankanzeige vollends am Anschlag kratzte. Ein paar Minuten blieb er direkt neben der Zapfsäule hinter dem Lenkrad sitzen und spähte aus sämtlichen Fenstern seines Wagens. Dann schüttelte er den Kopf über sich selbst. Jeder Idiot erkannte in ihm einen Flüchtigen. Auffälliger konnte er sich gar nicht benehmen.
Beklommen stieg er aus und sah sich um. Alles schien unauffällig. Eine der Lampen über ihm brummte, aus dem Kassenhaus drang leise Musik, und von irgendwo her erklang der Schrei eines Nachtvogels, was ihm so vorkam, wie das heimliche Signal eines Prärieindianers zum Angriff. Er nahm den Zapfhahn und tankte. In der übrigen Finsternis rund um das beleuchtete Dach der Tankstelle fühlte er sich wie eine fleischgewordene Zielscheibe. Verdammt, so konnten sie ihn problemlos von ein paar Metern Entfernung aus abknallen, ohne, dass er zuvor auch nur einen Schatten von ihnen wahrgenommen hätte. Niemand wusste das besser als er selbst. Unwillkürlich spannte er die Bauchdecke an, in der Erwartung, jederzeit von Kugeln zerrissen zu werden.
Das Benzin kroch quälend langsam durch den Schlauch. Klack! Kai riss den tropfenden Hahn aus der Tanköffnung, presste den Deckel auf das Loch, und lief ins Kassenhaus. Misstrauisch beäugte er den jungen Kassierer, während der auf die Tasten tippte. Sah er nicht aus wie jemand, den er kannte? Hatte er ihn schon einmal in einer der Kirchen des Lichts gesehen? Als er bezahlte, versuchte er, heimlich einen Blick auf den Hals des kräftigen jungen Mannes zu werfen. Was er suchte, war ein Amulett, ein Anhänger mit dem Symbol einer strahlenden Sonne. Zwar trug sein Gegenüber eine silberne Kette, aber was daran hing, versteckte sich wohlbehütet im Ausschnitt des dicken Pullovers. Der Junge hielt ihm das Restgeld hin und lächelte freundlich belanglos, wie es routinierte Verkäufer tun.
»Stimmt so!«, murmelte Kai und er eilte nach draußen, den Autoschlüssel einsatzbereit in der Hand.
Vor der Tür des Kassenhauses sah er sich um, obwohl er ja doch nichts in der Umgebung ausmachen konnte. Dann schritt er zügig auf sein Auto zu. So schnell wie möglich würde er wieder eine dieser verborgenen Landstraßen anfahren, auf denen er sich sicherer glaubte, obwohl es vermutlich nur ein trügerisches Gefühl war. Bevor er die Fahrertür erreichte, bemerkte er etwas vor ihm im Inneren seines Wagens – eine Bewegung, ein Schemen auf dem Beifahrersitz. War es wirklich so oder bildete er sich das bloß ein? Sein Herz führte einen zügellosen Tanz auf. Was nun? Allen Mut zusammennehmen und nachsehen? Oder lieber gleich flüchten? Obwohl er sich kalt fühlte, eisig geradezu, schwitzte seine Stirn heiße Tropfen. Sollten sie ihn tatsächlich jetzt schon aufgespürt haben? Nicht einmal vier Tage nach seiner Androhung, auszusteigen?
Er musste einen klaren Kopf bewahren.
Nachsehen, mach es so kurz wie möglich, keine Kurzschlussreaktion jetzt, beschloss er, auch wenn ihm mehr nach Flüchten zumute war.
Wieder war da dieser unsinnige Schimmer Hoffnung, der inmitten seines Hirnwassers schwappte und der ihn mit dem Glauben an eine Chance überflutete. Vielleicht umspülte er ihn deshalb, weil Kai meinte, dieses eine Mal etwas ethisch Wertvolles zu tun. Diese Verfolgung, das alles hier, hatte er sich selbst eingebrockt. Er hätte sich die ganze Angst ersparen können. Aber nein, er musste ja dem Gottkönig in einem Anfall unfassbarer moralischer Stärke dessen Abscheulichkeit um die Ohren schleudern. Nun musste er da durch. Er selbst hatte an diversen Rückholaktionen Abtrünniger, und somit Verrätern, teilgenommen. Dass manch einer von denen weder zurückkehrte, noch dort ankam, wohin er flüchten wollte, war mehr als einmal seinem eigenen fragwürdigen Verdienst geschuldet gewesen. Warum sollte er annehmen, dass es ihm anders ergehen könnte? Wie konnte er damals nur glauben, alles würde gut gehen, als der Padre ihn einfach so aus seiner Kirche spazieren ließ? Was hatte er sich nur dabei gedacht? Zögernd und mit Rauschen in den Ohren näherte er sich der Wagentür, in dem Wunsch, bloß ein Opfer seiner Angst zu sein. Doch drei Schritte vor dem Fahrzeug starrte ihn aus seinem eigenen Autofenster das Gesicht eines Mannes an, das er kannte, dessen aalglatte, nach hinten gegelten Haare im Licht der Tankstellenbeleuchtung verräterisch glänzten. Die rechte Hand Gottes! Wie gelähmt blieb Kai stehen, den Autoschlüssel in die Handfläche gekrallt. In diesem Moment spürte er eine Luftbewegung im Nacken, die ihm die Haare aufstellte. Kai riss den Kopf herum, sah die Faust des Kassierers auf sich zukommen und bückte sich instinktiv, um auszuweichen. Der Schlag verfehlte ihn. Er kämpfte mit seinem Gleichgewicht, hielt sich gerade noch, sodass er nicht fiel. Mit einem Schrei aus Angst und Schreck warf er sich gegen den Oberkörper seines Widersachers, mehr, um an ihm vorbeizurennen, als ihn umzuwerfen. Sie landeten beide auf dem Boden. Der Brustkorb des Jungen war hart und stieß in Kais Rippen, das Kinn traf ihn schmerzhaft am Jochbein. Kai stöhnte auf, kam auf die Knie und fasste sich ins Gesicht. Im Augenwinkel bekam er mit, wie der Mann aus dem Wagen stieg und langsam auf ihn zuschritt, während der andere sich vor ihm aufrichtete. Kai befahl seinen Beinen, aufzustehen. Taumelnd mühte er sich um Bewusstsein. Dann stieß er die beiden von sich, rannte los, kopflos, ohne nachzudenken. Weg von hier, nach vorn, ins Dunkle, immer weiter, bis in ein Maisfeld hinein, wo er über seine Füße stolperte und sich wieder aufraffte. Ganz so, wie es seine eigenen Opfer getan hatten, denen er gefolgt war. Ob ihm jemand hinterherlief, hörte er nicht. Zu laut pulsierte es in seinem Kopf. Vor ihm sah er nur die Dunkelheit und er spürte das Kratzen der Maisblätter auf seiner Haut, die er blind mit den Armen abzuwehren versuchte. Er rannte, griff orientierungslos in die Finsternis und fasste nach den umknickenden Halmen, als könnten sie ihm helfen.
Auf einmal war all das weg. Seine Beine trugen ihn nicht weiter und die Welt um ihn herum wurde noch schwärzer als zuvor. Sie hielten ihn von hinten fest. Die Flucht endete hier. Es wurde ihm sofort klar. Der Schimmer von Hoffnung in seinem Kopf verglimmte wie auf einem sich krümmenden Docht. Das war das Ende. Auf sein Gesicht legte sich etwas – ein kalter Film, den er mit dem eigenen Atem an Mund und Nase ansog und der auf seinen unbedeckten Augäpfeln kleben blieb. Kai zog nach Luft, wollte das Ding von seinem Kopf lösen, das sie ihm übergezogen hatten, aber sie hielten auch seine Hände fest. Mit aufgerissenem Mund lechzte er nach Sauerstoff, doch er behielt immer nur diese Folie im Mund, statt Luft zu bekommen. Sein Brustkorb schmerzte. Seltsam, jetzt dachte er an Lara – wie sehr er sie liebte und dass er sie vermisste und wie gern er sie in die Arme nehmen würde. Genau jetzt wusste er, warum er all das riskiert hatte: Nicht, weil er ein besserer Mensch geworden war – nein, weil er es nicht mehr ertragen konnte, sie zu belügen. Und nun tauchte sie im Geist vor ihm auf und lächelte ihn an, so nah, als könnte er sie berühren. War das ein Teil seines Lebens, das an ihm vorbeizog, wie es geschehen soll, bevor man stirbt? Aber er sah gar nicht sein gesamtes Leben vor sich, sondern nur Lara, wie sie ihn anlächelte mit ihrem verklärten Blick und jetzt wollte sie ihn küssen … doch dann gewann die Wirklichkeit. In den Ohren knisterte es bei jedem Atemversuch. Es war nicht einmal mehr Platz für ein Geräusch des Röchelns von ihm selbst. Gierig kämpfte seine zusammengefaltete Lunge um jeden Millimeter Ausdehnung. Es fühlte sich an, als wollten die Lungenflügel in ihrer Qual implodieren. Ihm wurde schwindelig … immer mehr … der Schmerz ließ nach, verschwand, und er merkte noch, wie er zu Boden sackte.
Teil 1
Der Friedhof
Eine Mischung aus Moder und Unkrautvernichter drängte sich in Peter Torbergs Nase, wie jedes Mal, wenn er das alte gusseiserne Tor aufschob. Den Geruch verband er mit dem Tod, mit der Beerdigung seiner Frau, und dem Dahinsiechen am Ende ihres Lebens. Er hasste diesen Beigeschmack des Todes, darum ließ er auf ihrem Grab Lavendel anpflanzen. Zumindest in Sommerzeiten maskierte der Duft der Staude den Mief des Friedhofs.
Welke Buchenblätter übersäten jetzt den feinen Schotterweg unter seinen Halbschuhen. Vom Nebel gehauchte Wasserperlen auf Schaft und Vorderkappe ließen das glänzende Leder rau aussehen. Nach ein paar Metern vereinten sich die braunen Blätter auf dem Weg mit den Resten von Nadeln und Zweigen einer vor Tagen geschnittenen Eibenhecke. Dahinter verbargen sich volle Abfallcontainer und Gartengeräte. Durch eine Lücke der mannshohen Einhegung konnte man die Gerätschaften erkennen. Für einen Moment verlor dort die Friedhofsatmosphäre das Stille und Andersartige. Peter schritt langsam vorbei, die kalten Hände in den Taschen seines schwarzen Dufflecoats vergraben. Das Gefühl, belauert zu werden, beschlich ihn angesichts der Hecke. Ob sie ihm bis hierher gefolgt waren? Er zögerte kurz, dann kehrte er um und zwang sich, zwei Meter in die grüne Einfriedung einzutauchen, um sich zu vergewissern. Nichts, auch kein verdächtiges Geräusch. Offensichtlich teilte keine einzige lebendige Seele die Einsamkeit mit ihm und alle anderen hier waren stumm, taub und blind.
Er setzte seinen Weg fort, noch immer schwanger mit der unangenehmen Ahnung, versteckte Augen könnten ihn beobachten. Peter passierte einige Grabsteine ihm unbekannter Toter, deren Namen er ungewollt mit jedem seiner zahlreichen Besuche mehr verinnerlichte. Sicher auch deshalb, weil er sich gern mit dem Lesen der Inschriften ablenkte, bevor er die Grabstätte erreichte.
Da lag sie. Claudia Torberg, geboren 14. Dezember 1960, gestorben 26. Mai 2018. Die Lavendelblütenstängel zeigten sich inzwischen entblößt, ihr Duft war am Anfang des Herbstes mit den vertrockneten Hülsen verflogen. So biss der Gestank der Friedhofsmischung weiter in seine Geruchsgänge und hielt den Gedanken an den alles umgebenden Tod aufrecht. Unwillkürlich malten sich Bilder in seinem Kopf. Nicht nur von ihrem ausgemergelten Leib vor dem Ende und vom wachsblassen Anblick des aufgebahrten Leichnams. Peter quälte die Vorstellung der fortschreitenden Verwesung, die Claudias dünne Haut im Sarg mehr und mehr zersetzte.
Es war früh am Morgen und noch immer dämmerig. Die Luft stand wie ein bewegungsloser Schleier. Feuchte Kälte kroch von unten in seine Hosenbeine. Eine Krähe hüpfte von Claudias Grabstein auf das Nebengrab, als sie ihn kommen sah. Die Mahnung seiner Großmutter fiel ihm ein, die ihn als Kind hatte schaudern lassen. Springe nie über Grabsteine, sonst greifen die Toten mit ihren Händen nach dir! Die beneidenswerte Krähe dachte sicher weder an den Tod noch daran, dass Claudia sie in die Erde ziehen könnte.
Sie hatten gekämpft, gemeinsam, zwei Jahre lang. Und wie! Nichts ließen sie unversucht, jede noch so kleine Chance ergriffen sie. All das blieb fruchtlos.
Peter legte eine frische rote Rose auf den polierten Marmorstein und wischte mit einem Taschentuch und Speichel den Vogelmist der Krähe weg.
»Du wolltest dich Gott zuwenden und verlorst dich in den Fängen eines abgöttischen Tentakels«, flüsterte er. »Und ich machte alles mit. Warum nur haben wir die wenige Zeit nicht anders genutzt?«
Wie konnten sie beide sich nur derart verlieren. Ein Geistlicher und Wunderheiler – was für ein Schwachsinn. Doch damals schien es ihnen die letzte verheißungsvolle Hoffnung gegen Claudias Krebs zu sein. Der charismatische Vater, der Padre, wickelte sie in ein Gespinst aus falschen Versprechungen ein. Peter hatte immer gedacht, so etwas könnte ihm nicht passieren. Ein Mann wie er entschied nicht mit dem Bauch, sondern mit dem Kopf. Zuerst sah er zerknirscht dem Handauflegen des Gottgleichen zu. Sie wollte es unbedingt und sie glaubte daran. Sollte er ihr das verbieten? Als Claudia aber nach all dem Heilfasten und Beten unerklärlich auflebte, weinte er vor Freude und vergaß alle Vernunft. Sie ahnten ja nichts von dem umwerfenden Placeboeffekt, den allein der Glaube an Heilung bewirken konnte. Vielleicht wollten sie es auch einfach nicht wissen. Für diesen Humbug hatte er Geld gespendet, viel Geld. Das halbe Vermögen aus seinem Unternehmen verschenkte er. Dann ließ er sich auch noch überreden, in Gesellschaften dieser Kirche zu investieren … Er hätte es besser der gescheiterten Existenz seines Sohnes hinterherwerfen können, denn man hatte sie betrogen. All die verlogen hingeworfenen Hoffnungsschimmer stahlen ihnen nur Zeit. Der Onkologe sagte später, mit einer palliativen Chemotherapie hätte sie noch Jahre lebenswert verbringen können.
Nun war Claudia für immer fort, viel früher als nötig. Weil er sein Denkvermögen eingebüßt hatte. Wertvolle Zeit war ihnen verloren gegangen. Wochen auf Sylt vielleicht oder sogar auf Neuseeland. Sie hätten all die Dinge genießen können, die sie schon immer erleben wollten. Die eigene Blödheit hatte es verhindert, das war das Schlimmste.
Zu der Wut und der Scham gesellte sich der finanzielle Verlust. Nicht einmal einen Teil des Geldes gaben sie ihm zurück. Selbst seine hartnäckige Drohung, die Forderung über Gerichte klären zu lassen, ließ sie kalt. Ihr Einfluss reichte erschreckend weit. Bereits die dritte Anwaltskanzlei, die er fragte, hatte den Fall abgelehnt und auf andere verwiesen. Einzig die Androhung eines Interviews mit der überregionalen Zeitschrift Weltenecho brachte Unruhe in die Sektenführung. Seitdem bedrohten und verfolgten sie ihn, seit Wochen nun schon. Er sah sich um. Bestimmt lauerten sie auch hier. Gab es da nicht auch den alarmierenden Fall von Kai Holzmann, dem Geschäftsführer einer der Gesellschaften? Er war verschollen, gerade dann, nachdem er Peter gegenüber angedeutet hatte, die Sekte zu verlassen. Was für ein Sumpf aus Lügen und Sünden. Nicht Gott lenkte die Sekte, der Teufel war es.
Doch inzwischen war es ihm fast egal. Peters Motivation, das durchzustehen, versank wie bei jedem seiner Friedhofsbesuche in der Trauer um Claudia. Rache? Wozu? Seine Frau kam dadurch nicht zurück. Ihm blieb nur die Einsamkeit. Er hatte einen Sohn. Der vegetierte als obdachloser Künstler in Berlin. Jan wusste nicht einmal, woran seine Mutter verstorben war, geschweige denn, unter welchen Umständen. Er hatte nie danach gefragt. Jan und er lebten völlig verschiedene Leben. Ihn anrufen? Es widerstrebte Peter. Nicht nur falscher Stolz hielt ihn zurück. Was sollte Jan denken, wenn er von der Verstrickung in die falsche Kirche erfahren würde? Nach dem Tod von Jans Mutter sehnte Peter sich jeden Morgen und jeden Abend nach einem Lebenszeichen seines einzigen Kindes. Er hatte den Jungen vergrault, ihm zu wenig Liebe gezeigt. Wegen ihm war Jan nach Berlin gezogen, möglichst weit weg von Streit und Verständnislosigkeit. Gern wollte er wieder gutmachen, was er in frühen Jahren verpasst hatte. Peter hatte das Testament geändert. Jan sollte das, was noch übrig war, erben. Nicht als Pflichtteil, sondern alles, was in der Vorversion des Testamentes bereits der Sekte zugedacht war. Und ihn, Jan Torberg Junior, den rebellischsten und dickköpfigsten aller möglichen Söhne, würde der Padre mit noch so großer Scheinheiligkeit niemals beschwatzen können. Peter selbst resignierte inzwischen.
Der Nebel zog seinen milchigen Schleier dichter um ihn. Vom Nebengrab aus starrte ihn die Krähe an und schrie auf, als wollte sie ihn fragen, welchen unheiligen Gedanken er gerade nachhing. Ja, er hatte daran gedacht, die Wartezeit bis zur Vereinigung mit seiner Frau erheblich zu verkürzen und zahlreiche Mittel und Wege abgewogen, die es ihm leicht machen sollten. Zu Hause und im Büro seiner Firma dachte er unentwegt daran, die Lügner aus der Sekte mit allen Mitteln zu bestrafen. Doch dann stand er jedes Mal schwach und wie betäubt vor dem Grab seiner Frau und überlegte, aufzugeben und für immer zu verschwinden – dahin, wo Claudia auf ihn wartete.
Er strich mit dem Zeigefinger über die Rose.
»Ohne dich macht alles keinen Sinn.«
Peter hörte das leise Knirschen von Sohlen auf nassem Schotter hinter sich. Gleich darauf überzog Gänsehaut seinen Nacken, als lägen nur Millimeter zwischen ihm und dem Atem eines fremden Menschen. Man merkt, wenn sich jemand von hinten nähert. Jedenfalls dann, wenn man in gänzlicher Stille verharrt. Da waren sie also, die Schergen des Padre, die Schläger Gottes. Er war sich sicher, doch die Enge seines Geistes im Bann des Grabes hinderte ihn daran, sofort um sich zu schlagen. Erstaunt nahm Peter seine Trägheit wahr, panische Angst zu empfinden. Die musste er gewiss haben, denn warum sonst sollte sich jemand an einsamer Stelle an ihn heranschleichen. An Geister glaubte er nicht, auch, wenn er manches Mal insgeheim auf die Hände seiner Frau hoffte, die ihn zu ihr in die weiche Erde ziehen wollten.
Peter nahm das Rauschen von Kleidung neben sich wahr und spürte eine Hand auf seiner rechten Schulter. Nun begann sein Herz doch, kräftig zu klopfen. Aber er sah sich nicht um, weder nach hinten noch zur Seite. Er starrte ohne zu Zwinkern die Krähe an, die wieder auf Claudias Grab hüpfte. Eine Hand fasste nach seinen Fingern. Sie fühlte sich unecht an, künstlich – nicht so warm wie die Haut eines Menschen. Zwischen seinen Fingern wiederum fühlte er etwas schrecklich Kaltes. Man hob Peters Arm, das Kalte drückte gegen seine Schläfe, sein Zeigefinger krümmte sich, ohne dass er etwas dazu tat. Er ließ es geschehen.
Ich komme, dachte er.
Der Atem neben ihm ging fast lauter und schneller als sein eigener. Dann riss es ihm fast den Kopf weg.
Das Erbe
Tot! Der Alte war tatsächlich tot. Ein leichter Schauder kroch Jan beim Anblick des mächtigen Holzschreibtisches den Rücken entlang, als säße sein alter Herr noch immer dahinter und debattiere mit ihm über Jans ineffektives Künstlerdasein. Dabei musste ineffektiv ja nicht gleichzeitig unproduktiv bedeuten. Aber das hatte seinen Vater nie interessiert. Kunst hatte Hobby zu sein, es sei denn, man wäre berühmt wie van Gogh oder Picasso. Dass auch die sich erst einen Ruf hatten erkämpfen müssen, war für den Alten schon zu viel des Geschwätzes gewesen. Das geldgeile Denken seines Vaters und Jans chaotische Lebenskunst … ein bis zum Ende unbefriedetes Schlachtfeld. Darauf zurückgelassen: nur Verlierer, wie in jedem ordentlichen Krieg.
Nun hatte er seinem Leben selbst ein jähes Ende bereitet. Ein Schuss, aufgesetzt auf die Schläfe, dessen Explosionskraft den Schädel zerfetzte, und dessen Spuren von Rauch und Hirngewebe an der rechten Hand von Selbstmord zeugten. So hatte man es Jan erklärt. Es waren ihm zu viele Details. Nie im Leben hätte Jan mit einer derartigen Tat seines Vaters gerechnet. Doch die Menschen, die seinen Vater besser kannten als er, erzählten etwas anderes. Sie sprachen von tiefer Trauer nach dem Tod seiner Frau, von abwechselnd depressiven und aggressiven Stimmungen.
Eine seltsame Mischung aus Schmunzelnmüssen und Schmerz vibrierte in Jan, während er sinnlos auf das Erscheinen der vertrauten grauhaarigen Gestalt mit den herabhängenden Mundwinkeln hinter dem Schreibtisch wartete. Irgendwie vermisste er ihn doch. Es war etwas Unvollendetes im Abgang seines Vaters. Er hatte etwas übrig gelassen, nicht nur die Marketingfirma mit – bis vor wenigen Tagen – 96 Beschäftigten, nicht nur eine Menge Geld … vielleicht hatte Jan sogar gehofft, seinen Vater doch noch stolz machen zu können, womit auch immer – jedenfalls nicht mit den Fotografien aus seiner betagten Nikon, der Zeichnerei und der Grafittikunst … aber jetzt war es zu spät. Der Alte war weg, verstaut im Grab der Mutter, die womöglich nicht besonders glücklich über die unerwartete Gesellschaft nach den letzten Monaten in Ruhe war.
»Tja, und jetzt wühle ich hier herum und bringe mit Sicherheit alles durcheinander. Ob du das so gewollt hast?«, flüsterte Jan.
Er schritt langsam um den Schreibtisch herum, ließ sich mit seiner seit Wochen nicht gewaschenen Jeans in dem durchgesessenen und speckigen Lederungetüm dahinter nieder und streckte seine langen Beine unter der verkratzten Holzplatte aus. Einen Moment lang wippte er gedankenvoll hin und her. Bald näherten sich seine Fingerspitzen dem Griff der Schublade vor ihm. Privatbereich Vater! Fast spürte er einen Klatsch auf seiner Hand.
Die Tatsache, dass ihm sein Vater trotz allem all das bedingungslos vererbt hatte, wertete Jan als letzten verzweifelten Versuch, den einzigen Nachkommen von der Gosse weg in ein normales Leben zu pressen. Was sollte er mit der Firma? Sie interessierte ihn einen Dreck! Das geerbte Geld reichte, um sich ein bescheidenes Leben lang auf die faule Haut zu legen, ein bisschen Künstler heraushängen zu lassen, Freunde zu kaufen. Er war genügsam, gewohnt, mit wenig auszukommen. Die mangelnde Unterstützung der vergangenen Jahre hatte ihn abgehärtet.
Jan spielte mit dem Knauf der Schublade. Als es in der Stille des Raumes an der Tür klopfte, zuckte er zusammen. Ein junger Mann öffnete, ohne eine Aufforderung dazu abzuwarten, und steckte den Kopf durch den Spalt. Jan erkannte Kemal Akdas, den Rechtsberater seines Vaters. Der Einzige, den er hier überhaupt näher kannte. Nun betrachtete er ihn als Teil der Erbmasse, die man ihm ans Bein gebunden hatte.
»Darf ich hereinkommen?«
Jan nickte wortlos. Der Kerl würde sowieso eindringen, egal, was er antwortete.
Zögernd betrat der Mann mit den ordentlich gekämmten schwarzen Haaren und dem gebügelten Anzug das Chefbüro. In den Händen trug er einen langweilig aussehenden Ordner und eine geöffnete Fächermappe, deren aufgeklappter Zustand Jan an ein gähnendes Maul erinnerte.
Kemal stellte sich vor den Schreibtisch und musterte ihn aus tiefdunklen Augen.
»Ich störe Sie nur ungern …«
»Warum tun Sie es doch?«
Der scharfe Ton seines neuen Chefs ließ Kemals Gesichtszüge entgleisen, aber nur kurz.
»Es gibt ein paar laufende Terminsachen, die geklärt werden müssen und in der Post von heute …«
»Kann das nicht die Zicke im Vorraum erledigen? Wofür habe ich sie?«
Kemal räusperte sich.
»Sie meinen die langjährige Sekretärin Ihres Vaters? Nun, Sie haben der Dame eine Kündigung nahegelegt. Da sie noch offenstehenden Urlaub und eine unendliche Anzahl an Überstunden übrig hatte …«
»Sie ist schon weg? Das ging aber verdammt schnell.«
»Ja, vermutlich hatte sie es damit so eilig, weil Sie ›blöde Schnepfe‹ und ›dämliche alte Schachtel‹ zu ihr sagten, als sie Ihnen gestern die Post bringen wollte. Ich schätze, dass da noch ein arbeitsrechtliches Nachspiel auf Sie zukommt.«
Jan runzelte die Stirn. Da war er wohl etwas voreilig und eine Idee zu wenig empathisch gewesen. Egal, nun war es eben so. Er brauchte keine alte Tante, die sich aufführte wie eine Expartnerin seines Vaters – was sie mit Sicherheit nicht war – und die glaubte, einen Anspruch auf ein besonderes Vertrauensverhältnis Jan gegenüber zu besitzen. Sollte sie doch weggehen, völlig bedeutungslos. Sie war ersetzbar.
»Genauso, wie Sie dem Pförtner gekündigt haben, dem Chefbuchhalter, einer Reinigungsfrau, die Ihnen lediglich mit dem Staubsauger im Weg war, und den beiden Sachbearbeitern aus der Organisationsabteilung. Ach ja, und der Personalchefin, weil sie ein ernstes Gespräch über all diese Kündigungen mit Ihnen führen wollte.«
»Und jetzt haben Sie Angst um Ihren Job?«, raunzte Jan Kemal von unten aus ins Gesicht.
»Nein, wohl kaum.«
»Ach nein?«
»Nein, Sie brauchen mich noch. Jetzt umso mehr.«
»Da sind Sie sich aber ziemlich sicher.«
»Allerdings, irgendjemand muss das Geschäft weiterführen, auch wenn Sie es vermutlich so schnell wie möglich veräußern wollen. Dabei könnte ich Ihnen übrigens behilflich sein.«
»Vielleicht will ich das ja gar nicht.«
Jan bemerkte einen Hauch von Enttäuschung in Kemals Miene. Hatte der Kerl doch wahrhaftig darauf gehofft, ihn derart schnell loszuwerden? Selbstredend überlegte Jan vom Todestag seines Vaters an, das Geschäft zu verkaufen. Nur wusste er nicht einmal, wie er das anstellen sollte, genauso wenig, wie er etwas vom Marketinggeschäft verstand, von Geschäften überhaupt. Er brauchte Kemal tatsächlich. Ein Glück, dass er ihm noch nicht gekündigt hatte.
»Ich bin also nach wie vor Ihr Rechtsberater?«
»Ja, seien Sie stolz darauf.«
»Da das nun geklärt ist, wäre ich froh, wenn wir ernsthaft über Geschäftliches sprechen könnten. Es gibt einen Vorgang, der mir Bauchschmerzen bereitet. Es betrifft ein – wie soll ich sagen – besonderes Unternehmen in Düsseldorf.«
Jan seufzte, es blieb ihm nicht erspart. Nun hatte ihn der Alte da, wo er ihn immer haben wollte.
»Was ist denn so besonders an diesem Unternehmen?«
»Es handelt sich um eine christliche Glaubensgemeinschaft. Sie nennt sich Kirche des Lichts.«
»Eine Kirche? Ernsthaft?«
»Ich weiß nicht, was Sie über die letzten zwei Jahre ihrer Eltern wissen. Ihre Mutter war sehr krank und in dieser Kirche wollte sie wohl so etwas wie Erlösung finden.«
»Ich weiß gar nichts. Mein Vater hielt es nicht für nötig, mich über irgendetwas zu informieren. Von der Krankheit und dem Tod meiner Mutter erfuhr ich erst nach ihrer Beerdigung.« Jan betrachtete das goldgerahmte Foto auf dem Schreibtisch, worauf seine Eltern Arm in Arm am Strand von Juist vor dem Meer posierten.
»Das wussten Sie nicht? Ihr Vater sagte, er hätte Sie in Berlin nicht erreichen können. Er meinte, Sie hätten kein Smartphone und keine Adresse, an die er sich wenden konnte.«
»Oh doch, die hatte er. Ich war in einer WG gemeldet. Jede Nachricht an diese Adresse gerichtet, hätte mich erreicht … zumal in einem Zeitraum von zwei Jahren …«
Ein Kloß in Jans Kehle hinderte die nachkommenden Worte, ausgesprochen zu werden. Dafür hasste er seinen Alten. Für diese Sturheit, nicht einmal in Mutters schlimmsten Zeiten den Kontakt zu ihm gesucht zu haben. Für wie undankbar hatte er ihn eigentlich gehalten? Es wurde ihm bewusst verschwiegen. Selbst bei Jans Weihnachtsanruf im letzten Jahr.
Jan wandte sich dem jungen Mann im Büro wieder zu. Er fand ihn etwas herablassend ihm gegenüber. Wer wusste schon, was sein Vater alles über Jan erzählt hatte.
»Was ist denn nun mit dieser Kirche?«, fragte Jan.
»Das, ich nenne ihn mal Oberhaupt, möchte unser Unternehmen kaufen.«
»Das hier? Sie meinen mein Erbe, die Marketingfirma Peter Torberg GmbH?«
»So ist es. Und an einer Marketinggesellschaft der Kirche sind Sie mit Ihren Anteilen zur Hälfte beteiligt. Ich hatte Ihrem Vater damals übrigens abgeraten, da zu investieren. Wie dem auch sei … der andere Anteilseigner möchte einen neuen Geschäftsführer einsetzen und benötigt Ihre Unterschrift dazu.«
»Das bereitet Ihnen Bauchschmerzen?«
»Nicht die Sache mit dem Geschäftsführer, obwohl … der gilt merkwürdigerweise als verschollen. Aber mich beunruhigt vielmehr dieses Geschäftsfeld. Es ist eine Sekte.«
»Verschollen?«
»Ich lasse Ihnen das Schreiben des Herrn aus Düsseldorf da. Vielleicht schaffen Sie es, sich neben Ihren Kündigungen an die Mitarbeiter und den daraus resultierenden Konsequenzen damit zu beschäftigen.«
»Kemal … ich darf Sie doch beim Vornamen nennen?«
»Wenn es sein muss.«
»Was denken Sie über den Selbstmord meines Vaters? War er wirklich so labil, dass er diesen Schritt gegangen ist?«
»Was sagen Sie denn da? Was soll es denn sonst gewesen sein?«
»Ich weiß nicht, das passte nicht zu meinem Vater. Nicht so, wie ich ihn kannte. Das habe ich den Polizisten auch gesagt.«
»Das hieße im Umkehrschluss, dass er ermordet wurde. Wer sollte so etwas tun? Können Sie sich nicht vorstellen, wie traurig und einsam jemand sein kann, der einen geliebten Menschen verloren hat? Der niemanden sonst mehr an seiner Seite hat, auch nicht den einzigen Sohn, der sich seit Jahren nur noch zu Weihnachten meldet.«
Jan hob den Kopf höher. »Sie werden unverschämt!«
»Ich dachte, Sie wollten meine Meinung hören.«
»Nein, nicht wirklich.«
»Ich arbeite immer noch für Sie?«
»Noch.«
Taxi nach Düsseldorf
Regen, dunkle Wolken, die den gesamten Horizont vereinnahmten, und das monotone Fahrgeräusch – seit Stunden zogen Bäume und Felder am Fenster vorbei. Die Scheibenwischer mühten sich unablässig um klare Sicht auf die unendlich scheinende Straße.
Angesichts dieser düsteren Stimmung und der versackten Haltung auf dem Rücksitz des Taxis blieb Jan nichts anderes übrig, als den Schlaf zu suchen. Stundenlanges Sitzen und Warten schien ihm unerträglich. Ohne Sicherheitsgurt an das Fenster gelehnt, die Knie hochgezogen, die verschmutzten Schuhe an den Vordersitz gedrückt, knautschte er sich aus seiner ausgebeulten Lederjacke erneut ein Polster für den Kopf. Immer wieder fiel sein Blick auf das ewig Gleiche am Rande der Autobahn.
»Geben Sie noch mal diese Geschäftsakte her«, brummte er.
Seinen Sitznachbarn Kemal schien die Fahrt ebenso mitzunehmen. Er spielte lustlos auf seinem Smartphone herum.
»Solcher digitaler Scheiß stiehlt Ihnen nur einen Teil Ihres Lebens«, stichelte Jan.
Er sah in umränderte Augen und auf eine angestrengt gerunzelte Stirn. Träge steckte der junge Mann das Handy ein und reichte ihm die Mappe.
»Irgendwann werden Sie so einen digitalen Scheiß dringend brauchen«, gab Kemal zurück.
»Nein, davon habe ich mich verabschiedet. Mein Leben funktioniert auch ohne.«
Jan blätterte und versuchte zu lesen – unmöglich, sich zu konzentrieren. Wortlos klatschte er die Unterlagen auf die Oberschenkel seines Mitarbeiters zurück. Er beobachtete ihn dabei genau – dessen erschrockenes Gesicht, der fragende Ausdruck. Ihn amüsierte die stumme Empörung, die ihm wie erwartet entgegenschlug.
»Ganz schön empfindlich, wie?«
Ein bisschen Provokation als aussichtsreiche Abwechslung zur Öde der Dienstreise – das war es doch.
»Ich bin Justiziar, kein Hafenarbeiter! Im Normalfall ist es heute nicht mehr nötig, eine raue Schale zu besitzen. Wissen ist gefragt und emotionale Intelligenz. Damit lässt sich mehr Geld verdienen.«
»Mein Geld, nicht wahr?« Jan bemühte sich um ein besonders breites Grinsen, von dem er wusste, dass es unausstehlich arrogant wirkte.
»Ihr Vater war diplomatischer im Umgang mit seinen Angestellten«, murrte sein Gegenüber.
»Dafür nenne ich Sie nicht Angestellter, sondern Mitarbeiter. Oder sollte ich Sie besser Alleinarbeiter nennen?«
Zweifelnd fixierte ihn der junge Mann.
»Das war nicht ironisch gemeint, wirklich nicht! Seien wir doch ehrlich, Sie arbeiten und ich ernte die Resultate. Ich habe Sie aus gutem Grund gebeten, mich nach Düsseldorf zu begleiten. Das alles ist Neuland für mich.«
Kemal löste die aufgekommene Starre seiner Gesichtsmuskeln. »Bei Ihnen weiß man eigentlich nie … also gut. Ich schätze, Sie hatten noch nicht viel Gelegenheit, sich mit den Grundlagen für unsere Verhandlungen vertraut zu machen …«
Schon jetzt gelangweilt winkte Jan Torberg nun doch ab. »Ach, wissen Sie was? Ich hab´s mir anders überlegt. Wenn ich schon höre, wie Sie das so monoton vortragen, wird mir schlecht. Bleiben Sie mir mit diesem Mist lieber doch vom Leib.«
In Torbergs Stimme lag etwas derart Abweisendes, dass Kemal vorsichtshalber ein paar entschärfende Minuten verstreichen ließ. Während er durch das Autofenster die ersten vorbeiziehenden Häuser des Ruhrgebietes beobachtete, fragte er sich, wie gefräßig Gier sein konnte. Sie fraß alles, was ihm früher einmal wichtig gewesen war … Selbstachtung, Stolz, Ehre … wo war das geblieben? Er betrachtete Torbergs schwarzen, ungepflegten Flusenbart, der das überheblich hochgezogene Maul umrahmte, das Kemal inzwischen hasste. Dieses Grinsen! Diese ständig zu Schlitzen geformten Augen, die vermuten ließen, dass Torberg gerade darüber nachdachte, wie er Kemal demütigen könnte! Wie lange konnte er das, des lieben Geldes wegen, noch ertragen? Nach diesem Einsatz in Düsseldorf würde Schluss sein, schwor sich Kemal. Danach wollte er sich endlich eine andere Arbeitsstelle suchen, die ihm das Selbstwertgefühl wiedergeben würde, welches er seit dem Tod des alten Torbergs vermisste. Er wollte noch mehr sparen und dann etwas Eigenes gründen – eine Kanzlei. Aber bis dahin musste er sich ducken, kriechen, säuseln, um so lange es ging das dicke, etwas zu üppige Gehalt einzustreichen. Seine einzige Möglichkeit, Torberg zu schaden.
»Hören Sie, Herr Torberg. Ich weiß, dass es Ihnen lästig ist, Papierkram zu studieren, aber wenn wir zu dem Meeting in Düsseldorf erscheinen, sollten Sie wenigstens die wichtigsten Leute mit Namen und deren Stellung kennen.«
»Dann tun Sie, was Sie nicht lassen können.«
»Wenn Sie es wünschen, fasse ich noch einmal alles zusammen. Der Geschäftsführer unserer Beteiligungsgesellschaft …«
»… führt unser Geschäft.« Eine Bemerkung, die sein musste.
»… führte, Herr Torberg … führte! Der Mann ist seit Wochen unauffindbar, einfach verschwunden. Außerdem führte er den Namen Kai Holzmann und einen anschaulichen Lebensstil – etwas zu anschaulich, für ein Mitglied einer angeblich bescheidenen und uneigennützigen Vereinigung, wie ich finde.«
Wortlos lenkte Jan Torberg seinen Blick nach draußen. Verschwunden … was hieß das? Entweder war der Mann Opfer eines Verbrechens geworden oder er wollte bloß nicht mehr gefunden werden. Jan strich sich eine Strähne seiner vernachlässigten Frisur aus den Augen. Unterzutauchen, anonym sein Leben zu verbringen, in einer anderen Stadt, oder in einem fremden Land – weg von allem … manchmal wünschte er sich das. Ein neues Leben anfangen, vieles anders machen, eine neue Rolle in der Gesellschaft spielen, das unbeliebte Alte ablegen. Es wäre nicht die schlechteste Wahl für ihn. Einmal hatte er es bereits versucht, als er nach Berlin gezogen war. Doch selbst im Schmelztiegel multikultureller Künstler, Hipster, Esoteriker, Abtrünniger, und Futuristen, war er nach kurzer Zeit schon wieder Außenseiter. Egal, wo er länger als ein paar Tage blieb, mochte ihn bald keiner mehr.
Jan sah zu Kemal hinüber, der belästigt aussah, wie so oft. Belästigt von ihm, allein durch seine Anwesenheit, von seinem bloßen Anblick wahrscheinlich. Der nur seinen Job machte. Der niemals auch nur entfernt darüber nachdachte, ein Freund seines neuen Chefs zu werden und dass er, Jan Torberg, vielleicht lieber heulen würde als zu belästigen. Kemal mit dem sensiblen Gesicht, den Blick nach draußen gerichtet, genau wie er selbst eben noch. Der saß da mit der Geschäftsakte auf den Knien, das Einzige, das ihn zu interessieren schien an ihrer gemeinsamen Fahrt. Darüber hätte Jan heulen können. Aber er beherrschte sich.
»Wie hieß noch dieser andere Mann … mein Geschäftspartner, zu dem wir jetzt fahren?«, fragte er an Kemals Hinterkopf gewandt. Er ließ das Wort ›Geschäftspartner‹ betont abwertend über seine Lippen fließen.
»Jorge Alonso.«
»Alonso? Ein Landsmann von Ihnen?«
»Ich bin Deutscher!«
»Sie sollten sich einen anderen Namen zulegen, Herr Akdas.«
Kemal Akdas hob den Kopf höher. »Ich bin stolz auf meinen Namen.«
Jan betrachtete den schmächtigen Mann mit den dunklen Augen und der braunen Haut an seiner Seite. Ein empfindliches Gemüt, fast so dünnhäutig wie das seine, nur offenkundiger. Ein Mann, mutig genug, das zu zeigen.
»Sicher, nehmen Sie es nicht so ernst. Sie kennen mich doch inzwischen.«
Er stieß Kemal spaßeshalber in die Rippen. Der zuckte.
»Über Namen scherzt man nicht. Jorge Alonso ist spanischer Herkunft, das sollte auch der Dümmste heraushören können. Er soll übrigens ein Riese sein.«
»Soso, ein Riese.«
»Ja, tatsächlich, einiges über zwei Meter groß. Außerdem hochintelligent und skrupellos. Wenn Sie mich fragen, ein gefährlicher Mann – wenn es stimmt, was man so munkelt. Sektenführer, Guru oder wie man das nennt. Die Sektenbeauftragten der christlichen Kirchen haben bereits ein Auge auf seine Kirche des Lichts geworfen.«
»Wenn es so offensichtlich eine Sekte ist, warum duldet man diesen alten Guru dann?«
»Woraus schließen Sie, dass der Mann alt ist? Sagte ich etwas in der Art? Man duldet ihn, weil wir in einem Rechtsstaat leben und diese Kirche legal ist. Religionsfreiheit – schon mal von gehört? Man kann ihm nichts nachweisen. So ist das – die größtmögliche Freiheit impliziert leider, dass man sie größtmöglich ausnutzt. Diesen Alonso sollten Sie nicht unterschätzen. Solche Menschen beherrschen die Gefühle anderer, stehen aber selbst mit beiden Beinen auf dem Boden.«
»Auf meinem Boden! Das ist also der Mann, der selbstständig einen neuen Geschäftsführer für meinen halben Teil der Firma dort bestimmen will?«
»Entschuldigung, nicht selbstständig … er schlägt Ihnen Herrn Wolff nur vor …«
»… und bittet schnellstmöglich um Zustimmung! Wo ist da der Unterschied?«
»In den Worten ›schlage ich vor‹. Vermutlich wusste er nicht, dass Ihr Vater verstorben ist und das Schreiben Ihnen zugehen würde. Sie haben es ja nicht für nötig gehalten, ihre Geschäftspartner zeitnah über den Tod Ihres Vaters zu unterrichten.«
»Ich verstehe bis heute nicht, warum meine Eltern die Verbindung zu dieser Kirche gesucht haben. Ausgerechnet diese Sekte! Wo mein Alter gerade so religiös war, dass es für die Weihnachtsmesse reichte. Und mir haben sie meine suchenden Reisen nach Asien als Zeitverschwendung vorgeworfen. Ich bin erstaunt, wie viel Geld meine Eltern gespendet und investiert haben.«
»Nicht nur Geld, sie verbrachten auch viel Zeit in Düsseldorf.«
»Was haben sie da gemacht? Gebetet? Meditiert?«
»Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie sich nach Tuchfühlung mit diesem Alonso, den man dort übrigens Padre nennt, nach und nach sehr veränderten. Als ob man ihnen langsam die Gehirne wusch. Ihre Mutter war zeitweise richtig euphorisch. Das war, bevor sie … bevor sich ihr Zustand rapide verschlechterte. Von da an musste ich mit den Mitarbeitern praktisch die Geschäfte allein führen.«
»Hätte mein Vater mich nicht wenigstens dann ins Vertrauen ziehen können? Früher war er doch so wahnsinnig daran interessiert, dass ich mich endlich in sein Marketinggeschäft stürze. Wissen Sie, ich bin und bleibe Fotograf. Fotograf mit Leib und Seele … oder auch nicht – gut gelebt habe ich davon nie … mit Betriebswirtschaft stehe ich jedenfalls auf Kriegsfuß. Man könnte fast meinen, ich wäre von Beruf aus Sohn.«
»Davon war ich überzeugt!«
Diese kleine Bemerkung erlaubte sich Kemal, obgleich er voraussah, welche Reaktion darauf folgen würde. Tatsächlich verhärtete sich das Gesicht seines Vorgesetzten augenblicklich.
»Und ich bin davon überzeugt, dass Sie von meinem Geld auch nicht gerade schlecht leben. Ich habe Ihre Gehaltszahlung unterschrieben und so viel Geschäftssinn habe selbst ich, dass ich die Summe getrost als völlig übertrieben betiteln kann.«
Kemal nahm sich vor, sich solche Bissigkeiten künftig zu verkneifen. Solange, bis er mit Genugtuung kündigen würde. Für den Rest der Fahrt schwiegen sie, ungeduldig das ausweglose Sitzen ertragend.
Die Zentrale der Kirche des Lichts
»Warum kommt der so spät? Zwei Stunden Verspätung! Ohne jede Entschuldigung. Was maßt der sich an?«
Der Mann, der vom Fenster des Büros aus die Hofeinfahrt überblickte, nahm eine Zigarette, drehte sie ein paar Mal um und zündete sie schließlich an.
Seine Zuhörerin lächelte.
»Der leistet sich so manches«, sagte sie, seine Finger beobachtend, wie sie ständig durchs Haar griffen, wie ein Redner, der nur aus Kopf und Händen bestand. Die Vorstellung von ihm als Kopffüßler rief eine gewisse Heiterkeit in ihr hervor.
Sie war die Einzige, die Torberg Junior schon kannte. Bei einem ihrer Besuche in der Firma seines Vaters vor ein paar Jahren hatten sie und Jan Torberg festgestellt, dass sie sich aus Schulzeiten kannten. Es war ein einmaliges Treffen gewesen und einiges in der Zwischenzeit geschehen, aber die Erinnerung an den jungen Rebellen war geblieben. Unvergesslich, dieser ironische Zug um Torbergs Mund. Eine Hand hatte er ihr damals nicht gereicht, sie dafür ungeniert, geradezu anzüglich, gemustert. Seine herablassende Art hatte, das musste sie sich zugeben, etwas anziehend Unverschämtes. Anna Schuster amüsierte der Gedanke, wie der junge Unternehmer hier ankommen würde, und sie freute sich jetzt schon auf reichliche Abwechslung. Vor allem auf die Reaktionen Ihres Chefs Alonso. So schnell, wie gewohnt, würde er diesen nicht einwickeln.
Sie nippte an ihrem Glas und beobachtete Wolff, der jetzt das Fenster verließ und auf und ab lief. Dermaßen nervös wie heute sah man ihn selten. Aber die wenig umgängliche Art Torbergs hatte sich durch informierte Zungen herumgesprochen – gerade auch durch ihre. Und wie vom Bösen getrieben, fand sie es an der Zeit, noch einmal darauf hinzuweisen.
Ein Grund für die Finger, wieder durchs Haar zu greifen. Dann schwiegen die Hände, nachdenklich verharrten sie am Körper.
»Ach was, der wird sich schon anpassen. So wie jeder.«
Er drehte wieder die Zigarette.
»Wenn nicht, dann wird der Padre schon dafür sorgen. Da können wir sicher sein.«
»So sicher wie das Amen in seiner Kirche!«
Anna fand ihre Bemerkung so passend, dass sie auf dem schwenkbaren Sessel hin und her wippte. Obwohl lautlos, schallte das Lachen in ihrem Kopf. Selbst Wolff schmunzelte heimlich, sie sah es. Wäre freilich der Padre anwesend gewesen, hätte sie niemals eine noch so passende Bemerkung gewagt.
Kurz bevor sie in Düsseldorf ankamen, wäre es Jan fast gelungen, einzuschlafen. Gerade kroch ein Gefühl tiefer Entspannung in seinen Körper. Als der Taxifahrer ihn ansprach, dauerte es einige Sekunden, bis er richtig zu sich fand. Sein Wir sind gleich da, Herr Torberg, schreckte ihn auf, wie ein Schrei. Sie passierten ein wegweisendes Schild am Straßenrand.
»Fahren Sie noch mal zurück«, befahl Torberg.
Der Taxifahrer murmelte unverständliche Flüche vor sich hin, bevor er den Rückwärtsgang einlegte. Fünfzig Meter zurück stoppte er abrupter als nötig mitten auf der Straße.
Mit zusammengekniffenen Augen studierte Jan durch das Autofenster hindurch die Aufschrift auf der Hinweistafel so lange, als wollte er sie ganz und gar verinnerlichen.
Auf silberfarbenem Grund stand in protzend goldener Schrift:
Kirche des Lichts Zentrale Marketing und Missionswerk
»Warum halten wir hier?« Kemal war ebenso wie sein Chef aus einem Fast-Schlaf aufgeschreckt.
»Ich wollte es schwarz auf weiß sehen und jetzt sehe ich es golden auf silber.«
»Sie wollten was? Ich kann Ihnen nicht folgen … wie so oft.«
»Ich meine dieses Schild. Kaum zu glauben, dass mir so etwas zur Hälfte gehört.«
»Tja, über einige wesentliche Dinge hat Ihr Vater Sie wohl im Unklaren gelassen. Aber Ihnen gehört von der Zentrale nichts. Sondern nur ein Teil dieses Marketing- und Missionswerks. Missionierung ist auch so eine Art Marketing, wenn man es genau nimmt.« Kemal verzog verächtlich die Mundwinkel.
Zwei Kilometer weiter erreichten sie die Einfahrt zu einem abgelegenen Anwesen. Ein grüner Streifen aus meterhohen Kirschlorbeeren kaschierte den dahinter verborgenen Metallzaun. Doppelstabgitter mit Auslegern, Jan durchdachte reflexhaft seine Chancen, den Zaun zu überwinden. Nicht ganz einfach, aber machbar, entschied er.
Der Taxifahrer seufzte auf, als er seinen übermüdeten Körper aus dem durchgesessenen Autositz hob. Draußen bog er den Rücken ausgiebig durch.
»Wird das heute noch was?«, rief Jan von der Rückbank durch die geöffnete Fahrertür. »Sie wissen schon, dass ich Sie üppig bezahlt habe?«
»Deswegen bin ich nicht Ihr Sklave«, antwortete der Fahrer. Den unbequemen Kunden hatte er nur angenommen, weil er sowieso von Hamburg aus zurück nach Düsseldorf wollte und sich dadurch eine lukrative Rückfahrt anbot. Er formte ein unsittliches Zeichen mit seinem Mittelfinger, bevor er sich vor das verschlossene Tor des Anwesens stellte und einen Knopf drückte. Kemal hob angesichts der frechen Antwort des Fahrers triumphierend die Faust.
Das Tor öffnete sich elektronisch und sie befuhren eine breite Schotterzufahrt, bis sie einen gepflasterten Hof erreichten. Der Hof erschien verschwenderisch groß. Er bot Platz genug für zweihundert Autos, aber nur wenige, höchstens zehn, parkten dort. Einige der Fahrzeuge protzten in Jans Augen wie Ludenkarren, die anderen wirkten auf ihn wie Seifenkisten. Ein großer weißer Transporter ohne Aufschrift rangierte vor dem geöffneten Tor einer Halle.
Kemal und Jan enttäuschte das nüchterne Äußere des Gebäudes vor ihnen. Sie hatten mehr Spiritualität erwartet. So etwas wie eine große Kirche oder Moschee, etwas Heiliges jedenfalls.
»Hier wollte meine Mutter ihren Glauben finden? Es sieht aus, wie ein gewöhnliches Bürogebäude«, sagte Jan.
»Es ging nicht nur um ihren Glauben. Es ging um Heilung. Dem Sektenführer wird die Fähigkeit zugeschrieben, Kranke heilen zu können.«
»Ein Wunderheiler? Ich kaufe Ihnen nicht ab, dass mein Vater an so etwas geglaubt hat.«
»Warum nicht? Niemand weiß, wie er reagiert, wenn er den Tod so dicht vor Augen hat. Tut man dann nicht alles, um sich zu retten?«
»Meine Mutter vielleicht, ja. Das kann schon sein.«
»Tja, wenn die Schulmedizin nicht hilft, suchen viele Trost und Hilfe im Glauben. Der Schritt vom Glauben zum Aberglauben ist vermutlich gar nicht so weit.«
»Was unterscheidet denn Aberglauben vom Glauben?«, fragte Jan. »Jede Religion pachtet für sich die Wahrheit. Warum soll die Wahrheit dieser Sekte falscher sein als die der anderen?«
Kemal dachte eine Weile nach. Diese Frage konnte er nicht einmal für sich selbst beantworten. Also schwieg er dazu. Dass Torberg aber fast philosophisch in die Tiefe fragte, wunderte ihn. Er hatte ihn für einen oberflächlichen Trampel gehalten.
Inzwischen hatte sich der Himmel derart verdunkelt, dass man den Eindruck eines drohenden Unwetters erhielt. Jan ließ den Wagen in einigem Abstand zum Gebäude und mit der Motorhaube zur Einfahrt hin parken. Es gab ihm ein sichereres Gefühl, im Notfall mit dem Gefährt näher am Ausgang zu sein. Er warf einen Blick auf das Tor und registrierte mit Unbehagen, wie es sich verschloss.
»Ich würde gern etwas essen. Wann brauchen Sie mich wieder?«, fragte der Fahrer.
»Sehen Sie hier ein Bistro zum Einkehren? Nein, Sie bleiben hier und warten.«
»Arschloch«, flüsterte es vom Fahrersitz aus.
»Das habe ich gehört.«