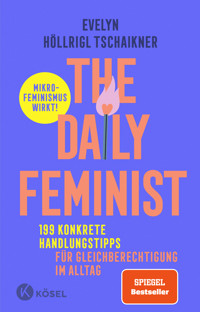
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
»Ein Buch, das auf geradezu unerhörte Ideen bringt. Zum Beispiel, dass Wut verbinden kann. Praktisch und hochunterhaltsam.«
Mareike Fallwickl
Leben in einer männergemachten Welt schlaucht: angefangen bei ungleichen Job- und Gehaltsaussichten über fragwürdige Sprach- und Schönheitsnormen bis hin zu gravierenden Ungerechtigkeiten in Medizin oder Sexualität. Doch wie können wir große Veränderungen anstoßen, wenn dank andauernder Mikroaggressionen im Alltag schlicht die Ressourcen fehlen?
Fundiert und unterhaltsam zeigt Evelyn Höllrigl Tschaikner, was kleine Gesten, alltägliche Handlungen und leicht umsetzbare Strategien bewirken. Eine Form der Revolution im Kleinen, die zeigt: so nicht. Eine ermächtigende Anleitung, die hilft, dagegenzuhalten, wenn der Alltag im Patriarchat mal wieder kickt.
»Wer kennt nicht den Wunsch, etwas zu verändern – aber wie? Dieses Buch liefert sofort umsetzbare Tipps, die auch noch Spaß machen. Eine Pflichtlektüre!« Dr. Elisabeth Wagner
»Dieses Buch ist für alle, die den Mut haben, die Welt jeden Tag ein kleines Stückchen gerechter zu gestalten.« Jana Heinicke
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Leben in einer männergemachten Welt schlaucht: angefangen bei ungleichen Job- und Gehaltsaussichten über fragwürdige Sprach- und Schönheitsnormen bis hin zu gravierenden Ungerechtigkeiten in Medizin oder Sexualität. Doch wie können wir große Veränderungen anstoßen, wenn dank andauernder Mikroaggressionen im Alltag schlicht die Ressourcen fehlen?
Fundiert und unterhaltsam zeigt Evelyn Höllrigl Tschaikner, was kleine Gesten, alltägliche Handlungen und leicht umsetzbare Strategien bewirken. Eine Form der Revolution im Kleinen, die zeigt: so nicht. Eine ermächtigende Anleitung, die hilft, dagegenzuhalten, wenn der Alltag im Patriarchat mal wieder kickt.
Evelyn Höllrigl Tschaikner
The Daily Feminist
199 konkrete Handlungstipps für Gleichberechtigung im Alltag
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 Kösel-Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Dr. Daniela Gasteiger
Umschlag: FAVORITBUERO, München
Umschlagmotiv: © Busy Lola / Shutterstock
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-33614-1V002
www.koesel.de
Inhalt
Zur Einordnung, falls nötig
Prolog
Die Alltagsfeministin
Wir stecken mittendrin
Was ist Mikrofeminismus?
Wo Veränderung beginnen kann
Ermächtigen wir uns
Mach(t) Platz! × Raum einnehmen
Worte schaffen Welten × Sprache und Geschlechtergerechtigkeit
FAIRminismus × Privilegien, Marginalisierung und Beton
Und wie du wieder aussiehst × Schönsein
Sichtbar, unsichtbar, stumm × Medien
Diagnose Ungleich gesund × Gendermedizin
Emotionale Arbeit und die Liebe × Partnerschaft und Beziehungen
In den Apfel beißen × Lust und Sex
Do you even care? × Feministische Elternschaft
Rosa vs. Hellblau × Erziehung
»Mom, I am a rich man« × Geld und Konsum
Machtverschiebung am Arbeitsplatz × Feminismus im Job
Healthy Masculinity × Neue Männlichkeit
Feministsphere × Solidarität und Schwesternschaft
The Female Rage × Die Wut
It’s time to SAY … Danke.
Quellen und Lesenswertes
Zur Einordnung, falls nötig
Über Gleichberechtigung zu schreiben, kann kompliziert sein. Sie macht es schwierig, gesellschaftliche Strukturen zu beschreiben, ohne dabei von den Männern oder den Frauen als Kategorien zu sprechen, auch dann, wenn mir absolut bewusst ist, dass es keine homogenen Gruppen sind. Wenn ich in diesem Buch über die Frauen und die Männer schreibe, dann beziehe ich mich auf die stereotypen und gesellschaftlich aufgeladenen Rollenzuschreibungen in patriarchalen Strukturen. Ich wähle diese Formulierungen auch, weil viele der Studien, die ich heranziehe, genau entlang dieser Kategorien Daten erheben und auswerten. Die Vielfalt menschlicher Identität lässt sich nicht auf binäre Begriffe reduzieren. Wo möglich und sinnvoll, versuche ich daher, diese Vereinfachung sichtbar zu machen. Wo nicht, bitte ich darum, die Begriffe als das zu verstehen, was sie hier sind: eine Krücke, um über komplexe Realitäten zu reden. Wenn ich außerdem von Feminismus spreche, dann meine ich einen Feminismus, der intersektional ist und inklusiv, der strukturelle Ungleichheiten sichtbar macht, der Machtverhältnisse hinterfragt und versteht, dass Geschlecht nur eine von vielen Achsen der Diskriminierung ist. Nicht einen, der unter anderen eine Katy Perry und ihre Gänseblümchen für zehn Minuten mit der Blue Origin ins All schickt.
Das andere Gefühl, das mich begleitet hat: So offen, sozial bewusst oder antirassistisch ich mich selbst auch einschätzen mag, tief in mir trage ich dennoch erlernte, versteckte Vorurteile. Dieses Buch erhebt keinen Anspruch auf Perfektion. Es ist der Versuch, zu hinterfragen, sich mit internalisierten Stereotypen auseinanderzusetzen und Verantwortung zu übernehmen. Alles, was hier steht, ist nach bestem Wissen und Gewissen formuliert. Zu vielen Themen, wie etwa Gesundheit und Gleichberechtigung am Arbeitsplatz, habe ich Interviews geführt, um tiefere Einblicke direkt von Expert*innen zu gewinnen und weiterzugeben.
Bereit? Es wird unbequem.
Prolog
Während ich dieses Buch geschrieben habe, hatte ich oft ein mulmiges Gefühl, denn ich weiß, dass ich damit anecken werde. Zu wenig, zu privilegiert, zu oberflächlich. Zu weit hergeholt, zu viel, zu unbequem. Irgendein zu eben. Aber vielleicht verbringe ich einfach schon zu viel Zeit im Internet und bin die rauen Manieren dort mehr gewohnt, als mir lieb sein sollte.
Als ich auf Instagram im Frühjahr 2024 Anregungen zu Mikrofeminismus postete, hagelte es Kritik. Gut, eigentlich waren es eher Hasskommentare von wütenden Männern, die es als Mikroaggression empfanden, wenn ihnen die Tür aufgehalten wird. Doch auch die eine oder andere Frau merkte an, dass die geposteten Punkte kein Mikrofeminismus seien, sondern einfach Feminismus.
Deshalb gleich vorweg: Mikrofeminismus meint nicht weniger Feminismus, sondern eine andere Perspektive darauf. Eine, die anerkennt, dass Veränderung nicht nur auf Bühnen und in Reden entstehen muss, sondern auch in Gesten, Gesprächen und Entscheidungen. In Gedanken, die im Alltag beginnen. Denn nicht jede*r hat die Kapazitäten für mehr oder lauter.
Oft habe ich den Eindruck, dass sich Menschen lieber über vermeintlich unvollständigen Feminismus empören als über allgegenwärtige Misogynie. Vielleicht, weil wir selbst oft genug die Abwertung, Herablassung und strukturelle Ungleichbehandlung von Frauen mittragen – bewusst oder unbewusst –, und es einfacher ist, mit dem Finger auf andere zu zeigen als auf sich selbst. Und gleichzeitig frage ich mich seither, warum wir uns von all dem, was auf den ersten Blick klein erscheint, abheben wollen. Warum das zu wenig ist. Ist das nicht auch ein Echo patriarchaler Denkweisen in uns, wenn wir glauben, etwas müsse laut, groß oder sichtbar sein, um Wirkung zu entfalten? Warum messen wir Bedeutung an Größe oder Aufwand? »Mikro« bedeutet nicht unwichtig. Es beschreibt das, was in unseren täglichen Begegnungen passiert. Was oft übersehen wird, im Privaten beginnt und durch unser Handeln nach außen schwappt. Größe sagt nichts über die Wirkung. Die Menge aber schon. Sonst wäre Mikroplastik keine massive Umweltgefahr.
Obwohl ich dieses mulmige Gefühl hatte, hatte ich zeitgleich auch Hoffnung, dass diese Zeilen Mut machen und ein Gefühl des Zusammenhalts geben würden. Dass sie ein Anstupser für all jene sein können, die glauben, schlechte Feminist*innen zu sein, weil sie keine Kraft für großes Engagement haben. Die gerne würden, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Es gibt erstaunlich viele Punkte, an denen sie ansetzen können. In diesem Buch genau genommen 199. Das Erschreckende? Es hätten mehr sein können.
Vielleicht ist dieses Buch zu wenig. Vielleicht ist das auch okay so. Vielleicht möchte ich auch vor allem die Menschen erreichen, bei denen »wenig« ein guter Anfang ist. Weil kleine Gesten, wenn sie sich summieren, Wirkung zeigen.
Die Alltagsfeministin
Im Frühling 2024 erzählte die amerikanische Produzentin Ashley Chaney ihren Follower*innen, was für sie Mikrofeminismus bedeutet. Es war ein kurzer, beiläufiger Satz in einem TikTok-Video, der eine überraschende Resonanz auslöste. Menschen auf der ganzen Welt teilten ihre eigenen kleinen feministischen Gesten. »Mein Mikrofeminismus ist es, den Taxifahrer zu fragen, ob der Koffer zu schwer für ihn sei, wenn er über das Gewicht witzelt.« – »Mein Mikrofeminismus ist es, immer von der Vorgesetzten zu sprechen.« – »Mein Mikrofeminismus ist es, meinen Mann als ersten Ansprechpartner im Kindergarten einzutragen.«
Ein Trend war geboren. Einer, der genau da ansetzt, wo es leichtfällt, ihn anzuwenden, nämlich mitten im Alltag. Denn so sehr wir über Fortschritte sprechen, so hartnäckig klammert sich die Realität an alten Mustern fest. Sie zeigt uns täglich, dass wir in einer Welt leben, die für FLINTA*-Personen oft alles andere als bequem ist. Die Tatsache, dass wir immer noch über das Recht von weiblich gelesenen Menschen auf körperliche Selbstbestimmung diskutieren müssen, dass sich in nahezu jedem Lebensbereich ein Gender Gap zeigt und dass statistisch gesehen der gefährlichste Ort für eine Frau ihr eigenes Zuhause ist, macht deutlich, wie viel noch immer im Argen liegt. Eigentlich. Denn ich weiß, dass es brodelt. Viele wissen, dass diese Ordnung, die wir gerade haben, nicht für alle ideal ist, und stellen sich die Frage: Was können wir tun? Können wir überhaupt etwas tun? Mit wir meine ich nicht nur weiblich gelesene Personen, sondern alle, die bereit sind, genauer hinzuschauen, auch wenn das manchmal wehtut oder unangenehm ist. Ich meine Menschen, die vielleicht in Routinen feststecken, kaum Kapazitäten haben, aber offen genug sind, sich selbst und das eigene Verhalten zu hinterfragen, und das wollen. Menschen, die nicht »perfekt« sind, aber aufmerksam. Die bei misogynen Witzen nicht mehr lächeln können und wollen, und ja, die wütend sind. Female Rage nennt sich das, wenn es in uns drin kocht, weil uns schon wieder auf der Straße hinterhergepfiffen wurde, weil wir schon wieder überhört wurden, weil schon wieder ein Femizid in den Schlagzeilen steht.
Wir haben ganz schön viele Gründe, wütend zu sein. Und wir müssen diese Wut nicht unterdrücken, im Gegenteil, wir können sie kanalisieren, denn Wut verliert ihre Ohnmacht, wenn sie geteilt wird. Aber bevor wir uns mit dem Wie beschäftigen, lohnt es sich, das Was zu betrachten.
Wir stecken mittendrin
Blondinenwitze, die Diätkultur der frühen 2000er-Jahre oder stereotype Frauenbilder in Teeniefilmen sind nicht die Ursache. Aber sie zeigen, worauf vieles zurückgeht. Sie wirken wie kleine Risse, durch die etwas Tieferes sichtbar wird. Die Rede ist vom Patriarchat. Ein Wort, das oft abschreckend klingt und, seien wir ehrlich, manchmal auch etwas abstrakt wirkt. Ein Begriff für die Ordnung, in der wir aufgewachsen sind. Er hat unsere Sicht auf die Welt geformt und die Vorstellungen davon, was »angebracht« ist und was »erwünscht«, hat uns glauben lassen, Ungleichheit sei irgendwie naturgegeben.
Ja, der Begriff ist aufgeladen, er klingt schnell nach Schuldzuweisung oder ideologischer Trennungslinie. Nach »böse Männer« und »arme Frauen«. Doch genau darum geht es nicht. Es geht um die Rollenbilder, die in Medien, Bildung, von unseren Familien und uns selbst vermittelt werden. Es geht um ungleiche Bezahlung, um die geringe Repräsentation von FLINTA-Personen in Führungspositionen, um sexualisierte Gewalt, die oft verharmlost wird, und um Alltagsdiskriminierung, die als »normal« erscheint. Es geht um Dynamiken, die sich unserem Blick oft entziehen und uns glauben lassen, das Problem liege an und in uns. Aber weder Geschlecht noch Hautfarbe oder eine Behinderung ist eine Hürde. Die eigentliche Hürde ist ein Machtgefüge, das Unterschiede als Grundlage für Ungleichheit nutzt und dabei vorgibt, neutral zu sein.
Das Patriarchat ist eine dieser Strukturen. Nicht greifbar, wie Nebel, der sich durch alles zieht. Er legt sich auf die Sprache, prägt unser Denken, beeinflusst, wie wir lieben, arbeiten, fühlen. Er zeigt sich in scheinbar harmlosen Sätzen wie: »Männer sind halt so« oder »Frauen haben dafür einfach ein besseres Gespür«. Er zeigt sich in Kinderbüchern, in denen Prinzessinnen gerettet werden müssen, statt selbst die Drachen zu bezwingen. In Schulbüchern, in denen fast ausschließlich Geschichten von Männern über Männer erzählt werden, während Frauen, wenn überhaupt, in den Randnotizen auftauchen. In Filmen, die zeigen, wer handelt und wer wartet, wer spricht und wer zuhört. Wer im Mittelpunkt steht und wer nur mitgemeint ist.
Weil das Patriarchat so selbstverständlich wirkt, fällt es uns oft erst auf, wenn wir bewusst innehalten, genauer hinsehen und verstehen, welche Bilder uns geprägt haben, welche Erzählungen wir verinnerlicht haben. Dazu gehört etwa die Erzählung, dass Männer rational und durchsetzungsstark sind, Frauen aber einfühlsam und fürsorglich. Dass Stärke männlich sei und Schönheit weiblich. Diese Vorstellungen wurden gehegt und gepflegt und immer wieder weitergegeben, um eine Ordnung aufrechtzuerhalten, in der Macht, Sichtbarkeit und Deutungshoheit ungleich verteilt sind. In der die Welt in zwei klar definierte Kategorien eingeteilt wird: männlich und weiblich, samt der Eigenschaften, die diesen Zuschreibungen folgen: maskulin und feminin. Stark und sanft. Dazwischen scheint es nichts zu geben.
Doch die Realität vieler Menschen passt nicht in dieses binäre Raster. Ihre Identitäten, ihre Erfahrungen, ihre Lebensentwürfe bleiben darin unsichtbar. Gerade das macht deutlich, wie begrenzt dieses System ist. Und doch wirkt es weiter. In dem, was wir für normal halten. In den Maßstäben, nach denen wir uns und andere bewerten. In unausgesprochenen Regeln darüber, wie jemand sein darf.
Und nein, das Patriarchat ist nicht aus Boshaftigkeit entstanden und auch nicht nur, um Frauen bewusst zu unterdrücken. Es ist ein System, das über Jahrhunderte hinweg gewachsen ist, geformt aus Geschichte, Gewohnheit und Machtverhältnissen, die lange nicht infrage gestellt wurden. Stimmen, die dagegenhielten, wurden überhört oder zum Schweigen gebracht, weil diejenigen, die vom Fortbestehen des Patriarchats profitierten, lange Zeit buchstäblich das Sagen hatten. So blieb vieles beim Alten, weil Veränderung Kraft kostet. Wer gegen jahrhundertealte Strukturen arbeitet, kämpft auch gegen Gewohnheiten, gegen Zweifel, gegen Erschöpfung, und das lässt uns im Alltag mit einem latenten Gefühl der Machtlosigkeit zurück. Damit meine ich – wiederum – nicht nur Frauen. Unsere Väter, Brüder, Partner, Söhne und Freunde sind im Patriarchat keine Gegenspieler. Sie sind Teil desselben Systems, in dem auch wir leben. Nur dass sie darin an anderen Stellen stehen, oft mit unsichtbaren Privilegien, die ihnen selbst vielleicht gar nicht auffallen.
Wer verstehen will, wo solche Vorteile wirken, sollte nicht nur beobachten, was leichtfällt, sondern auch, was andere ständig mittragen. Wenn das stille Abwägen der eigenen Worte uns verstummen lässt oder wir uns ständig bemühen müssen, kompetent zu wirken, um nicht übersehen zu werden. Und das ist oft nicht klar umrissen oder greifbar. Wie Nebel eben. Wir haben gelernt, ihn nicht zu sehen, und wenn er uns mal wieder auffällt, dann ist es, naja … unangenehm. Denn dann wird uns bewusst, dass sich dieser Nebel auch in unseren innersten Überzeugungen festgesetzt hat. Vielleicht ist das der schwierigste Teil: zu erkennen, dass es nicht nur um äußere Zwänge geht, sondern auch um die feinen Spuren, die sie in uns hinterlassen haben. Sie zeigen sich dann, wenn wir ein leises Unbehagen fühlen und die Hose doch wechseln, weil sie »aufträgt«. Wenn ein Vater dafür gelobt wird, dass er den Kinderwagen schiebt, während die Mutter für den Mental Load, der sie nachts wachhält, keine Anerkennung erfährt. Dieser Nebel ist eben da.
Es bleibt jedoch nicht bei diesem diffusen nebligen Gefühl. Wir wissen längst, dass es nicht nur subjektiv, sondern strukturell ist. Die Autorin Caroline Criado-Perez zeigt in ihrem Buch Unsichtbare Frauen anhand zahlreicher Studien und Statistiken, wie sehr Daten, Produkte und Systeme, die unseren Alltag bestimmen, auf den Körper eines gesunden weißen Mannes ausgerichtet sind. Autounfall-Tests werden fast ausschließlich mit männlichen Dummies durchgeführt. Medikamente werden an männlichen Probanden getestet, obwohl sie bei Frauen oft anders wirken. Selbst Bürostühle, Smartphones oder Einbauschränke orientieren sich an Durchschnittswerten, die auf männliche Körper zugeschnitten sind.[1] Frauen sind dabei höchstens mitgedacht, oft aber schlicht nicht vorgesehen. Und das kulminiert in einer enormen Wissens- und Datenlücke, dem Gender Data Gap. Diese Vorstellung, dass der Mann die Norm sei und die Frau eine Abweichung, hat einen Namen. Sie nennt sich Androzentrismus, abgeleitet vom griechischen Wort anḗr, Genitiv andrós, für Mann. Das ist ungerecht, ja, aber in vielen Fällen auch gefährlich. Denn eine Welt, die nur für die Hälfte ihrer Bevölkerung funktioniert und die andere Hälfte systematisch übersieht, ist keine gerechte. Und sie ist auch keine sichere.
Die gute Nachricht: Das Patriarchat ist kein Naturgesetz, es ließe sich also ändern. Das geht aber nur, wenn wir es als das erkennen, was es ist, und es auch so benennen. Es funktioniert, weil vieles als selbstverständlich gilt und nicht als Teil eines größeren Zusammenhangs verstanden wird. Weil wir glauben, es sei eben Zufall oder individuelles Pech, wenn Frauen weniger verdienen, seltener entscheiden oder im Privaten mehr Verantwortung tragen.
Dieses Buch ist eine Einladung, genauer hinzusehen. Dabei geht es weniger darum, alles auf einmal zu verändern oder die perfekte feministische Haltung zu entwickeln. Denn die gibt es nicht. Es gibt keine abschließende Checkliste, keine fehlerfreie Version. Feministisches Handeln beginnt aber auch nicht erst, wenn es laut wird oder groß erscheint. Für manche mögen bestimmte Gesten zu unwichtig wirken, für andere nur aus einer privilegierten Position möglich erscheinen. Aber Wirkung entsteht nicht nur durch Größe, sondern durch Wiederholung, durch Aufmerksamkeit, durch die Entscheidung, nicht einfach weiterzumachen wie bisher. Manchmal bedeutet feministisch zu handeln, Dinge neu einzuordnen, Worte bewusster zu wählen oder sich selbst zu korrigieren. Das kann am Esstisch sein, im Büro, im Bus oder auf dem Spielplatz. Manchmal beginnt es mit der Frage: »Warum ist das eigentlich so?« Und es wächst mit jeder Antwort, die wir ehrlich genug sind, uns selbst zu geben. Vielleicht liegt eine der Antworten auf die Frage, was wir konkret tun können, um unsere Female Rage zu kanalisieren, genau hier, im Alltag. Im Mikrofeminismus.
Was ist Mikrofeminismus?
Als ich 21 war, teilte ich mit zwei Studienkollegen eine WG. Wir waren alle drei im selben Semester, hatten denselben Workload und dieselben Prüfungen vor uns. Und doch schien es für meine beiden Mitbewohner eine unausgesprochene Selbstverständlichkeit zu sein, dass ich als einzige Frau in der Wohnung nicht nur meinen Teil der Haushaltsaufgaben übernahm, sondern am besten gleich die Verantwortung für alles tragen sollte. »Du kannst das besser«, sagten sie regelmäßig. Nicht herablassend oder in böser Absicht, sondern aus ehrlicher Überzeugung. Wenn ich darauf hinwies, dass das Geschirr in der Spüle längst ein Eigenleben entwickelt hatte, kam genau dieser Satz. Als wäre allein schon mein Geschlecht Kompetenz genug, dass sie sich nicht kümmern mussten.
Der skurrilste Höhepunkt dieser Zeit war, als mich eines Tages die Mutter meines Mitbewohners anrief. Sie wollte, dass ich etwas für ihren Sohn organisiere. Ein Formular, ein Termin, irgendetwas, das er problemlos selbst hätte erledigen können. Die Einzelheiten habe ich längst vergessen, aber das Gefühl ist geblieben. In ihren Augen war ich automatisch zuständig. Für Ordnung, für Organisation, für ihren erwachsenen Sohn, der zufällig mein Mitbewohner war. Dass er genauso alt war wie ich und dasselbe Studium absolvierte, spielte keine Rolle.
Damals war ich wütend. Über die Dreistigkeit. Über die Annahme, dass ich verantwortlich dafür sei, dass der Haushalt funktionierte, und für das Leben anderer. Aber was mich im Nachhinein noch mehr beschäftigte, war die Tatsache, dass ich es oft einfach gemacht habe. Ich habe den Müll runtergebracht, das Geschirr gespült, das Telefonat freundlich beendet. Es war mir unangenehm, etwas zu sagen, ich wollte keinen Streit. Ich wollte nicht anstrengend sein oder unkollegial. Nicht unbequem.
Das Patriarchat zeigt sich oft nicht in lauten, einschüchternden Gesten, sondern in leisen, unausgesprochenen Erwartungen. In den Rollen, die Menschen übernehmen, ohne je gefragt worden zu sein, ob sie das überhaupt wollen. Es wirkt, wenn kleine Jungs ausgelacht werden, weil sie weinen oder Freude an rosaroten Haarspangen haben. Wenn »Du siehst aus wie ein Mädchen!« eine Beleidigung sein soll. Wenn dieselben Jungs später in Beziehungen Kontrolle und Dominanz als Liebesbeweise deklarieren und einseitigen Respekt als naturgegeben hinstellen. Es wirkt, wenn Mädchen früh lernen, brav und hilfsbereit zu sein, und ihnen später vorgeworfen wird, sie seien für eine Gehaltsverhandlung zu nett oder nicht durchsetzungsfähig genug. Das sind die Mechanismen, durch die das Patriarchat funktioniert.
Genau hier, wo Rollenerwartungen fast unbemerkt greifen, beginnt Mikrofeminismus. Statt automatisch zu übernehmen, darf gefragt werden: »Muss ich das wirklich machen? Oder habe ich eine Wahl?« Wenn Aufgaben nicht mehr still getragen, sondern verteilt werden. Wenn Zustimmung nicht reflexartig kommt, sondern überdacht wird. Der Anfang von Mikrofeminismus ist der Moment, in dem wir innehalten und denken: »Warum?« Um dann den Mut zu finden, es nicht mehr zu tun.
Wo Veränderung beginnen kann
Die Soziologie beschreibt unsere Gesellschaft häufig in drei ineinandergreifenden Ebenen: der Mikro-, der Meso- und der Makroebene. Es ist fast ein bisschen absurd-komisch, dass ich mich damals in der WG-Küche mit genau diesen Begriffen beschäftigt habe, während direkt neben mir der Alltag oft ein ganz praktisches Lehrbuch über Rollenverteilungen war. Diese drei Ebenen machen sichtbar, wie eng individuelles Verhalten, zwischenmenschliche Dynamiken und gesellschaftliche Strukturen miteinander verwoben sind. Sie zeigen, dass soziale Muster nicht einfach von oben verordnet werden, sondern sich aus dem Alltag heraus formen, verstärken oder auch verändern können. Wenn wir über Mikrofeminismus sprechen, führt genau dieses Zusammenspiel zum Kern des Themas. Und wir beginnen von ganz oben.
Die Makroebene
Die Makroebene bildet den übergeordneten Rahmen, in dem gesellschaftliches Leben organisiert ist. Sie umfasst politische Systeme, wirtschaftliche Ordnungen, kulturelle Normen und gesetzliche Regelungen. Auf dieser Ebene werden jene Werte und Regeln verhandelt, die den Alltag aller Menschen prägen, es sind die Strukturen, die das Zusammenleben formen. Veränderungen beginnen selten auf der Makroebene, meist entstehen sie in kleineren Räumen, aus individuellen Erfahrungen und geteiltem Unmut. Erst wenn sich viele Stimmen verbinden, erreichen sie den politischen Diskurs, die Gesetzgebung oder das kollektive Bewusstsein. Hier knüpft die Mesoebene an.
Die Mesoebene
Die Mesoebene ist der Raum der Organisationen und Institutionen, der Gruppen und Gemeinschaften. Sie zeigt sich in Schulen, Universitäten, Medienhäusern, Vereinen, Unternehmen. In diesen Strukturen wird ausgehandelt, wer gehört wird, wie Verantwortung verteilt ist und welche Vorstellungen von Geschlecht, Arbeit oder Führung weitergegeben werden. Auf der Mesoebene verdichten sich individuelle Erfahrungen zu gemeinschaftlichen Dynamiken.
Die Mikroebene
Sie ist das unmittelbare soziale Geflecht, in dem wir handeln, sprechen, zuhören, entscheiden. Das können die Begegnungen im Büro, die Gespräche am Küchentisch, die Dynamik im Klassenzimmer, die unausgesprochenen Rollen in Freundeskreisen oder Familien sein. Hier wird gesellschaftliche Ordnung formuliert und gelebt und durch Gesten, Erwartungen und Wiederholungen verstärkt. Was auf der Mikroebene geschieht, prägt. Denn wer immer wieder erlebt, dass bestimmte Aufgaben selbstverständlich übernommen werden, entwickelt ein Verständnis dafür, was »normal« scheint und was nicht. Hier werden Vorstellungen darüber geformt, wer sich kümmert, wer entscheidet, wer im Hintergrund bleibt. Und genau deshalb liegt in dieser Ebene auch das größte Potenzial für Veränderung.
Wenn wir über Mikrofeminismus sprechen, geht es um genau diesen Raum, wo unser Handeln, Denken und unsere Entscheidungen unmittelbare Wirkungen zeigen. Dort, wo gesellschaftliche Erwartungen oft beiläufig weitergegeben werden, entsteht auch die Möglichkeit, sie zu hinterfragen und neu zu gestalten. Mikrofeminismus versteht Veränderung als etwas, das sich von unserem direkten Umfeld aus entfalten kann. »Mikro« ist dabei keine Abwertung, sondern eine Verortung in der Mikroebene.
Mein eigener Mikrofeminismus zeigte sich damals in meiner WG-Küche, als ich meinen Mitbewohnern ein Ultimatum stellte: Entweder sie würden Verantwortung übernehmen oder ausziehen. War es ungemütlich? Ja. Konfliktreich? Ja. War es Selbstachtung? Absolut. Und ja, es war Mikrofeminismus. Sie entschieden sich übrigens für Letzteres. Jahre später schrieb mir einer von ihnen und entschuldigte sich für die Ungleichverteilung, die damals wie selbstverständlich hingenommen wurde. Obwohl das keine Aktion war, die etwas auf der Makroebene verändert hat, hat es gutgetan und mir gezeigt, dass kleine Widerstände etwas bewirken können.
Ermächtigen wir uns
Neue Wege zu gehen, ist nicht immer leicht. Es kostet Kraft, sich gegen Erwartungen zu stellen, vor allem wenn sie nie ausgesprochen werden, sondern einfach mitschwingen. Es gibt keine Garantie, dass andere mitziehen oder Verständnis zeigen. Es ist unbequem. Manchmal unfassbar unbequem. Dazu kommt: Wir wollen nicht anecken, nicht unhöflich wirken, nicht als schwierig gelten. Aber vielleicht liegt genau darin eine Möglichkeit. Im Wechsel der Perspektive, weg von »Ich will niemandem zur Last fallen« hin zu »Die Last ist ungleich verteilt, und das sollte sich ändern«.
In diesem Buch möchte ich verschiedene Bereiche beleuchten, ich nenne sie Sphären, weil sie sich nicht klar voneinander trennen lassen, sondern sich überlagern, durchdringen und gegenseitig beeinflussen. Jede dieser Sphären steht für einen sozialen Raum, in dem wir handeln, entscheiden, sprechen, schweigen, zustimmen oder widersprechen. Und genau in diesen alltäglichen Räumen wirkt das, was ich zuvor als »Nebel« beschrieben habe – das patriarchale Gefüge, das unser Denken und Handeln oft leiser prägt, als uns lieb ist. Ziel ist es, den Nebel dort sichtbar zu machen, wo er so sehr zum Alltag gehört, dass er kaum noch auffällt.
Mikrofeminismus ist nicht der Ersatz für strukturelle Veränderungen, aber ein Teil davon. Diese kleinen Handlungen markieren den Moment, in dem wir aufhören, Dinge einfach hinzunehmen. Und wenn das nicht nur eine Person tut, sondern viele, dann ist auch ein Wandel möglich. Dabei erheben die Vorschläge, die ich in diesem Buch teile, keinen Anspruch auf Vollständigkeit und gelten vielleicht nicht für alle gleich. Manchmal geht es um konkrete Entscheidungen, manchmal um einen kurzen Moment des Innehaltens. Aber sie verstehen sich als Einladung. Zum Nachdenken, vielleicht auch zum Umdenken. Sie geben uns ein Stück weit das Gefühl zurück, zwar wütend, aber nicht ganz so machtlos zu sein. Die erste Sphäre, in der das Patriarchat sichtbar wird und Mikrofeminismus seinen Platz findet, ist der Raum. Gemeint sind damit Quadratmeter oder die Straße, aber auch Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit, Geltung. Es beginnt mit der Frage, wer Raum bekommt, wem er ganz selbstverständlich zusteht und wer sich dafür rechtfertigen muss, ihn überhaupt zu beanspruchen.
Also dann: Lichten wir den Nebel.
*Frauen, Lesben, Interpersonen, nicht-binäre Personen, Transpersonen und Agender-Personen.
Mach(t) Platz! × Raum einnehmen
Frauen, die auf der Rolltreppe zur Seite treten, obwohl niemand hinter ihnen steht. Frauen, die im Zug den Sitzplatz räumen, wenn ein Manspreader sich breitmacht, die im Fitnessstudio das Gerät freigeben, noch bevor sie fertig sind, die sich auf Gruppenfotos in den Hintergrund stellen, die Schultern einziehen, um weniger Raum zu beanspruchen. Frauen, die sich kleiner machen. Körperlich, sprachlich, sozial.
In vielen Kulturen werden Frauen, Mädchen und weiblich gelesene Personen früh darauf geprägt, sich zurückzunehmen. Das geschieht eingebettet in alltägliche Situationen, wenn Mädchen für ihr angepasstes Verhalten gelobt werden, in der Schule eher für Fleiß als für kluge Ideen Anerkennung erhalten oder wenn ihre Hilfe im Haushalt als selbstverständlich gilt. Zurückhaltung wird dabei als erstrebenswert dargestellt. Die gesellschaftliche Botschaft lautet: Sei hilfsbereit, sei höflich, sei angenehm und bleib innerhalb der Grenzen dessen, was als »angemessen« gilt.
Diese Zurückhaltung ist kein Persönlichkeitsmerkmal, sondern ein kulturelles Lernverhalten, das über Generationen hinweg weitergegeben wurde. Die Soziologin Iris Marion Young beschrieb bereits 1980 in ihrer Analyse Throwing Like a Girl die körperlichen Ausdrucksformen weiblicher Sozialisation: Während Männer lernen, ihren Körper aktiv, raumgreifend und zielgerichtet einzusetzen, wird Frauen eine zurückhaltende Körperhaltung beigebracht. Den Raum, den sie dabei einnehmen, nutzen sie nicht selbstverständlich, sondern verhandeln, entschuldigen und minimieren.[2]
Das Problem dabei? Die Präsenz im Raum entscheidet darüber, wer gesehen wird, wer sprechen darf, wessen Körper als selbstverständlich empfunden wird und wer als störend gilt. In gemischten Gruppen nehmen Männer häufiger eine dominierende Haltung ein, sitzen breitbeinig oder bewegen sich ausladend, während Frauen zu kompakteren, selbstbegrenzenden Haltungen neigen.[3] Was passiert also, wenn Menschen, die früh gelernt haben, sich zurückzunehmen, beginnen, bewusst Raum einzufordern? Wenn sie ihre Meinung äußern, klar und bestimmt auftreten und sich für ihre Präsenz nicht entschuldigen? Dann verschiebt sich etwas. Und das fällt auf. Denn wer Raum beansprucht, durchkreuzt Erwartungen, die lange selbstverständlich waren.
Als Greta Thunberg sich im August 2018 mit einem selbst gemalten Schild vor das schwedische Parlament setzte, war sie 15 Jahre alt. Ihre Aktion war ruhig, aber deutlich. Thunberg wurde zum Ausgangspunkt einer weltweiten Bewegung. Während viele sie dafür bewunderten, wurde sie zugleich Ziel massiver Abwertung. Erwachsene Männer klebten Anti-Greta-Sticker neben den Auspuff ihrer Autos, als ginge von einer Schülerin eine persönliche Bedrohung aus. Kritisiert wurde sie in erster Linie nicht für ihre Inhalte, sondern für ihr Auftreten, ihr Gesicht, ihre Stimme, ihre Frisur. Ihre Präsenz irritierte, weil sie nicht der gesellschaftlichen Vorstellung entsprach, wie jemand aufzutreten hat, der Raum beansprucht. Greta Thunberg wurde nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer jugendlichen, weiblich gelesenen Identität so stark abgewertet. Es kommt eben nicht allein darauf an, was gesagt wird, sondern auch, wer es sagt, wie es gesagt wird und in welchem Körper diese Stimme spricht.
Raum ist politisch. Das birgt Risiken. Greta Thunberg wurde verspottet und massiv bedroht. Sie war gezwungen, Personenschutz in Anspruch zu nehmen, weil sie – überspitzt formuliert – nicht freundlich lächelte. Raum einzunehmen, ist auch eine Frage des Mutes. Und für alle, die sich ein Stück mehr zumuten möchten, die sich nicht länger für ihre Stimme, ihren Körper oder ihre Meinung entschuldigen wollen, die es satt haben, auszuweichen und unterbrochen zu werden, sollte klar sein: Es gab nie zu wenig Raum. Er ist nur ungerecht verteilt.
1., 2. & 3. Mikrofeminismus ist, beim Manspreading Raum zurückzuholen.
Wer regelmäßig mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, kennt es vermutlich: Meist männlich gelesene Personen spreizen beim Sitzen die Beine so weit, dass sie den Platz nebenan gleich mitbesetzen. Der Begriff Manspreading wurde 2013 erstmals im englischsprachigen Raum populär. Er war eine Reaktion auf Ungleichheiten im Körperverhalten und besonders den deutlichen Unterschied darin, wie selbstverständlich Männer und Frauen im öffentlichen Leben Raum einnehmen, insbesondere dann, wenn es auf Kosten anderer geschieht.
Obwohl Männer inzwischen aufgefordert werden, ihre Beine im öffentlichen Raum etwas weniger raumgreifend zu positionieren, scheint das weder ihre Durchsetzungskraft noch ihre Potenz nachhaltig beeinträchtigt zu haben, wie Gegenargumente behaupteten. Wenn jemand also so viel Platz beansprucht, dass der Eindruck entsteht, es sei noch jemand Unsichtbares eingeladen, darf ein Dagegendrücken, ein: »Entschuldigung, könnten Sie etwas zur Seite rücken?« oder die Bemerkung: »So funktioniert das nicht, wenn andere auch noch sitzen wollen« sein. Und als Frau kann es durchaus Mikrofeminismus sein,die Beine im Sitzennichtzwangsläufig zu überschlagen. Mädchen wird beigebracht, dass ihr Körper beobachtet, reglementiert und diszipliniert wird. Wer versteht, was hinter dem geschlossenen Sitzen steckt, erkennt darin eine still erlernte Anpassung, um möglichen Grenzverletzungen vorzubeugen. Genau hier beginnen die ersten Funken, aus denen später Female Rage entsteht.
So sitzen, wie es angenehm ist, und nicht so, wie es erwartet wird – daraus folgt, dass es Mikrofeminismus ist, die Armlehne im Flugzeug oder der Bahn zu nutzen. Die Armlehne macht deutlich, wie ungleich selbst banale Flächen im öffentlichen Raum genutzt werden. Ist es böse gemeint, wenn der Herr im Zugabteil automatisch seinen Arm ablegt? Vermutlich nicht. Für ihn ist es einfach selbstverständlich. Genau darin liegt der Unterschied. Während viele Männer das ganz beiläufig tun, ohne es zu hinterfragen, kostet es viele Frauen Überwindung, dieselbe Fläche zu beanspruchen. Auch dann, wenn sie frei ist. Bewusst eine Armlehne zu nutzen, ist somit ein leiser Einspruch gegen eine soziale Ordnung, in der Komfort oft durch Geschlecht verstärkt wird. Und wir müssen uns immer wieder vor Augen halten: Die Gewohnheit, sich zurückzunehmen, verpflichtet nicht dazu, es weiterhin zu tun.
4. Mikrofeminismus ist, sich bei Meetings nicht an den Rand zu setzen.
Natürlich spielt der Charakter bei der Platzwahl eine Rolle. Menschen, die sich im Mittelpunkt wohlfühlen, setzen sich bei Meetings oder Veranstaltungen eher in die Mitte. Aber manche Menschen fühlen sich in der Mitte einfach selbstverständlich wohler als andere. Sheryl Sandberg, ehemalige Geschäftsführerin von Facebook (heute Meta), beobachtete in ihrer Zeit im Unternehmen immer wieder, dass junge Frauen sich an den Rand des Raumes setzten und das, obwohl am Tisch noch Plätze frei waren. Sie plädierte dafür, dass Frauen sich bewusst »mit an den Tisch setzen« sollten.[4] Ich denke, so einfach ist das nicht. Der Wunsch, als höflich zu gelten, ist bei vielen tiefer verankert als der Wunsch, überhaupt sichtbar zu sein. Denn wer lernt, »ordentlich« zu sitzen, auszuweichen und Armlehnen anderen zu überlassen, denkt auch, es sei unangemessen, sich in die Mitte des Raumes zu setzen. Aber …
5. & 6. Mikrofeminismus ist, sich nicht kleinzumachen.
Wir hatten jetzt abgegebene Armlehnen und übereinandergeschlagene Beine in überfüllten U-Bahnen. Kurz gesagt: Körpersprache. Das Problem liegt darin, dass viele Frauen sich schlicht nicht sicher genug fühlen, um Raum einzunehmen. Bewusst oder unbewusst, sei es durch Sozialisierung, durch Unbehagen oder durch eine Kombination aus beiden und vielem mehr.
Das kann sich auch auf die Selbstwahrnehmung auswirken. Wer sich klein macht, fühlt sich einerseits verletzlicher und wird andererseits seltener als kompetent wahrgenommen. Bereits zwei Minuten in einer offenen, raumeinnehmenden Körperhaltung können hingegen das Selbstvertrauen steigern.[5] Das klingt ebenfalls einfacher, als es ist, denn Mikrofeminismus ist, zu erkennen, dass öffentlicher Raum für FLINTA-Personen noch immer keine Selbstverständlichkeit ist. Öffentliche Räume wie Straßen, Plätze, Bahnhöfe, Parks, Bühnen, Panels oder digitale Plattformen und sogar Stadtplanungen sind auf die Bedürfnisse von gesunden Männern ausgelegt, die den Arbeitsweg mit dem Auto bewältigen. Aber es gibt eben auch Rollstühle, Rollatoren und Kinder. Frauen bewegen sich häufiger zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in öffentlichen Verkehrsmitteln.[6] Dort, wo die Armlehne oft abgegeben wird. Sie sind durch Care-Arbeit mehrbelastet, tragen Einkäufe, Babys, Verantwortung … und stoßen dabei regelmäßig auf schlecht beleuchtete Wege, mangelnde Sitzgelegenheiten und finden keine Stillräume.
Würdest du nachts allein durch einen dunklen Park gehen? Oder wählst du die längere Strecke über die hell beleuchtete Hauptstraße? Diese Entscheidung fällt nicht einmalig, sondern immer wieder neu. FLINTA-Personen passen ihr Verhalten an. Sie wählen Umwege, meiden bestimmte Orte, tragen Kopfhörer ohne Musik, halten den Schlüssel in der Faust, schicken Nachrichten an Freundinnen auf dem Heimweg. Schon Mädchen lernen, dass Sicherheit ihre Verantwortung ist, und nicht, dass sie ein Recht auf angstfreie Bewegung haben.
Hinzu kommt eine ständige körperliche Alarmbereitschaft. Viele FLINTA-Personen rechnen damit, dass Grenzen überschritten werden. Unerwünschte Berührungen in vollen Verkehrsmitteln, Foto- oder Videoaufnahmen unter Röcken und Kleidern – Upskirting – oder sexualisierte Kommentare gehören zum Alltag. Kurz gesagt: Frauen bewegen sich nicht mit derselben Selbstverständlichkeit durch den öffentlichen Raum wie cis-Männer, unter anderem deshalb, weil diese oft Mitverursacher für Unbehagen sind. Allein die Selbstverständlichkeit, mit der männlich gelesene Personen in der Öffentlichkeit urinieren oder auf den Gehweg spucken, macht deutlich, dass der Anspruch auf Raum und Präsenz oft geschlechtlich codiert ist. Wer sich selbstverständlich bewegt, tut das oft aus einer Position von Macht oder Gewöhnung heraus.
Auch auf symbolischer Ebene ist der Raum ungleich verteilt. In den 30 größten Städten Europas sind 91 Prozent der nach Personen benannten Straßen Männern gewidmet.[7] Wir leben in Städten, die von Männern für Männer gemacht und benannt wurden – und bemerken das oft erst, wenn wir bewusst innehalten und hinschauen. Ein Satz wie »Ich fühle mich hier nicht wohl« bekommt eine andere Bedeutung, wenn wir ihn nicht als individuelles Gefühl, sondern als Hinweis auf strukturelle Ausschlüsse verstehen.
7., 8. & 9. Mikrofeminismus ist, …
sich bei Fotos nicht automatisch in den Hintergrund zu stellen. Die Position, die man auf einem Gruppenfoto einnimmt – und ob man überhaupt darauf zu sehen ist – korreliert stark mit Sichtbarkeit. Wortwörtlich. Interessanterweise machte vor einigen Jahren, als X noch Twitter hieß, die Französin Laura Vallet auf den Gender Foto Gap aufmerksam, als sie feststellte, dass in heteronormativen Familienkonstellationen meist Mütter für die Erinnerungsfotos verantwortlich sind, während Väter in spontanen, ungestellten Alltagsszenen zu sehen sind.[8] Mütter tauchen seltener auf, nicht weil sie nicht anwesend wären, sondern weil sie fotografieren, statt fotografiert zu werden. Das Sichtbarsein auf Fotos mag zunächst trivial wirken, ist aber auch ein Symbol für größere gesellschaftliche Strukturen. Folglich ist Mikrofeminismus, auf Fotos den Kopf gerade, statt leicht geneigt zu halten. Weit hergeholt? Nicht wirklich. Mein Vater machte mich vor ein paar Jahren darauf aufmerksam, dass Frauen auf Fotos häufig den Kopf zur Seite neigen. Diese Haltung wird kulturell mit Eigenschaften wie Freundlichkeit, Empathie und Zugänglichkeit verbunden. Alles Eigenschaften, die im traditionellen Rollenbild von Frauen als wünschenswert gelten. Sein Hinweis brachte mich dazu, genauer hinzusehen. Und tatsächlich: Ob in Gruppen oder allein, weiblich gelesene Personen stellen sich auf Bildern oft kleiner und niedlicher dar und neigen den Kopf zur Seite, unabhängig davon, wie alt sie sind. Auch ich ertappe mich manchmal noch dabei, obwohl ich mit meinen 1,60 Metern ohnehin schon wenig Raum einnehme. Eine Analyse von 500 Selfies auf Social Media, wovon 250 jeweils von Frauen und Männern stammen, bestätigt das. Während die Männer sich mit betonter Muskulatur oder in dominanten, geraden Posen zeigen, präsentieren sich Frauen häufiger in passiver, asymmetrischer Haltung mit abgewandtem Blick.[9] Es ist übrigens auch Mikrofeminismus, auf einem Foto nicht zu lächeln. Dieses ständige Freundlich-sein-Müssen, um als die liebenswerteste Version unserer selbst zu gelten, ist das Ergebnis einer Sozialisierung, die uns freundlich, angepasst, zuvorkommend und harmlos sehen will.
10. & 11. Mikrofeminismus ist, Männern auf dem Gehweg nicht auszuweichen.
Als ich 2024 auf meinem Instagram-Kanal über genau diesen Mikrofeminismus sprach, war die Kommentarspalte schnell mit männlicher Empörung gefüllt. Ich sei unhöflich. Unsozial. Ich würde zu Mikroaggressionen aufrufen. Die Ironie? Genau darin liegt der Kern des Problems. Denn nicht das bewusste Nicht-Ausweichen ist die Aggression, sondern die Selbstverständlichkeit, mit der erwartet wird, dass Frauen Platz machen. Viele Männer ignorieren dabei, was unzählige Frauen regelmäßig beobachten: Männer weichen nicht aus.
Dieses Verhalten hat einen Namen: Manslamming. Die Journalistin Sarah Thiele unternahm dazu einen Selbstversuch. Zwei Wochen lang versuchte sie, sich im öffentlichen Raum zu bewegen »like a man«. Ihr Fazit: »Während mir die allermeisten Frauen Platz gemacht haben, bin ich mehrfach in Männer gelaufen, die nicht einmal Anstalten gemacht haben, zur Seite zu gehen. Die Reaktionen darauf reichten von irritierten Blicken über Entschuldigungen bis hin zu Beleidigungen. Bewusst mit jemandem zusammenzustoßen, hat das erste Mal Überwindung gekostet. Danach habe ich mit der Schulter extra nachgeholfen. Die Wut stieg von Tag zu Tag.«[10]
Nein, niemand muss ab jetzt mit ausgefahrenen Schultern durch Menschenmengen rammen. Aber vielleicht sollten wir uns vornehmen, den eigenen Weg nicht automatisch zu räumen. Nicht den Konflikt zu vermeiden, sondern einfach da zu sein. Und zu bleiben. Es kann somit Mikrofeminismus sein, in der Warteschlangenichtzur Seite zu treten. Es ist dieser kleine Schritt, den viele kaum bemerken und den doch auffällig oft Frauen machen. Selbst dann, wenn er nicht notwendig wäre. Vorausschauendes Verhalten wie dieses hat sogar einen Namen: Deferenzverhalten. Es beschreibt zum Beispiel die Frau mit dem Koffer, die umständlich ausweicht, statt kurz zu warten, bis das Gegenüber Platz macht. Rücksicht zu nehmen, ist wichtig. Ohne sie funktioniert kein soziales Miteinander. Gleichberechtigung heißt jedoch auch, dass Rücksicht nicht einseitig bleibt. Dass sich alle im Rahmen ihrer Möglichkeiten bemühen und nicht automatisch davon ausgegangen wird, dass eine Seite sich anpasst.
12. & 13. Mikrofeminismus ist, …
laut und klar zu sprechen.





























