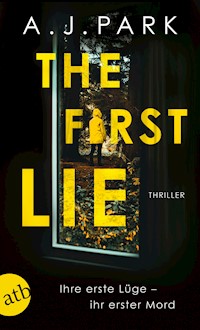
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kann man der Person trauen, die man am meisten liebt?
Paul Reeve ist auf dem Sprung zu einer großen Karriere als Anwalt, doch als er eines Tages nach Hause kommt, findet er seine Frau blutüberströmt vor. Sie hat mit einem Brieföffner in ihrem Bad einen Einbrecher getötet – aus Notwehr, wie sie behauptet. Paul sieht seine Karriere in höchster Gefahr und beschließt, zu handeln: Die Leiche muss aus dem Haus. Doch das ist nur die erste Lüge, auf die er und seine Frau Alice sich einlassen, und dann steht plötzlich die Polizei vor der Tür …
Ein packender Psycho-Thriller mit Spannungsgarantie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Kann man der Person trauen, die man am meisten liebt?
Paul Reeve ist auf dem Sprung zu einer großen Karriere als Anwalt, doch als er eines Tages nach Hause kommt, findet er seine Frau blutüberströmt vor. Sie hat mit einem Brieföffner in ihrem Bad einen Einbrecher getötet – aus Notwehr, wie sie behauptet. Paul sieht seine Karriere in höchster Gefahr und beschließt, zu handeln: Die Leiche muss aus dem Haus. Doch das ist nur die erste Lüge, auf die er und seine Frau Alice sich einlassen, und dann steht plötzlich die Polizei vor der Tür …
Ein packender Psycho-Thriller mit Spannungsgarantie
Über A.J. Park
A.J. Park ist das Pseudonym eines internationalen Thrillerautors. Er hat, bevor er Romane zu schreiben begann, als Journalist und Schauspieler gearbeitet. Er lebt in London.
Wolfgang Thon, geboren 1954 in Mönchengladbach, studierte Sprachwissenschaft, Germanistik und Philosophie in Berlin und Hamburg. Thon arbeitet als Übersetzer und seit 2014 auch als Autor in Hamburg, tanzt leidenschaftlich gern Argentinischen Tango und hat bereits etliche Thriller von u.a. Brad Meltzer, Joseph Finder, Robin Hobb, Steve Barry und Paul Grossman ins Deutsche übertragen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
A.J. Park
The First Lie
Ihre erste Lüge – ihr erster Mord
Aus dem Englischen von Wolfgang Thon
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
P (2. Oktober)
A
Kapitel 1 (4. September – ein Monat zuvor)
P (2. Oktober)
A
Kapitel 2 (12. September – drei Wochen zuvor)
P (10. Februar – vier Monate später)
A
P
A
P
A
Kapitel 3 (20. September)
P (13. März)
A
Kapitel 4
P
Kapitel 5
A
P
A
Kapitel 6
P (29. März)
A
Kapitel 7
P
A
Kapitel 8
A
P
A
Kapitel 9
P
A
P
A
Kapitel 10
P
A
Kapitel 11
P
A
P
Kapitel 12
P
A
Kapitel 13
P
A
Kapitel 14
P
A
P
Kapitel 15
P
Kapitel 16
P
A
Kapitel 17
Kapitel 18
P
A
Kapitel 19 (28. November)
Impressum
»Birg, falscher Schein, des falschen Herzens Kunde!«
Macbeth, William Shakespeare
2. Oktober
P
Als ich sehe, dass die Vordertür offen steht, trete ich abrupt auf die Bremse.
Sechs verpasste Anrufe.
Ich nehme mein Handy vom Beifahrersitz und springe aus dem Wagen.
Weshalb ist Alice nie ans Telefon gegangen, wenn ich zurückgerufen habe? Warum zum Teufel steht die Eingangstür offen? Warum ist es im Haus stockdunkel?
Es ist neun Uhr abends, und drinnen ist es ebenso dunkel wie draußen – so schnell ich kann laufe ich an Alices Mercedes-Cabrio vorbei zur Eingangstür.
Alice hatte mich wohl schon vor drei Stunden erwartet, aber ich war wieder zur Arbeit zurückgerufen worden. Ich hätte ihr Bescheid sagen sollen, dass ich aufgehalten worden war, aber auf der Arbeit war viel los gewesen, und ich hatte mich gleich wieder in meine Aufgaben hineingestürzt. Ich habe letzte Vorarbeiten zu einem Fall erledigt, der hoffentlich mein letzter als Strafverteidiger bei Blacksmith’s – einer der Top-Anwaltskanzleien Londons – sein wird. Es folgen Gespräche mit dem Komitee, und dann trifft der Ausschuss die endgültige Entscheidung darüber, wer zum nächsten Bezirksrichter ernannt wird. Falls man mich auswählt, werde ich mit meinen siebenunddreißig Jahren der jüngste Richter in der Geschichte Großbritanniens sein. Ich bin dann am Zentralen Strafgerichtshof tätig, besser bekannt als Old Bailey, aber auch an anderen Gerichtshöfen im Südosten des Landes.
Alice hat Geduld mit mir, sie weiß, unter welchem Druck ich stehe, deshalb ruft sie auch nie an, um nachzufragen, ob ich später nach Hause komme. Sechs verpasste Anrufe bedeuten also, dass etwas nicht stimmt. Und jetzt sehe ich mich am Rand eines schwarzen Lochs und habe keine Ahnung, was mir bevorsteht.
Ich stürme ins Haus, kann im Flur kaum etwas erkennen, mich aber trotzdem orientieren. Ich rufe nach Alice und versuche, nicht besorgt zu klingen, aber das gelingt mir gewiss nicht. Niemand antwortet, und mein Herzschlag beschleunigt sich. Ich schalte das Flurlicht ein und laufe nach rechts ins Bad. Danach weiter geradeaus in die Küche. Dann um die Ecke ins Wohnzimmer und gleich dahinter in das große Esszimmer.
Nichts, keine Spur von Alice.
Normalerweise würde das Haus in Festbeleuchtung strahlen. Alice wäre im Wohnzimmer, mit einem Glas Rotwein in der Hand, und der Fernseher liefe.
Normalerweise wäre sie mir an der Haustür entgegengekommen. Wir hätten uns geküsst, ich hätte meine Hände auf ihre Hüften gelegt und sie mit ihren über mein Gesicht gestreichelt, so sinnlich wie an jenem Tag vor zehn Jahren, als wir uns kennenlernten.
Normalerweise, aber nicht heute.
Ich nehme zwei Treppenstufen auf einmal und bin zu schnell, um den Lichtschalter zu erwischen. Oben ist es ebenfalls still, deshalb bleibe ich stehen. Alle Türen vor mir sind geschlossen. »Alice?«, rufe ich, zögerlicher als zuvor. Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht.
Ich versuche es bei den ersten beiden Türen. Nichts. Dann bin ich an der dritten, der zu meinem Büro. Als ich gerade meinen Kopf hineinstecke, kommt ein seltsam ersticktes Geräusch aus unserem Schlafzimmer am anderen Ende des Flurs. Ich gehe darauf zu, am Badezimmer vorbei. »Alice?«, wiederhole ich fast flüsternd.
An der Tür atme ich tief durch und packe die Türklinke. Im Raum erwartet mich absolute Dunkelheit. Ohne lange nachzudenken stürze ich mich mit geballten Fäusten kampfbereit hinein. Ich bin bereit, weiß nur nicht, wofür.
Es dauert einen Moment, bis sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, dann erkenne ich eine Silhouette.
Jemand sitzt auf dem Bett.
»Alice«, sage ich sanft. Sie sitzt zum Wandschrank gedreht, und ich sehe ihren Kopf im Profil. Sie hat mich anscheinend nicht wahrgenommen, und falls doch, reagiert sie nicht auf meine Anwesenheit.
»Alice!«, sage ich jetzt in normaler Lautstärke und längst nicht mehr so besorgt.
Sie dreht sich langsam um.
Als sie nicht antwortet, fasse ich zum Lichtschalter.
»Nein!«, schreit sie plötzlich; es klingt gequält. »Mach nicht das …«
Ich weiche zurück, aber mein Arm bleibt ausgestreckt, und ich berühre den Schalter. Im Zimmer wird es hell.
Sie ist bleich, ihre Wangenknochen und ihre Augen sind feucht. Ihre weiße Bluse ist aufgeknöpft und voller Blut, auch ihre nackte Haut ist damit bedeckt. Sie hat Blut an den Händen und im Haar, auch auf ihrem Gesicht. Sie sieht aus wie Lady Macbeth nach der Ermordung Duncans.
Ihr Anblick verschlägt mir den Atem. »Alice, was …?«
»Das Badezimmer«, schluchzt sie. Ich will sie in die Arme nehmen, doch sie wehrt mich mit erhobenen Händen ab. »Bitte! Das Badezimmer!«
Ich lasse sie, wo sie ist, und eile ins Badezimmer. Ich stoße die Tür auf, schalte das Licht ein und krümme mich beim Anblick, der sich mir bietet.
Über dem Badewannenrand liegt ein Mann mit dem Gesicht im Wasser, es ist schaumig und voller Blut. Sein Nacken sieht förmlich zerfetzt aus – mein Brieföffner, der wie ein Dolch geformt ist, ragt daraus hervor. Normalerweise liegt er auf meinem Schreibtisch, aber heute Morgen hatte ich im Schlafzimmer die Post von gestern gelesen und ihn danach auf Alices Schminktisch zurückgelassen.
Am liebsten würde ich schreien, aber was ich hier sehe, übersteigt mein Fassungsvermögen, und mir fehlen die Worte. Dann ziehen mich plötzlich Hände vom Tatort weg, in den Flur. Dort drückt mich Alice an die Wand.
»Paul«, sagt sie und packt meine Schultern.
Ich sehe nur das Blut auf ihrer Haut und ihrer Kleidung.
»Es ist nicht so, wie es aussieht«, sagt sie panisch. Offenbar spürt sie meine Besorgnis und Verwirrung. Sie sucht meinen Blick. »Du kennst mich. Ich bin deine Frau. Bitte, du musst mir glauben!«
Ich versuche, ihren Blick auszuhalten, auch wenn das nicht einfach ist und mir dabei alle möglichen Gedanken durch den Kopf schießen. »Alice«, frage ich, »was hast du getan?« Dann wiederhole ich, langsamer: »Was hast du getan?«
A
»Es ist nicht so, wie es aussieht. Du kennst mich. Ich bin deine Frau. Bitte, du musst mir glauben!«
Einen Moment lang starrt er mich nur an und sagt kein Wort. Ich sehe, dass er unter Schock steht.
Als er spricht, flüstert er, als ob man uns belauschen würde. »Alice, was hast du getan?«
»Ich hatte keine Wahl.« Ich klammere mich an sein Revers und schlage verzweifelt mit den Fäusten auf seine Brust. »Ich hatte keine Wahl.«
Er umarmt mich. »Wie? Weshalb?«
»Er war in unserer Wohnung!«
Er lässt mich los und blickt wieder in den Raum, wo der Körper dieses Fremden halb in der Badewanne liegt.
»Was ist passiert?« Paul klingt atemlos.
Ich ziehe ihn hinter mir her ins Schlafzimmer und spreche so schnell und klar, wie ich kann, obwohl ich einen stechenden Schmerz in meiner Brust verspüre. »Ich hatte mir gerade ein Bad eingelassen. Es lief Musik … ich hatte die Bluetooth-Lautsprecher da drin eingeschaltet. Gerade wollte ich das Schlafzimmer verlassen, als ich ihn sah – er war plötzlich da, wie aus dem Nichts –, aber aus irgendwelchen Gründen sah er mich nicht, Gott weiß warum. Er hatte so eine Art … Draht in den Händen. Ich konnte sehen, wie er damit in Richtung Badezimmer ging. Er war … Oh, Paul, ich wusste, dass er es auf mich abgesehen hatte, ich wusste es einfach!«
Er sieht verwirrt aus. »Aber weshalb?«
»Ich weiß es nicht«, schluchze ich. »Ich weiß nur … ich dachte, er will mich … er will mich umbringen. Paul, ich habe im ganzen Leben noch nie so viel Angst gehabt. O Gott. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich sah den Brieföffner auf dem Schminktisch und habe einfach danach gegriffen, ohne nachzudenken. Ich wusste kaum, was ich tat, und dann war ich da drin. Ich habe ihn hinten im Nacken erwischt, habe wieder und wieder zugestoßen. Ich konnte nicht aufhören. Ich konnte es nicht, Paul, ich dachte, er wollte mich töten. Ein fremder Mann in unserer verdammten Wohnung! Hier sollten wir doch sicher sein!« Ich starre auf meine blutigen Hände und mein Körper zittert unkontrolliert. »Warum, Paul? Warum war er hier? Warum musste er in unser Haus kommen?« Ich schluchze, er nimmt mich wieder in die Arme und versucht, mich zu beruhigen. »Warum ich? O mein Gott, was habe ich getan, Paul, was habe ich getan?«
Er drückt mich an sich. Ich möchte mich in seiner Umarmung geborgen fühlen, aber das tue ich nicht. Ich fürchte, nichts wird jemals wieder ändern können, was ich jetzt empfinde.
Es gibt nichts, was die Sache besser machen könnte.
»Es ist okay, ganz ruhig. Es ist okay, Liebling. Ich bin bei dir.«
Ich schmiege mich tiefer in seine Umarmung und wünsche mir, ich könnte mich darin auflösen und weit von hier weggebracht werden. Ganz weit weg von dem, was ich getan habe.
Er atmet schwer, aber er ist gefasst. Das sollte mich beruhigen. Ich wünschte, es wäre so. »Küss mich, bitte«, flüstere ich in sein Jackett.
Er versucht, mich aus dieser Gletscherspalte zu ziehen, in die ich gefallen bin, aber mein Körper widersetzt sich.
»Bitte«, wiederhole ich gegen diesen Widerstand. »Küss mich.«
Er streichelt mir übers Haar. Ich spüre seine Berührung im ganzen Körper, lege den Kopf in den Nacken und schaue ihm in die Augen. Seine Lippen nähern sich meinen, und für einen Moment fühle ich mich ganz leicht, so, als würde ich auf einer Wolke sitzen und auf eine glücklichere Zeit hinuntersehen, auf früher, als wir uns zum ersten Mal küssten, oder unseren ersten Kuss als verheiratetes Paar. Das war an einem provisorischen Altar an dem Karibikstrand, wo wir geheiratet haben. Seine Küsse und seine Berührungen haben die Macht, alle meine Ängste verschwinden zu lassen. Jetzt zieht er mich damit von einer Tragödie weg, die, wie ich fürchte, unser künftiges Leben ruinieren wird. Und Gott sei Dank – es funktioniert.
»Oh, Paul«, seufze ich und lasse mich fallen.
Er küsst mich weiter, ich drücke meinen Kopf an seine Brust, schlinge die Arme um seinen Hals, und er legt die Arme um meine Schultern. Wir halten uns ganz fest.
»Das Leben wird nie wieder so sein wie früher«, flüstere ich.
»Doch«, antwortet er leise, »wird es. Wir finden einen Weg. Alles wird gut.«
Nach ein paar Minuten bringt er mich sanft ins Schlafzimmer und legt mich aufs Bett. »Bleib hier«, sagt er und verschwindet nach unten. Ohne ihn wird das Zittern stärker, ich flüstere leise seinen Namen, und Tränen strömen aus meinen Augen. Als er ein paar Minuten später zurückkommt, bin ich unglaublich erleichtert. Er hat eine große Schüssel und einen Waschlappen dabei. »Jetzt machen wir dich erst mal sauber«, sagt er und kniet sich neben das Bett. Langsam und sorgfältig taucht er das Tuch ins Wasser und wischt damit über mein Gesicht. Es ist so warm und angenehm, dass meine Widerstände dahinschmelzen. Ich sehe ins Wasser. Jedes Mal, wenn er das Tuch wieder hineintaucht, verfärbt sich das Wasser stärker.
»Sieh nicht hin«, beschwört er mich. »Lass mich einfach machen. Du wirst dich besser fühlen, wenn ich fertig bin und alles weg ist.« Ich zittere, und mein Schluchzen wird wieder lauter. »Wir kriegen das alles hin.«
»Wie denn?«, frage ich fast unhörbar.
»Ich brauche nur Zeit zum Nachdenken. Ich werde schon dafür sorgen, dass wir alles richtig machen.« Er wischt über mein Gesicht, meinen Hals, meine Brust und dann über meinen Bauch.
»Ich habe einen Mann ermordet, Paul.«
»Er ist in unsere Wohnung eingedrungen, Alice. Du hattest keine andere Wahl.«
»Aber ich habe trotzdem jemanden umgebracht! Diese Hände …« Ich halte sie hoch und sehe, wie sie zittern. »Ich habe jemanden getötet!«
Paul unterbricht seine Tätigkeit, blickt mir in die Augen und drückt seine Lippen auf meine. Er stellt die Schüssel auf den Boden, und ich spüre seine Hände in meinem Haar. Er massiert meine Kopfhaut. Dann küsst er mich auf beide Wangen. »Du bist aber nicht allein. Ich bin bei dir. Ich werde dir helfen. Wir stehen das zusammen durch.«
Er nimmt die Schüssel hoch und streicht mir mit dem Waschlappen über die Unterarme.
»Was wird jetzt mit mir passieren?«
Er stellt die Schüssel wieder ab und streichelt mit der Rückseite seiner Finger über meine rechte Wange. Ich weiß, dass er eine Antwort darauf hat, aber er wird sie nicht laut aussprechen.
»Muss ich ins Gefängnis?«, frage ich.
Er lächelte mich an. Es sieht wie ein unbeschwertes Lächeln aus, aber er überspielt damit seine wahren Gefühle. Und er hat noch kein Wort gesagt.
»Sollen wir die Polizei rufen, Paul?«
Als er stumm bleibt und mich weiter nur anlächelt, was allmählich hilflos und voller Zweifel wirkt, wiederhole ich die Frage eindringlicher. »Sollen wir das tun, Paul?« Ich weine jetzt nicht mehr.
Ich sehe, dass er Ja sagen möchte und noch nicht weiß, wie. Dann nickt er, senkt jedoch dann den Kopf und schüttelt ihn schließlich. »Nein«, sagt er, ohne den Blick vom Boden zu heben. »Nein, wir sollten die Polizei nicht rufen.«
»Weil du es weißt?«
»Weil ich es weiß.« Er schüttelt energisch den Kopf, legt die Hände auf meine Knie und drückt sie zu fest. »Natürlich sollten wir die Polizei rufen, Alice. Wir sollten sie verständigen und ihnen genau sagen, was passiert ist.« Er sieht sehr angeschlagen aus, als ob er gerade etwas Furchtbares erfahren und noch nicht ganz verarbeitet hätte.
»Aber ich habe einen Mann getötet, Paul.«
»Ich weiß …«
Er schließt die Augen und nickt langsam.
»Was bedeutet das für mich, Paul?«
Er stützt die Stirn in seine Handflächen. Ich blicke zu meinem Schoß hinunter, wo meine Hände sind. Von den Handflächen hat er mir das Blut nicht abgewaschen – ich führe sie dichter an meine Augen, um den Beweis meiner Tat besser zu sehen. Dann wende ich mich zu ihm.
»Schau doch«, sage ich kläglich und strecke sie aus. Er blickt auf. »Schau und sag mir, was du siehst!« Ich bilde mir ein, Tränen in seinen Augen zu sehen. »Wonach sehe ich für dich aus? Sag schon.«
Er keucht, legt wieder die Hand an meine Wange. »Du hast dich nur verteidigt.«
»Danach sieht es aber nicht aus, oder?«
Er schüttelt den Kopf. »Nein, das tut es nicht, aber du hast dich selbst verteidigt. Er war immerhin bei uns zu Hause.«
Paul, der normalerweise selbstbewusst wirkt und bei allem so sicher zu sein scheint, wirkt verwirrt.
»Es tut mir so leid.«
»Oh, Alice …«
»Tut mir leid. Ich habe … alles … kaputtgemacht.«
»Dir braucht nichts leidzutun. Du musstest dich selbst verteidigen. Sonst wärst du jetzt tot. Und ich könnte nicht ohne dich leben.«
»Du kannst mich immer noch verlieren. Ich könnte im Gefängnis enden.«
»Du hattest keine Wahl.«
»Ich sehe es in deinen Augen, Paul. Du weißt, was mit mir passieren wird. Und du wirst erledigt sein. Alles, wofür du gearbeitet hast. Es ist ausgeschlossen, dass sie dich befördern, wenn deine Frau eine überführte Mörderin ist.«
»Du hattest keine Wahl«, sagt er nachdrücklicher, und plötzlich steht er auf. Die Veränderung seiner Bewegungen und seines Tonfalls erschreckt mich.
Er wird ruhig und blickt auf mich hinunter. »Du hattest keine Wahl«, sagt er kühl und professionell. »Er wollte dich umbringen. Und jetzt haben wir keine andere Wahl.«
Ich beuge mich vor. »Wie meinst du das?«
»Vertraust du mir, Alice?«, fragt er.
»Mit jeder Faser meines Körpers.«
»Wenn ich doch nur hier gewesen wäre …«
Ich nicke.
»Aber jetzt bin ich für dich da.« Dann spricht er plötzlich schneller, als ob er die Worte selbst nicht hören will. »Wir müssen die Leiche loswerden.«
4. SEPTEMBER – EIN MONAT ZUVOR
1
Detective Sergeant Katherine Wright und Detective Constable Ryan Hillier trafen in Kendall Green ein. Sie waren Teil des Major Investigation Teams der Mordkommission Nordwest, einer Spezialeinheit der Kriminalpolizei. Detective Wright parkte das Auto, und sie stiegen aus. Ihr ziviler Wagen war einer von vielen Polizeifahrzeugen, die auf der Straße und rings um den Wohnblock standen. Sie sollten dort bis zur Ankunft ihres Vorgesetzten Detective Superintendent Jonathan Lange, des Leiters des MIT, die Ermittlungen am Tatort übernehmen und die Erkenntnisse der Ermittler und Beamten vor Ort zusammenstellen.
Wright ließ den Blick über das düstere Panorama schweifen, das Kendall Green zu dem hinlänglich bekannten Schandfleck machte. Der Wohnblock hatte die Form eines großen L, war sehr breit, sehr braun, sehr heruntergekommen und nur vier Stockwerke hoch. Trotzdem gab es dort über hundert Wohnungen, in denen insgesamt fünfhundert Bewohner untergebracht waren. Alles wirkte auf den ersten Blick ziemlich verwahrlost, aber die Eigentumswohnungen konnten beim Verkauf durchaus mittlere sechsstellige Beträge einbringen. Der Block gehörte zum Postbezirk NW5, lag also nahe genug am Stadtzentrum Londons, um Wucherpreise bei Verkäufen und exorbitant hohe Monatsmieten zu rechtfertigen. Wright und Hillier zückten ihre Dienstausweise, durchquerten die Polizeiabsperrung und gingen zum Eingang des Blocks. Ihr Ziel war Apartment Nummer 74. Man hatte sie bereits darüber informiert, was sie dort erwartete, aber auch solche Vorwarnungen konnten das unangenehme Gefühl nicht lindern, das eine natürliche Begleiterscheinung dieses Berufes war. Trotz Wrights achtjähriger Erfahrung als Detective hatte sie sich nicht an solche Situationen gewöhnt. Polizisten, auf diese Feststellung legte sie Wert, waren auch Menschen – ganz gleich, wie Kinofilme das darstellten oder was die Jugendlichen so dachten. Man gewöhnt sich nie daran. Man muss einen Weg finden, um das, was man sieht, nicht an sich heranzulassen und damit fertigzuwerden.
Oder man muss aussteigen.
Genau darüber dachte sie seit geraumer Zeit nach.
Wie üblich bei so einem Einsatz sprachen die beiden Detectives nicht mehr miteinander, nachdem sie ihren Wagen verlassen hatten – sie brauchten Zeit, um sich vorzubereiten. Der Fahrstuhl brachte sie in den dritten Stock, dort gingen sie den Korridor entlang. Ein Polizist hielt vor der Tür mit der Nummer 74 Wache. Die Wohnungstür war gepflegt und in einem leuchtenden Blau gestrichen, was einen starken Kontrast zum Äußeren des Gebäudes bildete.
Wright und Hillier zeigten ihre Dienstausweise vor; der Officer nickte und trat sofort zur Seite. Beide Detectives legten Schutzhandschuhe und Überzieher für die Schuhe an, die sie am Ende ihres Einsatzes zurücklassen würden. Sie wurden sorgfältig kontrolliert, damit sie nicht unabsichtlich Beweismittel vom Tatort entfernten. Wright ging voran.
Die Wohnungseinrichtung passte zur Tür: Sie war makellos, hell, modern und teuer. Dieses Apartment wirkte wie ein Fremdkörper in dem Haus, in dem sie sich befand.
Der Flur war leer, Wright und Hillier gingen vorbei an der Küche auf der rechten und dem Schlafzimmer auf der linken Seite. Das Bad befand sich rechts von ihnen – es war niemand darin. Am Ende des Flurs lag ein geräumiges und helles Wohnzimmer mit einem Esstisch und Stühlen, daneben ein Ecksofa und ein an der Wand montierter Fernseher.
Verschiedene Kriminaltechniker in weißen Overalls sicherten Fingerabdrücke, fotografierten, steckten Gegenstände in Beutel und gingen ihren zahllosen weiteren Aufgaben nach.
Mitten auf dem großen Sofa war Richard Dollard, der Besitzer und einzige Bewohner der Wohnung. Er saß aufrecht da und hatte die Hände in den Schoß gelegt. Sein Kopf war unnatürlich weit nach hinten gekippt, weil jemand ihm die Kehle durchtrennt hatte. Die Wunde war tief – so tief, dass es von Weitem betrachtet aussah, als würde sein Kopf nur von der Haut in seinem Nacken festgehalten. Auf seinem weißen Hemd war das Blut bereits angetrocknet, und der oberste Knopf war offen. Auch das cremefarbene Sofa hatte eine Menge Blut abbekommen.
Wright und Hillier gingen bis vors Sofa und stellten sich neben einen Mann mittleren Alters, der die Spurensicherung leitete. Daniel Emerson hatte kaum noch Haare auf dem Kopf, und Wright kannte ihn gut, zu gut. Seine Anwesenheit erinnerte sie immer schmerzhaft daran, dass der Tod mit zahllosen Rätseln verknüpft war, von denen manche zu schwierig waren, als dass man sie jemals lösen konnte.
»Dan«, begrüßte sie ihn knapp.
»Katie.« Er war der einzige Kollege, der sie so nannte. Obwohl sie außerhalb der Arbeit nichts miteinander zu tun hatten, kamen sie gut miteinander aus. Das ging auch gar nicht anders, nach allem, was sie bereits zusammen gesehen hatten – bei ihren Berufen wurde jeder stützende Arm benötigt, Freundlichkeit und vertrauter Umgang halfen sehr.
»Was haben Sie bis jetzt?«
»Wir haben eine Art Draht gefunden. Sehr scharf. Hat direkt ins Fleisch geschnitten. Er hat nicht mal versucht, sich zu wehren. Allerdings hätte der arme Kerl sowieso keine Chance gehabt. Er hat ferngesehen und es wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Der Täter stand hinter ihm, hat sich vorgebeugt und den Draht nach hinten gerissen – er hat seinen Hals wie Butter durchtrennt.«
»Wie ist er hereingekommen?«, fragte sie.
»Die Haustür wurde mit einem Dietrich geöffnet. Soweit wir das bisher beurteilen können, steht alles noch an seinem Platz. Es gibt viele Fingerabdrücke, aber die können auch von ihm oder irgendwelchen früheren Besuchern stammen – das ist sogar ziemlich wahrscheinlich. Es kann eine Ewigkeit dauern, bis wir alles abgeglichen haben. Vielleicht schaffen wir es nie. Es gibt nicht viele Leute, die so ein Schloss aufbekommen und alles sauber hinterlassen. Das viele Blut und kein Fußabdruck … Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich könnte mich nicht an jemanden heranschleichen, der so jung ist wie der hier, und damit so leicht davonkommen. Wer auch immer das getan hat, hat Selbstbewusstsein. Und zwar jede Menge.«
»Gibt es noch mehr zur Tatwaffe zu sagen?«
»Es war ein scharfer Draht – mehr haben wir zurzeit nicht. Aber wenn man sich den Schnitt ansieht und wie leicht und sauber er durch die Haut gegangen ist, würde ich auf Klavierdraht tippen. Früher hätte man gesagt, er wurde garrottiert.«
»Garrottiert? Klavierdraht?«, wiederholte sie.
»Das funktioniert immer«, nickte er. »Und zwar mühelos.«
Wright begegnete diese Methode zum ersten Mal, obwohl sie seit fast einem Jahrzehnt bei der Londoner Mordkommission arbeitete. »Aber Klavierdraht hat ein Durchschnittsmensch nicht gerade zu Hause herumliegen.«
»Allerdings.«
»Und normalerweise würde man auch nicht so einfach darauf kommen, das als Mordwaffe zu benutzen.«
»Sie nehmen mir die Worte aus dem Mund.«
»Ryan«, wandte sie sich an Hillier, »finden Sie heraus, wo hier in der Gegend und generell in der Stadt Klavierdraht verkauft wird.«
»Dafür gibt es bestimmt eine Menge Läden, könnte ich mir vorstellen.«
»Denke ich auch. Aber lassen Sie es uns versuchen. Man kann nie wissen. Vielleicht gibt es hier in der Nachbarschaft ein Geschäft, das uns auf die Spur von jemandem bringt«, sagte sie, ohne selbst auch nur eine Sekunde lang daran zu glauben. »Außerdem sollten wir versuchen, die Sache methodisch anzugehen. Finden Sie raus, ob es in den letzten … sagen wir fünf Jahren … aufgeklärte oder ungelöste Mordfälle gab, bei denen Klavierdraht verwendet wurde.«
»Nur fünf Jahre?«
»Fangen Sie mit fünf an, und sehen Sie, was Sie herausfinden. Wenn das nichts bringt, erweitern Sie den Zeitrahmen auf zehn Jahre.«
Sie wandte sich an Emerson und deutete auf die Leiche. »Darf ich?«
»Klar.« Er trat einen Schritt zurück und zog die Handschuhe aus. »Ich kann sowieso einen Kaffee gebrauchen.« Er verließ die Wohnung ohne eine weitere Bemerkung.
»Sehen wir uns auf der Wache?«, fragte Hillier.
»Klar, Ryan. Wenn Lange auftaucht, berichte ich ihm, was passiert ist. Nehmen Sie den Wagen.« Sie reichte ihm den Schlüssel.
Er berührte freundschaftlich ihren Arm, nahm den Schlüssel und ging.
Wright richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Leiche. Das war kein Mensch mehr, kein Richard Dollard. Sie versuchte, nicht allzu genau in die Wunde hineinzusehen, weil sie sich den Anblick nicht einprägen wollte. Allerdings befürchtete sie, dass die Erinnerung an diese Szene sie noch lange verfolgen würde. Noch ein Bild, das sich zu der Flut der anderen gesellte, die sie auch nicht mehr verdrängen konnte.
Sie beugte sich vor und blickte prüfend in die toten Augen, hoffte auf Hinweise, ein Zeichen, irgendeine Art von Hilfe. Augen, die sie verfolgen würden, so wie all die anderen.
Sie schluckte die Galle hinunter, die in ihrer Kehle nach oben stieg. Sie hätte gern geweint. Wieder ein Leben ausgelöscht.
Schließlich war sie ein Mensch.
Tote Augen.
2. Oktober
P
»Ich muss nachdenken. Wir müssen die Sache richtig anpacken.«
Wir müssen das Haus wieder in unser Haus verwandeln. Nichts darf darauf hindeuten, dass dieser Mann hier gewesen ist. Es dürfen keine Spuren davon zurückbleiben, dass hier heute Abend etwas Schreckliches passiert ist.
»Wir müssen sehr sorgfältig vorgehen«, sage ich zu Alice. »Wir müssen ihn wegschaffen und das Haus gründlich reinigen. Ich habe Fälle gesehen, in denen schon ein mikroskopisch kleiner Fleck zu einer Verurteilung geführt hat.«
Es fällt mir nicht leicht, uns als Kriminelle zu sehen, doch genau das werden wir sein, wenn wir unseren Plan durchziehen. Alice gegenüber bezeichne ich uns lieber nicht so, denn sie ist schon aufgeregt genug. Das könnte ihr den Rest geben.
»Ein einziges Haar oder eine Faser seiner Kleidung könnte ihn mit uns in Verbindung bringen. Das würde reichen, falls die Polizei danach sucht.«
Aber warum sollten sie bei uns zu Hause auftauchen?
»Schaffst du das?«, frage ich.
Sie atmet tief durch und nickt. »Ich werde alles tun, was du für nötig hältst.«
»Aber du kannst es dir hinterher nicht mehr anders überlegen.«
»Trotzdem.«
»Dann holen wir uns jetzt unser Leben zurück. Besorg uns zwei Paar Gummihandschuhe, etwas Klebeband und zwei schwarze Säcke.« Sie geht sofort los. Inzwischen nehme ich eine alte Decke aus dem Wäscheschrank und breite sie im Flur direkt vor dem Badezimmer aus. Für Alice hole ich einen frisch gewaschenen Pullover, dann laufe ich die Treppe hinunter und ziehe gerade ein paar alte Stiefel an, als sie aus der Küche kommt. »Hast du so etwas wie diese Gummistiefel? Schuhe, die wir wegwerfen können, wenn wir hier fertig sind?«
Sie nimmt schmutzige Turnschuhe aus dem Schuhschrank neben der Treppe. Ich reiche ihr den Pullover, und sie streift ihn über. Mit unseren Schuhen steigen wir in einen schwarzen Sack und schneiden Löcher für die Beine hinein. »Und jetzt mach da ein Loch hinein und zieh ihn dir über den Kopf«, sage ich und halte ihr einen anderen schwarzen Sack hin. »Dann noch Löcher für deine Arme.« Ich verwende das Klebeband, um den schwarzen Sack an ihr zu befestigen. »Kleb das genauso an mir fest.« Während sie damit beschäftigt ist, frage ich: »Hast du irgendwelche Badehauben, solche Dinger, die man in der Dusche trägt?«
»Einwegduschhauben, ja.«
»Hol zwei. Unbenutzte. Wir müssen so viel von uns verdecken, wie wir können. Kein Haar von uns darf auf ihn fallen. Um den Fußboden und die Wohnung kümmern wir uns später, das können wir in Ruhe machen, aber wir müssen verhindern, dass ihn jemand ausgräbt und etwas von uns an ihm haftet.«
Das Klebeband ist alle. Ich gehe in die Küche, ohne mich um den Dreck zu kümmern, den meine Stiefel auf den glänzenden Fliesen zurücklassen, und suche nach mehr. Ich finde eine ganze Rolle und gehe damit gerade zurück in den Flur, als Alice die Treppe herunterkommt. »Ich habe nur eine Duschhaube gefunden.«
»Mist«, erwidere ich. »Okay, du hast das längere Haar, also nimm du sie. Binde dein Haar richtig fest zusammen und zieh die Haube so tief darüber, wie du kannst, damit alles bedeckt ist.«
Wir gehen die Treppe hinauf. Oben sucht sich Alice ein paar Bänder und Haarclips, und ich nehme mir einen Pullover aus dem Schlafzimmerschrank. Ich habe einen mit Bändern an der Kapuze, die man zuziehen kann. Das muss reichen.
»Wer um alles in der Welt könnte er sein?«, fragt sie, als sie zurückkommt.
»Wahrscheinlich irgendein zugedröhnter Psychopath. Ich frage mich, ob er einen Ausweis bei sich hat.«
»Nein, hat er nicht. Ich habe schon nachgesehen.«
»Du hast nachgesehen?«, sage ich ganz plötzlich, als mir klar wird, welchen Fehler sie begangen hat. »Du hast eine DNS-Kontamination riskiert, Alice. Das hättest du nicht tun dürfen!«
Sie schlägt die Hände vors Gesicht. »Das wusste ich nicht, Paul. Das wusste ich doch nicht!«
»Wir sollten die Leiche eigentlich verbrennen«, sage ich leise zu mir selbst, aber Alice hört es.
Sie klingt erschrocken. »Verbrennen?«
Ich schließe die Augen und stöhne. »Nein, es ist nur … Ach, vergiss es, ich hätte nichts sagen sollen. Tut mir leid, ich habe es nicht so gemeint.«
Wir gehen in den Flur. Ich überprüfe Alices Duschhaube. »Sitzt eng genug«, sage ich. »Gut. Streck die Hände aus.« Ich ziehe ihr die Gummihandschuhe über, klebe sie mit Klebeband an ihren Pulloverärmeln fest und wickele es dann ein paarmal herum. »Fest genug?«
»Fast zu fest.«
»Perfekt. Mach dasselbe bei mir. So fest du kannst.«
Nachdem sie das letzte Stück Klebeband befestigt hat, frage ich sie: »Bereit?« Ich sage nicht, wofür. Sie weiß instinktiv, was ich meine. Ich führe sie zum Badezimmer. Wir nähern uns ihm nicht direkt, sondern bleiben an der Tür stehen und fassen uns an den Händen. Keiner von uns beiden möchte hineingehen.
Ich bin der Erste, der sich vorwärtsbewegt, Alice bleibt bei der Tür. Ich gehe vorsichtig Richtung Badewanne, auf mein Ziel zu. Hin zu der Leiche in meinem Badezimmer – wer auch immer der Mann gewesen sein mag. Ich sehe die Stiefel mit den dicken Sohlen. Dann die dunkle Jeans. Ein schwarzer Pullover. Der zerfetzte, blutige Hals.
Ich will ihn aus der Badewanne herausholen, aber nichts geschieht, als ich versuche, ihn nach hinten zu ziehen. Er ist riesig und schwer wie Blei. Ein totes Gewicht.
Als sie sieht, wie ich mich quäle, kommt Alice mir zu Hilfe. Sie hält sich an meinem rechten Arm fest und geht hinter mir in Deckung, als wollte sie nicht sehen, was sie getan hat.
»Versuch an diesem Arm zu ziehen, dann nehme ich den hier«, sage ich.
Sie geht um mich herum, kneift dabei aber die Augen zu.
»Ist schon okay«, versuche ich sie zu beruhigen.
Ein paar Rucke später kommt er allmählich aus dem Wasser, sein Kopf berührt das Emaille der Badewanne, als wir ihn auf den Boden ziehen, gefolgt von einer Menge Wasser, das auf den Boden und über unsere Schuhe läuft. Wir brauchen einen Moment, bis wir wieder zu Atem kommen, dann nimmt jeder ein Bein und zieht. Wir schaffen es, ihn aus dem Badezimmer zu schleifen, wobei sich sein Hals wegen des durchtrennten Nackens seltsam verdreht. Im Flur versuche ich ihn unter den Achseln zu fassen, damit ich ihn anheben und auf die Decke platzieren kann. »Mein Gott, hilf mir doch bitte«, stöhne ich, weil ich ihn nicht richtig zu fassen bekomme. Alice versucht, was sie kann, und schiebt und zieht an jedem Körperteil, den sie zu packen bekommt. »Ist schon okay«, wiederhole ich und atme aus. Ich will mich mit diesen Worten ebenso überzeugen wie sie. Als er endlich auf der Decke liegt, richte ich mich auf und strecke mich, vor Anstrengung aufstöhnend.
Seine Augen starren zur Decke. Jetzt kann ich ihm zum ersten Mal lange und genau ins Gesicht blicken. Seine weit aufgerissenen Augen bohren sich in mich hinein, als ich mich über ihn beuge. Er sieht wütend aus, oder zumindest war er voller Zorn, als er starb. Seine Gesichtszüge sind davon gezeichnet. Seine Stirn ist faltig, seine Haare sind kurz geschoren. Er hat ein Muttermal auf der rechten Wange und einen breiten Kiefer. Vorne ist sein Hals unversehrt, er ist kurz, eigenartig zu einer Seite gekrümmt, und sitzt tief zwischen den stämmigen Schultern.
»O Gott«, wimmert Alice.
»Sieh ihn nicht an«, sage ich und weiß sofort, wie lächerlich das klingt, denn man muss einfach hinsehen. »Schau stattdessen lieber zu mir.« Ich deute mit dem Zeigefinger auf meine Augen. »Schau mich an und vergiss ihn. Nur wir beide sind gerade wichtig!«
Sie schluchzt. Ich nehme ihr Handgelenk und drücke es, vielleicht etwas zu fest, aber ich tue das aus einem einzigen Grund: Sie muss sich zusammenreißen und darf nicht die Fassung verlieren, denn das hier schaffe ich nicht allein.
»Uns bleibt keine Wahl, Alice. Wir sind hier nicht die Kriminellen. Das ist er.«
Sie nickt.
»Vergiss ihn.« Dann küsse ich sie. »Ich habe mir alles genau überlegt. Wir gehen sorgfältig vor. Das schaffen wir.«
»Ich glaube dir«, sagt sie.
»Okay. Komm, lass uns versuchen, ihn in die Decke zu wickeln.« Alice nimmt ein Ende, ich das andere, und wir ziehen die Decke über ihm zusammen. Dann rollen wir ihn mühsam auf die Seite und versuchen, ihn ganz in die Decke einzuschlagen. Es gelingt uns halbwegs. »Wo ist das Klebeband?«, frage ich und blicke mich ungeduldig um. Sie sucht den Boden ab und entdeckt es. Ich klebe die Decke fest und verbrauche Unmengen von dem Zeug. »Hoffentlich hält das.«
Dann stehe ich auf, strecke mich wieder und atme schwer durch. Das Paket sieht wie ein weicher Sarg aus. »Okay, wir schaffen ihn jetzt runter und aus dem Weg. Dann fängt die richtige Arbeit an.«
Wir versuchen, den in die Decke eingeschlagenen Körper anzuheben, doch es gelingt uns nicht. »Ziehen«, sage ich und packe vorne an, Alice schiebt von hinten. Das Paket richtig in den Griff zu bekommen und dann nicht mehr loszulassen, ist schwierig, die Decke fällt immer wieder flach auf den Boden, aber wir lassen nicht locker. Als wir bei der Treppe angelangt sind, sage ich: »Wir sind gleich da. Wir ziehen ihn die Treppe hinunter, und dann können wir hier oben mit dem Saubermachen anfangen.«
Wir wechseln die Seiten, damit ich besser kontrollieren kann, wie schnell das Paket hinunterrutscht. Alice macht den ersten Schritt auf die Treppe. Sie ist bereits fünf Stufen tiefer. Das Paket ist nicht mehr im Gleichgewicht, die Hälfte des Leichnams ist bereits über die obere Stufe hinaus, als ich merke, dass wir einen Fehler gemacht haben. Ich sehe, wie Alice das Gleichgewicht verliert. Sie strauchelt und taumelt ein paar Treppenstufen hinunter. Ich rufe ihren Namen, stürze ihr instinktiv hinterher und lasse die Decke los, das Paket rutscht ein paar Stufen hinunter und kommt dann zum Stillstand. »Bist du okay?«, frage ich, als ich Alice erreiche.
Sie windet sich, drückt die Hand auf ihre Hüfte. »Geht schon«, stöhnt sie. Sie versucht aufzustehen, schafft es aber nicht, sich aufzurichten. »Mist!«
»O nein, o Gott«, sage ich und schiebe mich um die Leiche herum. Die Decke hat sich teilweise gelöst, und ich sehe einen Arm heraushängen.
Hoffentlich hat sie sich nichts gebrochen. Ich helfe Alice dabei, aufzustehen. »Kannst du deine Hüfte belasten?« Ich warte mit klopfendem Herzen auf die Antwort. Wenn sie es nicht kann, sind wir geliefert.
Sie stöhnt auf, es gelingt ihr aber, ihr Gewicht zu halten. »Das geht schon«, sagt sie und verzieht das Gesicht. Einen Moment bin ich erleichtert, aber dann wird mir eines sehr deutlich klar: Wir haben noch viel vor uns, bevor wir in Sicherheit sind.
Wir wechseln die Positionen, ich ziehe, und sie drückt, und irgendwann haben wir es geschafft. Er liegt wie ein Bündel auf dem Boden im Flur. Wir gehen in die Küche und holen alles aus den Schränken, von dem ich glaube, dass wir es vielleicht brauchen könnten. »Füll einen Eimer mit heißem Seifenwasser«, sage ich und lege eine Flasche Bleiche in den Wäschekorb, noch mehr Gummihandschuhe, Papierhandtücher, Küchen- und Badezimmerreiniger und schwarze Müllbeutel – alles, was so aussieht, als könne es uns dabei nützlich sein, zu schrubben, zu reinigen und zu vertuschen, was wir hier tun.
»Okay, wir putzen nebeneinander«, teile ich ihr mit. »Wir werden jetzt alles gemeinsam tun. Du beobachtest jede meiner und ich jede deiner Bewegungen. Wir dürfen auf keinen Fall nachlässig werden. Alles muss absolut sauber sein – und es wird vieles geben, was wir nicht einmal sehen können. Sieh mir dabei gut zu. Ich werde eine Stelle reinigen, und danach putzt du dieselbe Stelle noch einmal.«
Ich drehe die Dusche auf und spüle so viel wie möglich von dem Blut weg. Es verschwindet in einem langen roten Rinnsal im Abfluss. Der Anblick geht mir durch und durch. Wir reinigen den Duschvorhang, dann entferne ich ihn und packe ihn in die Plastiktüte. Dasselbe wiederholen wir mit dem Badteppich. Den restlichen Oberflächen rücke ich mit Chlorreiniger zu Leibe. Ich ziehe ein zweites Paar Gummihandschuhe an und schrubbe mit einer Geschirrbürste, Alice macht es mir nach. Mit Blut vermischte Wasserspritzer treffen mein Gesicht und meine Kleidung. Ich halte kurz inne, schließe die Augen und versuche zu ignorieren, dass ich sein Blut im Gesicht habe; ich wünschte, es wäre schon vorbei, aber ich habe keine Zeit zu vergeuden; ich mache weiter. Ich spüle das Reinigungsmittel ab, und das Bad glänzt sauber, aber ich mache Alice Platz, damit sie alles noch einmal tun kann. Sie gießt eine Menge Chlorreiniger nach, zu viel, und man hört ein saugendes Geräusch aus der Flasche, dann sagt sie: »Sie ist leer.« Der Geruch ist unerträglich.
Das restliche Badezimmer ist voller Kacheln, und der Flur draußen hat einen Parkettfußboden. »Wir brauchen mehr davon«, sage ich. »Ich habe nur die eine Flasche gefunden. Haben wir irgendwo noch was?«
Sie schüttelt den Kopf. »Nein, ich glaube nicht.«
»Mist.« Wir können es uns jetzt nicht erlauben, einfach aufzuhören.
Ich haste nach unten und öffne den Schrank unter der Spüle. Nichts. Ich blicke an mir herunter. Das werde ich alles ausziehen müssen.
Als ich wieder oben bin, hilft mir Alice beim Ausziehen, und ich ziehe ein paar frische Sachen an. »Ich bin bald zurück«, versichere ich ihr und werfe einen Blick auf den Wecker. 21:45 Uhr. »In fünfzehn Minuten macht der Supermarkt zu. Ich muss mich beeilen.« Ich verlasse das Zimmer und mache mich auf den Weg nach unten.
»Paul!« In Alices Stimme ist eine Spur von Panik.
Ich stoppe. »Ich muss los! Was ist denn?«
Sie erscheint oben auf der Treppe. So, wie sie angezogen ist und von dort oben zu mir herunterschaut, erinnert sie mich an Annie Wilkes. Es läuft mir kalt den Rücken herunter. »Das Blut«, sagt sie. »Du hast Blut im Gesicht. Wasch es ab.«
Meine Hand berührt meine Wange. »Okay.« Ich atme erleichtert aus. Ich gehe zurück ins Badezimmer, schrubbe, so fest ich kann, und muss dabei an die Zeit denken, die ich verliere.
»Schließ die Tür ab und öffne niemandem«, rufe ich, als ich die Treppe hinunterlaufe. »Ich werde dreimal klopfen, damit du mich wieder hereinlässt. Öffne nur, wenn du ganz sicher bist, dass ich es bin. Und schalte das Licht aus.«
»O nein, nicht mit ihm hier drin.« Ihre Stimme zittert.
Ich stehe neben dem Toten und habe schon eine Hand an der Haustür. Ich drehe mich zu Alice um. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll.
»Paul, bitte lass mich jetzt nicht allein«, sagt sie.
»Uns bleibt keine Wahl. Wenn ich nicht mehr Reinigungsmittel bekomme, schaffen wir es nicht, das alles richtig sauber zu kriegen.«
»Aber er ist da unten, und du verlangst von mir, hier im Dunkeln zu sitzen.«
Ich habe wirklich keine Zeit für solche Dinge. Ich beiße die Zähne zusammen. »Er ist tot, Alice. Er kann dir nicht mehr wehtun.«
»Das kann er«, nickt sie eindringlich. »O doch, das kann er.«
»Ich muss gehen. Hör auf damit. Du musst stark sein. Reiß dich zusammen.«
»Paul …«
Die Entscheidung, die ich jetzt treffe, ist entweder mutig oder dumm, aber jedenfalls gehe ich. Wenn ich bliebe, kämen wir nicht weiter. »Ich werde mich wirklich beeilen. Bitte.« Ich warte ihre Antwort gar nicht erst ab und schließe die Haustür hinter mir.
Zum Glück ist der Supermarkt nur ein paar Straßen von unserer Wohnung entfernt, deshalb komme ich gerade noch rechtzeitig. Ich nehme für alle Fälle gleich fünf Flaschen Chlorreiniger und eine ganze Reihe anderer Putzmittel mit. Mir ist klar, dass ich von der Videoüberwachung gefilmt werde, aber angesichts der Uhrzeit bleibt mir keine Wahl. Ich kann nur hoffen, dass niemals jemand herausfinden will, wo ich mich an diesem Abend aufgehalten habe. Ich benutze die Selbstbedienungskasse, damit mich keiner der Angestellten dabei beobachtet, wie ich eine ungewöhnliche Menge Reinigungsmittel bezahle. Dazu kaufe ich eine stabile Einkaufstüte und trage alles hastig aus dem Laden.
Ich eile nach Hause, weil ich mir Sorgen darüber mache, in welchem Zustand sich Alice wohl befindet, wenn ich zurückkehre. Das Licht ist an. Ich parke den Wagen und steige so unauffällig aus, wie ich kann.
Nicht weit entfernt brennt ein Licht, aber ich achte kaum darauf, bis ich eine Stimme höre. »Hey, alles in Ordnung, Paul?«
Ich bleibe stehen, weil mir klar wird, dass ich mich nirgendwo verstecken kann. Ich wende mich nach rechts. Jemand hat mich gesehen. Ich hebe zur Begrüßung eine Hand, dabei wird mir der Beutel aus dem Supermarkt bewusst, und ich rufe zurück. »Mir ist die blöde Milch ausgegangen, Bob. Das ist schon alles.« Er ist teilweise hinter der dichten und langen Reihe von Bäumen und Büschen verborgen, die unsere Häuser und Einfahrten voneinander trennt, aber ich kann sehen, dass sein Kofferraum geöffnet ist und er darin herumkramt.
»So spät abends trinke ich meinen Kaffee immer schwarz«, sagte er. »Ich bin vielleicht nicht ganz normal, aber das knockt mich jedes Mal aus. Versuch das mal, wenn du kein Auge zukriegst.«
»Danke, mache ich.« Ich versuche ein freundliches Lächeln.
Er hebt einen Daumen. »Schlaf gut.«
»Nacht, Bob.«
Ich klopfe an die Tür, langsam und dreimal hintereinander. Durch das Milchglas sehe ich eine Gestalt die Treppe herunterkommen. Sie öffnet die Tür. Ich dränge mich an ihr vorbei nach drinnen und schließe die Haustür wieder, so schnell es geht. Ich merke sofort, dass Alice geweint hat, aber sage nichts, nehme sie nur in die Arme und hoffe, dass das reicht. Sie zittert, und ich vergesse Bob sofort. Wir ziehen unseren Plan weiter durch, aber ich merke, dass sie in meiner Abwesenheit nicht viel geschafft hat. Ich streichle ihr Haar. »Ich musste das tun, Darling. Wir brauchen das alles.« Ich zeige auf die Einkaufstasche. »Wir hatten keine Zeit.«
»Du hast mich mit ihm alleingelassen«, flüstert sie, und für einen Moment klingt ihre Stimme eine Spur bedrohlich.





























