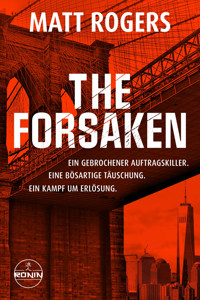
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ronin-Hörverlag, ein Imprint von Omondi GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Er war eine Waffe. Konditionierung, Auftrag, Vollstreckung – das war sein Leben. Jetzt kämpft er für die Wahrheit. Er hat Hunderte getötet. Nicht für Geld. Nicht für Rache. Zehn Jahre lang war Logan Booth ein Auftragskiller – fest überzeugt davon, im Namen einer idealistischen Untergrundorganisation zu handeln. Doch dann erfährt er: Alles war Täuschung. Zehn Jahre lang hat er im Auftrag der CIA gemordet – ohne es zu wissen. Als sein bester Freund, der Enthüllungsjournalist Jorge Romero, brutal ermordet wird, erwacht in Logan der letzte Funken Überzeugung – und mit ihm ein tödlicher Plan. Gemeinsam mit der Crack-süchtigen Alice Mason, einer Zeugin mit dunkler Vergangenheit, nimmt er den Kampf auf – gegen eine Macht im Schatten. Ein System aus Lügen, Gewalt und Verrat, das vor nichts zurückschreckt – und das längst beschlossen hat, ihn zum Schweigen zu bringen. Ein Mann ohne Gnade. Eine Frau ohne Schutz. Und ein Gegner, der alles zu verlieren hat. Ein kompromissloser Thriller mit Wucht, Tiefe und Sog, der sofort süchtig macht. Der Selfmade-Bestsellerautor Matt Rogers ist die spannendste neue Stimme des Actionthrillers. »Rasant, pointiert und düster. Ein großartiger Thriller.«– Kathy Reichs
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Prolog
Teil eins – Asche
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Teil zwei – Funke
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Teil drei – Flamme
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Teil vier – Feuersbrunst
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Teil fünf – Glut
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Über den Autor
Die Orphan X-Reihe von Gregg Hurwitz
Die Tesseract-Reihe von Tom Wood
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Inhaltsbeginn
Impressum
The Forsaken
Matt Rogers
Aus dem Englischen von Urban Hofstetter
Für Matt Clarke
Prolog
Die Crackpfeife wispert in Alices Händen.
Sie sieht zu, wie die Rauchfäden zur Decke des Verschlags aufsteigen, und denkt über Ordnung und Chaos nach.
Sie könnte daran ziehen, könnte es aber auch lassen.
Die Entscheidung fällt nicht leicht ...
Zwei Türen, zwei voneinander abweichende Pfade in einem Quantenraum, der alle möglichen Ereignisse und Konsequenzen beinhaltet. Es erstaunt sie, dass sie objektiv genug ist, um dies zu erkennen, und trotzdem darüber nachdenkt, an der Pfeife zu ziehen. Aber das tut sie.
Ruby hält das Feuerzeug darunter, seine Flamme leckt am Pfeifenkopf. Besorgt beobachtet sie, wie der dünne Rauch sich auflöst, und betrauert jede verschwendete Schwade. »Schnell. Zieh daran.«
Alice tut es nicht.
Noch nicht.
Sie denkt nach.
Was soll es sein ...?
Sie könnte sich für Ordnung entscheiden und auch weiterhin immer die richtige Wahl treffen. Weniger Zucker, mehr Gemüse. Ballaststoffreiche Ernährung. Yoga. Therapie. Achtsamkeit. Sonntags Dad anrufen. Sich für eine Instagram-Optik mit einheitlicher Farbpalette entscheiden, sodass ihre Posts wie aus einem Guss wirken. Früh zur Arbeit gehen und den Chef beeindrucken. Den Nährstoffgehalt beachten. Mit dem Baby im Tragetuch durch die Natur spazieren. Ihr Leben auf die Reihe bringen. Sterben.
Oder ...
Chaos. Sich ein bisschen Spaß gönnen. Einen Drink oder vielleicht auch zehn. Pizza bestellen oder gar nichts essen. Einen Joint drehen. Über die Stränge schlagen. Mit dröhnenden Kopfschmerzen den Sonnenaufgang beobachten. Ein Meeting sausen lassen. Ihr Kind mit dem Handy ruhigstellen. Sterben.
All diese Dinge tarieren wir so gut wie möglich aus, denkt Alice. Und das Ergebnis ist unser Leben: die kollektive menschliche Erfahrung, fein säuberlich etikettiert.
Alice hat Kokain noch nie in kristalliner Form probiert. Sie sagt sich, dass es nichts anderes ist: bloß eine Variation ihres üblichen Lasters – und streng genommen hat sie damit auch recht. Man kann sich alles schönreden. Crack rast auf der Überholspur direkt ins Gehirn, und schon nach zwanzig Minuten ist der Kick wieder vorbei. Viel besser als der Euphorie-Tropf, an den man sich hängt, wenn man das Pulver schnupft. Klar, traditionell wird eine Line durch die Nase bevorzugt. Davon kann die Toilette deiner Stammkneipe sicher ein Liedchen singen.
Scheiß auf die Tradition, denkt Alice.
Tradition bedeutet Ordnung, und Ordnung bedeutet Kontrolle. Doch sie weiß, dass die Pfeife ebenfalls ein Kontrollinstrument ist.
Dafür ist sie schlau genug.
Da sie in ihrem Abschlussjahr die Beste in Algebra und Differentialrechnung war, konnte sie anschließend vier Jahre lang am MIT Mathematik und Wirtschaftswissenschaften studieren und dabei dreihunderttausend Dollar Studienschulden anhäufen. Auf dem Arbeitsmarkt machte sich das für sie nicht bezahlt, und eines Tages hat ihre Kindheitsfreundin Ruby die streng katholisch erzogene Alice zum ersten Mal in ihrem Leben mit Schnaps und Gras in Berührung gebracht. In dieser Nacht ist den beiden klargeworden, dass sie sich liebten. Natürlich hatte Alice all das Gerede über Einstiegsdrogen gehört, aber als Monate später eine weiße Line vor ihr auf dem Tisch lag, sagte ihre Freundin, es wäre keine große Sache, sie müsse nur ihrem Verlangen nach mehr widerstehen – und so zuckte sie mit den Schultern und beugte sich darüber.
Dass man eine Grenze überschritten hat, merkt man erst, wenn man sich auf der anderen Seite befindet.
Alice hat es also mit Ordnung versucht und auch mit Chaos. Sie ist nicht sicher, was sie besser findet.
Und jetzt ist sie hier, und Ruby will ihr diese Pfeife aufdrängen.
Sie sieht einen Ausweg aus dieser Zwickmühle. Vielleicht muss es ja gar nicht das eine Extrem oder das andere sein. Vielleicht ist eine Balance zwischen beidem möglich. Gleichwertige Aspekte, die sich zu einem chaotischen, aber zufriedenstellenden Leben zusammenfügen. Alice weiß, wie unangenehm es ist, etwas tun zu wollen und es nicht zu schaffen. Dass dabei ein kleiner Teil von ihr stirbt. Aber das Crack wird noch viel mehr von ihr abtöten.
Die Antwort lautet also nein. Sie weiß, dass Ruby enttäuscht sein wird, aber sie muss ablehnen. Sie kann sich ein erstrebenswerteres Leben als dieses hier vorstellen: unvollkommen und verdreht, aber besser. Mit geregelten Tagesabläufen, aber auch Freiräumen für gelegentliche Ausrutscher – ein paar Gläser Wein zu viel, ein Joint auf der Veranda, ein Wutausbruch gegenüber dem Ehepartner, ein ungezogenes Kind. Das ist kein Scheitern, sondern Teil des Drahtseilakts, den wir alle im Verlauf unserer kurzen Existenz nun mal vollführen müssen.
Das ist es, was sie tun wird – sich weigern.
Und dann sieht sie es.
Sie hat Crack-Hände. Die heiße Pfeife hat mit der Zeit breite schwarze Spuren in ihre Handflächen eingebrannt, teilweise aufgeplatzt wie Furunkel. Manche sind verhärtet. Normalerweise müssten sie sich auf die dominante Hand beschränken, doch Alice erinnert sich, wie sie die Pfeife mit links wie mit rechts zum Mund führt. Ihr erstes Mal erscheint ihr wie ein weit zurückliegender Traum. Sie erinnert sich an die vielen hundert Pfeifen seither.
Sie erinnert sich daran, wie Ruby vor sechs Monaten an einer gezogen hat und danach nicht mehr aufgewacht ist.
Sie erinnert sich an die Sirenen.
Sie ist allein. Und das schon seit einem halben Jahr. Nun hat sie nur noch ihren Dealer und die verlorenen Seelen, mit denen sie gelegentlich eine Pfeife teilt.
Sie hält das Feuerzeug fest und betrachtet ihre Haut, die sich so straff über ihre ausgelaugten Knochen spannt, dass sie auf das Skelett gemalt zu sein scheint. Sie fährt mit der rissigen Zunge über blutende Abszesse in ihrem Zahnfleisch und die vergilbten Zahnstümpfe, die sich mit letzter Kraft an ihre verrottenden Wurzeln klammern. Als sie draußen ein Vogelzwitschern hört, zuckt sie zusammen, als hätte sie einen Stromschlag bekommen. Ihr Herz fühlt sich an, als würde es von einer eisernen Faust zerquetscht.
Sie besteht nur noch aus Schmerzen und Verlangen.
Aus der Abwesenheit des Cracks, einer klaffenden, allumfassenden Leere, die ständig nach Nachschub verlangt, aber niemals gefüllt werden kann.
Nun hat sie es begriffen. Sie ist an eine Zeitachse gebunden, in der es keine Türen und keinerlei Entscheidungsfreiheit gibt. Alles ist geordnet, alles ist chaotisch. Zielstrebig und diszipliniert führt sie das Ende der Welt herbei.
Neben ihr sagt ein klapperdürrer Typ, dessen Namen sie vergessen hat: »Wollt ihr was voll Abgefahrenes hören?«
Sie antwortet nicht.
Ihnen gegenüber antwortet ein anderer Süchtiger, der ziemlich sicher Isaiah heißt: »Okay.«
Der Mann neben Alice schnieft. »Cole und ich werden dafür bezahlt, heute Abend wen kaltzumachen.«
Isaiah kratzt sich an seinem dunklen, von Pockennarben übersäten Unterarm. »Was bekommt ihr dafür?«
Keinen kümmert es, womit man sein Geld verdient, nur, wie viele Hits dabei herausspringen.
Der Typ sieht zu Alice. Er hebt einen knöchrigen Finger, stößt ihr damit seitlich gegen den Kopf und wickelt ein dünnes Haarbüschel darum. Sie leistet ihm keinen Widerstand. »Will das kleine Fräulein Genaueres wissen?«, gurrt er.
Sie zuckt mit den Schultern. »Klar.«
Aber das stimmt nicht. Sie sehnt sich nach einem Gefühl der Taubheit.
Der Mann grinst. »Also, es wird folgendermaßen ablaufen ...«
Alice durchschaut das Wunderland und sieht die Welt, wie sie ist, aber das hält sie nicht auf.
Sie führt die Pfeife an die Lippen, zieht daran und fällt in den Kaninchenbau.
Teil eins – Asche
»Wie wird die Festung zerstört? Nicht mit Eisen oder Feuer, sondern mit Vorurteilen ...«
Epiktet, Gespräche
Kapitel 1
Donnerstag8:17 Uhr
Dreihundert Milligramm Oxycodon, verteilt auf fünfzehn kleine weiße Retardtabletten auf dem Couchtisch, und daneben eine versiegelte 750-Milliliter-Flasche Jack Daniel’s Tennessee Fire.
Logan weiß, dass sie ihren Zweck erfüllen werden.
Hätte er sich für sofort wirksame Pillen entschieden, wären rund achtzig Milligramm ausreichend gewesen, doch er wollte sanft ins Jenseits übergehen. Ein allmähliches Ausblenden war ihm lieber als ein abrupter Schnitt, gefolgt von völliger Schwärze.
Er sitzt da und redet sich ein, es bestünde noch immer Hoffnung – dass noch Zeit wäre, das Unvermeidliche abzuwenden. Seine Umgebung widerspricht dem jedoch vehement. Die Einzimmerwohnung ohne Fahrstuhl in Brownsville – New Yorks Viertel mit der höchsten Mordrate, in dem die Crack-Epidemie besonders verheerend wütet – hat von Anfang an nicht viel hergemacht, doch seit Logan vor sechs Monaten eingezogen ist, ist es mit ihr nochmal steil bergab gegangen. Anfangs hat er noch versucht, das Chaos auf den Boden zu beschränken, doch mittlerweile bedeckt es auch die Arbeitsflächen und Regale: ein Gemisch aus zerknüllten Pizzakartons, zerquetschten Energydrink-Dosen, uralten Zigarettenkippen und leeren Jack-, Jim- und Johnnie-Flaschen – seit seiner Wiedereingliederung in die Zivilgesellschaft seine drei engsten Freunde.
Als ehemaliger Auftragskiller hat er Dinge erlebt, von denen die meisten keinen blassen Schimmer haben, doch er weiß, dass ihn diese Erfahrungen nicht klüger gemacht haben. Alle glauben, auf der anderen Seite des jeweiligen Hindernisses, das sie sich selbst in den Weg legen, warte Erleuchtung auf sie. Sie erkennen nicht, dass das nur eine Illusion ist – ein krankes Spiel, mit dem sich der Verstand von der Realität ablenkt.
Ein Couchpotato denkt: Zwei Kilometer laufen würde mich glücklich machen.
Der Gelegenheitsjogger denkt: Was ich brauche, ist ein Marathon.
Der Ultra-Marathon-Läufer denkt: Was zum Teufel soll das alles?
Logan reißt die Versiegelung von der Flasche.
Ein Summen durchdringt sein dumpfes Brüten und beendet die nervöse Stille, bevor er sein One-Way-Ticket löst. Es wird von einer Vibration an seiner Hüfte begleitet. Stöhnend zieht er das Handy heraus, sieht aber nicht auf das Display. Er weiß auch so, wer anruft. Widerwillig geht er dran.
»Von dir bekommt man in letzter Zeit ja gar nichts mehr mit.« Man hört sofort, dass Jorge Romero Investigativjournalist ist.
Logan räuspert sich. »Ach ja?«
»Ja.«
Logan starrt wie gebannt auf die Tabletten, die eine makabre Leinwand aus weißen Punkten bilden. »Weshalb rufst du an?«
»Ich vermisse dich.«
»Wirklich?«
»Nein, aber ich werde nicht hier sitzen und nichts tun, während du vor die Hunde gehst.«
»Wer sagt, dass ich das tue?«
»Ach, komm schon.«
Logan stößt einen Seufzer aus, der tief aus seinem Knochenmark aufzusteigen scheint. »Ich lege jetzt auf.«
»Was wäre nötig?«
»Hä?«
»Um das Steuer herumzureißen.«
Der Whiskey schimmert in der Flasche. Wunderbarer Bernsteinnektar, der nur darauf wartet, die Oxys runterzuspülen und in seinem Magen zu einer wunderschönen, tödlichen Pampe aufzulösen.
»... Logan.«
Es kommt ihm vor, als würde er aus einem Fiebertraum hochschrecken. Er reißt den Blick von der Tischplatte los. »Hmm?«
»Hast du gehört, was ich gesagt habe?«
»Nein.«
»Ich finde, es wird Zeit, dass wir uns über Washington unterhalten.«
Diese Worte wirken auf Logan wie ein Bolzenschuss in die Brust. Mit hämmerndem Herzen setzt er sich auf und sammelt sich kurz, um sich nichts anmerken zu lassen. Nicht um seinetwillen – seinen Selbsterhaltungstrieb hat er schon lange abgelegt –, sondern aus Sorge um seinen Freund.
»Was zum Teufel habe ich im März zu dir gesagt?«, zischt er ins Handy.
»Es sei ein Wunder, dass sie dich gehen ließen«, erwidert Jorge. »Dass deine Existenz als freier Mann nur ein Irrtum sein kann. Dass du, indem du dich mir anvertraust, unser beider Leben riskierst, und dass du mich zum Schweigen bringen würdest, wenn ich irgendwem auch nur ein Wort von alldem verraten würde. Für immer.«
Wort für Wort, als würde er aus einem Verhandlungsprotokoll zitieren. Sogar der Tonfall stimmt.
Manchmal vergisst er, dass es das unbestechliche Aufnahmegerät zwischen Jorges Ohren ist, das ihn zu so einem guten Reporter macht.
Bis zu ihrem gemeinsamen Grundstudium an der NYU hat Logan geglaubt, so etwas wie ein fotografisches Gedächtnis gäbe es gar nicht. Er hatte damals bereits einen Bachelor und einen Master in Informatik in der Tasche, was ihm einen enormen Vorsprung gegenüber dem jüngeren, unerfahrenen Kubaner hätte verschaffen müssen, doch Jorge eignete sich neues Wissen mit einer spielerischen Leichtigkeit an, die ihre Professoren immer wieder in Staunen versetzte.
Das war lange her, als sie noch beide in der Medienbranche arbeiten wollten – bevor die Brutalität und die Abgründe der Welt alles Spielerische auslöschten. Logan schüttelt den Kopf. Die NYU ist eine uralte Geschichte. Was kann er jetzt noch ändern?
»Hey«, sagt Jorge.
»Hmm?«
»Bei einem Telefonat findet normalerweise ein Wortwechsel statt.«
Logan sieht wieder zu den Oxys. »Du hast mich angerufen.«
»Washington.«
Logan steht auf, um sich ein wenig Bewegung zu verschaffen. Dabei wird ihm schwindlig. »Du hast genau wiedergegeben, was ich zu dir gesagt habe, und checkst es trotzdem noch immer nicht?«
»Ich checke immerhin, dass du nicht mehr wie ein Zombie klingst. Du bist wütend.«
»Geht es dir darum? Soll ich zur Times rüberfahren und dich erwürgen, damit es mir besser geht?«
»Dann gibst du also endlich zu, dass es dir nicht gut geht.«
Logan lässt den Blick durch den Raum schweifen. Hinter seinen Augenhöhlen braut sich ein dumpfer Kopfschmerz zusammen. Seit er seine letzte Red Bull-Dose aufgemacht hat, sind fast zwei Stunden vergangen. Seine Koffeinsucht hat ihn wirklich voll im Griff. »Was willst du?«
»Mit dir reden. Helfen.«
»Wie kommst du darauf, dass ich Hilfe nötig habe?«
»Weil du nicht aufgelegt hast, als ich in einer ungesicherten Leitung Washington erwähnt habe.«
Logan starrt die Wand an. Das war ein nicht wiedergutzumachender Fehler. »Shit.«
»Jetzt mach bloß keinen Rückzieher. Ich kann hören, wie sich die Zahnräder in deinem Kopf drehen.«
»Wir können nicht alle da Vinci sein.«
Jorge zögert kurz. »Was?«
»Er hatte ein hervorragendes Erinnerungsvermögen, nicht wahr? Wie nennt man so ein Gedächtnis noch mal? Eidetisch?«
Diesmal dauert die Gesprächspause etwas länger. »Klingt, als wären deine Lebensgeister wieder erwacht. Wir sehen uns in einer Stunde am üblichen Ort. Der doppelte Espresso geht auf mich.«
»Jorge ...«
Klick.
Logan hält das Handy auf Armeslänge von sich entfernt und starrt das Display an. Das Hintergrundbild hat er seit zehn Jahren nicht verändert – ein japanischer Ensō, ein einzelner kreisförmiger Pinselstrich, der für außergewöhnliche Zielstrebigkeit und eine plötzliche Erleuchtung steht. Früher hat er sich sehr für Bushidō interessiert, den Weg des Kriegers, Frieden im Krieg. Damals hat ihm Philosophie noch etwas bedeutet.
Er lässt das Handy sinken und sieht auf den Couchtisch hinunter. Aus der Vogelperspektive wirkt das Arrangement nicht mehr ganz so einladend.
Logan denkt über das Telefonat nach.
Soll das dein Vermächtnis sein?
Nein. Das will er nicht.
Auf dem Weg zur Tür tritt er fluchend gegen den Tisch.
Als er umkippt, zerbricht die Glasplatte. Die Flasche zerspringt ebenfalls.
Die Scherben und die Pillen liegen in einer Whiskeylache.
Logan hasst es, in der Öffentlichkeit zu sein.
Er rechnet grundsätzlich mit dem Schlimmsten. Deshalb verlässt er seine Wohnung nur selten. Egal, wohin er geht, die Welt hält ihm einen Spiegel vor und zeigt ihm, was für ein Feigling er doch ist.
Zum Beispiel jedes Mal, wenn er an seinem örtlichen Waschsalon, dem Vincenzo’s, vorbeikommt. Der Laden existiert schon seit über einem Jahrzehnt, doch er sieht inmitten des stetigen Stroms von Ganoven, die darin ein- und ausgehen, selten einen echten Kunden. Wie viel Dollar hat Vincenzo wohl schon für die Mafia gewaschen? Mittlerweile müssen es Hunderttausende sein. Logan fragt sich, was er deswegen unternehmen könnte, wenn er an derlei Dingen noch genügend Interesse und das nötige Rückgrat hätte.
Früher hat er sich in solche Angelegenheiten ohne Zögern und ganz instinktiv eingemischt.
Beispielsweise vor fünf Jahren, als er zwischen zwei Aufträgen an der Südspitze von Manhattan auf einer Bank im Battery Park saß, um nach einem besonders brutalen Job den Kopf freizubekommen. Damals hat er noch etwas dagegen gehabt, seine besonderen Fähigkeiten auch in der Freizeit einzusetzen. Doch während er auf dieser Bank saß, gingen ein paar Mafiosi an ihm vorbei. Sie schienen gerade eine Zigarettenpause zu machen. »Dreißig Riesen?«, fragte einer von ihnen. »Das ist leichtverdiente Knete. Erinnert ihr euch noch an die alte Schachtel, die ich für hundertsechzig erledigt habe? ›Ja, ganz richtig, Ma’am, ich bin vom Finanzamt.‹« Das unbekümmerte Lachen, mit dem die anderen auf diese Worte reagierten, verriet, dass sie in ihrem ganzen Leben noch nie für irgendetwas zur Rechenschaft gezogen worden waren. Und ehe Logan sich versah, wütete er wie eine Kreissäge unter ihnen.
Er ging ihnen ansatzlos an die Gurgel und machte kurzen Prozess mit ihnen, wie es der Typ offenbar mit jener betagten Dame getan hatte.
Er schlug zwei Köpfe gegeneinander und versetzte den Brustkörben von vier der Männer so feste Tritte, dass ihre Rippen wie Knäckebrote brachen – all das innerhalb von wenigen Sekunden. Der fünfte – der eben noch das große Wort geführt hatte, machte ein Gesicht, als hätte er gerade zum ersten Mal seine wahre Position in der Nahrungskette erkannt. Das war der Moment, in dem Logan eigentlich »Lauf!« hätte sagen und ihn davonstürmen lassen sollen, doch ihm war nicht nach Gnade zumute. Stattdessen trat er dem Kerl zwischen die Beine und zerschmetterte ihm, während er sich zusammenkrümmte, mit einem weiteren Tritt die Gesichtsknochen. Anschließend ging er, knapp fünfzehn Sekunden nachdem er von der Bank aufgesprungen war, ohne ein Wort der Erklärung davon. Er wusste, dass sie von nun an – selbst wenn ihre Verletzungen längst ausgeheilt wären – immer über die Schulter blicken und Angst haben würden, dass weitere Prahlereien zu ebenso unerwarteten wie schrecklichen Konsequenzen führen könnten.
So ist Logan früher gewesen.
Jetzt gerade bekommt er mit, wie an der Ecke Blake und Saratoga ein Deal vonstattengeht. Eine kleine, gebeugte Frau reicht einem großen Mann mit Kapuze einen knittrigen Zwanzig-Dollar-Schein. Im Gegenzug erhält sie ein Tütchen mit einem kleinen weißen Kristall darin. Ihre blutunterlaufenen Augen leuchten, als hätte sie im Lotto gewonnen. Logan, der dicht an ihnen vorbeigeht, beobachtet den Austausch aus nächster Nähe.
Der Dealer wirft ihm über die Schulter einen finsteren Blick zu. Er leidet an Alopezie und hat weder Kopfhaare noch Augenbrauen. Seine großen Augen, die nicht zu blinzeln scheinen, liegen tief in den Höhlen. Noch dazu ist er sehr blass. Alles in allem wirkt er wie ein wandelndes Skelett.
Logan bleibt stehen – was man nicht tun sollte, wenn man von jemandem so angesehen wird.
Nicht in Brownsville.
Die Frau tut, was Süchtige am besten können: Sie macht sich so klein, dass sie fast zu verschwinden scheint. In einem Moment ist sie noch da, im nächsten huscht sie so gut wie unsichtbar davon, um sich möglichst ungestört ihren Kick zu genehmigen.
»Was?«, fragt der Dealer.
Nicht gerade höflich.
Er weiß, dass er es nicht mit einem Kunden zu tun hat. Logan ist nach allem möglichen süchtig – vor allem Schnaps, Koffein und Selbsthass –, aber von den harten Sachen hat er immer die Finger gelassen. Ihm ist klar, wie heuchlerisch diese Sichtweise ist, wenn man bedenkt, was in der Whiskeylache auf dem Fußboden seines Wohnzimmers schwimmt. Doch er findet nicht, dass ihm eine einmalige tödliche Dosis als Drogenproblem ausgelegt werden kann. Vielmehr ist er sicher, dass sie all seine Probleme gelöst hätte.
Der Dealer starrt ihn an. Logan weiß, dass ihm seine Süchte nicht anzusehen sind. Er hat in der genetischen Lotterie das große Los gezogen und einen Stoffwechsel, der alles verarbeitet, was er in sich hineinstopft. Außerdem beschleunigen der Alkohol und die Energydrinks seinen Ruhepuls so sehr, dass er gar nichts tun muss, um überschüssige Kalorien abzubauen. Das ist zwar alles andere als gesund, aber er hat sich ohnehin nie auf ein langes Leben eingestellt. Dank seines Fetischs für Aufputschmittel muss er nur dreimal pro Woche Gewichte stemmen, um einen Körperbau beizubehalten, den andere als einschüchternd empfinden. Das kriegt er hin.
Schmerzen machen ihm nicht viel aus. Vor allem deswegen ist er ein so exzessiver Alkoholiker.
Dank seiner Größe von einem Meter neunzig wirkt er mit seinen neunzig Kilogramm nicht übertrieben massig. Sein Gewicht ist günstig verteilt. Er hat eine breite Brust, die sich zu einer schmalen Taille verjüngt, und seine Oberschenkelmuskeln sehen wie dicke Drahtseile aus. Auch das verdankt er seinen Genen. Im Gegensatz zu früher, als es noch ständig um Leben und Tod gegangen ist, trainiert er heute kaum noch.
Der Dealer tritt einen Schritt auf ihn zu. Er ist noch größer als Logan. Was ihn offensichtlich mit Selbstvertrauen und der Neigung erfüllt, da zu scheißen, wo er isst. Ein Blick in seine geweiteten Pupillen genügt, um zu erkennen, dass er das Produkt, das er in den dunklen Ecken von Brownsville vercheckt, auch selbst konsumiert.
Der Mann bleckt die gelben Zähne zu einem höhnischen Grinsen. »Ich hab dich hier in der Gegend schon mal gesehen.«
Logan erwidert ungerührt seinen Blick.
»Du hast bisher nix gemacht.« Der Dealer hustet Schleim aus. »Und du wirst auch jetzt nix machen.«
Der Wind weht Logan seine langen braunen Locken ins Gesicht. Er streicht sie zurück und überlegt, wie er weiter vorgehen soll.
Die Leber bietet sich förmlich an, und Logan ist in Reichweite für einen Muay-Thai-Angriff. Es wäre ein Leichtes, die Hände im Nacken des Dealers zu verschränken und ihn ruckartig an sich heranzuziehen, um mit einem Kniestoß eines seiner verletzlichsten Organe zu zerfetzen. Wenn man an der Leber getroffen wird, wähnt man sich sofort auf der Schwelle zum Tod. Es verschlägt einem den Atem, und die meisten Körperfunktionen setzen einen Moment lang aus. Egal, wie hart im Nehmen und willensstark jemand ist, die Schmerzen sind unerträglich. Der Dealer wird nicht einmal schreien können, und während er zusammenklappt, wird Logan ihm einen weiteren Kniestoß versetzen, diesmal ins Gesicht, um ihm die Nase und einen Orbitalknochen zu zerschmettern.
Der Typ wird aussehen, als hätte er den Kopf in einen Bienenstock gesteckt. Von seinen Augen werden nur noch schmale Schlitze zu erkennen sein. Zur Sicherheit könnte Logan ihm noch einen Ellbogen seitlich in den Kopf rammen, sodass sich die Spitze des Knochens in das weiche Fleisch über und hinter dem Ohr bohrt. Das würde den Dealer todsicher außer Gefecht setzen, und er würde tage-, vielleicht sogar wochenlang unter einer schweren Gehirnerschütterung leiden. Beim Aufwachen würde er sich übergeben und wahrscheinlich sogar einkoten.
Obwohl Logan ziemlich eingerostet ist, würde er für all das nicht länger als zwei Sekunden brauchen.
»Mach was«, sagt der Dealer.
Letztes Jahr hätte Logan es noch getan, doch er ist nicht mehr derselbe wie damals.
Und so dreht er sich um und geht davon.
Der Dealer spuckt ihm hinterher. Der Wind trägt den Schleim ein Stück weiter, als man erwarten würde, doch er verfehlt Logans Hemd.
Logan dreht sich nicht um. Er ist tief in Erinnerungen versunken und denkt darüber nach, was ihn so sehr verändert hat.
Kapitel 2
Washington, D.C.Acht Monate zuvor
Logan betastet die grobe Jute. »Auf keinen Fall.«
Der Sack fühlt sich schwer an, vor allem wenn man bedenkt, dass er ihn mindestens eine Stunde lang über dem Kopf tragen soll. Er leidet zwar nicht an Klaustrophobie, aber wenn man in seiner Welt die Kontrolle abgibt, ist man so gut wie tot.
Die Unterführung liegt in tiefem Schatten. Über ihm rattern Autos und Lastwagen, ihre Reifen erzeugen auf den Bremsschwellen einen rhythmischen Trommelschlag.
In der klirrend kalten Luft bilden sich Atemwölkchen vor seinem Gesicht.
Er kennt den fünfzigjährigen Mann ihm gegenüber unter dem Namen Thoreau. Sie arbeiten seit zehn Jahren zusammen. Angesichts seines tiefverwurzelten Individualismus muss man kein Einstein sein, um zu erraten, wie er zu seinem Alias gekommen ist.
Logan hat in den letzten zehn Jahren einiges von Henry David Thoreau gelesen, und er kann viel damit anfangen. Es gefällt ihm. Wäre er der Ansicht, dass man auch einem ungerechten Staatswesen Gehorsam schuldet, würde er dieses verworrene Leben nicht auf sich nehmen. Er und sein Führungsoffizier haben also eine ähnliche Sicht auf die Welt. Sie sind davon überzeugt, dass Bürokratie unweigerlich zu Korruption führt. Sie glauben, wenn ein Mensch die Möglichkeit dazu hat, sollte er sich mittels Disziplin über seine animalische Natur erheben und im Namen der Gerechtigkeit zivilen Ungehorsam betreiben. Sie haben sehr oft und überall auf der Welt – in einer Ruinenbar in Budapest, in einem sicheren Haus in Mazatlán oder in einem baufälligen Restaurant in Nowosibirsk – bis spät in die Nacht darüber gesprochen, welche Verpflichtungen man mit so einer Entscheidung eingeht.
Sie verstehen einander und wissen, warum sie tun, was sie tun.
Doch jetzt sieht Thoreau ihm unbegreiflicherweise ernst in die Augen und sagt: »Du hast keine andere Wahl.«
Logan hält den Sack auf Armeslänge von sich weg und sieht Thoreau fragend an.
Thoreau ist ein kleiner, unscheinbarer Mann, vor allem vor dem riesigen Chevy Suburban, der hinter ihm steht. Seine noch immer vollen Haare und kurzen Bartstoppeln sind stahlgrau. Von seinen hellblauen Augen abgesehen wirken seine Gesichtszüge unauffällig. Auf der Straße würde sich niemand nach ihm umdrehen. Und genau das ist seine Absicht: Die unmenschliche Rücksichtslosigkeit, die er für diesen Job benötigt, will er sich auf gar keinen Fall anmerken lassen.
Das Gleiche gilt für Logan.
Doch nun lässt Thoreau etwas von dieser Unerbittlichkeit durchschimmern. »Du musst das machen«, sagt er mit gesenkter Stimme. »Du weißt, was das bedeutet, Junge. Habe ich dich je zu irgendetwas gezwungen?«
Logan umklammert den Sack so fest, dass seine Fingerknöchel weiß werden. »Und wie willst du mich jetzt dazu zwingen?«
»Das weißt du genauso gut wie ich.«
Thoreau wird ihn sicher nicht am Kragen packen, denn Logan ist rund dreißig Kilo schwerer und hat viel mehr Leute auf dem Gewissen als er.
Schließlich ist er derjenige, der die Drecksarbeit erledigt. Thoreau trägt sie ihm nur auf.
Und woher bezieht Thoreau seine Aufträge? Gute Frage. Logan hat dazu nur ein paar vage Ideen.
Das ist der Deal.
Logan starrt Thoreau an. Das war’s also. Was auch immer heute passiert, ist unumkehrbar und wird alles auf den Kopf stellen, was sie bisher gemacht haben – Thoreau fast zwanzig Jahre lang, Logan immerhin zehn. Thoreau wird keine körperliche Gewalt anwenden, und es kann gut sein, dass Logan auch ansonsten keine körperliche Gefahr droht. Es gibt Möglichkeiten, jemanden auszuschalten, ohne dass man ihm dafür die Augen verbinden muss. Doch der Tod ist nicht das Schlimmste, was einem Menschen widerfahren kann.
Die meisten sterben lange, bevor sie zu Grabe getragen werden.
»Ich will das nicht tun«, sagt Thoreau, »aber du verdienst die Wahrheit.«
»Welche Wahrheit?«
Thoreau deutet auf den Sack. »Die Antworten findest du da drinnen.«
Logan seufzt. Ihm ist klar, was er tun wird. Er weiß es schon die ganze Zeit. Worte sind bloß Schall und Rauch, nur Taten zählen. Hätte er nicht vor, Thoreaus Anweisungen zu gehorchen, hätte er den Sack gar nicht erst entgegengenommen.
Gefügiger Diener, der er ist, nimmt er den Sack mit beiden Händen und hebt ihn sich über den Kopf.
»Warte«, sagt Thoreau.
Logan wartet.
Thoreau blinzelt, als ringe er mit seinen Gefühlen. Es ist ein surrealer Anblick, bei dem Logan flau zumute wird.
»Ich will dir nur noch Lebwohl sagen.«
Eine Böe fegt durch die Unterführung. Die Kälte geht Logan durch Mark und Bein. »Werde ich dich nie wiedersehen?«
»Doch, du wirst mich sehen«, erwidert Thoreau. »Noch mindestens ein- oder zweimal. Du musst einen Offboarding-Prozess durchlaufen. Aber hiernach wirst du mich bis ans Ende deines Lebens hassen.«
Danach herrscht helle Aufregung.
Sie versuchen, keine Geräusche zu machen, doch da Logan nichts sieht und riecht außer Jute, konzentriert er sich voll und ganz auf sein Gehör.
Ein schweres Tor schwingt auf. Bedrohliches Hundegebell erklingt.
Im Inneren des Suburban murmelt ein Mann etwas. Thoreau antwortet ebenso leise. Logan kann ihre Stimmen auseinanderhalten, aber nicht verstehen, was sie sagen.
Eine Weile geschieht nichts. Das Warten scheint kein Ende zu nehmen. Wenn die Sinne eingeschränkt sind, verliert die Zeit an Bedeutung. Sie zieht sich endlos hin und vergeht zugleich wie im Flug. Eine Minute gleicht einer Sekunde, eine Sekunde fühlt sich an wie eine Stunde. Logan war schon mal gefesselt und ist dankbar, dass diesmal kein Metall in seine Hand- und Fußgelenke schneidet und er nicht mit einem Lederriemen geknebelt ist, der so straff sitzt, dass seine Mundwinkel aufplatzen.
Weitere Tore, weitere Hunde, weiteres Gemurmel.
Dann eine Männerstimme, laut genug, um zu verstehen, was sie sagt: »Ich muss ihn abtasten.«
Thoreau stößt einen gutturalen Ton aus, vielleicht, um den anderen zu ermahnen, dass er leiser sprechen soll. Doch er selbst klingt nervös, als er ansetzt, und Logan vernimmt auch seine Worte: »Glauben Sie etwa, das hätte ich nicht schon gemacht?«
»Ich habe meine Befehle«, entgegnet die unbekannte Stimme.
»Rufen Sie oben an«, erwidert Thoreau mit einem geringschätzigen Schnauben. »Befehle!«
Eine Weile herrscht Stille, dann: »Sie können durch.«
Thoreau murmelt etwas, leiser jetzt. Für Logan klingt es wie: »Habe ich es nicht gesagt?«
Die Zeit schleppt sich dahin. Es ist vielleicht eine Stunde her, dass Logan sich selbst den Sack übergestreift hat. Seither hat er es kein einziges Mal gewagt, ihn kurz anzuheben, um einen Blick auf seine Umgebung zu erhaschen. In seiner Welt sind bestimmte Dinge so selbstverständlich wie Essen und Schlafen. Wenn jemand mit Befehlsgewalt sagt, dass du etwas tun sollst, dann tust du es.
Und Thoreau ist so jemand.
Mittlerweile sind sie unter der Erde. Logan spürt das Gewicht, das auf diesem Ort lastet, und die Isolierung um sie herum. Der Motor des Chevy klingt gedämpfter. Die Reifen gleiten über den Fahrbahnbelag wie Messer durch Butter. Thoreau bringt den Wagen zum Stillstand.
Gleich wird etwas geschehen.
Die Tür neben Logan wird geöffnet, und mehrere Hände zerren ihn aus dem Fahrzeug. Sie führen ihn hastig durch einen riesigen unterirdischen Raum mit Betonboden. Dann befinden sie sich in einer Kabine, die kaum als Aufzug zu erkennen ist – es ist der leiseste kabelgeführte Fahrstuhl, den Logan je erlebt hat –, gefolgt von einer raschen Abfolge endlos scheinender Betonflure, die wie Grabkammern wirken.
Es ist unheimlich still.
Er hört seinen eigenen Puls, der über einhundertzwanzig Schläge pro Minute liegt, und versucht, ihn zu verringern. Im Moment ist er das Einzige, was er kontrollieren kann, und die Kontrolle über sich selbst ist ihm das Allerwichtigste. Er weiß, dass ihr Verlust die Wurzel allen Übels ist, mit dem die Menschheit je konfrontiert war. Seines Erachtens gibt es Dinge, die man beeinflussen kann, und welche, die man nicht in der Hand hat. Und was man nicht ändern kann, muss man ertragen, vorzugsweise klaglos.
Logan weiß nicht, dass er schon bald seiner Philosophie und überhaupt jedem Versuch, ein gutes Leben zu führen, abschwören wird.
Vor ihm geht ächzend eine schwere Tür auf, und sie verlassen den Korridor. Auf der anderen Seite steht die Luft. Sie scheinen sich in einer Art Vorzimmer zu befinden.
Die Hände, die ihn links und rechts festhalten, verschwinden, und er spürt nur noch eine Berührung im Rücken, die er als Thoreaus identifiziert.
»Wir beide sind jetzt allein«, sagt Thoreau.
Er spricht leise, doch seine Stimme scheint dröhnend von den Wänden widerzuhallen.
Er schiebt Logan vorwärts, durch eine weitere Tür, in den nächsten Raum. Logan spürt, dass er viel größer ist als der vorherige.
Thoreau platziert Logan auf einen Sessel mit hölzernen Armlehnen. »Wir beide«, sagt er von hinten. »Und ein Freund.«
»Nehmen Sie den Sack ab, Logan«, erklingt vor ihm eine zweite Stimme.
Logan langt nach oben, zieht sich die Jute vom Kopf und blinzelt gegen das schwache Licht an. Seine Augen brauchen einen Moment, um sich auf die Umgebung einzustellen. Vor ihm befindet sich ein klotziger Metalltisch, dahinter ein Mann in einem schweren Sessel.
Logans Herz beginnt zu rasen – mit einhundertdreißig, einhundertvierzig Schlägen pro Minute – und er versucht gar nicht erst, es zu beruhigen.
Bei dem fensterlosen Raum, in dem sie sich aufhalten, könnte es sich um einen Atombunker handeln. Der Boden, die Decke und die Wände bestehen aus fugenlosem Gestein. Doch Logan hat genug von der Welt gesehen, um sich nicht vor Orten zu fürchten, die wie Kerker wirken. Der Anblick des Mannes ihm gegenüber trifft ihn dagegen wie ein Schlag in die Magengrube. Sein hagerer Körper ist in einen unförmigen Anzug gehüllt. Er hat das weiche und unscheinbare Gesicht eines Politikers, doch seine kalten, leblosen Augen verraten, dass er mit den Mechanismen hinter der Politik vertraut ist. Würde man Zivilisten sein Foto zeigen, käme er vielleicht einem von zweihundert bekannt vor, doch Logan weiß genau, wen er vor sich hat. Er kennt die Leute, die er verabscheut.
Michael Kaiser ist der Direktor der CIA.
Logan setzt eine nichtssagende Miene auf und verbirgt seinen Schock, bis er abflaut. Es dauert rund fünfzehn Sekunden. Der Direktor hält so lange, ohne zu zwinkern, die grünen Augen auf ihn gerichtet.
Auf einmal schießt Logan das Blut in die Wangen. Denn nun wird ihm – wenn auch zunächst nur unterbewusst – klar, dass sein ganzes Leben auf einer Lüge basiert. Ihm wird schwindlig, und er verspürt den Drang, sich zwischen seinen schweren Stiefeln auf den Boden zu übergeben.
Ohne auf den Direktor zu achten, sieht er über die Schulter zu Thoreau, der ein paar Schritte hinter ihm steht. »Was soll das?«, fragt er ihn.
Thoreau weicht seinem Blick aus.
»Ich habe Ihnen doch gesagt, dass es keinen Zweck hat«, lässt sich der Direktor vernehmen.
Logan fährt zu ihm herum. »Was?«
»Nicht Ihnen.« Kaiser deutet mit dem Kinn auf Thoreau. »Ihm.«
Logan fühlt sich, als würde sich ein Amboss auf seine Brust herabsenken und ihn tiefer in den Sessel drücken. Er kauert sich zusammen und versucht verzweifelt, die Fassung wiederzugewinnen. Schließlich hat er sich weit genug im Griff, um eine Frage zu formulieren, und hebt den Blick zu Kaiser. »In welchem Verhältnis stehen Sie beide zueinander?«
Kaiser verzieht keine Miene. Auf seiner hierarchischen Ebene existieren keine Gefühle mehr. »Er arbeitet für mich. Und damit auch Sie.«
»Seit wann?«
»Seit Sie angefangen haben. Zuerst waren sie zwei Jahre für Präsident Gardner tätig und danach für Präsident Reed. Dessen zweite Amtszeit neigt sich nun dem Ende zu, und damit benötigen wir Ihre Dienste nicht mehr.«
»Was ...?«, ist alles, was Logan herausbringt.
»Sie, Mr Logan Edward Booth«, sagt Kaiser und macht zwischen den einzelnen Namen eine Pause, als würde er sie ablesen, »sind kein auf eigene Rechnung arbeitender Verbrechensbekämpfer, sondern ein verdeckt operierender Auftragskiller des Special Activities Center der CIA.«
Logan schafft es nicht mehr, die Fassade aufrechtzuerhalten. Die Gesichtszüge entgleiten ihm, und er sackt in sich zusammen.
»Sie wussten es bisher nur nicht«, fügt Direktor Kaiser hinzu.
Logan verliert das Zeitgefühl, während er gebannt auf den schmutzigen Betonboden starrt.
Als er endlich wieder in die Gegenwart zurückkehrt, beschäftigt ihn vor allem eine Frage: »Warum erzählen Sie mir das jetzt?«
»Weil es immer wieder Whistleblower gibt«, erwidert Kaiser ungerührt. »Mir ist es lieber, dass Sie es jetzt erfahren, bevor wir getrennte Wege gehen, anstatt irgendwann später, weil sie Ihren Namen in einem geleakten Einsatzbericht lesen. Ich finde, das haben Sie verdient.«
»Wie freundlich von Ihnen.«
»Um ehrlich zu sein, hat James mich darum gebeten. Er scheint Ihnen gegenüber irgendwelche Gefühle zu hegen. Er glaubt, Ihnen etwas zu schulden.«
»James?«
Wieder deutet Kaiser mit dem Kinn, diesmal über Logans Schulter.
Logan dreht sich langsam zu dem Mann hinter ihm um. »Thoreau?«
»Ein zweckmäßiger Tarnname«, entgegnet James mit gesenktem Blick. »Für den Partner eines Mannes, der die Regierung verachtet.«
»Von dir habe ich diesen Stuss überhaupt erst. Individualismus. Anti-Institutionalismus. Ziviler Ungehorsam. Dieser ganze Scheiß ...«
»Für mich persönlich ist das nichts«, erwidert James. Sein Gesicht sieht anders aus, als hätte er sich gehäutet. »Das dürfte dir doch nun klar sein.«
»Du hast mir das doch eingeredet.«
Zum ersten Mal, seit Logan sich den Sack vom Kopf gezogen hat, sieht James ihm in die Augen. »Nein, es war immer dein Ding. Ich habe nur die Flammen geschürt.«
»Ich –«
»Vor langer, langer Zeit, bevor du während deines Informatikstudiums auf verschlüsselte Browser umgestiegen bist, hast du einen umfangreichen und leicht zugänglichen Suchverlauf angehäuft. Wir wussten, dass wir dich mit diesem Wissen zu Dingen animieren konnten, die du niemals aus eigenem Antrieb getan hättest. Es ist alles eine Frage des Narrativs.« James tippt sich mit einem Finger gegen die Schläfe. »Der Perspektive.«
Logan kann ihn nicht mehr ansehen. Er dreht sich um und starrt mit leerem Blick die Metalloberfläche des Tisches an.
»Deine Weltanschauung war schon längst ausgereift, als du mich kennengelernt hast«, fährt James fort. »Deine Interessen waren breitgefächert, aber uns war klar, dass du Emerson liebst. Deswegen habe ich dir den anderen großen Transzendentalisten, Thoreau, nähergebracht, weil er neu für dich war und dich gleichzeitig in deinen Ansichten bestärkt hat. Wie lautete noch mal das Emerson-Zitat, das du an die Wand deiner Studentenbude gepinnt hast?« James denkt einen Moment lang nach. »Ach ja: ›In der Gemeinschaft ist es leicht, nach fremden Vorstellungen zu leben. In der Einsamkeit ist es leicht, nach eigenen Vorstellungen zu leben – aber bewundernswert ist nur der, der sich in der Gemeinschaft die Unabhängigkeit bewahrt.‹«
»James«, sagt Logan, ohne sich umzudrehen.
»Hmm?«
»Halt’s Maul.«
»Sehr gern.«
Kaiser wirkt vage amüsiert. »Sie haben sicher Fragen. Ich habe in meinem Terminkalender zehn Minuten für Sie freigeschaufelt.«
»Nur ein paar«, erwidert Logan und atmet tief durch. Er hofft, dass die beiden nicht die pochende Ader an seinem Hals bemerken. »Warum habe ich all diese Leute getötet?«
»Um die Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika zu wahren.«
Logan ist einen Moment lang sprachlos. Er wartet auf weitere Erklärungen, doch Kaiser schweigt. Und so schiebt er, um keine kostbare Zeit zu verschwenden, schnell hinterher: »Das hätte ich doch bemerkt.«
»Hätte es irgendwelche offensichtlichen Hinweise gegeben, wären sie Ihnen bestimmt aufgefallen. Mit Ihrem Master in Informatik und dem Journalismus-Studium sind Sie ein Ein-Mann-Recherchenetzwerk. Ihre Nachforschungen waren jedes Mal akribisch, aber wir haben Sie nie daran gehindert. Wie auch? Deswegen musste alles, was James Ihnen auftischte, absolut wasserdicht sein. Wären Sie nicht einverstanden gewesen, hätten sie die jeweiligen Aufträge nicht erfüllt. Das hätte ihrem Moralkodex widersprochen, nicht wahr?«
Logan fühlt sich nackt, auf unbeschreibliche Weise bloßgestellt. Es ist entsetzlich.
In der angespannten Stille denkt er darüber nach, wie es nur so weit mit ihm kommen konnte.
Bereits mit vierzehn hat er begonnen, den Sinn des Lebens zu hinterfragen. Da ihm leeres blumiges Gerede zuwider war, fühlte er sich von den Lehren des Stoikers Epiktet angezogen – insbesondere von der nüchternen Sachlichkeit seiner Gespräche, in denen der antike Philosoph diejenigen anprangert, die sich allzu sehr ihres Buchwissens rühmen. Nie wird Logan vergessen, wie er das erste Mal die Passage las, in der Epiktet einen Mann verspottet, der sich damit brüstet, zahlreiche Abhandlungen des Philosophen Chrysippos gelesen zu haben: »Bei den Göttern, Mann, du machst ausgezeichnete, wirklich wunderbare Fortschritte!« Als ihn jemand fragt, wieso er sich über den belesenen Studenten lustig mache, erwidert er: »Und du, warum hinderst du ihn daran, sich seiner Fehler bewusst zu werden?«
»Ihr werdet niemals in einer Sache Fortschritte machen«, sagt Epiktet, »solange ihr euch nebenbei etwas anderem widmet.«
Schon als Zehntklässler hat Logan gewusst, dass er kein Theoretiker, sondern ein Mann der Tat sein wollte, doch erst im College wurde ihm klar, was er aus dieser Erkenntnis machen sollte.
Als Journalist lernte er viel über die dunklen Abgründe der Menschheit und deckte auf, wozu Naivität und Inkompetenz führen konnten. Und so hatte er, lange bevor Thoreau in sein Leben trat, einen Entschluss gefasst: Er wollte sich dazu befähigen, auf eigene Faust gegen Unrecht vorzugehen. Zwar reizte ihn die Vorstellung, das System finanziell auszubluten und das dabei angehäufte Vermögen für wohltätige Zwecke einzusetzen, doch letztlich hielt er es für zielführender, im Nahkampf seine Knochen hinzuhalten.
Damals hatte er bereits herausgefunden, dass man viel mehr bewirken kann, als man glaubt, wenn man seinen eigenen kleinlichen Vorlieben und Abneigungen keine Beachtung schenkt.
Damit hatte er sich also ein hehres Ziel gesteckt und musste nur noch überlegen, wie er es erreichen konnte. Hierbei kam ihm sein erster Collegeabschluss zugute: Die Informatik hatte ihn gelehrt, sich auf den eindeutigen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung zu verlassen. Wenn man einem Computer zehnmal hintereinander einen Befehl gibt, wird er ihn zehnmal perfekt ausführen. Als er beschloss, einen Menschen aus sich zu machen, der zu extremer Gewalt fähig ist – ein Lebensweg, der eine hohe Toleranz für endlosen Schmerz und ständiges Unwohlsein voraussetzte –, fand er heraus, wie sehr ein menschliches Gehirn einer Maschine gleicht.
Er programmierte sich sozusagen mit einem Trainingsplan und führte ihn aus. Binär. Ohne Emotionen. Rein objektiv. Er erkannte, dass man sich mit den richtigen mentalen Modellen zu so ziemlich allem bringen konnte.
Wenige Wochen vor seinem dreißigsten Geburtstag machte sich dann Thoreau an ihn heran. Logan hatte ein paar Jahre zuvor sein Studium abgeschlossen und einen komfortablen sechsstellig dotierten Job als Programmierer für ein Medizin-Software-Startup ergattert. Er leistete hervorragende Arbeit, doch seine Vorgesetzten störten sich daran, dass er keine Überstunden machen wollte. Sie konnten nicht begreifen, warum sich ein derart vielversprechender Mitarbeiter strikt weigerte, außerhalb der Kernzeiten auch nur einen Finger zu krümmen. Natürlich ahnten sie nicht, dass er sich in den Morgenstunden und nach Feierabend einem unerbittlichen Training unterzog und davon träumte, als moderner Rōnin auf Rachefeldzug zu gehen. An jenem Tag trat im Rezeptionsbereich des Jiu-Jitsu-Clubs, den er täglich besuchte, ein Mann in seinen Vierzigern mit grauer Mähne und befehlsgewohntem Gebaren auf ihn zu. Er fragte Logan, weshalb er sich, obwohl er offenbar kein professioneller MMA-Kämpfer sei, körperlich so schinde.
Aus Gründen, die er sich noch immer nicht erklären kann, antwortete Logan wahrheitsgemäß: Im College sei er von der Idee fasziniert gewesen, sich einer Sache nur um ihrer selbst willen voll und ganz zu verschreiben, und er wolle sehen, wie schwer er ohne äußere Anreize trainieren könne.
Der Mann stellte sich ihm als Thoreau vor und schaute sich um, ob jemand in Hörweite war, bevor er mit gesenkter Stimme fortfuhr: »Ich habe zwar schon viele Leute kennengelernt, die wie Sie denken, aber noch niemanden, der tatsächlich nach diesem Prinzip lebt. Sie sind absolut einzigartig, mein Freund. Was halten Sie davon, Ihre Talente für ein höheres Ziel einzusetzen?«
Ein Jahrzehnt später hat Logan eine beispiellose Karriere hinter sich. In all der Zeit hat er nie vergessen, warum er rekrutiert wurde. Es hatte nichts mit seinen sportlichen Fähigkeiten zu tun – abgesehen von seiner stattlichen Größe und seinem mesomorphen Körperbau hatte er in dieser Hinsicht keine besonderen Talente –, sondern nur mit dem, was zwischen seinen Ohren steckt. Deswegen hat er vor allem an seiner mentalen Einstellung gearbeitet und sich in die Lage versetzt, unter den widrigsten Bedingungen mit unmenschlicher Entschlossenheit voranzustürmen und alles zu zerschmettern, was sich ihm in den Weg stellt. Er wusste, dass er nur einen kleinen Teil seines Lebens unter Kontrolle hatte, und war fest entschlossen, aus seinen beschränkten Voraussetzungen das Beste zu machen.
Kaisers Stimme reißt ihn nun aus seinen Grübeleien und erinnert ihn daran, dass er nie auch nur das Geringste unter Kontrolle gehabt hat: »Stimmt’s nicht, Logan? Sie halten sich doch immer an Ihren Moralkodex, nicht wahr?«
Logan bekommt den Mund nicht auf. Er kann nicht denken.
»Das stimmt«, antwortet James, der noch immer hinter ihm steht, für ihn. »Wenn dir der Auftrag nicht gefällt, führst du ihn nicht aus. So bist du schon immer gewesen. Du holst dir aus dem Darknet und deinen sonstigen Quellen alle verfügbaren Informationen zusammen, und wenn du nicht der Ansicht bist, dass eine Zielperson den Tod verdient hat, schaltest du sie nicht aus. Deswegen mussten wir dafür sorgen, dass dir die Aufträge gefallen. Dazu war nicht viel nötig. Die meisten deiner Opfer waren richtige Scheißhaufen, krimineller Abschaum.«
»Die meisten?«, platzt es aus Logan heraus.
»Sie müssen das realistisch sehen«, erwidert Kaiser. »Manchmal durften wir es mit der Wahrheit nicht allzu genau nehmen. Egal, ob wir die unmittelbaren oder nachrangigen Konsequenzen der Tötungen und ihren Nutzen für die Vereinigten Staaten verschleiert haben oder irgendeine Gräueltat erfanden, damit sie darüber stolpern ... es musste getan werden.«
Es musste getan werden. Finsterer Zorn steigt in Logan auf. Er weiß, wenn er ihm keinen Ausdruck verleiht, wird er stattdessen etwas tun, das er anschließend bereut.
Er starrt über den Tisch und senkt die Stimme: »Sie wissen, was ich getan habe, Mike. Ihnen ist klar, wozu ich fähig bin. Und trotzdem bringen Sie mich in einen Raum, in dem niemand Sie beschützt, um mir zu sagen, dass sie mich seit einem Jahrzehnt für Ihre Zwecke missbrauchen?« Er umklammert die Enden der Armlehnen so fest, dass sie knarzen. »Haben Sie sich das wirklich gut überlegt?«
Der Direktor lässt keinen Hauch von Anspannung erkennen. Er wirkt wie ein Mönch, fast gelangweilt. »Ich hätte die halbe Special Operations Group dazuholen können, um Sie einzuschüchtern. Aber ich musste es so machen, damit Sie etwas über sich selbst herausfinden.«
»Und was soll das sein?«
»Dass Sie nicht der Held sind, für den Sie sich immer gehalten haben.«
In diesem Moment zerbricht etwas in Logan.
»Hätten Sie aufgrund eines Datenlecks erfahren, was Sie getan haben, oder einen Bericht gesehen, der sich auf einen Ihrer Morde bezieht, wären Sie womöglich übermütig geworden. Vielleicht hätten Sie sich für radikalisiert erklärt und es für richtig gehalten, ein paar Köpfe rollen zu lassen. Aber eigentlich wollen Sie das nicht. Sie sind gut in Ihrem Job, gut darin, das zu machen, was andere Ihnen auftragen. Und Sie wollen leben.«
»Will ich das?«
»Natürlich. Andernfalls wäre ich schon längst tot. Sie wären über diesen Tisch gehechtet und hätten mit bloßen Händen Hackfleisch aus mir gemacht. James könnte sie nicht aufhalten, und ich schon gar nicht. Aber das wäre unser aller Ende. Wenn Sie anschließend diesen Raum verlassen würden, kämen sie keine drei Meter weit. Und das wissen Sie.«
Logan verkrallt die Finger so fest um die Armlehnen, dass die Knöchel weiß hervortreten.
»Na los, machen Sie schon«, sagt der Direktor, der Logans Zögern zurecht als Schwäche deutet. »Tun Sie es, mein Junge.«
Logan ist neununddreißig und hat Hunderte von Morden begangen, aber Kaiser hat recht.
Er fühlt sich wie ein Kind.
Fünf quälende Minuten lang herrscht Schweigen. Allmählich lockert Logan den Griff um die Armlehnen. Es ist, als würde sein innerer Druck wie durch ein Ventil entweichen, und mit ihm seine Seele. Er hat das Gefühl, in tausend Stücke zu zerbrechen. Schließlich senkt er den Kopf. »Und was mache ich jetzt?«
Es klingt wie ein Flehen, ein Hilferuf.
Und genau das ist es auch.
»Du versuchst, Frieden damit zu schließen«, sagt James hinter ihm. »So gut es geht. Mehr können wir alle nicht tun. Und hey« – Logan hört ihn lächeln – »wenigstens bist du reich.«
Kaiser sieht auf seine Rolex. »Okay. Die zehn Minuten sind vorbei. Ich muss zu meinem nächsten Termin.«
James nickt. »Nachdem du ...«
Logan springt von seinem Sessel auf.
Michael Kaiser zuckt zusammen.
Damit gibt Logan sich zufrieden. Erneut streifen sie den Sack über seinen Kopf, und die Welt wird wieder dunkel.
Wie sich herausstellt, gibt es gar keinen Offboarding-Prozess. Nach diesem Tag sieht er seinen Führungsoffizier nie wieder. Sobald sie ihn aus diesem geheimen Gefängnis hinauseskortiert haben, ist er ein Zivilist. Sie lassen ihn mit seinem schlechten Gewissen allein und schicken ihn auf eine achtmonatige Tour de Force aus Alkoholmissbrauch und Selbsthass.
Es verschlägt ihn nach Brownsville, wo er eines schönen Morgens im Herbs Oxys kauft. Er will einen Schlussstrich ziehen, wie er es gleich hätte tun sollen, als er damit noch etwas hätte bewirken können.
Als es ihm noch möglich gewesen wäre, Kaiser mit sich in den Tod zu reißen.
Kapitel 3
Donnerstag9:38 UhrIn der Gegenwart
Das Empyrean ist ein gehobenes, überteuertes Café, eine Seitenstraße vom New-York-Times-Gebäude entfernt, in dem sich die Baristas als »Alchemisten« bezeichnen.
Logan verabscheut ihr hochtrabendes Getue, weiß aber die äußerst minimalistische Inneneinrichtung zu schätzen. Auf dem Weg zu Jorges Tisch kommt er an bogenförmigen Stehlampen vorbei, die sich der Schwerkraft zu widersetzen scheinen. Vor dem lockenköpfigen Kubaner mit dem runden Gesicht steht ein doppelter Espresso.
Es läuft immer exakt gleich ab zwischen ihnen. Logan rührt keinen Finger, um ihre Freundschaft zu pflegen, irgendwann ruft Jorge ihn resigniert an, und sie treffen sich hier. Heute schon zum sechsten Mal, und inzwischen weiß Jorge sogar genau, wann er Logan seinen Kaffee bestellen muss.
Logan nimmt Platz und leert ihn in einem Zug. »Du musst das nicht tun«, sagt er und deutet auf die Tasse. »Ich habe selbst Geld.«
»Das ist doch nicht der Rede wert«, entgegnet Jorge.
Logan ignoriert den gönnerhaften Unterton. Stattdessen versucht er es mit einer dummen Bemerkung, wie in den alten Tagen: »Was ist aus die erste Runde geht auf dich, die nächste auf mich geworden?«
»Das hat nur am College gegolten. Seitdem hat sich viel verändert.«
»Na ja, aber nicht alles. Zum Beispiel sind wir noch immer beide Single.« Logan blickt über die Schulter. An der Theke drängt sich eine Schar von Manhattanern. Ihr geselliges Geplauder besitzt eine ganz eigene Dynamik, eine Art knisternde Energie. Alle Plätze sind besetzt. Er dreht sich wieder zu Jorge um. »Hast du jemand Interessantes gesehen?«
»Für dich oder mich?«
»Was spielt das denn für eine Rolle?«
»Ich muss realistisch bleiben.«
Logan hebt eine Braue.
Jorge verdreht die Augen. »Ach komm schon. Du siehst aus wie Paul Newman, wenn er lange Haare gehabt hätte und leidenschaftlicher Bodybuilder gewesen wäre. Ich dagegen wirke wie ein übergroßer Barockengel.«
»Jetzt hör aber auf.«
»Findest du Barockengel zu fies? Dann vielleicht besser wie ein braunes Michelin-Männchen.«
Logan will es mit einem halben Lächeln versuchen, vergräbt das Gesicht aber stattdessen unwillkürlich in den Händen und stöhnt.
Jorge wird ernst. »Wir müssen darüber reden.«
Logan greift in die Jackentasche, drückt zwei Nikotin-Kaugummis aus der 6x4-Blisterfolie und wirft sie sich in den Mund. Das eiskalte Pfefferminzaroma verschmilzt mit der Haselnussnote des Espressos. Ein himmlisch stimulierendes Geschmacksgemisch. Er weiß, dass er sich den Energieschub nur einbildet – das Nikotin kann unmöglich so schnell ins Blut übergegangen sein –, dennoch verspürt er auf einmal das überwältigende Bedürfnis, alle Karten auf den Tisch zu legen. »Ich hatte vor ...«, beginnt er und kneift von sich selbst überrascht die Lippen zusammen.
»Du hattest was vor?«, fragt Jorge.
»Ach nichts.«
Jorge sieht ihn eindringlich an. »Ich sage es noch einmal: Wir müssen über Washington reden. Was sie dir dort angetan haben.«
Unwillkürlich blickt Logan erneut über die Schulter.
Als er sich wieder umdreht, schnaubt Jorge und deutet auf den Fuß des Nachbartisches. »Selbst wenn sie gleich dort eine Wanze installiert hätten, würden sie nicht das Geringste mitbekommen. Du bist nirgends besser vor Überwachung geschützt als hier. Vertrau mir.«
»Ach ja? Arbeitest du mittlerweile nebenbei für die NSA?«
Jorge zuckt mit den Schultern. »Im Moment muss ich misstrauisch sein.«
»Wieso? Bist du gerade an einer großen Story dran?«
»Interessiert dich das wirklich?«, entgegnet Jorge ernst.
Logan kann vieles ertragen, vor allem Schmerzen – womit er nicht klarkommt, ist, dass Jorge glaubt, er würde sich einzig und allein für sich selbst interessieren. Das stimmt einfach nicht.
Logan verabscheut sich selbst. Er holt tief Luft. »Ich weiß, ich bin gerade nicht ich selbst, aber deswegen ist mir trotzdem wichtig, was in deinem Leben passiert. Es ... es besteht einfach nur eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was ich sagen will, und was ich tatsächlich sage. Was ich machen will und ...«
»Du machst gar nichts, Logan.«
»Ganz genau.«
»Ich arbeite an einem Artikel«, gibt der Reporter seufzend nach. »Es ist tatsächlich eine große Sache. Ich möchte ein paar Leuten auf die Zehen steigen. Und die Idee dazu verdanke ich dir.«
»Wie das? Ich habe doch schon seit acht Monaten keinen originellen Gedanken mehr gehabt.«
»Es war kein Gedanke, sondern ein Ort, auf den du mich aufmerksam gemacht hast.«
Logan hebt eine Augenbraue. »Brooklyn?«
»Ja. Brownsville, um genau zu sein. Normalerweise bin ich der Ansicht, dass man sich in journalistischen Artikeln mit seinen eigenen Meinungen zurückhalten sollte, aber diesmal gehe ich in die Vollen. Ich will so viel Staub aufwirbeln, dass dem Bürgermeister gar nichts anderes übrigbleibt, als etwas zu unternehmen.«
»Wogegen oder wofür?«
»Der Staat gibt Jahr für Jahr vierzig Millionen für Häftlinge aus Brownsville aus. Nirgends gibt es so viele Morde, Drogentote und eine derart hohe Säuglingssterblichkeit wie in deinem Viertel. Das ganze Ausmaß habe ich erst begriffen, als ich im Sommer anfing, meine Umgebung zu googeln und von der U-Bahn zu deiner Wohnung gelaufen bin. Das war, bevor du die Schotten dichtgemacht hast und ich dich nicht mehr besuchen durfte.« Er macht eine kurze Pause. »Die Leute in deiner Nachbarschaft kamen mir gutmütig und tüchtig vor, nicht wie Unmenschen. Aber jeder fünfzigste Mann in den New Yorker Gefängnissen stammt aus Brownsville. Also bin ich neugierig geworden und habe ein paar Quellen angezapft. Dabei habe ich schnell herausgefunden, dass es in der Gegend eine Handvoll Drahtzieher gibt, die für den Großteil der Gewaltverbrechen verantwortlich sind. Und zumindest ein paar von denen haben genug offensichtlichen Dreck am Stecken, um ihnen das Handwerk zu legen. Ursprünglich wollte ich in meinem Artikel die Frage aufwerfen, wer etwas gegen sie unternimmt. Aber dann hat sich etwas noch Besseres ergeben. Ich habe einen richtig guten Zeugen an der Hand, der aussagen wird.« Jorge verstummt und sieht Logan erwartungsvoll an.
Der verdreht die Augen. Sein Freund will es spannend machen, aber er tut ihm den Gefallen und spielt mit. »Und was wird er sagen?«
»Er war dabei, als letztes Jahr ein paar aufrechte Cops den Bürgermeister dazu animieren wollten, sich öffentlich zu Brownsville zu äußern. Schließlich gibt es nichts Besseres als Medienberichte und den daraus resultierenden öffentlichen Druck, wenn man etwas verändern will, stimmt’s?«
»Wenn du das sagst.«
»Weißt du, was der Bürgermeister darauf geantwortet hat?«
»Las mich raten«, erwidert Logan und tut, als müsste er nachdenken. »Dass es nicht sein Problem ist, wenn sich ein paar hirnverbrannte Süchtige gegenseitig kaltmachen und ihre minderbemittelten Kinder dabei in die Schusslinie geraten, weil aus diesen Kindern ohnehin nur weitere Süchtige werden, die die Welt nicht braucht.«
Jorge sieht ihn mit großen Augen an. »Warst du etwa auch dabei?«
»Der Mann ist Politiker.«
Jorge räuspert sich. »Du hast den Nagel voll auf den Kopf getroffen. Jetzt verstehst du sicher auch, weshalb ich so misstrauisch bin. Ich weiß gar nicht mehr, wie vielen Leuten ich schon auf den Schlips getreten bin.«
Logan macht einen Kellner auf sich aufmerksam und bestellt zwei weitere Espresso. Dann sieht er Jorge wieder an und denkt: Und was glaubst du, damit bewirken zu können? Doch er spricht den Gedanken nicht aus.
»Aber genug von mir«, sagt Jorge.
»Washington ...«, erwidert Logan widerwillig, und Jorges Augen beginnen zu leuchten. »Ich habe dir bereits erzählt, was dort passiert ist.«
»Ich will das nicht alles noch mal durchkauen, sondern herausfinden, was dir noch immer so zusetzt.«
»Soll das so was wie eine Therapie werden?«
»Wenn nötig.«
»Warum?«
»Weil du das Rückgrat hattest, mir von deinem Leben zu erzählen. Also sollte ich zumindest den Mut aufbringen, ein oder zwei unangenehme Gespräche mit dir darüber zu führen. Ich will dir helfen.«
»Weil du mein Freund bist, stimmt’s?«
»Richtig.«





























